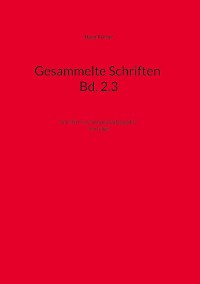Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Band 3.1 der Gesammelten Schriften enthält grundsätzliche Werke zur Sozialpädagogik, insbesondere zur Heimerziehung und zur Volksbildung. Er umfasst das Buch 'Mut zur Utopie', einer umfassenden Darstellung des Wirkens von A.S. Makarenko, eingebettet in die politischen, ideologischen und sozialen Verhältnisse seiner Zeit. Weiter ist ein Vergleich dreier 'sozialpädagogischer Lehrstücke' in Stans (Schweiz), Poltawa (Ukraine) und Solomona (Eritrea) abgedruckt. Unter dem Titel 'Volksbildung und Erwachsenenbildung an der Schwelle zur Moderne' wurden sechs Aufsätze übernommen, die anlässlich des 'bicentenaire' der Französischen Revolution in der Schweizerischen Lehrerzeitung erschienen sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt Bd. 3.1
Vorwort zu Band 3.1
Mut zur Utopie
Zur Pädagogik A.S. Makarenkos
(
1988)
I Vorwort
II Die Entwicklung der russischen Pädagogik im 19. Jahrhundert
III Grundlagen einer marxistischen Pädagogik
IV Die politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen der sowjetischen Pädagogik
V Die wichtigsten schulpolitischen Entscheidungen nach 1917
VI Die Persönlichkeit Makarenkos
VII Die pädagogischen Prinzipien Makarenkos
VIII Die Erziehung in der Familie
IX Makarenko und der Marxismus
Stans – Poltawa – Solomona.
Drei sozialpädagogische Lehrstücke
(
1988)
Vorrede
Stans
Poltawa
Solomona
Volksbildung und Erwachsenenbildung an der
Schwelle zur Moderne
(
1989/90)
Vorrede
I Ursprünge der Erwachsenenbildung
II Von Rousseau zu Robespierre
III Erziehungsprogramme in der französischen Revolution
IV Pestalozzi und die französische Revolution
V »Der Anfang und das Ende meiner Politik ist Erziehung«
VI »Die wahre Bestimmung des Menschen ist in der Gesellschaft«
VII Die schweizerische Erwachsenenbildung im frühen 19. bis 20. Jahrhundert
Vorwort zu Band 3.1
Der Band 3.1 enthält das 1988 erschienene ›Makarenko-Buch‹, die kleine Broschüre ›Stans - Poltawa - Solomona‹ mit einem Vergleich von Pestalozzis und Makarenkos Anstalten und dem Waisencamp von Solomona in Eritrea, sowie eine Sammlung von Essays, die anlässlich des ›bicentenaire‹ der Französischen Revolution in der ›Schweizerischen Lehrerzeitung‹ erschienen sind.
Das Buch über Makarenko ist aus pädagogischer Sicht auch darum heute noch lesenswert, weil es den Zugang zu diesem wenig bekannten Sozialpädagogen gibt und erleichtern will.
Es ist aber auch aus geschichtlicher Sicht interessant, da es das politische Umfeld von Makarenkos Pädagogik in den Jahren 1917-36 beschreibt. Zudem wird auch auf die frühere russische Pädagogik eingegangen und sie enthält wertvolle Hinweise, wo evtl. noch weiter geforscht werden könnte. Denn in der hierzulande recht unbekannten russischen Pädagogik lassen sich einige interessante Ansätze zu einer ressourcen- und handlungsorientierten Pädagogik und Berufsbildung finden.
Die Aufsatzsammlung zur Pädagogik der Französischen Revolution und der Helvetik zeigt schonungslos auf, wie es die bürgerliche Pädagogik fertigbringt, einen für sie brauchbaren Bürger zu formen.
Alle Texte sind unverändert übernommen – eventuell notwendige Anmerkungen zu damals aktuellen Ereignissen, die von heutigen, jüngeren Lesenden, wurden in Fussnoten platziert.
Codroipo, 7. Juni 2022
Mut zur Utopie1
Zur Pädagogik A.S. Makarenkos
1 erschienen 1988 im Athenäumverlag, Frankfurt a.M.
Inhaltsverzeichnis
I Vorwort
1 Die Bedeutung Makarenkos
2 Das gesellschaftliche System der Sowjetunion
3 Der Aufbau des Buches
4 Dank
II Die Entwicklung der russischen Pädagogik im 19. Jahrhundert
1 Der Gedanke der Volksbildung
1.1 Die liberale Pädagogik des 19. Jahrhundert
1.2 Die pädagogischen Ideen der Sozialrevolutionäre
2 Die Pädagogik Leo N. Tolstois
2.1 Die Schule von Jasnaja Poljana
2.2 Tolstoi als Lehrerbildner
2.3 Tolstoi als Volksbildner
2.4 Tolstoi aus der Sicht der sowjetischen Pädagogik
3 Die Pädagogik der ›freien Erziehung‹
III Die Grundlagen einer marxistischen Pädagogik
1 Das Menschenverständnis bei Marx
1.1 Das Menschenverständnis in den Frühschriften
1.2 Die Wende seit der ›Deutschen Ideologie‹
1.3 Die Realabstraktionen als grundlegende Kategorien
1.4 Der Begriff der Arbeit im Marx’schen Werk
1.4.1 Arbeit als anthropologische Kategorie
2 Pädagogische Konsequenzen aus dem marxistische Menschenverständnis
2.1 Programmatische Forderungen bei Marx und Egels
2.2 Das pädagogische Programm der russischen Sozialdemokratie bis 1917
IV Die politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen der sowjetischen Pädagogik
1 Bürgerkrieg und Intervention
1.1 Allgemeine Situation
1.2 Die Situation in der Ukraine
2 Die Entwicklung der Sowjetwirtschaft
2.1 Die erste Periode der Staatskapitalismus
2.2 Die Periode des Kriegskommunismus
2.3 Die ›Neue ökonomische Politik‹
2.4 Die Periode der ersten Fünfjahrespläne
V Die wichtigsten schulpolitischen Entscheidungen nach 1917
1 Revolutionspädagogik
1.1 Die Grundprinzipien der Einheits-Arbeitsschule
2 Die Aufgaben der sowjetischen Schule während der NEP
2.1 Die Entwicklung der sowjetischen Psychologie
3 Die Kinderverwahrlosung in der jungen Sowjetunion
4 Die sowjetische Schule in der Periode der ersten Fünfjahrespläne
VI Die Persönlichkeit Makarenkos
1 Makarenkos Leben
1.1 Die offizielle Biografie
1.2 Die ›Marburger‹-Biografie
2 Makarenko und Gorki
VII Die pädagogischen Prinzipien Makarenkos
1 Das Prinzip der Arbeitserziehung
1.1 Die Organisierung des Arbeitsprozesses
1.2 Die Stellung der Schule in Makarenkos System
2 Das Kollektiv als zentrales Erziehungsmittel
2.1 Die formale Organisation des Kollektivs
3 Die Perspektive als Erziehungsmittel
4 Die Methode der ›Explosion‹
5 Von der ästhetischen Erziehung zur Ästhetik der Erziehung
VIII Die Erziehung in der Familie
1 Die Familie als Kollektiv
1.1 Eltern und Kind
1.2 Die Beziehung der Eltern untereinander
2 Wirkungen des ›Buchs für Eltern‹
IX Makarenko und der Marxismus
1 Perspektive und Marxismus
2 Die Dialektik der Erziehung
3 Makarenkos Verhältnis zu Staat und Partei
4 Schlussfolgerungen
»An unsre dritte Front, das Herz nicht grade heiter an unsre Bücherfront da rückt der Lehrer ein, dem Heer der Lernenden ein Kommandeur zu sein ...«
W.W. Majakowski
I Vorwort
Das vorliegende Buch entstand aus der Einführungsvorlesung zu einem Seminar über die Pädagogik A.S. Makarenkos, die ich im Wintersemester 1986/87 an der Universität Zürich gehalten habe. Aus diesem Grunde kann und will dieses Buch nicht die Lektüre von Makarenkos wichtigsten pädagogischen Texten ersetzen, sondern es will zur Pädagogik A.S. Makarenkos hinführen, indem es das Werk Makarenkos in den Kontext seiner Zeit stellt. Eine begleitende Lektüre von Texten Makarenkos beginnt man am besten mit dem Pädagogischen Poem2. Dies einerseits darum, weil darin die Entwicklung der pädagogischen Praxis und Theorie Makarenkos beispielhaft abgehandelt ist und andererseits, weil es durch seinen romanhaften Charakter leicht, ja erfrischend zu lesen ist. Als zweites Buch empfehle ich den. Roman Flaggen auf den Türmen3. Darin wird nun nicht mehr der Aufbau, sondern das Funktionieren eines bestehenden Kollektivs geschildert. Wer sich anschliessend noch mit der theoretischen Konzeption Makarenkos befassen möchte, dem sei dessen Methodik der Organisierung des Erziehungsprozesses4 empfohlen. Zu einer umfassenderen Kenntnis von Makarenkos Werk gehört mindestens noch die Lektüre von Ein Buch für Eltern5.
Dabei mag der deutschsprachige Leser – trotz gewisser Vorbehalte – zur siebenbändigen Werkausgabe aus der DDR greifen. Auch ich beziehe mich in meinen Literaturangaben auf diese Ausgabe, obwohl sie – und die russische Originalausgabe, von der sie sich ableitet – umfangreiche Kürzungen und Textveränderungen enthält. Es ist das Verdienst Götz Hilligs und seines Marburger Makarenko-Referats, diese Änderungen aufgrund von Neuübersetzungen der zugänglichen Originaldokumente festgehalten zu haben. Dabei sind jedoch auch seine Interpretationen nicht frei von ideologischen Verengungen. Bei der heutigen Quellenlage können wir dies alles nur als Tatsache hinnehmen und sie als Indiz dafür werten, dass die Originaltexte noch heute von hoher Brisanz für beide gesellschaftlichen Systeme sind.
Dass ich mich in meinen Literaturangaben auf die DDR-Ausgabe beziehe, hat eine Konsequenz bezüglich der Umschrift der russischen Namen, indem ich bei den meisten Namen nicht die wissenschaftliche Umschrift der preussischen Bibliotheken, sondern die eingedeutschte Schreibweise verwende, wie sie in den DDR-Ausgabe gebraucht wird.
Nach diesen editorischen Vorbemerkungen möchte ich an dieser Stelle auch noch meine Beschäftigung mit Makarenko begründen.
2 Makarenko [1933/1935]
3 Makarenko [1939]b
4 Makarenko [1936]a
5 Makarenko [1937]a
1 Die Bedeutung Makarenkos
Makarenko war Ende der Zwanziger- und anfangs der Dreissigerjahre sicher der bedeutendste und folgenreichste Pädagoge der Sowjetunion. Ich möchte sogar behaupten, dass er über die Sowjetunion hinaus der bedeutendste Pädagoge dieses Jahrhunderts war und in seiner Praxis und seiner Wirkung wohl überhaupt nur noch mit Pestalozzi verglichen werden kann. Nachdem er zu Beginn seines pädagogischen Wirkens mit dem Aufbau seiner Arbeitskolonien für verwahrloste Jugendliche vor allem praktisch eine ungeheure Wirkung ausgeübt hatte, wurden seine Erziehungsmethoden durch die Veröffentlichung seiner ersten Werke in der Sowjetunion bekannt und er erreichte ab Mitte der Dreissigerjahre eine grosse Breitenwirkung. Seine Werke sind heute in über 60 Sprachen übersetzt und wir finden Anklänge an seine pädagogischen Ideen vor allem auch in den Schulgesetzgebungen der meisten Länder der Dritten Welt. (So war es z.B. bis vor wenigen Jahren für einen Lehrer in Mali zur Erlangung der zweiten Lohnstufe notwendig, eine pädagogische Prüfung abzulegen, die unter anderem die Kenntnis von Makarenkos Werk verlangte!)
Seine Ideen haben zumindest theoretisch und verbal das sowjetische Schulwesen nachhaltig geprägt und noch heute kann in der Sowjetunion kein schulpolitisches Referat gehalten, keine Einweihungsfeier einer pädagogischen Institution vorgenommen werden, ohne Makarenko zu zitieren. Dieser Kanonisierung Makarenkos auf der verbalen Ebene steht nun aber eine grosse Simplifizierung, ja Verfälschung seiner Ideen in der Praxis gegenüber. Somit gilt es heute, Makarenko gegen seine Apologeten in der Sowjetunion zu verteidigen, was eine Beschäftigung mit ihm so schwer macht.
Eine Auseinandersetzung mit dem pädagogischen Phänomen Makarenko kann nun meiner Ansicht nach nicht darin bestehen, Makarenko vom sowjetischen System abzuheben und alle seine Verdienste diesem System und dem Marxismus gegenüberzustellen, wie dies in der bundesdeutschen Makarenko-Rezeption geschieht, die in ihrer Argumentation letztlich auf Nohl zurückgeht6.
Die Beschäftigung mit Makarenko steht also heute zwei Tendenzen gegenüber, die etwas zugespitzt folgende Positionen vertreten:
Makarenko war ein hervorragender Pädagoge und Marxist-Leninist, der seine Theorie und Praxis stets in Einklang mit der sowjetischen Partei und dem Staat entwickelte;
Makarenko war ein hervorragender Pädagoge, dessen grosse Verdienste in Theorie und Praxis nichts mit dem Marxismus und mit der sowjetischen Partei und dem Staat zu tun haben.
Dem möchte ich nun eine Position entgegenhalten, die keineswegs als eine Art Kompromiss verstanden werden darf:
Makarenko war ein hervorragender Pädagoge, der seine Theorie und Praxis, gerade wegen ihres marxistischen Gehaltes, oft im Gegensatz zu Partei und Staat entwickeln musste.
Diese Position beinhaltet natürlich eine ganz spezifische Sichtweise der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung in der Sowjetunion, die ich im Folgenden – auch im Sinne einer Offenlegung meines Erkenntnisinteresses – kurz umreissen will.
2 Das gesellschaftliche System der Sowjetunion
Angesichts des unermesslichen Leids der bäuerlichen und proletarischen Massen in Russland zu Beginn unseres Jahrhunderts, halte ich die sowjetische Revolution im damaligen Zeitpunkt und in ihrer Form für gerechtfertigt. Ich bin der Ansicht, dass sie den Massen damals – und bis in die Vierzigerjahre hinein – eine deutliche Verbesserung der Lebenslage gebracht hat. In diesem Zusammenhang beurteile ich auch das Wirken Makarenkos für die Lage der Kinder als positiv.
Dieses eindeutige Bekenntnis zur sowjetischen Revolution kann angesichts der späteren Entwicklungen in der Sowjetunion nicht unangefochten bleiben. Es ist hier aber nicht der Ort, eine eingehende Analyse der Entartung der sowjetischen Gesellschaft zu leisten. Soweit diese Entwicklung die Schule und das pädagogische Denken betrifft, werde ich an den betreffenden Stellen des Buches und in einem Schlussabschnitt darauf eingehen. Zur allgemeinen Einschätzung der Sowjetunion für den Moment nur so viel:
Mit der Etablierung einer bürokratischen Führungsschicht in der Folge der Fünfjahrespläne und mit den wirtschaftlichen und politischen Reformen in der Sowjetunion anfangs der Fünfzigerjahre wurde in allen Lebensbereichen und somit auch in der Schule das Interesse des Volkes an besseren Lebensbedingungen den Macht- und Profitinteressen einer neuen herrschenden Klasse geopfert. Dies konnte dank der Zentralisation der Macht und dank der Umverteilung der Besitzverhältnisse auf einem viel höheren Niveau geschehen als im Westen.
Auf der ökonomischen Ebene wurde diese Entwicklung von Charles Bettelheim umfassend analysiert7, während Herbert Marcuse in seiner Untersuchung eher den Bereich des Überbaus und die Entwicklung der Ideologie berücksichtigte8. Zusammen ergeben die beiden Untersuchungen – obwohl sie von verschiedenen Ansätzen ausgehen – ein recht kohärentes Bild der Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion.
Dieser Analyse könnte nun entgegengehalten werden – und von revisionistischer9 Seite geschieht dies auch –, dass in der Sowjetunion die Klassen abgeschafft seien. Dieses Argument geht von der falschen Gleichsetzung der juristischen Eigentumsformen mit den Klassenverhältnissen aus.
Die Erfahrung hat gezeigt (oder vielmehr daran erinnert), dass die Umgestaltung der juristischen Eigentumsformen nicht genügt, um die Existenzbedingungen der Klassen [...] verschwinden zu lassen.10
Vielmehr hat sich – gerade mit Hilfe der obigen These – in der Sowjetunion eine neue Klasse etabliert, die zwar nicht die juristische, aber eine kollektive administrative Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel ausübt. Die objektiven Verwertungsgesetze des Kapitals führten, unterstützt durch die These vom Primat der Produktivkräfte, auch in der kapitalistischen Sowjetunion zwangsläufig zu einer imperialistischen Politik (z.B. ČSSR, Afghanistan, Eritrea u.a.). Aus den oben angeführten Gründen – d.h. durch die Knebelung der innenpolitischen Opposition – kann die imperialistische Politik der Sowjetunion heute offener und rücksichtsloser durchgeführt werden als von der anderen Supermacht, den USA. Das heisst aber nicht, dass die eine oder andere der Supermächte harmloser bzw. gefährlicher sei, sondern der Unterschied ist nur eine Stilfrage, was für die betroffenen Völker allerdings nicht relevant ist. An dieser Einschätzung der Sowjetunion muss meiner Ansicht nach auch im Zeichen der Politik von ›Glasnost‹ und ›Perestroika‹ festgehalten werden. Mit Gorbatschow und seinen Gefolgsleuten hat nur eine neue, etwas pragmatischere und vor allem noch technokratischere Fraktion der
neuen Klasse die Macht übernommen. Ob sie konkret der sowjetischen Bevölkerung einen Fortschritt bringt, muss die Zukunft erweisen; nach allen bisherigen Erfahrungen ist dies aber mehr als zweifelhaft, setzt sie doch weiterhin auf die Theorie vom Primat der Produktivkräfte, was im Anschluss an die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl besonders eindrücklich demonstriert wurde.
Nach diesem grundsätzlichen sozial- und weltpolitischen Credo, das für das Verständnis meiner Position notwendig war, nun zurück zu Makarenko und zum Aufbau des Buches.
3 Der Aufbau des Buches
Aus dem bisher Gesagten dürfte klar geworden sein, dass das Werk Makarenkos nicht isoliert von seinem geisteswissenschaftlichen und politischen Umfeld gesehen werden kann; so halte ich alle Darstellungen des Makarenko’schen Werks, die das versuchen, für unvollständig, ja falsch. Im Folgenden werde ich in einem ersten Teil folgende Aspekte dieses Umfeldes behandeln:
die geistesgeschichtliche Situation insbesondere der Pädagogik des 19. Jahrhunderts in Russland, da Makarenko trotz aller Differenzen tief in der pädagogischen Tradition Russlands verwurzelt ist (II);
das Menschenverständnis des Marxismus, welches dem ganzen Werk Makarenkos zugrunde liegt (III);
die politische und soziale Situation in der Ukraine nach der Beendigung des Bürgerkriegs und der ausländischen Intervention (IV);
die pädagogische und schulpolitische Grundkonzeption Lenins und seiner Mitarbeiter, insbesondere seiner Frau, der Pädagogin Krupskaja und des ersten Volkskommissars für das Erziehungswesen A.W. Lunatscharski (III. 2. 2 und V);
die schulpolitischen Entwicklungen im Verlaufe der politischen Auseinandersetzungen in der Sowjetunion ab 1917 (V).
Nur aus diesen Zusammenhängen heraus ist das Werk Makarenkos zu verstehen, dessen wichtigste Komponenten ich im zweiten Teil darstellen werde.
3.1 Editorische Vorbemerkungen
Da ich annehme und hoffe, dass der Leser dieses Buches bereits die wichtigsten Werke Makarenkos gelesen hat, sind verschiedene Kenntnisse, z.B. über das Leben in der Gorki-Kolonie vorausgesetzt. Dagegen habe ich Begriffserklärungen und kleinere und grössere Exkurse, die den Lesefluss gestört hätten in die Fussnoten ›verbannt‹.
Bei den Literaturangaben bezeichnen Jahreszahlen in runden Klammern jeweils das Erscheinungsjahr derjenigen Ausgabe, aus der zitiert wurde. Eckige Klammern geben das Erscheinungsdatum der Erstausgabe in Originalsprache an, soweit dieses bekannt ist.
4 Dank
An dieser Stelle danke ich den Studenten des Seminars für ihre ergänzenden und kritischen Hinweise. Auch bin ich Frau Elisabeth Burisch-Wieler für ihre überaus kompetente Durchsicht des Manuskriptes dankbar.
6 vgl. Nohl [1950]
7 vgl. Bettelheim [1974]
8 vgl. Marcuse [1957]
9 Die Ausdrücke ›revisionistisch‹ und ›Revisionismus‹ werden hier und im Folgenden im Sinne der chinesischen kommunistischen Partei gebraucht und dienen der Bezeichnung der Ideologie und Politik der sowjetischen Partei seit Mitte der Fünfzigerjahre, seit die sowjetische Partei sich endgültig von einer marxistischen Theorie und Praxis abgewandt hat. Sie gelten sinngemäss natürlich auch für die Parteien der Länder des sogenannten ›real existierenden (bzw. eben nicht existierenden; HF) Sozialismus‹ in Osteuropa und die moskauorientierten Parteien Westeuropas, Indochinas und Lateinamerikas, d.h. die PdA in der Schweiz, die DKP in der Bundesrepublik usw.
10 Bettelheim [1974], S. 25
II Die Entwicklung der russischen Pädagogik im 19. Jahrhundert
Der Einfluss der traditionellen russischen Pädagogik auf Makarenko wird, im Allgemeinen als sehr klein bezeichnet, insbesondere da er oft gegen die wichtigste der pädagogischen Strömungen, die eine ›freie Erziehung‹ vertrat, polemisierte. Trotzdem scheint es mir notwendig, die hauptsächlichsten Linien der russischen Pädagogik des 19. Jahrhunderts kurz zusammenzufassen, da zumindest Makarenkos Widersacher im Volkskommissariat für das Bildungswesen stark in diesen Traditionen befangen waren und auch die offizielle Bildungspolitik prägten.
Grob können zwei Hauptlinien der Pädagogik unterschieden werden, eine eher liberale (1.1) und eine Sozialrevolutionäre (1.2), wobei die Grenzen fliessend sind, ja durch die im russischen Geistesleben wichtige Trennung in ›Westler‹ und ›Slavophile‹ wiederum durchbrochen wurden. Ein besonderes Kapitel (2) möchte ich dem weltweit wohl bekanntesten russischen Pädagogen, L.N. Tolstoi, widmen, um zum Schluss (3) noch auf die Vertreter der ›freien Erziehung‹ einzugehen.
1 Der Gedanke der Volksbildung
Im Russland des 18. Jahrhunderts war die Bildung auf eine schmale Schicht von Adeligen beschränkt. Die Kinder der Adeligen wurden, wenn überhaupt, durch Hauslehrer geschult, während es auf dem Lande höchstens einige Klosterschulen gegeben haben dürfte. Von einer auch nur rudimentären Volksbildung kann nicht gesprochen werden. 1764 wurde am Zarenhof unter dem Titel ›Von Sklavenschulen als erster Grundlage guter Erziehung‹ ein Projekt ausgearbeitet, das aber nie in die Praxis umgesetzt wurde. Darin wurde vorgeschlagen, in einigen Schulen die Kinder von Leibeigenen zu Hauslehrern für die Kinder der Gutsherren auszubilden.
Die Ideen der Aufklärung hatten zwar einen gewissen Einfluss in Russland, doch waren sie eng beschränkt auf eine kleine Zahl vor allem westlicher Gelehrter, die am Zarenhof beschäftigt waren oder an der Universität von Moskau lehrten. Nur wenige Schriften der Aufklärung wurden ins Russische übersetzt.
Erst durch Katharina II. wurden einige Scheinreformen auf dem Bildungssektor durchgeführt. Sie schrieb dazu dem Moskauer Gouverneur:
Wenn ich Schulen errichte, so geschieht es nicht für uns, sondern für Europa, wo wir unsern Rang in der öffentlichen Meinung behaupten müssen.11
Sie war jedoch grundsätzlich der Meinung, dass sich »ein Analphabetenvolk leichter regieren lasse«12, denn:
An jenem Tage, da unsere Bauern anfangen werden nach Aufklärung zu verlangen, werden weder Sie (der Moskauer Gouverneur; HF) noch ich auf unseren Plätzen bleiben.13
Sie holte den serbischen (damals österreichischen) Schulreformer Jankovic de Mirievo (1741-1814) an den Hof, um einige Reformen in ihrem Sinne durchzuführen. Dieser gründete dann 1783 in Petersburg das erste Lehrerseminar Russlands.
allzu gerne auf den schädlichen Einfluss der Bildung und der ausländischen Philosophie zurückgeführt wurden. Nikolai ermahnte die Offiziere:
Widmen Sie sich dem Dienst und nicht der Philosophie. Ich kann Philosophen nicht leiden; ich werde alle Philosophen herumjagen, bis sie die Schwindsucht bekommen.16
In einem Dekret vom 8. Dezember 1829 wurde denn auch die Standesgleichheit in den Schulen wieder aufgehoben und so die Volksschule praktisch wieder abgeschafft.
In den noch bestehenden Schulen wurde die christliche Frömmigkeit, zur Grundlage einer wahren Bildung bestimmt. An den Universitäten wurden Philosophie, Naturrecht, Nationalökonomie, Kaufmannslehre und Statistik aus den Lehrplänen gestrichen, der Unterricht in modernen Fremdsprachen reduziert und das Gewicht der alten Sprachen verstärkt, ja es wurde sogar erwogen, die Universitäten ganz abzuschaffen.
Trotz eines neu organisierten, straffen Repressionsapparates wurde aber in den bürgerlichen Salons weiterhin intensiv über die Zukunft Russlands debattiert. Es bildeten sich zwei Strömungen in der russischen Intelligenz. Eine Gruppe der ›Westler‹, die glaubte, dass es nicht möglich sei, aus sich selbst heraus Russland zu erneuern, und man sich darum bemühen müsse, dem Westen nachzueifern, ja ihn zu kopieren. Die ›Östler‹ hingegen vertrauten auf das russische Volk, auf seine Traditionen und sahen darin die Kraft, die Russland aus sich selbst heraus erneuern konnte. Ähnlich wie in der ›Deutschen Bewegung‹ stand auch der beginnenden ›Russischen Bewegung‹ Hegel Pate und es lassen sich in dieser ›Russischen Bewegung‹, neben und quer zu den Gruppen der ›Westler‹ und ›Östler‹, auch rechts- und linkshegelianische Tendenzen feststellen.
Ich möchte an dieser Stelle nicht auf die philosophischen Nuancen dieser Tendenzen eingehen, sondern mich auf die Weiterentwicklung des humanistischen Bildungsbegriffs in Russland konzentrieren.
11 zit.n. Gitermann (1945), S. 201
12 zit.n. Gitermann (1945), S. 208
13 zit.n. Gitermann (1945), S. 201
14 Frédéric César Laharpe (1754-1838), Schweizerischer Aufklärer und Politiker. Nachdem er nicht mehr als Hauslehrer Alexanders I. wirkte, kehrte er in die Schweiz zurück Und bereitete die bürgerliche Revolution im Waadtland vor. Dazu fuhr er auch nach Paris, um dort Unterstützung für die Unabhängigkeit der Waadt zu finden. Nach dem Einmarsch der Franzosen wurde er Mitglied des Direktoriums der Helvetischen Republik.
15 Der sogenannte Dekabristenaufstand erfolgte am 26. Dezember (darum Dekabristen) 1825 in Petersburg und Anfang Januar in Südrussland. Die Teilnehmer, in Geheimbünden zusammengeschlossene Adelige und Offiziere, forderten als Minimalforderung eine Verfassung (so der ›Nordbund‹ in Petersburg) bzw. als Maximalforderung die Republik (der ›Südbund‹ in der Ukraine). Der Aufstand wurde wegen seiner mangelnden Vorbereitung von Nikolai I. leicht niedergeschlagen, wobei es unter den Truppen der Aufständischen etwa 250 Tote gab. Fünf Dekabristen wurde hingerichtet, die restlichen nach Sibirien verbannt.
16 zit. n. Gitermann (1965), S. 16
1.1 Die liberale Pädagogik des 19. Jahrhunderts
Es ist eine der Konstanten der Entwicklung aller pädagogischen Ideen in Russland und natürlich dann auch der Sowjetunion, dass das Arbeitsprinzip als für den Bildungsbegriff zentral angesehen wurde. Einer der ersten, der dies ausformulierte, war V.F. Odojewski (1803-1869). In seinem Hauptwerk ›Russische Nächte‹ wendet er sich gegen das optimistische Menschenbild insbesondere Rousseaus. Im Zentrum seiner Bildungskonzeption steht die Arbeit. Darunter versteht er jede auf eine bestimmte Leistung ausgerichtete Grundhaltung. Arbeit ist für ihn das Gegenteil des Spiels, vor dem er ausdrücklich warnt. Arbeit ist nicht für den Wissenserwerb oder gar die Produktion wichtig, sondern für den Erwerb der Sittlichkeit.
Als ganz klare ›Westler‹ standen die beiden bedeutendsten Vertreter der frühen russischen pädagogischen Bewegung, Wissarion Grigorjewitsch Belinski (1811-1848) und Alexander Iwanowitsch Herzen (1812-1870) in einem gewissen Gegensatz zu Odojewski, haben aber gerade seinen Arbeitsbegriff aufgenommen und weiterentwickelt.
Belinski hat als ›Westler‹ und auch vom Westen her, aus dem Exil, die russische Autokratie scharf angegriffen, glaubte aber, und hier ist er mit Pestalozzi einig, dass das russische Volk nur zu seiner Freiheit kommen könne, wenn vorher die demokratischen Grundsätze und das humanistische Ideal durch Volksbildung im Volke verankert worden seien. »Wer nicht vorher ein Mensch wurde, der ist ein schlechter Bürger.«17 Auch in anderer Beziehung ist Belinski direkt oder indirekt stark von Pestalozzi beeinflusst. Für ihn ist die Liebe das Bedeutendste in der Erziehung und zwar wie bei Pestalozzi die Elternliebe und die darüber hinauswachsende Gott-Vater-Liebe. Sie ist Quelle für jede Sittlichkeit. Mit der Betonung der Liebe trifft er sich mit einem andern seiner Vorbilder, nämlich Feuerbach. Mit diesem betont er auch die Wichtigkeit der naturwissenschaftlichen Bildung. Immer stärker hebt er im Laufe seines Werks die Rolle der Arbeit hervor und sieht ihre Bedeutung in der Gewöhnung. Dabei geht es ihm nicht um einzelne konkrete Arbeiten, sondern um eine allseitige Bildung:
Die elementare Erziehung muss in den Kindern nicht einen Beamten, nicht einen Dichter, nicht einen Handwerker sehen, sondern einen Menschen, der später dann das eine oder andere sein kann, dabei aber ein Mensch bleibt.18
Bedeutender als Belinski war für die weitere Entwicklung des russischen Volksbildungsbegriffs sein Zeitgenosse A.I. Herzen und zwar wegen seines Einflusses auf die Sozialrevolutionäre Bewegung und ihre pädagogischen Vertreter Tschernyschewski und Dobroljubow (vgl. 1. 2), und er soll darum auch in jenem Zusammenhang besprochen werden.
In unserem Überblick muss noch N.I. Pirogow (1810-1881) genannt werden, ein Arzt, der in der Schulverwaltung tätig war und, obwohl er einen klassischen Humanismusbegriff wie Humboldt vertrat, die Realbildung (naturwissenschaftliche Bildung) vorangetrieben hat. Zudem forderte er als einer der ersten einflussreichen Schulpolitiker die allgemeine Schulpflicht.
Auf den Ideen Belinskis und Pirogows aufbauend, sie aber in kritischer Weise weiterentwickelnd, gilt Konstantin Dimitrijewitsch Uschinski (1824 -1870) bis in die heutige Sowjetunion als der eigentliche ›Vater der russischen Pädagogik‹.
Uschinski richtete recht scharfe Angriffe gegen Pirogow und Belinski, vor allem wegen deren Überbetonung der humanistischen Bildung.
Der Verfasser (Pirogow; HF) sagt, dass die klassische Bildung viele hochbegabte Männer heranzog, er verschweigt aber, wieviel inhaltsleere Pedanten, die das Leben vor lauter Buchstaben nicht sahen, wie viele Menschen, die das umgebende Leben nicht verstanden, wenn es sich ihnen nicht in der Form eines lateinischen oder griechischen Zitates vorstellte, sie hervorgebracht hat. [...] Niemand strebte z.B. mehr als die Deutschen zur Nachahmung der Griechen und niemand gleicht weniger einem Griechen als ein deutscher Gelehrter, eben deshalb, weil der Grieche vom Leben umgeben war, der deutsche Gelehrte aber von Büchern umringt ist.19
Aber nicht nur formal, sondern auch inhaltlich bringe das Studium der alten Sprachen nicht viel, denn
werft einen Blick in die ›Politik‹ des Aristoteles, und ihr werdet auf den ersten Seiten solche Ansichten über den Menschen, über die Frau, über fremde Völkerschaften antreffen, die auszusprechen sich heute höchstens etwa ein Pflanzer der Südstaaten nicht schämen würde!20
Uschinski betont im Gegensatz dazu, dass die Quelle unserer Erkenntnis das Volksleben, die Volksseele, das Volkstümliche sein müsse, eine Idee, die die Volkstümler bei ihm aufgegriffen haben. In diesem Zusammenhang betont er auch die Wichtigkeit der russisch-orthodoxen Kirche, die eben vom russischen Volk geschaffen worden sei, und er sieht die Schule als einen Vorhof zur Kirche.
Auch für Uschinski ist die Arbeit in der Erziehung zentral:
Die materiellen Früchte der Arbeit bilden das Einkommen des Menschen, aber nur die innere, geistige, lebensspendende Kraft der Arbeit ist die Quelle der menschlichen Würde und somit auch der Moral und des Glücks.21
Der Mensch könne ohne Arbeit nicht leben, »denn Arbeit, persönliche, freie Arbeit ist das Leben«22. Arbeit also als konstitutives Element des Menschseins, wie wir das bei Marx und dann auch bei Makarenko wieder antreffen werden (vgl. II. 1. 1. 4 und VII. 1).
Interessant ist auch seine Ansicht, dass der Unterricht auf der Elementarstufe viel wichtiger und auch viel schwieriger sei als auf der Oberstufe, und darum müsse die Auswahl der Elementarlehrer mit besonderer Umsicht getroffen werden.
Viele seiner Ideen wurden von den Pädagogen der Sozialrevolutionären Bewegung, von Tschernyschewski und Dobroljubow, aufgenommen.
1.2 Die pädagogischen Ideen der Sozialrevolutionäre
Als der Gründer der sozialrevolutionären Bewegung gilt Alexander Iwanowitsch Herzen (1812-1870). Er war einer der ersten, denen es gelang, die Dialektik Hegels mit dem Materialismus Feuerbachs zu verbinden. »Herzen kam ganz dicht an den dialektischen Materialismus heran und machte halt vor dem historischen Materialismus.«23 Herzen wurde wegen seiner Ideen schon sehr bald ins Exil getrieben und hat von London aus durch die Schaffung einer, freien Presse viel zum Aufbau der pädagogischen Bewegung beigetragen.
In seinen Ansichten zur Erziehung und Bildung betont Herzen noch mehr als Belinski die Bedeutung der naturwissenschaftlichen Arbeit für die Erziehung der Menschen: »Ohne die Naturwissenschaften kann ein Mensch unserer Zeit die ihm gestellten Aufgaben nicht lösen.«24 Doch ohne klassische Bildung verfalle man leicht in Handwerkelei und verliere den Blick für das Ganze. Dies ist auch bei der Liebe so, die für Herzen ebenfalls eine Grundlage der Erziehung ist, was bei seiner Stellung zu Feuerbach nicht verwundert. Auch bei Herzen ist die Liebe zum Menschen, ja zur Menschheit wichtig und in diesem Sinne fordert er die jungen Intellektuellen auch zum ›Zug ins Volk‹ auf, was von den Volkstümlern, den ›Narodniki‹ (народники), aufgenommen wurde. Da Herzen aber selbst aus den Kreisen des Adels und der Gutsbesitzer stammte, nahm er in verschiedenen Fragen eine äusserst schwankende Haltung ein.
Allein die Gerechtigkeit fordert zu sagen, dass bei allen Schwankungen Herzens zwischen Demokratismus und Liberalismus dennoch der Demokrat in ihm die Oberhand behielt.25
Herzen war bis ins hohe Alter Mitarbeiter der verschiedensten Zeitschriften, die hauptsächlich im Ausland herausgegeben oder gedruckt wurden, so in den Sechzigerjahren auch bei der Zeitschrift Der Zeitgenosse (современник), in welcher drei der bedeutendsten Pädagogen jener Zeit mitarbeiteten: Tschernyschewski, Dobroljubow und Pissarew.
Beginnen wir mit dem in seiner Wirkung bedeutendsten russischen Philosophen und Pädagogen des 19. Jahrhunderts, mit Nikolai Gawrilowitsch Tschernyschewski (1828-1889). Tschernyschewski wurde als Sohn eines gebildeten Geistlichen geboren, absolvierte das Priesterseminar und studierte dann Philosophie in Petersburg. Philosophiegeschichtlich ist er eindeutig dem Linkshegelianismus zuzuordnen, und er hat sich oft als Schüler Feuerbachs bezeichnet. Lenin schrieb über ihn:
Tschernyschewski ist der einzig wirklich grosse russische Schriftsteller, der es verstand, von den fünfziger Jahren bis zum Jahre 1888 auf dem Niveau eines geschlossenen philosophischen Materialismus zu bleiben und den kläglichen Unsinn der Neukantianer, Positivisten, Machisten26 und sonstigen Wirrköpfen zurückzuweisen. Tschernyschewski vermochte es aber nicht – oder richtiger, er konnte infolge der Rückständigkeit des russischen Lebens nicht –, sich zum dialektischen Materialismus von Marx und Engels aufzuschwingen.27
Nach seinem Philosophiestudium war er als Lehrer zuerst an der Kadettenschule in Petersburg und dann am Gymnasium von Saratow tätig. 1853 kehrte er an die Universität zurück und reichte 1854 seine Dissertation mit dem Thema Über das ästhetische Verhältnis der Kunst zur Wirklichkeit ein. Da er wegen der scharfen Zensur in der Dissertation seine Ansichten nicht eindeutig vertreten konnte, brachte er diese in einer anonymen Rezension der Dissertation im Zeitgenossen in die öffentliche Diskussion ein. Er kritisiert in seiner Ästhetik vor allem die idealistische Ansicht, dass das Kunstwerk über der Natur stehe. Ich werde auf seine Ästhetik weiter unten (VII. 5) noch eingehen. Das Unterrichtsministerium verhinderte seine von der Fakultät befürwortete Habilitation und er wandte sich privaten wirtschaftlichen und politischen Studien und der Publizistik zu. Er studierte vor allem das in der russischen Bauernschaft traditionelle Gemeindeeigentum des ›Mir‹ (мир), und versuchte Ideen des französischen utopischen Sozialisten Charles Fourier28 auf diese Organisationsform des Eigentums anzuwenden. Er glaubte, dass es in Russland möglich sei, direkt, ohne den Kapitalismus zu durchlaufen, vom Feudalismus in den Sozialismus zu schreiten. Dabei betonte er, dass dies nur durch revolutionäre Aktion und nicht auf friedliche Weise möglich sei. Im Sommer 1862
wurde er aufgrund einer anonymen Denunziation verhaftet. In seiner zweijährigen Untersuchungshaft schrieb er seinen revolutionären philosophischen Roman Was tun? der von der studentischen Jugend Russlands verschlungen wurde. (Ein begeisterter Leser war der junge Lenin, der später eines seiner Hauptwerke, eine wichtige revolutionsstrategische Schrift, ebenfalls Was tun? nannte29.) Aufgrund gefälschter Dokumente wurde Tschernyschewski nach einem zweijährigen Prozess folgender Anklagepunkte für schuldig befunden:
1. des Verkehrs mit Herzen, 2. der Abfassung eines aufreizenden Aufrufs ›an die Herrenbauern‹, der angeblich dem Denunzianten W. Kostomarow zum Drucken übergeben worden war, und 3. der Vorbereitung zur Empörung.30
Aufgrund dieser Anklage wurde er 1864 zu 14 Jahren Zwangsarbeit in den Bergwerken von Nertschinsk und lebenslänglicher Verbannung in Sibirien verurteilt. 1889 wurde er begnadigt und konnte als körperliches Wrack nachhause zurückkehren, wo er ein halbes Jahr später, im Oktober 1889, starb.
In seinen pädagogischen Ansichten geht er ganz klar davon aus, dass sich die Erziehung ganz in den Dienst des Volkes, in den Dienst der Volksaufklärung, zu stellen habe. Die drei wichtigsten Punkte eines Erziehungsplanes seien: umfassendes Wissen, d.h. auf dem neuesten Stand des Wissens beruhende Kenntnisse, klares Denken und ideale Gefühle. Dabei soll der Mensch schon als Kind zur Freiheit erzogen werden. Darum ist was nottut
nicht der Zwang gegenüber dem Zögling, sondern dass der Erzieher sich selber umerzieht und umlernt. [...] Wenn diese Forderungen [...] vom Erzieher erfüllt werden, wird der Junge alles das (frei)willig lernen, was dann der Lehrer, der ein vernünftiger und guter Mensch, geworden ist, für seine Unterrichtung nötig findet.31
Auch für die Erwachsenen fordert er Lektionen, Kurse, Lese- und Kunstzirkel. Vieles, was Tschernyschewski wegen seiner Konzentration auf die politischen und sozialen Verhältnisse nicht ausführen konnte, wurde von seinem Freund und Mitarbeiter Nikolai Alexandrowitsch Dobroljubow (1836-1861) pädagogisch wirksam gemacht.
Dobroljubow, der im Grossen und Ganzen dieselben philosphischen Ansichten hatte wie Tschernyschewski, widmete sich in seinem kurzen Leben mehr der Pädagogik und Psychologie. In seinem anthropozentrischen Menschenbild spielt die Erziehung eine wichtige Rolle. Er sieht den Menschen als ein bildsames, formbares, d.h. also erziehbares Wesen. Gemäss seinem materialistischen Weltbild bilden die Erfahrungen die wichtigsten Elemente der Menschwerdung. So behauptet er,
dass, je weniger Eindrücke ein Mensch empfangen hat, desto kleiner, enger sein Begriffskreis und desto beschränkter infolgedessen auch sein Urteilsvermögen ist.32
Diese Erfahrungen müssen aber konkreter Natur sein und nicht nur papierenes Wissen.
Besonders häufig leiden darunter die Kinder, deren Bestimmung es überhaupt ist, zu lernen, gebildete Menschen zu werden. Man beginnt damit, dass man sie an das Buch setzt und sie zwingt, aus dem Buch das zu lernen, was sie aus dem lebendigen Leben, aus der Wirklichkeit, erfahren müssten.33
In der Diskussion um die Bedeutung von ›Anlage und. Umwelt‹ nimmt er ganz klar Stellung. Nur die lebendige Aufnahmefähigkeit für die Natur sei gegeben – alles andere falle in die Verantwortung des Milieus. Dieses Milieu soll geprägt sein von der Achtung vor dem Kinde. Er wendete sich vehement gegen die autoritäre Pädagogik eines Pirogow, »der nicht will, dass das Kind denkt und Überzeugungen gewinnt, und nur fordert, dass es gehorcht«34. Dobroljubow dagegen forderte eine eindeutige Umkehr in der pädagogischen Haltung:
Ihr seid für das Kind da, nicht das Kind für euch; ihr habt euch seiner Natur, seinem Geisteszustand anzupassen, wie, sich der Arzt dem Kranken, der Schneider dem Kunden anpasst, für den er die Kleider anfertigt.35
In den politischen Ansichten stimmte Dobroljubow weitgehend mit Tschernyschewski überein, wenn er auch den direkten Übergang von der Leibeigenschaft zum Sozialismus in Russland nicht in demselben Masse für möglich hielt wie Tschernyschewski. Trotzdem sah er die einzige Chance zu einer freiheitlichen Entwicklung in Russland in einer gewaltsamen Volksrevolution, einer Revolution der Bauern, kleinen Handwerker und einfachen Intellektuellen.
Zur Wirkungsgeschichte Dobroljubows noch eine vielleicht etwas anekdotische Anmerkung: Einer der begeisterten Anhänger Dobroljubows war der Vorsteher der Volksschulen von Simbirsk an der Wolga, Ilja Nikolajewitsch Uljanow. Er vertrat nicht nur in seiner Schule die pädagogischen Ideen Dobroljubows, sondern versuchte auch seine Kinder in dessen Sinne zu erziehen. Sein ältester Sohn Alexander wurde Student in Petersburg. Dort kam es 1886, anlässlich des 25. Todestages von Dobroljubow, zu blutigen Studentenunruhen, die von Kosaken und der Polizei des Zaren Alexander III. niedergeschlagen wurden. Einige der Studenten, unter ihnen Alexander Iljitsch Uljanow, planten daraufhin ein Attentat auf den Zaren, das aber misslang. Die Studenten wurden gefasst und verurteilt, einige davon zum Tode. Auch Alexander wurde am 20. Mai 1887 gehängt. Aufgrund dieses Erlebnisses beschloss der damals 17jährige Bruder Alexanders, Wladimir Iljitsch Uljanow, sich der revolutionären Bewegung anzuschliessen, die Sache aber besser zu machen als sein Bruder. Er sollte später unter seinem konspirativen Namen Lenin diesen Vorsatz verwirklichen!
Nachdem Dobroljubow 1861 starb, 1862 Tschernyschewski verhaftet und später verbannt wurde, blieb vom damaligen Redaktionsteam der Zeitschrift Zeitgenosse nur noch Dimitri Ivanowitsch Pissarew (1840-1868) übrig. Aber auch er wurde 1862 verhaftet, sass viereinhalb Jahre im Gefängnis und starb zwei Jahre nach seiner Entlassung auch erst 28jährig. Pissarew war ursprünglich Naturwissenschafter, und von daher rührt auch seine pädagogische Methode, die er Forschungsmethode nannte.
Für den Lehrer ist es natürlich weitaus leichter, dem Schüler ein Lehrbuch in die Hand zu geben und darüber zu wachen, dass er seine Hausaufgaben sorgfältig erledigt, als einen solchen Unterrichtsplan aufzustellen, bei dem der Schüler durch eigene Arbeit und eigenes Denken zu den Hauptnaturgesetzen gelangen kann; doch hier geht es keineswegs darum, dem Lehrer seine Aufgabe zu erleichtern; seine Aufgabe muss schwer sein, damit sie nutzbringend ist.36
Aber nicht nur diese Art der Arbeit war für Pissarew wichtig, sondern auch Arbeit im eigentlichen Sinne des Wortes. Seine bekannte pädagogische Triade lautete: Liebe, Wissen und Arbeit!
Der Einfluss der drei Zeitgenossen auf die frühe sowjetische Pädagogik war sehr gross, da nicht nur Lenin und seine Frau Krupskaja, sondern auch viele Mitarbeiter im Volkskommissariat für das Bildungswesen stark von diesen drei sozialrevolutionären Pädagogen beeinflusst waren. Ein zweiter starker Einfluss, vor allem bei Krupskaja, rührte vom Werk Tolstois her, dem das nächste Kapitel gewidmet sein soll.
2 Die Pädagogik Leo N. Tolstois
Einer der wichtigsten und wohl der bei uns bekannteste Vertreter der russischen pädagogischen Bewegung war Lev Nikolajewitsch Tolstoi (1828-1910). Doch selbst unter Pädagogen ist meist nur einem kleinen Kreis bekannt, dass Tolstoi neben seinen berühmten Romanwerken auch ein umfangreiches pädagogisches Werk hinterlassen hat. Die Rezeption Tolstois in Westeuropa beschränkte sich auf einige Reformpädagogen und auf Emile Durkheim, der sich in seinen Vorlesungen an der Sorbonne in den Jahren 1902/03 mit den pädagogischen Vorstellungen Tolstois beschäftigte. Heute wird das pädagogische Schaffen Tolstois hauptsächlich noch unter Slawisten aus dem Umkreis von Froese untersucht. Weiter beruft sich auch die Antipädagogik – wahrscheinlich zu Unrecht – auf Tolstoi. Überhaupt wurde Tolstoi, und insbesondere seine pädagogischen Schriften, in den anarchistischen Zirkeln der Jahrhundertwende gelesen und zum Teil umgesetzt, so z.B. auch vom Schweizer Reformpädagogen A. Ferrière.
Tolstoi stammte aus einem alten russischen Grafengeschlecht mit riesigen Ländereien und unzähligen Leibeigenen. Obwohl sein Vater allgemein als ›milder und gerechter‹ Gutsherr galt, empörte sich Lev Tolstoi bereits als Kind gegen das Grundübel der Leibeigenschaft. Trotzdem ist aber auch bei ihm neben einer zutiefst humanistischen Grundhaltung ein feudalistischer Zug angelegt, wenn er sich z.B. vornimmt, die
beklagenswerte, elende Lage der Muschiks, der armen Bauern, zu ändern und sich um das Glück dieser mir anvertrauten Menschen zu kümmern, für die ich mich vor Gott werde zu verantworten haben.37
Seinen ersten Versuch, die Lage seiner Untertanen zu verbessern, unternahm er 1849, als er begann, sich um die Schule auf seinem Gut zu kümmern, indem er vermehrt die Arbeit des schon von seinem Vater angestellten Lehrers kontrollierte und auch selbst begann, an dieser Gutsschule zu unterrichten. Diese ersten Versuche, in welchen er bereits einige Reformen einführte, scheiterten am grossen Unverständnis, ja Misstrauen, seiner Umgebung. Daraufhin unternahm er zwei längere Reisen ins Ausland, nach Deutschland, Frankreich, Italien, England, Belgien und der Schweiz, deren zweite von 1860/61 man als eigentliche pädagogische Studienreise bezeichnen kann. In all diesen Ländern studierte er eingehend das Schulwesen und einzelne reformerische Schulversuche. Besonders beeindruckt war er von Fröbels Kindergartenidee. Für seine weitere Entwicklung waren aber auch die Begegnungen mit den russischen Emigranten Turgenjew und Herzen sowie mit dem utopischen Sozialisten Proudhon38 bedeutsam.
Zurück von seiner zweiten Reise widmete sich Tolstoi ganz seiner schon 1859 gegründeten Schule, der Schule von Jasnaja Poljana. Er konnte dies nun, nach der Bauernbefreiung von 1861, unter neuen Voraussetzungen tun. Auf die pädagogischen Prinzipien dieser Schule werde ich weiter unten eingehen. Neben der Leitung der Schule gab Tolstoi auch eine pädagogische Zeitschrift mit dem Namen der Schule heraus39. Diese Zeitschrift enthielt einen Schulteil, der über die Reformpläne an der Jasnopoljaer Schule berichtete, und einen Teil für die Aufklärung des Volkes mit einfachen literarischen Texten. Mit dieser
Zeitschrift, seinen etwa zwanzig Schulgründungen in seinem Bezirk und mit seiner Amtsführung als Friedensrichter, einem Amt, das er seit Juli 1861 innehatte, weckte er die Aufmerksamkeit des Feudaladels und der Polizei, was 1862 zu einer ersten Haussuchung bei Tolstoi führte. Es ist für die trotz aller Reformpläne grundsätzlich feudalistische Haltung Tolstois charakteristisch, dass ihn diese Hausdurchsuchung nicht etwa zum Kampf gegen den absolutistischen Staat aufstachelte, sondern dass er sie als eine ungeheuerliche Beleidigung empfand und sich schmollend aus dem öffentlichen Leben zurückzog. Dieser Rückzug umfasste auch die Aufgabe seiner theoretischen wie praktischen pädagogischen Arbeit. Damit zerstörte er die Hoffnungen all der Kinder, die begonnen hatten, sich in seiner Schule wohlzufühlen und er muss sich den harten Vorwurf gefallen lassen, dass die Kinder, die von ihm scheinbar so geliebten Menschen, nur eine Manövriermasse für seine pädagogischen Versuche bildeten. Neben seinem umfangreichen literarischen Wirken durchlief er auch später nochmals zwei ›pädagogische‹ Perioden, eine etwa ab 1868, in welcher er sich vorwiegend um die Lehrerbildung kümmerte, und eine letzte ab Mitte der Achtzigerjahre, die man als volksbildnerische bezeichnen könnte.
Im Folgenden sollen diese drei Perioden etwas genauer dargestellt werden.
2. 1 Die Schule von Jasnaja Poljana
Die Schule von Jasnaja Poljana wurde von Tolstoi in seiner Grafschaft als Modellschule gegründet und mit einem Unterrichtsplan ausgerüstet, den er als ›Programm eines Programms‹ bezeichnete. Es wird aus seinen Schriften und auch aus Erlebnisberichten von ehemaligen Schülern und von Besuchern nicht ganz klar, wie weit dieser Unterrichtsplan nur Modell, nur Plan war oder wie weit er wirklich in die Praxis umgesetzt wurde. In der Wirkungsgeschichte der Modellschule von Jasnaja Poljana ist dies letztlich nicht relevant, da es der Unterrichtsplan und seine ihm zugrundeliegenden Prinzipien waren, die die russische und frühsowjetische Schule nachhaltig beeinflusst haben. Was waren dies nun für Prinzipien?
Die grundlegenden Prinzipien kreisen um den Gedanken einer ›freien‹ Pädagogik, einer ›Pädagogik vom Kinde aus‹ und ›Nichteinmischung in den Bildungsgang‹40. Die freie Ordnung der Schule gipfelt in der Forderung Tolstois nach Abschaffung der allgemeinen Schulpflicht. In die Schule sollte nur derjenige kommen, dem es Freude macht, nur derjenige, der wirklich will. Jederzeit soll sich der Schüler auch entscheiden können, die Schule zu verlassen und später wieder zu kommen. Auch innerhalb des Schulbetriebs soll das Kind wählen können, welches Fach es gerade besuchen will, ja auch innerhalb des Faches kann es frei wählen, wie es sich den angebotenen Stoff zueignen will.
Diesen absolut freiheitlichen Geboten steht nun aber doch eine, von Tolstoi beschriebene äussere Ordnung gegenüber. So existierte eine Art Stundenplan, an den sich die Lehrer und Schüler einigermassen, wenn auch nicht streng, zu halten hatten. Innerhalb dieses Tages- und Stundenplans sollten sich die intellektuellen, musischen und manuellen Fächer etwa die Waage halten. Von den 16 Stunden sollten nur die Hälfte der eigentlichen Schule im engeren Sinne dienen, während die Schüler in der übrigen Zeit ›durch das Leben‹, d.h. durch Arbeiten wie Holzhacken, Kochen, Putzen erzogen wurden. In der Schule wurden die folgenden Fächer angeboten: Religion, Naturwissenschaft, Mathematik, Sprache, Zeichnen und Modellieren, Musik und Gesang sowie Handwerk.
Der Arbeit in der Schlosserei, Malerei, Zimmerei und Schneiderei mass Tolstoi grosse Bedeutung zu. Hier macht sich sowohl der Einfluss Proudhons als auch die Tradition der russischen pädagogischen Bewegung geltend, denn Tolstoi sah das gesellschaftliche Hauptübel darin, dass jedermann danach strebt, sich von der körperlichen Arbeit zu befreien, ja sie andern zur Erledigung zuzuweisen. Tolstoi hingegen betrachtete die Arbeit als Glück und als Erfüllung der allereinfachsten sittlichen Grundsätze.
2. 2 Tolstoi als Lehrerbildner
Nachdem er sich nach der Hausdurchsuchung schmollend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, begann er etwa 1868 mit den Arbeiten für ein ABCBuch, das 1872 erschien. Dieses ABC-Buch war, wie schon der Titel antönt, ein im Pestalozzischen Sinne geschriebenes Lehrbuch für die Wohnstube. Auf diese Weise wurde es dann auch von ihm und seiner Frau für etwa 35 Kinder im eigenen Haus gebraucht. Der Erfolg seiner Methode brachte ihn dazu, eine Lehrerkonferenz seiner Grafschaft einzuberufen und dieser seine Methode mit noch nicht eingeschulten Kindern zu demonstrieren. Auch diese Demonstration war ein Erfolg und Tolstoi begann, als Mitglied des Schulrates seines Bezirks, diese Methode weiter zu verbreiten. Ein Versuch, seine Methode in Moskau zu demonstrieren, schlug fehl, was ihn zur Abfassung seiner bedeutenden theoretischen Schrift Über Volksbildung veranlasste. Da ihm der Erfolg auf gesamtrussischer Ebene versagt blieb, entschloss er sich, in seinem engeren Kreise weiter zu wirken. Er plante die Schaffung einer Lehrerbildungsstätte auf seinem Gut, einer ›Universität in Bastschuhen‹, wie er sie nannte. Damit wollte er ein Gegenmodell zur akademischen Bildung an den Universitäten schaffen, die er schonungslos kritisierte. Er behauptete,
dass man für Menschen mit akademischer Bildung wenig Verwendung hat, und dass sie ihre Tätigkeit in erster Linie auf die Literatur und Pädagogik richten, also nur den ewigen Zirkel der Heranbildung; ebensolcher Menschen wiederholen, die keine Verwendung im Leben haben.41
Er begann auch, zusammen mit seinem Schwager, mit Lehrerfortbildungskursen. Die Aufnahme einer geregelten Ausbildung von begabten Bauernkindern zu Lehrern scheiterte jedoch an finanziellen Problemen. Der Plan hatte zwar 1876 die Zustimmung des Volksbildungsministeriums gefunden und im Bezirksrat, der Zemstvo, war eine Mehrheit der Vertreter bereit, 30’000 Rubel für das Projekt zur Verfügung zu stellen. Auf der entscheidenden Sitzung des Bezirksrats von Tula erhob sich jedoch ein Greis und schlug vor, die 30’000 Rubel aus Anlass der Hundertjahrfeier des Tulaer Bezirks zugunsten eines Denkmals für die Gründerin des Bezirks Tula, für Katharina II., zu verwenden und seinem Vorschlag wurde schliesslich zugestimmt. Es ist wohl kein Zufall, dass Tolstois reformerische Bemühungen gerade an der Errichtung eines Denkmals für die reaktionäre Kaiserin Katharina II. scheitern mussten, begann doch gerade in den Jahren nach 1876 das Ende der etwas liberaleren Periode unter Alexander II., nicht zuletzt unter dem Eindruck der ersten Arbeiterdemonstrationen in Petersburg, wo unter der Führung des zwanzigjährigen Plechanow an 6. Dezember 1876 zum ersten Mal in Russland eine rote Fahne entrollt wurde.
Nach diesem Misserfolg zog sich Tolstoi zum zweiten Mal resigniert aus der pädagogischen Tätigkeit zurück.
2. 3 Tolstoi als Volksbildner
In seinem letzten Lebensabschnitt widmete sich Tolstoi nur noch über seine Erzählkunst der Volksbildung. Hier ergibt sich auch ein Anknüpfungspunkt zu Makarenko, der durch seine Erzählungen und Romane (z.B. Ein Buch für Eltern; vgl. VIII) ebenfalls zur Volksbildung beitragen wollte. Tolstoi schrieb einfache, für die Verbreitung im Volke gedachte Erzählungen, und er förderte die Schaffung und Herausgabe ähnlicher Erzählungen durch andere Autoren. Zu diesem Zwecke schuf er zusammen mit gleichgesinnten Freunden die Verlagsbuchhandlung ›Der Vermittler‹ (посредник), die bis 1935 die führende Institution der ›freien Pädagogik‹ in Russland und der Sowjetunion blieb. Diese Tätigkeit brachte Tolstoi auch erstmals in direkten Kontakt mit den Volkstümlern und den Sozialdemokraten unter der Führung Plechanows. Man war sich einig in der Absicht, das Volk durch Bildung aus dem Elend zu erlösen. Aus dieser Zeit stammt auch, die Zusammenarbeit von N.K. Krupskaja, der späteren Frau Lenins, mit Tolstoi, die im Auftrag Tolstois einige vom Verlag ›Der Vermittler‹ herausgegebene Bücher korrigierte, unter anderem den Grafen von Monte Christo. Krupskaja und Lenin sei nun auch zum Abschluss das Wort für eine Würdigung Tolstois aus marxistischer Sicht gegeben.
17 zit.n. Froese (1963), S. 55
18 zit.n. Froese (1963), S. 55
19 zit.n. Froese (1963), S. 66
20 zit.n. Froese (1963), S. 68
21 zit.n. Froese (1963), S. 71
22 Froese (1963), S. 71
23 Lenin [1913]a, S. 10
24 Herzen [1859], S. 61
25 Lenin [1913]a, S. 13
26 Anhänger Ernst Machs (1838-1916) eines der Begründer des Empiriokritizismus; zu Lenins Kritik des Empiriokritizismus vgl. Lenin [1909.]
27 Lenin [1909], S. 366
28 Charles Fourier (1772-1837), französischer utopischer Sozialist; laut Fourier hat die Menschheit bisher vier Perioden durchlaufen – die Wildheit, das Patriarchat, die Barbarei und die Zivilisation – und es gehe nun darum, die Menschheit in die fünfte Periode zu führen, in welcher soziale Gerechtigkeit herrschen soll. Der Konkurrenzkampf soll überwunden werden durch eine Vielzahl. von locker föderierten und kooperierenden Landwirtschafts- und Handwerksgenossenschaften, den Phalanstères.
29 vgl. Lenin [1902]
30 Plechanow (1894), S. 112f; diese Schrift Plechanows enthält überhaupt interessante Details zu Leben und Werk Tschernyschewskis
31 zit.n. Froese (1963), S. 75
32 Dobroljubow [1858], S. 146
33 Dobroljubow [1858], S. 139
34 Dobroljubow [1857], S. 61
35 Dobroljubow [1857], S. 73
36 zit.n. Krupskaja [1927], S. 35
37 zit.n. Froese (1963), S. 97
38 Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865); französischer utopischer Sozialist, von dem der berühmte Satz stammt: »La propriété c’est le vol« Er konnte aber seine bäuerlich-handwerkliche Herkunft nie abschütteln und schwankte daher immer zwischen sozialistischen und kleinbürgerlich-anarchistischen Ideen. Von daher war er prädestiniert als Vorbild für die russische Volkstümlerbewegung. Neben Tolstoi waren auch Herzen und Tschernyschewski von ihm beeinflusst.
39 vgl. Tolstoi [1862]b
40 vgl. dazu Tolstoi [1862]a, S. 58ff
41 Tolstoi [1862]a, S. 56
2. 4 Tolstoi aus der Sicht der sowjetischen Pädagogik
Nadeschda Konstantinowna Krupskaja betont zwar, dass sie niemals eine »›Tolstojanerin‹ im eigentlichen Sinne des Wortes«42 gewesen sei, doch meint sie: »ich bin Lew Tolstoi zu tiefem Dank verpflichtet, da er mir geholfen hat, dem Leben furchtlos ins Auge zu blicken«43. Sie erwähnt vor allem zwei Elemente des Tolstoischen Gedankenguts, die sie als junges Mädchen sehr beeinflusst hätten:
Erstens, dass er das Dorf und seine Lebensweise so, gut kannte. Auch ich kannte das Dorf und hatte viele Freunde unter den Dorfkindern. Ich stellte fest, dass Tolstoi das Dorf so schilderte, wie es war. Ausserdem gefiel mir sehr, dass er in jedem Kind den Menschen sah und seine Persönlichkeit achtete. [...] Mir schien, dass Tolstoi verstanden hatte, wie behutsam man die Kinder behandeln muss, dass man ihnen Gelegenheit geben muss, sich frei zu entwickeln und das Leben in seiner ganzen Fülle zu begreifen. Mir gefiel, dass Tolstoi die damalige Schule kritisierte und nach Wegen suchte, wie man sie für die Kinder besser, schöner und nützlicher machen konnte. Ich hasste jede Sklaverei und wollte eine freie Schule. Es bewegte mich tief, dass Tolstoi, der einen so wundervollen Roman wie Krieg und Frieden geschrieben hatte, auch darauf bedacht war, dass die Kinder etwas zu lesen hatten, dass er sich darüber Gedanken machte, wie er die Kinder lehren konnte, besser zu singen, und anderes mehr. Und er machte sich nicht nur Gedanken, sondern er genierte sich auch nicht, Fehler einzugestehen.44
Etwas härter urteilt Lenin über Tolstoi. Auch er betont die Volksverbundenheit Tolstois:
Tolstoi war ein vorzüglicher Kenner des dörflichen Russlands. Er gab in seinen künstlerischen Werken Abbilder dieses Lebens, die zu den besten Schöpfungen der Weltliteratur gehören. Die jähe Zerstörung aller ›alten Säulen‹ des dörflichen Russlands schärfte seine Aufmerksamkeit, vertiefte sein Interesse für alles, was sich rings um ihn her abspielte, führte zu einer Wende in seiner gesamten Weltanschauung. Seiner Geburt und Erziehung nach zum höchsten Grundherrenadel Russlands gehörend, brach Tolstoi mit allen gewohnten Ansichten dieses Milieus und fiel in seinen letzten Werken mit leidenschaftlicher Kritik über alle heutigen staatlichen, kirchlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zustände her, die auf der Unterjochung der Massen, auf ihrem Elend, auf dem Ruin der Bauern und überhaupt der Kleinbesitzer, auf Gewalt und Heuchelei beruhen, die das ganze Leben von oben bis unten durchtränken. [...] Tolstois Kritik zeichnet sich durch eine solche Kraft des Gefühls aus, durch solche Leidenschaftlichkeit, Überzeugungskraft, Frische, Aufrichtigkeit, Furchtlosigkeit in dem Streben, ›bis zum Kern vorzudringen‹, in dem Streben, die wahre Ursache für die Not der Massen zu finden, weil diese Kritik wirklich den Umschwung in den Ansichten von Millionen Bauern widerspiegelt, die eben erst aus der Leibeigenschaft zur Freiheit gelangt sind und erkannt haben, dass diese Freiheit neue Schrecken des Ruins, des Hungertods, des obdachlosen Lebens unter ›gerissenen‹ Städtern usw. bedeutet. [...] Der Protest von Millionen Bauern und ihre Verzweiflung – das ist in Tolstois Lehre zusammengeflossen.45
Soweit die Würdigung Tolstois durch Lenin. Seine Kritik setzt nun daran an, dass Tolstoi nur die Verzweiflung und nicht die Hoffnung der Massen zum Ausdruck gebracht habe. Vor allem aber kritisiert er seine Philosophie vom ›Verzicht auf Widerstand gegen das Böse‹, die ihn auch dazu geführt habe, in den grossen Kämpfen von 1905-1907 teilnahmslos abseits zu stehen.
Damit offenbarte der feurig protestierende, der leidenschaftliche Ankläger, der grosse Kritiker in seinen Werken eine solche Verständnislosigkeit für die Ursachen der Krise und die Möglichkeit eines Auswegs aus der Krise, die über Russland hereinbrach, wie sie nur ein patriarchalischer, naiver Bauer haben kann, nicht aber ein europäisch gebildeter Schriftsteller.46
Lenin macht aber nicht etwa Tolstoi persönlich für dieses Versagen verantwortlich, sondern er sieht ihn ganz klar als das Produkt der widerspruchsvollen Verhältnisse um die Jahrhundertwende. Tolstoi ist für ihn ein typischer Vertreter der Reform von 1861, der die Revolution von 1905 nicht verstehen konnte und wollte. Aus diesem Grunde wird Tolstois Pädagogik von Lenin auch in ihrer Zeit gewürdigt, doch verspricht er sich, vielleicht im Gegensatz zu Krupskaja, nichts von ihr für die Erziehung eines modernen Menschen.
Auch Makarenko hat sich an verschiedenen Stellen über Tolstoi geäussert. Dabei lobt er in ihm vor allem den grossen Schriftsteller. Er stimmt mit Tolstoi überein, vom Menschen das Gute zu fordern, doch bekämpfte er dessen Forderung, sich dem Bösen nicht zu widersetzen. In dieser Lehre Tolstois, ›Widersetze dich nicht dem Übel‹, sieht er die Grundlage aller negativen Erscheinungsformen der ›freien Erziehung‹. Es gelte, sich eben gerade in der Erziehung dem Bösen zu widersetzen.
3 Die Pädagogik der ›freien Erziehung‹
Noch zu Lebzeiten Tolstois, nämlich 1907, wurde von Pädagogen aus dem Kreis um den Verlag ›Der Vermittler‹ die Zeitschrift Freie Erziehung