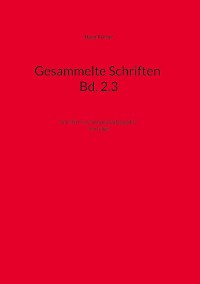Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Band 4.1 der Gesammelten Schriften sind grundsätzliche Beiträge zur Entwicklungspolitik enthalten, wie 'Die Interdependenz von Schule und Ökonomie' aus dem Jahr 1984, aber auch neuere Arbeiten wie 'Afrika dekonstruieren - und rekonstruieren' und die deutschsprachige Neufassung der Analyse zur 'Rolle der Lehrerinnen und Lehrer in der malischen Schule', beide aus dem Jahr 2021. Weiter sind darin alle Artikel, Vorträge und Berichte aus der Zeit enthalten, als Hans Furrer Projektleiter der 'Lehrerbildung Afrika' des Schweizerischen Lehrervereins war (1983-1996).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt Bd. 4.1
Vorwort
I Grundsätzliches
Die Interdependenz von Schule und Ökonomie in den Ländern der Dritten Welt
(
1984)
1. Einleitung
2. Begriffsklärungen
3. Ökonomische Grundlagen
4. Heterogene Sozialisation
5. Die Marginalisierung
6. Gibt es Alternativen?
7. Abschliessende Bemerkungen
Was heisst unterentwickelt?
(
1984)
Geschichte der ›self-reliance‹
(
1992)
Von Korsika nach Eritrea
(
2016)
Afrika dekonstruieren – und rekonstruieren
(
2021)
II Schriften zu Mali und Togo
L’éducation à la République du Mali – et le rôle du maître
(
1983)
1. Introduction
2. L’éducation précoloniale
3. L’école coloniale
4. L’éducation après l’indépendance
5. Le rôle du maître malien
6. Conclusions
Deutschsprachige Neufassung
Die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer in der malischen Schule – eine dialektische Analyse
(2021)
Die Schule von M’piébougou
(
1984)
Lehrerfortbildung in Afrika: Kollegiale Hilfe aus der Schweiz
(
1989)
Welche Schule für welches Afrika?
(
1989)
Was können wir von der afrikanischen Schule lernen?
(
1990)
Die Verdammten hatten genug
(
1991)
Jahresbericht LBA 1990/91
(
1991)
Discours auprès du SELT
(
1992)
Schlussbericht der Arbeitsgruppe LBA
(
1993)
Vertraulicher Bericht einer ›privaten‹ Reise nach Mali
(
1995)
Projektskizze ›Schulentwicklung‹
(
1996)
Vorwort
Eigentlich war dieser Band unter dem Titel Schriften zur Dritten Welt geplant, doch hat sich in der Zwischenzeit der Begriff des ›globalen Südens‹ durchgesetzt und ich habe ihn darum auch übernommen. In den hier abgedruckten Texten aus den Jahren 1984 – 2015 habe ich aber den Begriff ›Dritte Welt‹ beibehalten, da er doch einen etwas anderen Gedanken beinhaltet, als derjenige des ›globalen Südens‹. Ich habe dies bereits in der Begriffsklärung meiner Lizentiatsarbeit erläutert und kann dort in einer ausführlichen Version nachgelesen werden (vgl. S. 35ff dieses Bandes). Hiermöchte ich aber trotzdem kurz den Unterschied erläutern und dazu die ursprüngliche Definition des Ägypters Ismail-Sabri Abdalla beiziehen:
In zusammenfassender Weise betonen wir einmal mehr, dass die Dritte Welt eine historische Tatsache der heutigen Weltordnung ist. Dieser Begriff kann nicht aufgegeben werden ohne Schaden für die Analyse der internationalen Beziehungen, der Ausarbeitung von Entwicklungsstrategien und des Studiums der Hauptfragen der Menschheit: Massenarmut, Lebensstil, Umwelt und Krieg und Frieden. Der Begriff erlaubt keinerlei Hierarchie der Welten und auch keinen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Er drückt lediglich den Gedanken der Nichtzugehörigkeit zu den Industrieländern aus, seien sie kapitalistisch oder sozialistisch; er drückt auch aus, dass diese Länder den Stempel der Abhängigkeit und Ausbeutung tragen. Brasilien und Saudi-Arabien sind genauso Länder der Dritten Welt wie Kuba und Vietnam, trotz ihrer jeweiligen Ideologien, ihres Reichtums und ihrer Entwicklungsmodelle. Wir kennen keinen anderen Begriff, der unsere Länder besser kennzeichnet. Der Begriff ›Entwicklungsländer‹ ist nichts als ein Mythos.1
Indem dass der Begriff die realen Machtverhältnisse ausdrückt, finde ich ihn immer noch angebrachter, als den rein geografischen Ausdruck des ›globalen Südens‹. Angesichts der heutigen Situation müsste die Kategorisierung angepasst werden. So müssten heute Brasilien, Saudi-Arabien – aber z.B. auch Indien – eher der ›Zweiten Welt‹ zugerechnet werden, da sie regional auch Abhängigkeiten generieren.
Angesichts der heutigen Machtverhältnisse verstehe ich unter der ›Ersten Welt‹ die imperialistischen Staaten, dh. die USA, Russland und China sowie die EU als Ganzes. Zur ›Zweiten Welt‹, gehören ›die Schwellenländer‹ (Brasilien, Indien, Südkorea, Singapur) u.a.), die kleineren Industrienationen, die keine globalen Machtgelüste haben, wie die Schweiz, Serbien, Japan und kleineren EU-Staaten, insbesondere die osteuropäischen und baltischen Staaten. Die ›Dritte Welt‹ würde die restlichen Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas umfassen. Obwohl nach allen drei Definitionen die Dritte Welt stets in etwa die gleichen Länder umfasst, nämlich den ärmsten Teil unserer Welt, ergeben sich bei einer dialektischen Analyse in den drei Modellen andere Widersprüche und vor allem ein anderer Hauptwiderspruch und daraus auch unterschiedliche Lösungsansätze. Diese Analyse müsste aber noch geleistet werden.
In diesem Band sind die meisten Schriften zum globalen Süden enthalten, die bisher ganz verstreut erschienen sind. Einzig ein wichtiger Artikel aus dem Jahre 1995 mit dem Titel 25 ans de coopération pédagogique en Afrique konnte nicht mehr aufgefunden werden. Er ist erschienen in ›L’écho‹, einer ehemaligen Beilage zum ›L’éducateur‹ der Zeitschrift der SPR ›Société Pédagogique Romande‹, der Lehrergewerkschaft der französischsprachigen Schweiz.
Die Artikel, Vorträge und Beiträge zu Sammelbänden wurden grösstenteils genauso übernommen, wie sie damals erschienen sind, so gross auch die Versuchung gewesen war, aus heutiger Sicht einige Änderungen vorzunehmen. In wenigen Ausnahmen wurden einige Ergänzungen (nicht Änderungen) zum besseren Verständnis eingefügt.
Orthographische und grammatikalische Fehler wurden korrigiert — evtl. sind aber durch das einscannen und Konvertieren der Texte neue Fehler entstanden, die nicht bemerkt wurden. Zudem wurden in ganz offensichtlichen Fällen gendermässig korrekte Änderungen gemacht.
Ich kann auch heute noch zu all den Inhalten stehen. Einzig bei einigen Artikeln würde ich heute eine weniger plakative Sprache und weniger ideologisch geprägte Begriffe verwenden, Doch in der damaligen politischen Situation waren sie durchaus stimmig.
Was mich aber ungemein gefreut hat ist, dass gerade die grundsätzlichen Schriften, wie z.B. meine Lizentiatsarbeit aus dem Jahre 1984 zur Interdependenz von Schule und Ökonomie in den Ländern der Dritten Welt und die Beiträge zur ›Self-reliance‹, bis heute aktuell geblieben sind. Aus diesem Grunde wäre es wichtig, eine Neufassung dieser Arbeiten an die Hand zu nehmen und dabei die durch die Globalisierung neu geschaffenen ökonomischen Begebenheiten zu berücksichtigen und, statt allgemein auf die Schule, mehr auf die Berufsbildung zu fokussieren. Diese Arbeit ist aber bisher nicht zustande gekommen, jedoch ist ein längerer Essay aus dem Jahre 2020 auf englisch2, der einen Beitrag zu einer Neuorientierung der Berufsbildung im globalen Süden leisten soll, in der Festschrift zu meinem 75. Geburtstag3 erschienen und auch im Band 1.1 der Gesammelten Schriften abgedruckt.
Boll, im August 2022
1 Abdalla (1978), S. 21; übers. HF
2 Furrer (2020)
3 Furrer et al. {2021}
Teil I
Grundsätzliches
Titelblatt der Lizentiatsarbeit (geschrieben mit einer IBM-Kugelkopf-Maschine mit Korrekturtaste)
Hans Furrer
Die Interdependenz von Schule und Ökonomie in den Ländern der Dritten Welt
Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Situation in Westafrika4
Für Elisabeth und unser im Werden begriffenes Kind, das hoffentlich eine Lösung, der in dieser Arbeit beschriebenen Probleme miterleben kann.
Forch, 23. Januar 1984
4 Diese Arbeit wurde im Mai 1984 von der Philosophischen Fakultät I der Universität Zürich von Prof. Konrad Widmer als Lizentiatsarbeit angenommen. Sprachliche Fehler wurden korrigiert und wenige Erklärungen angefügt und zwar zu einzelnen damals aktuellen Bezügen – oder wenn sich die Bedingungen seit 1984 allzu sehr geändert haben.
1 Einleitung
Die vorliegende Arbeit entstand aus tiefster Betroffenheit vor den Problemen der Dritten Welt. Bei mehreren Reisen in verschiedene Länder Afrikas sind mir zwei gegensätzliche Eigenschaften der Afrikaner aufgefallen: einerseits eine lebensfrohe, weltoffene und uneigennützige Grundhaltung der meisten Menschen, die ich angetroffen und näher kennengelernt habe; andererseits aber die durch die grosse materielle Not hervorgerufene tiefe Resignation und der grosse Pessimismus, was die Perspektive des eigenen Lebens und des Landes, ja des ganzen Kontinents anbetraf.
Als Pädagoge interessierte es mich natürlich, ob und wie die Schule mit diesem Problem fertig wird. Versteht sie es, die Kraft der positiven Grundhaltung zur Bewältigung der riesigen Probleme zu nutzen oder ist etwa gerade die Schule mit ein Grund für die grenzenlose Resignation.
Ein Einsatz als Lehrerfortbildner in Mali5 und viele Schulbesuche in diesem Land haben mich sehr beeindruckt. Was ich dabei kennenlernte war ein Schulsystem, das sich völlig auf europäische Curricula abstützt und die Kinder so ihrer Kultur entfremdet. Solch ein Schulsystem kann nur Gefühle der Minderwertigkeit und der Machtlosigkeit hervorrufen. Als einziges Ziel wird der individuelle Aufstieg durch Anpassung, Erlernen der französischen Sprache und Erlangung eines Diploms gesetzt. Nur dadurch steht einem der Weg zu einer Karriere in der Administration offen, was heute als einziger Ausweg aus der materiellen Misere für sich und die Familie gesehen wird. Aber mit der zunehmenden Verschuldung des Staates ist auch eine solche ›gute‹ Schulbildung nicht mehr Garantie für eine gesicherte Stellung und man kann trotz Schulbildung in die Arbeitslosigkeit und sogar wieder in den Analphabetismus verfallen.
Diese persönlichen Erfahrungen von der Inadäquatheit des malischen Schulsystems wurden auch durch Statistiken und durch Schilderungen von Mitarbeitenden in der Entwicklungszusammenarbeit aus andern Ländern bestätigt. Obwohl die 25 ärmsten Länder der Welt mehr als 20% ihres Budgets für das Erziehungswesen ausgeben, stagniert in diesen Ländern die Einschulungsrate zwischen 20 und 30%. Der Prozentsatz der Analphabeten nimmt sogar jährlich zu.
Diese bedenklichen Fakten und die damit verbundenen riesigen Probleme haben mich gedrängt, das Problem der Schule in der Dritten Welt einmal in seinem Gesamtzusammenhang zu analysieren. Dass dabei nicht eine distanzierte, neutrale Untersuchung entstand, versteht sich von selbst. Vor soviel menschlichem Elend vergeht einem die Überparteilichkeit.
Das Denken muss parteilich sein und ist es immer gewesen. Heute leugnen das nur noch diejenigen ab, die ihre Farbe verstecken müssen oder sich über sie nicht klar sind. Auch die bürgerliche Wissenschaft war nie eine neutrale, obwohl sie sich darüber in falschem Bewusstsein wiegte.6
Wichtig scheint mir, dass ich dieses Erkenntnisinteresse offen darlege und versuche, im Laufe der Untersuchung intersubjektiv einfühlbar zu machen. Ich beanspruche keine absolute Wahrheit, keine Wahrheit ›an sich‹, sondern Wahrheit ›für uns‹, das heisst, für die Emanzipation der Menschen in der Dritten Welt und hier bei uns, da nur durch die Lösung der unermesslichen Probleme der Dritten Welt auch für uns, in den sogenannt entwickelten Ländern, eine Perspektive abzusehen ist.
An dieser Stelle möchte ich all meinen afrikanischen Kollegen für ihre Informationen und Hinweise recht herzlich danken. Vor allem Modibo Diarra7 aus Bamako hat mir mit seiner grossen Erfahrung im afrikanischen Schulwesen unschätzbare Dienste erwiesen. Die stundenlagen nächtlichen Diskussionen mit ihm und unseren Kollegen Yusuf Ganaba und Amadou Diabaté haben meine Notizhefte mit konkreten Erfahrungen gefüllt. Der ausgedehnte Briefwechsel mit ihnen über allgemeine Fragen der Erziehung und über die Probleme der Schule im Besonderen, haben viel zur Klärung meiner Position beigetragen.
Ich hoffe, mit dieser Arbeit letztlich auch etwas beizutragen zu ihrer erfolgreichen Arbeit im Dienste einer besseren Zukunft ihres Volkes.
1.1 Fragestellungen
Angesichts der unzähligen gescheiterten Schulungsprojekte, der stagnierenden, ja sinkenden Alphabetisierungsraten in der Dritten Welt, kam weltweit ein Umdenken in den Entwicklungsprojekten für das Bildungswesen zustande. Radikale Kritiker wie Ivan Illich, bahnbrechende Pädagogen wie Paolo Freire und die diversen UNESCO-Programme fordern eine Reform des Bildungswesens in den Ländern der Dritten Welt.
Da auch diese Ansätze nur punktuell zu Erfolgen führten, stellt sich die Frage nach den Gründen. Sind sie etwa darin zu suchen, dass die Schule und die Erziehung stets isoliert, ohne Rekurs auf die ökonomische Situation der Dritten Welt gesehen wurde? Dieser Frage nach dem Zusammenhang von Ökonomie und Schule in der Dritten Welt will diese Arbeit nachgehen.
Es wird die Hypothese aufgestellt, dass in diesen Ländern ökonomisch und in Bezug auf die Schule nicht einfach eine Situation besteht, wie sie bei uns vor 150 bis 200 Jahren bestand und somit Entwicklung einfach nachgeholt werden muss, sondern dass ein qualitativer Unterschied in der Entwicklung besteht.
Konkret stellen sich folgende Forschungsfragen:
Worin besteht der qualitative Unterschied zwischen unserem Erziehungswesen und demjenigen der Dritten Welt in Bezug auf seine historische Gewordenheit und die heutige Situation?
Inwiefern lässt sich dieser Unterschied aus der qualitativ andern Entwicklung der ökonomischen Situation erklären?
Gibt es Alternativen für eine Entwicklung der Schule in der Dritten Welt im Hinblick auf eine Emanzipation des einzelnen Menschen und damit auch der Völker der Dritten Welt?
Obwohl im Laufe der Untersuchung zu Vergleichszwecken verschiedentlich auf Beispiele aus andern Ländern Afrikas und der übrigen Dritten Welt zurückgegriffen wird, möchte ich meine Arbeit auf den kulturell und geschichtlich relativ einheitlichen Raum von Westafrika beschränken. Bei konkreten Beispielen beschränke ich mich oft auf die Republik Mali, da ich deren Verhältnisse am besten kenne. Ich bin dabei der Ansicht, dass gerade Mali als Sahelland typisch für einen grossen Teil der westafrikanischen Länder ist und darum keine Verzerrung der Situation stattfindet.
Im Folgenden wird so vorgegangen, dass im Kapitel 2 zuerst die Begriffe Schule, Ökonomie und Dritte Welt definiert werden. In Kapitel 3 wird die ökonomische Entwicklung der Länder der Dritten Welt untersucht. In Kapitel 4 soll die Heterogenität der verschiedenen Erziehungsformen in den Ländern der Dritten Welt dargestellt werden. In einem nächsten Kapitel sollen mögliche Entwicklungen der Situation, wie sie aus dem weltweiten Vergleich hergeleitet werden können, aufgezeigt werden. Im sechsten und wichtigsten Kapitel wird der Frage nach Alternativen nachgegangen. Dabei können weder ökonomische noch pädagogische Rezepte für eine erfolgreiche Entwicklung gegeben werden, sondern es sollen nur Denkanstösse formuliert und auch einzelne Projekte, z.B. aus Simbabwe, vorgestellt werden. Im letzte Kapitel wird versucht, eine Gesamtdarstellung der Untersuchung zu präsentieren und die gewonnenen Ergebnisse auf die Fragestellungen rückzubeziehen.
Die Vielfältigkeit der Probleme und Fragestellungen muss auch mit verschiedenen Methoden angegangen werden, welche im folgenden Abschnitt dargelegt werden.
1.2 Methoden
Die in der vorliegenden Untersuchung verwendeten Methoden müssen unterschieden werden in die Methoden der Datengewinnung und die Methode der Datenverarbeitung. Die Daten zur ökonomischen Entwicklung wurden hauptsächlich durch die Verbindung von erarbeiteten ökonomischen Theorien, der Interpretation von Statistiken und den auf Reisen in Afrika gemachten Beobachtungen gewonnen. Die Informationen zur pädagogischen Situation wurden zum Teil durch das Studium von Berichten der UNESCO, von Schulprogrammen und durch Interviews mit Schulinspektoren, Schuldirektoren und dem Erziehungsminister von Mali gewonnen. Hauptsächlich aber handelt es sich um eigene Erfahrungen bei Schulbesuchen und im eigenen Unterricht mit afrikanischen Schülern und vor allem Lehrern. Es handelt sich dabei also um die Methode der ›teilnehmenden Beobachtung‹.
1.2.1 Teilnehmende Beobachtung
Es gibt in den Humanwissenschaften (und wahrscheinlich überhaupt) keine Beobachtung ohne Teilnahme. Zwar kann mit den verschiedensten technischen Hilfsmitteln, wie Einwegspiegeln, versteckter Kamera usw. eine minimale Teilnahme erreicht werden8, »doch direkte Beobachtung schliesst immer schon die Rolle des Teilnehmers mit ein«9.
Diese direkte Teilnahme stand bei meinen Untersuchungen stets ausser Frage; dabei möchte ich neben der rein physischen Teilnahme am Unterricht auch die emotionale Teilnahme an den Problemen der Schüler und Lehrer hervorheben. Es ist unmöglich, distanziert zu beobachten, wie ein Lehrer vor hundert Schülern unterrichtet, von welchen nur etwa die Hälfte eine Schiefertafel und winzige Stückchen von Kreideabfall besitzen oder zu wissen, dass ein grosser Teil dieser Schüler seit Tagen nichts Anderes mehr gegessen hat, als zweimal täglich eine kleine Schüssel Hirsebrei! Wenn man weiss, dass der Lehrer vielleicht seit drei oder vier Monaten auf den Lohn wartet und seine zahlreiche Familie nur mit Gelegenheitsarbeiten durchbringt, begreift man sein oft mangelndes Engagement, begreift man, dass er für die Vorbereitung der Stunden nur wenig Zeit einsetzt und oft während Jahren die gleichen vorbereiteten Lektionen hält10.
Konkret sahen meine teilnehmenden Beobachtungen folgendermassen aus:
In zweistündigen Seminaren wurden mit den malischen Lehrern die dringendsten pädagogischen und didaktischen Probleme eines zu unterrichtenden Themas erörtert. Anschliessend wurden in gemeinsamer Arbeit Musterlektionen erarbeitet, die Lösungsvorschläge für die Probleme enthielten. Diese Lektionen wurden von malischen Lehrern oder von mir nachher mit einer Übungsschulklasse von etwa zwanzig Kindern durchgeführt und anschliessend gemeinsam besprochen.
Ich unternahm in Begleitung eines afrikanischen Kollegen oder allein Schulbesuche in Primarschulklassen mit den üblichen Klassenbeständen von oft über hundert Schülern und sprach anschliessend mit den Lehrern über die Lektion, ihre Intentionen aber auch über die Schule und die Rolle des Lehrers allgemein.
Am Abend besprach ich meine Notizen in kleinem Kreise mit befreundeten malischen Kollegen und wir versuchten, meine Beobachtungen zu systematisieren.
Ein Grossteil der gesammelten Informationen, insbesondere was die Rolle des Lehrers betrifft, wurden an anderer Stelle bereits dargestellt.11
Ausser durch meine teilnehmende Beobachtung gewann ich meine Daten auch ›hermeneutisch‹ durch die Analyse und Interpretation von Quellentexten, Schulprogrammen, Statistiken und Interviews.
1.2.2 Hermeneutik
Unter Hermeneutik im engeren Sinne versteht man allgemein das »kunstgemässe Verstehen«12 von vorwiegend sprachlichen Äusserungen. Dabei entstehen in einem interkulturellen Vergleich nicht nur sprachliche Probleme auf der Ebene der Denotation, sondern hauptsächlich solche auf der Ebene der Konnotation. So bedeutet z.B. der Ausdruck ›Erziehung in der Familie‹ in Afrika mit seinen Grossfamilien etwas ganz Anderes als bei uns. Aber auch in Afrika selbst wird er in Burundi, mit seinen Streusiedlungen, andere Inhalte haben, als etwa in Mali mit seinen geschlossenen Haufendörfern.
Nicht beachtet wurde der Ansatz. der Ethno-Hermeneutik13, wie er von Bosse und Erdheim14 in ihren Analysen von Autobiographien angewendet wird. Dieser Ansatz scheint mir für das Verstehen von kulturellen Entwicklungen äusserst brauchbar, doch setzt er eine psychoanalytische Vorbildung voraus. Daneben gibt es aber — auch schon bei Dilthey — einen weiter gefassten Begriff der Hermeneutik:
Dies Verstehen reicht von dem Auffassen kindlichen Lallens bis zu dem Sprechen des Hamlet oder der Vernunftkritik. Aus Steinen, Marmor, musikalisch geformten Tönen, aus Gebärden, Worten und Schrift, aus Handlungen, wirtschaftlichen Ordnungen und Verfassungen spricht derselbe menschliche Geist zu uns und bedarf der Auslegung.15
In diesem weiten Sinne gehe ich in der vorliegenden Arbeit hermeneutisch vor. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen. Das Verstehen und Interpretieren des abgebildeten Bauplans einer ›concession‹ in Bamako, in welcher vier Familien, mit etwa zehn Kindern, zum Teil mit Grosseltern, sowie ein alleinstehender junger Mann wohnen, sagt sehr viel über die Erziehung in Mali aus (genauso wie unsere sterilen Wohnblocks einiges über unsere Erziehungsformen aussagen).
a, b, c, d,
Wohnungen der vier Familien
e
Zimmer des Junggesellen
1
Brunnen
2
gemeinsame Küche
3
gemeinsames WC und Waschgelegenheit
4
Kleintiere (Geflügel, Ziegen)
5
Mangobaum
Dem Verstehen in diesem weiten Sinne dient es auch, wenn wie z.B. im Kapitel 4 ähnliche Entwicklungen in andern Ländern, ja andern Erdteilen analysiert werden, um dadurch mögliche Entwicklungen in Westafrika vorweg zu begreifen.
Die hermeneutische Methode, wie sie in der vorliegenden Arbeit verstanden wird, besteht »also im Zusammenwirken von Induktion, Anwendung allgemeinerer Wahrheiten auf den besonderen Fall und vergleichendem Verfahren«16.
Ein weiteres Problem der Hermeneutik besteht in dem, was man als ›hermeneutischen Zirkel‹ bezeichnet: Verstehen bezieht sich in erster Linie einmal auf einzelne Äusserungen.
Diese(s) ist jedoch gleichsam in das Medium eines historisch-gewordenen Ganzen eingetaucht. Es muss sogar in jedem menschlichen Verstehen mitbewusst sein, um dem Einzelnen gerecht zu werden.17
Wenn diese bei Linke auf den einzelnen pädagogischen Akt bezogene Dialektik zwischen dem Teil und dem Ganzen bereits im Kleinen ein Problem ist, um wieviel grösser muss die Problematik bei der Untersuchung der komplexen Gesamtheit des Erziehungswesens und seiner Beziehung zur Ökonomie in der Dritten Welt sein.
Bereits Hegel stellte fest: »Das Wahre ist das Ganze.«18 Damit meinte er, dass das Einzelne erst durch das Ganze, durch das Allgemeine ausgedrückt werden kann; anderseits wird das Ganze nur durch die Gesamtheit aller Einzelnen, aller Besonderheiten fassbar.
Dies meint auch Adorno mit folgender Bemerkung:
Die gesellschaftliche Totalität führt kein Eigenleben oberhalb des von ihr Zusammengefassten, aus dem sie selbst besteht. Sie produziert und reproduziert sich durch ihre einzelnen Momente hindurch. […] So wenig aber jenes Ganze vom Leben, von der Kooperation und dem Antagonismus seiner Elemente abzusondern ist, so wenig kann irgendein Element auch bloss in seinen Funktionen verstanden werden ohne Einsicht in das Ganze, das an der Bewegung des Einzelnen selbst sein Wesen hat. System und Einzelheit sind reziprok und nur in ihrer Reziprozität zu erkennen.19
Aus diesen Gründen kann der dialektische Sachverhalt des hermeneutischen Zirkels nur durch dialektisches Vorgehen bewältigt werden.
1.2.3 Dialektik – mehr als eine Methode
Dialektisches Vorgehen besteht nicht darin, dass man einem gegebenen Sachverhalt seine Antithese entgegenstellt und dann auf irgendeine wunderbare Weise zu einer Synthese kommt. Dieses ›mechanistische‹ Verständnis der Dialektik als eines unendlichen spiralförmigen Prozesses ist eben gerade nicht dialektisch.20 Dieses noch ganz in cartesianischen Denkfiguren verhaftete Verständnis ist auf dreifache Weise falsch:
Erstens besteht die Dialektik nicht in einem Nacheinander von These und Antithese, sondern in ihrer Gleichzeitigkeit, in der Einheit der Gegensätze. Das Eine kann ohne das Andere nicht existieren.
Dies soll kurz an der Bedeutung der Dialektik von Quantität und Qualität in der Zahlbegriffsbildung beim Kinde erläutert werden:
Um die Quantität einer Menge festzustellen, müssen gleichzeitig qualitative und quantitative Kategorien verwendet werden. Es muss klar sein, was zur Menge gehört und was nicht. Diese Dialektik hat im Erkenntnisprozess des Kindes bei der Bildung des Zahlbegriffs ihre Parallele in der Dialektik, d.h. der Gleichzeitigkeit und Einheit des Widerspruchs von kardinalem und ordinalem Aspekt der Zahl.
Diese Spaltung des Einheitlichen in seine widersprüchlichen Bestandteile und seine gleichzeitige Synthese zur Totalität ist nun aber nicht nur das Bewegungsgesetz unseres Denkens, wie dies Hegel definierte, sondern es ist Erkenntnisprozess und Bewegungsgesetz des Seins in einem.
Il nostro pensiero soggettivo e il mondo oggettivo sono sottoposti alle stesse leggi generali, perché il pensiero non è introdotto dall'esterno nel mondo, ma si è sviluppato come forma specifica di movimento della materia altamente organizzata.21
Erst dieser, auch wieder dialektische Prozess von Erkennen und Sein, von Theorie und Praxis lässt uns die Dinge in ihrer inneren Widersprüchlichkeit erkennen, erschliesst den Bewegungsprozess der Dinge unserer sinnlichen und gesellschaftlichen Umwelt in ihrer Totalität. Aus diesem Zusammenhang heraus ist es nun zweitens ist klar, dass die Dialektik keine Methode ist, die von aussen an die Dinge herangetragen werden kann.
Die Dialektik kann also nur von einem im Innern ›situierten‹ Beobachter erkannt werden, das heisst von einem Forscher, der seine Forschung gleichzeitig als einen möglichen Beitrag zur Ideologie der ganzen Epoche erlebt und als besondere Praxis eines Individuums, das durch sein historisches und persönliches Geschick innerhalb einer weiterreichenden und ihn bedingenden Geschichte bestimmt ist.22
Von dieser Bestimmung der Dialektik her muss ein weiteres Mal die Überparteilichkeit, die Wertfreiheit der Forschung infrage gestellt werden: Wenn sich der Mensch, wie in den Humanwissenschaften, als innerlich selbst beteiligter selbst thematisiert, so werden »Erkenntnis und Interesse« eins23. Dieses Primats des Interesses des Seins über das Denken war sich bereits Hegel, als hervorragendster Vertreter des deutschen Idealismus, klar, als er schrieb:
Ich habe mich durch Erfahrung von der Wahrheit des Spruches in der Bibel überzeugt und ihn zu meinem Leitstern gemacht: Trachtet am ersten nach Nahrung und Kleidung, so wird euch das Reich Gottes von selbst zufallen.«24
Dialektik ist also nicht eine vom Stoff abgetrennte Methodologie, sondern eine menschliche Grundhaltung, die vom Erkenntnisinteresse des Menschen in die Bewegungsgesetze der Menschheit und ihrer Geschichte geleitet ist, mit dem Ziel der emanzipatorischen Befreiung des Menschen zur Mündigkeit.
Drittens nun, und dies ist eine klare Abgrenzung von Hegel, besteht ein dialektischer Prozess nie aus nur einem Widerspruchspaar.Im Entwicklungsprozess eines komplexen Dinges gibt es eine ganze Reihe von Widersprüchen, unter denen stets einer der Hauptwiderspruch ist; seine Existenz und seine Entwicklung bestimmen oder beeinflussen die Existenz und die Entwicklung der anderen Widersprüche. 25
So gibt es zum Beispiel in den Gesellschaftsformationen der Dritten Welt zwar den wichtigen Widerspruch zwischen den Interessen der einheimischen Bevölkerung und denen des Neokolonialismus. Daneben aber bestehen noch unzählige weitere Widersprüche, wie diejenigen zwischen Stadt- und Landbevölkerung, zwischen einheimischer Elite und den breiten Volksmassen, zwischen Handwerkern und Händlern, zwischen Lehrern und Schulbürokratie, zwischen den Intentionen der Lehrer und den Schulprogrammen usw. usf. Die Kunst der dialektischen Analyse besteht nun darin, all diese Widersprüche und ihre gegenseitige Bedingtheit zu untersuchen, das Allgemeine im Besonderen zu finden und so den Hauptwiderspruch, an welchem es zur Lösung der Probleme anzusetzen gilt, herauszukristallisieren.
Dieses Verständnis von Dialektik, das in völligem Gegensatz zum mechanischen Dialektikbegriff der Dogmatiker in Ost und West steht, drängt auch zu einem Paradigmenwechsel,26 wie er in der heutigen Wissenschaftstheorie so vehement gefordert wird27.
Es ist wohl kein Zufall, dass das vernetzte Denken, wie es von diesen Wissenschaftstheoretikern immer wieder gefordert wird, stets in einem Atemzug mit der östlichen Philosophie des Yin und Yang28 genannt wird und dass ich als Beispiel für ein wirklich dialektisches Vorgehen die Theorie und Praxis eines östlichen Denkers, nämlich Maozedongs, beigezogen habe. Die östliche Philosophie, die sich unberührt vom cartesianischen Kausalitätsdenken entwickelt hat, konnte neben der Dialektik zu einer der Quellen für einen Paradigmenwechsel werden.
Neben diesen wissenschaftstheoretischen Fragen stellt sich bei einer dialektischen Untersuchung stets ein weiteres Problem. Der hermeneutische Zirkel manifestiert sich dabei nicht als Denkfigur, sondern als Darstellungsproblem. So ist es wohl möglich, das Ganze und seine Teile, die Einheit der Widersprüche gleichzeitig zu denken, sie können aber wegen der Digitalität unserer Sprache und Kommunikation nicht gleichzeitig beschrieben werden. Daher muss bei der Darstellung dialektischer Sachverhalte oft getrennt werden, was eigentlich zusammengehört; es muss oft auf etwas Bezug genommen oder etwas vorausgesetzt werden, was erst weiter hinten ausführlich beschrieben werden kann.
Dieses Dilemma versuchte ich so zu lösen, dass ich die einzelnen Aspekte der Probleme, d.h. die einzelnen Widersprüche isoliert, in einzelnen Fallen vielleicht sogar reduktionistisch, darstellte und erst am Schluss versuche, sie in ihrer gegensätzlichen und gegenseitigen, dialektischen Bedingtheit darzustellen29.
1.2.4 Probleme der Vergleichbarkeit
Nur Ähnliches lasst sich vergleichen: Betrachtet man aber die Länder Afrikas, oder auch eingeschränkt Westafrikas, mit ihren verschiedenen Kulturen, ihrer verschiedenen Geschichte und den verschiedenen politischen Ausrichtungen und Systemen, so fragt man sich, ob überhaupt ein verbindendes Glied zwischen den Erziehungssystemen der verschiedenen Ländern Westafrikas gefunden werden kann30.
Einerseits muss bei dieser Frage nach der Vergleichbarkeit in Betracht gezogen werden, dass die heutigen Länder Afrikas keineswegs kulturelle Einheiten bilden, sondern künstliche, von den Kolonisatoren geschaffene Gebiete sind. Aus den obigen Betrachtungen heraus könnte also nicht einmal das Erziehungswesen eines afrikanischen Landes als Einheit untersucht werden. So bestanden vor der Kolonisation in allen Gebieten weiträumige intakte alte Kulturen, mit eigenen Erziehungsidealen. All diesen Gebieten wurde während der Kolonialzeit ein europäisches Schulsystem übergestülpt, das einzig auf die Bedürfnisse der Kolonialmacht ausgerichtet war. Weiter gehören heute alle Länder Westafrikas zur Dritten Welt und es gilt für sie, gewaltige Anstrengungen im Erziehungssektor zu unternehmen, um ihre Abhängigkeit und ihre Armut zu überwinden. Eine einheitliche Vergleichsbasis scheint also doch vorhanden zu sein.
Ein weiteres Problem aber stellt sich in der Frage, im Hinblick auf was verglichen werden soll. Bestimmt kann dieses ›tertium comparationis‹ nicht unser schweizerisches oder irgendein europäisches Bildungsziel und Schulsystem sein, sondern es muss aus den Bedürfnissen der afrikanischen Staaten selbst erwachsen. Damit kann aber eine solche Analyse nicht auf den pädagogischen Bereich beschränkt werden, sondern
se verá obligado el experto en educación a estudiar más atentamente los elementos variables externos que influyen en el proceso educativo, bien sean de caracter social, económico, cultural o político31.
Eine Untersuchung der Bedürfnisse einer Gesellschaft bezüglich des Bildungswesens ist immer auch eine gesellschaftliche Auseinandersetzung um die Entwicklungsperspektiven dieses sozialen Systems. Damit wird sie aber zur normativen Frage und es soll darum zum Schluss dieses methodischen Teils nochmals ganz deutlich gesagt werden, dass es sich bei der vorliegenden Untersuchung nicht um eine Arbeit handelt, die sich pseudowertfrei versteht, sondern es steht als oberstes Ziel die Verbesserung der materiellen und geistigen Situation der Völker der Dritten Welt zur Diskussion.
2 Begriffsklärungen
2.1 Schule
Da Schule im weitesten Sinne als von der Gesellschaft veranstaltete Erziehung verstanden werden kann, hängt ihre inhaltliche und funktionale Bestimmung in erster Linie von den Vorstellungen über die Gesellschaft, von den Persönlichkeitsmodellen und von den Ansichten über den Beitrag, den die Schule zu deren Verwirklichung zu leisten hat, ab.
Grundsätzlich können zwei Inhalte und zwei Arten von Funktionen der Schule unterschieden werden:
Erhaltung der in der Kultur sich manifestierenden Werte und Normen und Befähigung zur Weiterentwicklung von Kultur: vergangenheits- und zukunftsorientierte Sozialisation, Aneignung von Wissen und Können durch Lernen.
Aussparung eines Lebensraums, in dem sich Begabungen entfalten, in dem sich Persönlichkeitsfaktoren in Abgrenzung zu gefährdenden Umwelteinflüssen enthalten können: gegenwartsorientierte Individuation.
32
Auf das Verhältnis zwischen diesen sich gegenseitig bedingenden, aber auch widersprechenden Faktoren soll nun eingegangen werden.
2.1.1 Die Dialektik von Individuation und Sozialisation
Der Mensch als natürliches Wesen ist ein Individuum, das eine bestimmte physische Konstitution, ein bestimmtes Nervensystem, Temperament, bestimmte dynamische Kräfte der biologischen Bedürfnisse und Affekte und viele andere Merkmale aufweist, die im Laufe der ontogenetischen Entwicklung, teils entwickelt, teils unterdrückt werden, mit einem Wort, sich mannigfaltig verändern.33
Die individuierende Funktion der Schule (und der Erziehung überhaupt), besteht nun darin, die Bedingungen und Freiräume zu schaffen, damit sich jedes Individuum seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprechend entwickeln kann. Diesem Drang nach unbeschränkter Entfaltung des Einzelnen steht nun eine andere Funktion der Erziehung entgegen, die sozialisierende Funktion zur Reproduktion und Weiterentwicklung der Gesellschaft.
Diese beiden Funktionen dürfen und können nicht getrennt werden, denn einerseits wirkt die Gesellschaft auf die Individuen, formt und verändert sie, andererseits aber besteht die Gesellschaft eben gerade aus diesen Individuen und wird von ihnen gestaltet. Die Aufgabe einer Individuations- oder Sozialisationstheorie ist es, in der konkreten Situation die Hauptseite dieses Widerspruchs zu bestimmen, das heisst zu untersuchen, welcher der beiden gegenläufigen Prozesse in einer gegebenen Gesellschaftsformation der ausschlaggebende ist.
In der heutigen Situation der Länder der Dritten Welt, deren Probleme in erster Linie Probleme des Überlebens und zwar des ökonomischen Überlebens sind, überwiegen unweigerlich die gesellschaftlichen Funktionen der Schule. Dies ist der Hauptgrund, warum im Folgenden hauptsächlich die sozialisierenden Funktionen der Schule untersucht werden. Zudem hat die Individuation in den afrikanischen Kulturen einen ganz anderen Stellenwert als bei uns, steht doch dort die Eingliederung in den Familien- und Sippenverband im Vordergrund. Aus diesen Gründen müssten die Kategorien, in denen Individuation fassbar wird, von diesen Kulturen her neu bestimmt werden, was den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Einzig in den Kapiteln 4.1 und 4.5, die sich mit der traditionellen Erziehung und mit der Identitätsfindung in der heutigen Situation befassen, sowie dem Kapitel 6.2.3, in welchem versucht wird, ein alternatives Schulmodell zu entwickeln, kommen Aspekte der Individuation zur Sprache.
Der dort verwendete Begriff der Persönlichkeitsbildung soll an dieser Stelle in einem Exkurs entwickelt werden.
2.1.1.1 Die Persönlichkeitsbildung
Der dialektische Widerspruch zwischen Individuation und Sozialisation strebt – wie jeder dialektische Prozess – seiner Auflösung in einer höheren Kategorie entgegen, der Persönlichkeit.
Das dauernd sich verändernde Resultat dieses bis zum Tode anhaltenden Prozesses beinhaltet die Merkmale beider Seiten in widersprüchlicher Einheit. Diese Einheit bildet sich jedoch nicht so heraus, dass der einzelne Mensch mit seinen individuellen Merkmalen einfach die gesellschaftlichen Faktoren passiv auf sich einwirken lässt. Nein, die Persönlichkeit
wird durch die Natur jener Beziehungen bestimmt, die (sie) erzeugen, und das sind für den Menschen die spezifischen gesellschaftlichen Beziehungen, die er in seiner gegenständlichen Tätigkeit eingeht.34
Dieses Moment der Tätigkeit in der Persönlichkeitsbildung erscheint vom ›zu sich selbst befreiten Menschen‹ der Aufklärung bis zur Erziehung zur Mündigkeit35 bei Adorno, in den verschiedensten Ausprägungen. Einer der ersten, der diesen Gedanken für die Pädagogik fruchtbar gemacht hat, war Pestalozzi, der in seinen ›Nachforschungen‹ von Menschen als dem »Werk der Natur, […] des Geschlechts […] und seiner selbst«36 sprach. Pestalozzi sah nun aber diesen Akt der Selbstwerdung zu sehr als einen reinen Willensakt:
Die Widersprüche, die in meiner Natur zu liegen scheinen, sowie der Mangel von Wahrheit und Recht, dem mein Geschlecht in gesellschaftlichen Zustand als solchem allgemein unterliegt und unterliegen muss, sind beides Folgen meiner sinnlichen tierischen Neigung, auf einem Punkt der Ausbildung, auf dem ich nur ein Werk meines Geschlechts und nicht ein Werk meiner selbst bin, stehenzubleiben und mich auf diesem Punkt, auf dem die innere Veredlung meiner selbst nicht erzielet werden kann, vollendet zu glauben.37
Mit dieser Auffassung nähert er sich sehr dem Kantischen Gedanken von der ›selbstverschuldeten Unmündigkeit‹ des Menschen. Er lässt dabei die gesellschaftlichen Zwänge, die gesellschaftlichen Bedingungen der Selbsttätigkeit ausser Acht. Die Ausformung einer allseitig entwickelten Persönlichkeit ist eben gerade kein reiner Willensakt, sondern sie ist aufs engste verbunden mit den Bedingungen der Individuation und der Sozialisation.
Wie sieht nun eine solche allseitig entwickelte Persönlichkeit aus. Sie kann hier nur kurz skizziert werden. Dazu muss einmal mehr Freuds bekannter Ausspruch zitiert werden, dass eine gesunde Persönlichkeit »arbeitsfähig und liebesfähig« zu sein hat38. Freud trifft damit ins Zentrum der Persönlichkeitstheorie. Es sind genau diese zwei Eigenschaften, die den Menschen vom Tier unterscheiden.
Tiere besitzen eine Individualität, sind aber keine Persönlichkeiten. Nur der Mensch ist eine Persönlichkeit. Die individuellen Besonderheiten der Psyche des Tieres sind das Resultat einer Anpassung an die Umwelt. Die Umwelt gibt jedem Tier ein individuelles Gepräge. Eine Persönlichkeit dagegen prägt ihre Umwelt durch schöpferische produktive Tätigkeit.39
Die Schule hatte nun in der Persönlichkeitsbildung die Aufgabe, das Kind zu bewusstem Handeln, zu verantwortungsvollem Umgang mit seiner Umwelt zu erziehen. Derjenige Mensch, der nicht passiv über sich verfügen lässt, sondern aktiv versucht, seine Lebensumstände und seine Umwelt im weitesten Sinne zu verstehen und zu gestalten, ist eine Persönlichkeit.
Dieses Tätigwerden des Individuums geschieht nun nicht als Einzelwesen mit egoistischen Zielen, sondern eingebettet in ein soziales Umfeld. Verantwortungsvolles Handeln heisst Rücksichtnahme auf den Nächsten, auf die höheren Ziele eines umfassenden Kollektivs. Liebesfähigkeit im weitesten Sinne heisst Abstimmung der eigenen Interessen mit den Interessen seines Familien-, Sippen- oder Staatsverbandes. Wenn sich der Mensch
nur mit der eigenen wenn auch fernen Perspektive begnügt, dann kann er wohl stark erscheinen, erweckt bei uns jedoch nicht den Eindruck von Schönheit und wirklichem Wert seiner Persönlichkeit. Je grösser das Kollektiv ist, dessen Perspektiven für den Menschen zu persönlichen Perspektiven werden, desto schöner erscheint der Mensch und desto höher steht er.40
In diesem Entwurf der Persönlichkeit gestaltet der Mensch nicht nur seine Lebensumwelt mit, sondern sie erzieht ihn ihrerseits durch ihre Ziele und Einwirkungen. Es ist dies das, was Makarenko ›parallele pädagogische Einwirkung‹ nennt; das Kollektiv, die Gesellschaft entwickelt die gleichen Ziele und Einstellungen, wie sie sich auch im Menschen entwickeln. Der Mensch lebt, d.h. liebt und arbeitet in Harmonie mit seiner Umwelt. Dadurch ist die Herausbildung einer entwickelten Persönlichkeit erst möglich in einer Gesellschaft, in welcher die Tätigkeit, die die Persönlichkeit formt, keine entfremdete mehr ist. Die Schule kann dazu nur in einer engen Verbindung von Unterricht, Produktion und Erziehung zur Eigenverantwortlichkeit beitragen. Dies gilt natürlich insbesondere auch für. die Schulen in der Dritten Welt, die sich zudem in einer doppelten Fremdbestimmtheit befinden.
Aber auch die Schulen in den Industrienationen in Ost und West sind noch weit entfernt von solchen Idealen der Persönlichkeitsbildung. Die Funktionen der Schule sind heute noch weltweit ganz anders geartet. Sie sollen im nächsten Kapitel untersucht werden.
2.1.2 Funktionen der Schule
Es gibt. wohl mindestens ebenso viele Bestimmungen der Funktion der Schule, wie es Pädagogen gibt. So hat z.B. Theodor Ballauf in seinem Buch Funktionen der Schule deren 31 verschiedene aufgezählt41. Dabei darf nie vergessen werden, dass jede Funktionsbestimmung der Schule, weil sie gesellschaftlich veranstaltete Erziehung ist, von der Theorie abhängt, mit der diese Gesellschaft begriffen wird. Eine Theorie der Schule, auch wenn sie noch so pädagogisch bezogen scheint, ist stets gesellschaftstheoretisch bestimmt. Die Gesellschaftstheorie, die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt, ist kurz zusammengefasst die folgende:
In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktivkräfte bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt.42
Unter gewissen Umständen können die Widersprüche zwischen der realen Basis und dem Überbau so gross werden, dass die Verhältnisse zu einer Umkehrung des Prozesses drängen, d.h. dass durch Veränderungen des sozialen, politischen und geistigen Prozesses die reale Basis verändert werden kann.43
Eine der Institutionen dieses Überbaus ist die Schule, die nach der oben formulierten Gesellschaftstheorie primär von der Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt ist. Um ihre Funktionen von diesem Gesichtspunkt her zu bestimmen, verwende ich die Kategorien, wie sie unter anderem von Fend verwendet werden: Qualifikationsfunktion, Selektionsfunktion und Legitimationsfunktion.44
2.1.2.1 Die Qualifikationsfunktion der Schule
Die Entstehung der Schule im heutigen Sinn geht einher mit der Veränderung der benötigten Qualifikationen des Menschen. Während in der vorindustriellen Gesellschaft die Qualifikation der Arbeitskraft weitgehend direkt in der Produktion, in der Handwerkslehre und in den Zünften geschah, werden sie in der Industrialisierung zunehmend der Schule Übertragen. Um diesen Prozess genauer zu analysieren, ist eine Darstellung des ›Doppelcharakters‹ der Ware und der Arbeit notwendig.
a) Der Doppelcharakter von Ware und Arbeit
Jede Ware, die auf den Markt gelangt, besitzt zwei Eigenschaften. Einerseits hat sie für den Käufer einen ganz bestimmten Gebrauchswert, derentwegen er sie überhaupt zu erwerben sucht.
Der Käufer ersteht sich ein Paar Schuhe, weil er nicht barfuss gehen will, einen Tisch, weil er darauf essen oder arbeiten will, Nahrungsmittel, weil er Hunger hat usw. Diese Nützlichkeit des Gegenstands wird durch seinen Gebrauchswert bestimmt; er verwirklicht sich in der Konsumation.
Andererseits besitzt die Ware auch einen gewissen Tauschwert. Dieser ermöglicht es, dass Ware, die für jemanden keinen Gebrauchswert hat, gegen eine andere Ware, die für ihn Gebrauchswert hat, eingetauscht werden kann. So braucht z.B. ein Schuhmacher nicht zwanzig Paar Schuhe; also haben sie für ihn keinen Gebrauchswert; er braucht aber Lebensmittel für sich und seine Familie und er kann sie dank dem Tauschwert seiner Schuhe erhalten. (Dass heute nicht mehr direkt getauscht wird, sondern dass Geld als quasi neutrales Wertäquivalent dazwischentritt, spielt dabei keine Rolle.) Der Tauschwert von an sich doch so verschiedenen Produkten wie z.B. Schuhen und Kartoffeln wird durch die in ihnen vergegenständlichte gesellschaftlich notwendige Arbeit bestimmt. Unter gesellschaftlich notwendiger Arbeit wird die Arbeit verstanden, die unter den momentan dominierenden Produktionsbedingungen notwendig ist, um den Gegenstand zu produzieren. Sie und nicht die individuelle Arbeit eines Handwerkers bestimmt den Tauschwert, da ja sonst eine Ware umso wertvoller wäre, je fauler und ungeschickter der Handwerker sich anstellt.
Dieser Doppelcharakter der Waren resultiert aus dem Doppelcharakter der in ihr verkörperten Arbeit.
Alle Arbeit ist einerseits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft im physiologischen Sinn, und in dieser Eigenschaft gleicher menschlicher oder abstrakt menschlicher Arbeit bildet sie den Warenwert. Alle Arbeit ist andrerseits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft in besonderer zweckbestimmter Form, und in dieser Eigenschaft konkreter nützlicher Arbeit produziert sie Gebrauchswerte.45
In der Industriegesellschaft ist nun aber auch die menschliche Arbeitskraft eine Ware. Der Arbeiter trägt sie auf den Arbeitsmarkt und versucht sie einem Käufer anzubieten. Als Ware hat sie, wie jede Ware, auch den Doppelcharakter von Gebrauchs- und Tauschwert. Der Unternehmer, der die Ware Arbeitskraft kauft, ist vorerst an ihrem Gebrauchswert interessiert. Für eine Schuhfabrik z.B. braucht er einen für diese Arbeit qualifizierten Arbeiter und nicht etwa einen Automechaniker.
Neben diesen konkreten Qualifikationen besteht die Ware Arbeitskraft aber auch noch aus abstrakten Qualifikationen. Diese treten mit zunehmender Industrialisierung immer mehr in den Vordergrund.
b) Veränderungen in der Qualifikationsstruktur der Ware Arbeitskraft
Während im Handwerk und zum Teil auch noch in der Manufaktur die Arbeit direkt auf die Produktion von Gebrauchswert gerichtet ist, verliert sie im kapitalistischen Produktionsprozess ihren Sinn in Bezug auf den Gebrauchswert. Durch die Entfremdung wird es dem Arbeiter zunehmend egal, was er produziert; er muss nicht mehr Werte schaffen, deren Sinn er unmittelbar einsieht, sondern Waren, die verkauft werden zum höheren Sinn der Wertsteigerung des Kapitals. Seine Arbeitskraft wird also unter den Zweck des Kapitals subsumiert. Damit verliert seine Arbeitskraft zunehmend ihre Qualifikationen in Bezug auf den Gebrauchswert, und die Qualifikationen in Bezug auf den Tauschwert treten in den Vordergrund. Je weiter die Industrialisierung fortschreitet, umso austauschbarer wird die Arbeitskraft. Es werden nicht mehr spezifische Handfertigkeiten wichtig, sondern abstrakte Qualifikationen wie Belastbarkeit, Ausdauer, Disziplin, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit usw.
Die Schule muss nun in immer grösserem Masse diese Funktion übernehmen. Beim heutigen Tempo der sich ständig folgenden technischen Neuerungen ist die Schule nicht mehr fähig, mit der Herausbildung der dafür notwendigen konkreten Qualifikationen Schritt zu halten. Sie muss sich daher auf zwei Sachen beschränken: auf die Vermittlung der wichtigsten Kulturtechniken, da diese zur permanenten Weiterbildung der Arbeitskräfte notwendig sind und auf die Erziehung zur Pünktlichkeit, Disziplin, Flexibilität, Belastbarkeit, Frustrationstoleranz usw. usf. Diese Anforderungen der Wirtschaft an die Schule sind aber, zum Glück, nicht voll durchzusetzen. Die Schule entwickelt als Institution eine gewisse Eigendynamik. Dies zeigt sich z.B. daran, dass die bisherigen Versuche einer effizienten Bildungsplanung gescheitert sind.
Trotzdem muss festgestellt werden, dass die Schule einen grossen Teil der Herausbildung der Qualifikationen für die moderne Arbeitswelt übernimmt.
Dies geschieht zum Teil auch in Verbindung mit den beiden andern zu betrachtenden Funktionen der Schule der Selektions- und der Legitimationsfunktion.
2.1.2.2 Die Selektionsfunktion der Schule
Da die Schule in früheren Zeiten ganz klar gegliedert war in Schulen für die Oberschicht, z.B. Gelehrtenschule, und die Volksschule für die breite Masse, war die Schule als Ganzes nicht mit der Selektion belastet. Die Schaffung und Bewahrung des sozialen Status geschah vorwiegend ausserschulisch und die Schulwahl erfolgte schichtenkongruent, d.h. sie war vom sozialen Status der Eltern abhängig.
In der heutigen Gesellschaft mit ihrer mobilen Schichtenstruktur hat »die Gesellschaft der Schule die Selektion übertragen«46. Durch den Besuch einer besseren, bzw. höheren Schule ist eine Statusveränderung möglich.
In einer solchen Gesellschaft wird die Schule leicht zur ersten und damit entscheidenden zentralen sozialen Dirigierungsstelle für die künftige soziale Sicherheit, für den künftigen sozialen Rang und für das Ausmass künftiger Konsummöglichkeiten, weil sowohl die Wünsche des sozialen Aufstiegs wie der Bewahrung eines sozialen Ranges primär über die durch die Schulausbildung vermittelte Chance jeweils höherer Berufsausbildungen und Berufseintritte gehen.47
Mit dieser Selektionsfunktion kehrt sich die Forderung nach ›Ausbildung entsprechend der Begabung‹ gegen sich selbst. Während diese Forderung gegen eine starre Schichtstruktur der Gesellschaft gerichtet ist, ja sogar tendenziell die Zerstörung dieser Struktur beabsichtigt, erzeugt sie nun ihrerseits eine neuartige Schichtung. Dabei ist die Schule aber »kein ›Rüttelsieb‹, das eine vollkommene Neuverteilung der Lebenschancen zwischen den Generationen vornimmt«48, denn es wirken eine ganze Reihe von schulexternen Faktoren an dieser Umstrukturierung mit49. Aus diesen Gründen kommt auch die Diskussion um die Chancengleichheit bzw. Chancenungleichheit nicht zur Ruhe.
Da die Schule nun einerseits »primäre, entscheidende und nahezu einzige soziale Dirigierungsstelle für Rang, Stellung und Lebenschancen des einzelnen in unserer Gesellschaft [ist]«50, andrerseits aber stark durch ausserschulische Faktoren beeinflusst wird, bekommt die Legitimationsfunktion der Schule ein immer stärkeres Gewicht.
2.1.2.3 Die Legitimationsfunktion der Schule
Bereits Max Weber hat in Bezug auf die traditionellen Gesellschaften bemerkt, dass das Erziehungssystem primär die Aufgabe habe, zum jeweiligen Klassenhabitus zu erziehen, d.h. insbesondere für die Elite die Kultur- und Lebensformen zu erzeugen, die ihre privilegierte Stellung legitimieren51. Verschiedene Soziologen wie Durkheim oder Habermas sehen diese Funktion auch noch im heutigen Staat und staatlichen Erziehungssystem.
Zentral ist dabei die Leistungsideologie, durch die der einzelne für seine Stellung in der Gesellschaft verantwortlich gemacht wird. Dabei versucht sie die Vorstellung zu nähren, dass alle von gleichen Voraussetzungen aus in die Wettbewerbssituation Schule eintreten und schliesslich der Tüchtigere gewinnt.
So repräsentiert das Schulsystem ein Allokationssystem, d.h. ein Regelsystem der Zuweisung unterschiedlich hoch bewerteter Positionen. Im Schulsystem ist in der Form unterschiedlich hoher Schulabschlüsse [...] Ungleichheit eingebaut. Im Verlaufe seiner Schulzeit lernt der Schüler, diese Ungleichheit zu akzeptieren, indem er das Regelsystem der Zuordnung zu unterschiedlichen Leistungspositionen und deren Verfahren (Prüfungen) zu akzeptieren lernt.52