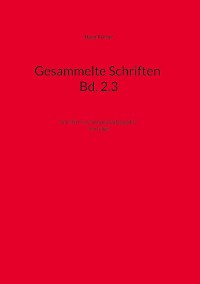
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Band 2.3 der Gesammelten Schriften enthält die Vorträge zur Sonderpädagogik aus den Jahren 1985 - 2011, deren Manuskripte noch vorhanden waren. Die meisten Vorträge wurden an internationalen Tagungen zur Erwachsenenbildung von kognitiv beeinträchtigten Menschen gehalten, u.a. in Berlin, München, Prag, Gizycko (Polen) ... Die meisten werden hier zum ersten Mal veröffentlicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt Bd. 2.3
Teil III Vorträge (1985 – 2011)
Neuere Resultate der Dyskalkulieforschung (1985)
Manche freilich ... – mehr Lebensqualität für behinderte Menschen durch besser ausgebildete Erwachsenenbildner (1990)
Die Peripherie der Peripherie (1990)
Selbstverantwortung und Fremdverantwortung (1991)
Biographien entscheiden – entschieden (1992)
L’importance de la formation continue pour les couches marginales de la population (1992)
Cultura e formazione per persone invalide – il modello ticinese (1992)
Von der Integration zum Recht auf Verschiedenheit (1992)
Computer für Menschen mit geistiger Behinderung (1993)
Note di una vita handicappata (1993)
Bildungsfähigkeit und das Phantasma der ›geistigen Behinderung‹ (1993)
Was sind behinderte Menschen der Gesellschaft Wert (1993)
Bildung und Biographie (1995)
Ist Bildung für Behinderte möglich? (1998)
Erwachsenenbildung von behinderten Menschen aus der Sicht der allgemeinen Erwachsenenbildung (1999)
Bildung und kritische Theorie (2000)
Behinderte als selbstbewusste Kunden (2000)
Schöne neue Welt – oder die Selbstinszenierung eines Lebens-unternehmers (2000)
Bildung als Selbsthilfe für ein selbstständiges Leben (2002)
Inklusion in der Erwachsenenbildung (2008)
Inklusive Erwachsenenbildung in der Schweiz – Geschichte eines Scheiterns (2011)
Literaturverzeichnis Bd. 2.1, Bd. 2.2 und Bd. 2.3
Teil IVorträge1
1 Die hier gesammelten Vorträge entstanden zu verschiedenen Zeiten und erschienen an verschiedensten Orten. Dabei wurden natürlich hin und wieder auf die gleichen Vorarbeiten und Gedanken zurückgegriffen. Aus diesen Gründen kommt es an einigen Stellen zu Wiederholungen von Gedanken.
Neuere Resultate der Dyskalkulieforschung2
Die Dyskalkulie oder Rechenschwäche ist immer noch das Stiefkind der Sonderpädagogik. Das ist einerseits natürlich schade, andererseits aber hat es auch nicht zu den gleichen Auswüchsen geführt wie seinerzeit beim Legasthenie-Boom.
Man unterscheidet heute im grossen und ganzen drei Arten der Dyskalkulie:
allgemeine Rechenschwäche: diese kommt eher selten vor, hauptsächlich im Zusammenhang mit vererbter Rechenschwäche, mit POS oder mit Epilepsie.
mechanische oder wie ich sie bezeichne ordinale Rechenschwäche: diese betrifft vorwiegend die Grundoperationen (Zehnerübergänge und Einmaleins) und rührt hauptsächlich von einer allgemeinen oder spezifischen Speicherschwäche her.
die wie ich sie nenne kardinale Rechenschwäche: diese verunmöglicht den Schülern ihr meist gutes mechanisches Rechnen anzuwenden, d.h. Satzaufgaben zu lösen aber auch mit Zahlen zu spielen. Diese Form der Dyskalkulie ist es, die anscheinend zur Zeit vermehrt auftritt.
Damit habe ich bereits ein immer wieder diskutiertes Thema angeschnitten, nämlich: Hat die Dyskalkulie zugenommen oder scheint dies nur so, weil wir eher auf diese Phänomene sensibilisiert sind?
Dazu gibt es eine äusserst interessante Untersuchung des Psychologischen Instituts der Universität Zürich, durchgeführt von Andreas Erdin, Assistent bei Prof. Stoll; eine Untersuchung, die aber nur einen Teilbereich der Dyskalkulie, nämlich die mechanische Dyskalkulie abdeckt. In diesem Projekt wurde eine Untersuchung genauestens wiederholt, die vor etwa als fünfzig Jahren durchgeführt worden war. Der genau gleichen Anzahl Schülern wurden unter den genau gleichen Bedingungen die gleichen Rechnungen vorgelegt wie vor fünfzig Jahren.
Das Resultat verblüffte jedermann: Es gab keine signifikanten Änderungen. Das einzige was sich geändert hat war die Reihenfolge der sogenannten ›schwierigen Rechnungen‹ in der Art, dass vielleicht vor fünfzig Jahren 8x9 die am häufigsten falsch gelöste Rechnung war und heute vielleicht 7x8. Dies hat darum alle erstaunt, da man nur schon wegen der allgemein anzunehmenden geringeren Konzentrationsfähigkeit der heutigen Schüler ein schlechteres Resultat erwartete.
Schade, dass diese Untersuchung nur für die mechanischen Rechenleistungen durchgeführt werden konnte, hätte sie doch meiner Ansicht nach für angewandten Rechnungen ein ganz anderes Resultat erbracht. Ich stelle die Hypothese auf, dass sich bei einer solchen Untersuchung evtl. eine gleiche, wenn nicht sogar bessere Durchschnittsleistung ergäbe als vor fünfzig Jahren, dass aber die Unterschiede innerhalb der beiden Generationen viel grösser geworden sind. Ich kann diese These nicht nachweisen, da vor fünfzig Jahren eben keine Untersuchung dieser Art durchgeführt worden ist.
Zuerst möchte ich auf die Ursachen der Dyskalkulie eingehen. Es werden heute im allgemeinen drei Ursachenkomplexe unterschieden, die sich aber zum Teil überschneiden können:
organische Ursachen
didaktogene Ursachen
psychische Ursachen
Bevor ich nun auf die einzelnen Ursachenkomplexe eingehe, möchte ich Ihnen noch einige grundsätzliche Betrachtungen zur Zahlbegriffsentwicklung in Erinnerung rufen. Dabei stütze ich mich im Wesentlichen auf die Erkenntnisse Piagets, die trotz einiger Kritiken immer noch die besten Untersuchungen über diesen Gegenstand sind.
Nach Piaget ist das Kind im Stadium der konkreten Operationen fähig einen Zahlbegriff zu entwickeln. Was bedeutet dies nun? Wie sie sich bestimmt erinnern, ist eines der Paradebeispiele für das Erreichen des Stadiums der konkreten Operationen das Experiment zur Mengenkonstanz, bei welchem Wasser von einem engen hohen Glas in ein breites niedriges Glas geschüttet wird. Wenn das Kind die Mengenkonstanz sieht und erklären kann, hat es das Stadium der konkreten Operationen erreicht. Was bedeutet dies nun für seine kognitiven Leistungen? Es ist fähig sich nicht mehr nur, wie vor dem Erreichen dieses Stadiums, auf eine Dimensionsänderung zu zentrieren, sondern diese beiden Zentrierungen zu koordinieren, sie mit einander in Beziehung zu setzen. Ich will diesen Koordinationsvorgang, den Piaget Dezentrierung nennt, nun noch am Beispiel des Zahlbegriffs erläutern. Auch dazu macht Piaget verschiedene Experimente:
1. Die Schüler werden aufgefordert, mit unterschiedlich langen Stäben eine Treppe zu bauen oder sie werden aufgefordert, verschieden grossen Puppen verschieden grosse Spazierstöcke zuzuordnen. Dazu sind die Kinder erst mit dem Erreichen des Stadiums der konkreten Operationen fähig. Sie haben damit den ordinalen Aspekt der Zahlen begriffen.
2. Einer der zentralen Versuche ist derjenige zur Eins-zu-eins-Zuordnung. Dabei legt Piaget dem Kind zwei Reihen von gleich vielen Bätzchen vor. Wenn das Kind überzeugt ist, dass es in beiden Reihen gleich viele Bätzchen hat, schiebt er die eine Reihe auseinander und fragt das Kind ob es nun immer noch gleich viele seien. Vor dem Erreichen des Stadiums der konkreten Operationen antworten die Kinder, dass es in der auseinandergeschobenen Reihe nun mehr habe. Erst im Stadium der konkreten Operationen sehen sie die Eins-zueins-Zuordnung und können sie auch begründen. Sie haben also den kardinalen Aspekt der Zahl begriffen.
Diese beiden Aspekte genügen nun aber noch nicht für einen kompetenten Zahlbegriff. Es gilt diese beiden Aspekte noch zu koordinieren, sie dialektisch zu verbinden. Dazu ein sehr umstrittenes Experiment von Piaget, das aber etwas Wesentliches aufzeigt.
3. Piaget legt den Kindern etwa zwanzig Holzperlen vor, fünf weisse und die restlichen sind z.B. rot. Nachdem die Kinder etwas mit diesen Perlen gespielt und über ihre Eigenschaften gesprochen haben, frägt Piaget, ob es mehr rote oder mehr Holzperlen habe. Bis zum Erreichen des Stadiums der konkreten Operationen werden die Kinder antworten es habe mehr rote Perlen. Einige von Ihnen werden sagen, dies sei eine unfaire Frage. Das mag stimmen, aber es ist ja der Witz der Sache, dass nur wir, die wir das Stadium der konkreten Operationen durchlaufen haben, diese Frage unfair finden. Das Kind, das dieses Stadium noch nicht erreicht hat, findet nichts Unfaires an dieser Frage, sondern beantwortet sie schlicht falsch. Erst ein Kind, das Oberbegriffe bilden kann wird zuerst stutzen, wie Sie auch, und dann aber die richtige Antwort geben. Der Versuch ist darum eben sehr signifikant.
Was hat dies nun aber mit der Koordinierung des ordinalen und kardinalen Aspekt zu tun?
Bei der Bildung des Zahlbegriffs geht es darum, dass einerseits gleichmächtige Mengen gleich gesetzt werden können (kardinaler Aspekt), dass aber auch ungleichmächtige Mengen in eine Reihenfolge gebracht werden können, ja dass eingesehen wird, dass eine Menge mit sechs Elementen eben auch Mengen mit fünf Elementen, mit vier usw. Elementen umfasst und dass man so einmal auf eine kleinste Menge kommt, mit der man die anderen Mengen ausmessen kann. In Anlehnung an die dialektische Logik Hegels nenne ich dies den Massaspekt der Zahl. Diese Fähigkeit, Oberbegriffe zu bilden, zwei verschiedene Eigenschaften aufeinander zu beziehen und zu koordinieren misst der oben beschriebene Versuch.
Nun also zurück zu den Ursachen der Dyskalkulie. Wir wollen sie auf dem Hintergrund dieser Zahlbegriffsbildungstheorie betrachten:
Organische Ursachen
Dazu gehören einerseits die vererbten Hirnstörungen, das POS und Schäden durch epileptische oder traumatische Einwirkungen. Zu ihrer Wirkung möchte ich nur kurz daran erinnern, dass unser Hirn in zwei spezifische Hirnhälften geteilt ist, von welchen die linke nach digitalen, die rechte nach analogen Verarbeitungsschemata arbeitet. Für unser Problem heisst dies, dass linkshemisphärische Hirnschäden eher zu einer ordinalen, rechtshemisphärische eher zu einer kardinalen Rechenschwäche führen werden. Ich weise ganz deutlich darauf hin, dass ich gesagt habe ›eher‹ zu ordinalen bzw. ›eher‹ zu kardinalen Rechenschwächen, da diese Zuordnungen nicht ganz eindeutig sind.
Auch zu den organischen Ursachen möchte ich ein wichtiges Phänomen zuordnen, da es in der Hirnentwicklung entsteht und im Ergebnis auch konstitutionell ist.
Ich meine das Phänomen der heutigen ›linkslastigen‹ Kulturentwicklung. (Ich bitte dies nicht politisch zu verstehen, sondern in Bezug auf die Hirnhälften!) Es ist eine eindeutige Tendenz zur Digitalisierung unserer Kultur zu beobachten. Die Entstehung dieses Phänomens wäre eine separate Vorlesung wert, doch ich will hier nur ganz summarisch daran erwähnen, dass es in unserer Kultur eine unheimliche Quantifizierung und Linearisierung gibt. Nur was quantifiziert werden kann ist wertvoll. Weiter werden viele rhythmische Prozesse, wie Jahres- und Tageszeiten eingeebnet, linearisiert. Was hat dies nun aber für Konsequenzen auf das menschliche Hirn und die Rechenleistung?
Die Entwicklung des Hirns des Kindes geschieht phasenweise. In der ersten Zeit wird eher die rechte Hirnhälfte entwickelt, während gerade in der Latenzzeit, also beim Schuleintritt sich die linke Hälfte vermehrt entwickelt. Durch unsere sehr digitale Schule wird nun die linke Hirnhälfte stärker ausgebildet, wird noch dominanter als es der natürlichen Entwicklung entspräche. Andererseits verkümmert die rechte Hirnhälfte unter dem Einfluss der analogen Reizüberflutung durch Massenmedien. Ich betrachte dies als eine der Ursachen für das Zunehmen der kardinalen Rechenschwäche.
Didaktogene Ursachen
Dieses heikle Thema hat zwei Komponenten, eine davon weniger heikel und darum wollen wir damit beginnen.
Die traditionellen Lehrmittel, angefangen bei Pestalozzis Tabelle der Zahlverhältnisse, die während einem ganzen Jahrhundert den Rechenunterricht in der Schweiz bestimmt hat, bis zum heutigen Sonderklassenlehrmittel betonten und betonen den ordinalen Aspekt der Zahl. Wenn man ein Blümchen ins Heft malt und dann eine Seite mit Einsen vollschreibt, dann zwei Kirschen malt und eine Seite mit der Ziffer 2 vollschreibt, dann ein Kleeblatt malt usw. usf. kommt das Kind zwar zu einem rudimentären ordinalen Verständnis des Zahlzeichens, aber nie zu einem kardinalen Verständnis und schon gar nicht zu einem Zahlbegriff.
Als Reaktion auf diese Lehrmittel wurde in unserem Zürcher Lehrmittel – und auf dieses möchte ich mich beschränken – ein Lehrmittel geschaffen, das den kardinalen Aspekt etwas überbetont. Dies ist heute auch den Autoren klar, darum merken sie im Lehrerkommentar auch an, dass es natürlich unerlässlich sei, weiterhin vorwärts und rückwärts zu zählen. Ich möchte das Lehrmittel aber insofern verteidigen, als ich mit meinen Studenten die Behandlung der verschiedenen Aspekte im Lehrmittel der 1. Klasse herausgearbeitet habe und wir dabei viel mehr Ordinales gefunden haben als erwartet. Es liegt nun eben an den Lehrern (und Mathematik-Didaktikern in der Lehrerbildung bzw. Kursleitern in der Lehrerweiterbildung) diese Aspekte und vor allem ihre Verbindung herauszuarbeiten.
Bei meinen vielen Schulbesuchen erlebe ich in dieser Beziehung sehr viel Betrübliches. Da werden die Blätter ohne Einsicht in diese dialektischen Verknüpfungen durchgeackert. Es kommt z.B. vor, dass ein Lehrer sagt, er mache jetzt alle Blätter mit logischen Blöcken, dann alle Blätter mit den Cuisenaire-Stäbchen usw.3, ohne zu sehen, dass diese mit Absicht über das Lehrmittel verstreut sind, um immer wieder die verschiedenen Aspekte miteinander zu verknüpfen. Viele Lehrkräfte ignorieren die Dialektik von ordinalem und kardinalem Aspekt und erhalten so ein unbrauchbares Fragment (und geben die Schuld dem Rechenlehrmittel).
Vielleicht kennen sie das Chanson Mani Matters über die Dialektik eines Sandwiches, in welchem er singt:
»Es Sändwich ohni Fleisch isch nüd als Brot;
es Sändwich ohni Brot isch nüt als Fleisch«
und in diesem Sinne möchte ich sagen:
Ein Zahlbegriff ohne Kardinalaspekt ist nichts als Ordinalaspekt;
ein Zahlbegriff ohne Ordinalaspekt ist nichts als Kardinalaspekt!
Mein Vorwurf an viele Unterstufenlehrpersonen ist nun der, dass sie diese Verknüpfung nicht verstanden haben und dann letztlich wieder in das frühere ordinale Konzept abgleiten und somit den Schülern keinen Zahlbegriff, sondern nur die Zahlwörter vermitteln, ganz nach dem Diktum aus Goethes Faust:
Denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.4 Dies setzt sich dann in den anderen Klassen fort indem nur die Rechenmechanismen eingeübt und gedrillt werden statt Verständnis und Einsicht in den Rechenvorgang.
Psychische Ursachen
Einige von Ihnen werden beim Stichwort psychische Ursachen an Aussagen denken wie: »Eine schlechte Vaterbeziehung ergibt schlechte Rechner«, was übrigens sehr oft zutrifft. Fürs erste möchte ich es hier einmal mit der Erklärung bewenden lassen, dass es in der doch immer noch traditionellen Rollenverteilung in unserer Gesellschaft, es halt üblicherweise Vater ist, der hinaus in die Welt geht, der das Geld heimbringt, der die Steuererklärung ausfüllt, kurz, der es mit Zahlen zu tun hat. Ich sehe aber psychische Ursachen in einem viel weiteren Rahmen.
Erinnern wir uns, eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Zahlbegriffsbildung ist die Fähigkeit zu dezentrieren, d.h. verschiedene Perspektiven einnehmen zu können und zu koordinieren. Dies ist aber auch genau diejenige Fähigkeit, die das Kind in diesem Alter für die Lösung der ödipalen Krise braucht. Es muss in dieser Krise versuchen die Geschlechtsrolle mit der Generationsrolle zu koordinieren. Nur wenn ihm dies gelingt kann es eine gefestigte Rollenidentität ausbilden. Es muss die verschiedenen Perspektiven des Kindes, der Mutter, des Vaters einnehmen und sie vermitteln können, muss also dezentrieren können. In der Lösung der ödipalen Krise wird, je nachdem auf welche Art es die elterlichen Rollen interionisiert ein starres, autoritäres, diffuses oder ein flexibles, autonomes Überich ausbildet. Es ist nun aber nicht so, dass die Lösung der ödipalen Krise die Voraussetzung für die Entwicklung der kognitiven Strukturen der konkret-operationalen Phase ist, sondern es handelt sich hier um ein dialektisches Verhältnis. Im Idealfall entwickeln sich die kognitiven und psychischen Strukturen parallel, beeinflussen sich gegenseitig und bringen so eine in allen Bereichen ausgeglichene Persönlichkeit hervor – die, so quasi als Zugabe, erst noch ein gutes mathematisches Verständnis hat.
Störungen in der Persönlichkeitsentwicklung werden sich nun ergeben, wenn einer der beiden Prozesse eindeutig verlangsamt bzw. zurückgeblieben ist. So wird ein Kind, das von seiner kognitiven Struktur her noch nicht fähig ist zu dezentrieren, die ödipale Krise nicht ideal lösen können, mit dem Resultat ganz starrer Über-Ich-Funktionen. Ein Kind, das die ödipale Krise einseitig, durch Introjektion eines starren Vater- bzw. Mutterbildes ›gelöst‹ hat in der kognitiven Entwicklung gehemmt. Diese Entwicklung ist für die Entwicklung der mathematischen Fähigkeiten fatal. Die Kinder werden daran gehindert kognitiv zu dezentrieren, ein Phänomen, das uns allen bestimmt bekannt ist. So sind doch rechen-schwache Kinder äusserst autoritätsgläubig und das auch im Umgang mit Zahlen. Sie wagen es nicht die ›Autorität der Zahlen‹ anzugreifen und damit zu spielen – und genau dies ist eben Mathematik. Sie sind im Umgang mit Zahlen unflexibel, halten an einem einmal gelernten Rezept fest, haben eine schlechte
Orientierung im Zahlenraum, können also auch räumlich nicht dezentrieren. Auch bei einer falsch verstandenen ›antiautoritären‹ Erziehung, bei welcher das Kind eine diffuse Rollenidentität ausbilden kann, ist die Dezentrierung kaum möglich. Um dezentrieren zu können, muss ich eben zuerst meiner selbst sicher sein, um mich auf andere Gesichtspunkte einlassen zu können. Beim sogenannten ›Neuen Sozialisationstyp‹5, der stark narzisstisch veranlagt ist, wird sich sein starker Egozentrismus auf die Dezentrierungsfähigkeit störend auswirken.
Bevor ich auf die Konsequenzen dieser meiner Hypothesen eingehe, möchte ich Ihnen einen Fall präsentieren. Es ist das typischste rechenschwache Kind, das ich kenne und an ihm lassen sich die geschilderten Phänomene gut aufzeigen.
Hier bricht das Manuskript ab, ich habe aber versucht einige Punkte stichwortartig zu rekonstruieren, da ich mich einerseits gut an das Fallbeispiel erinnern kann, andererseits weiss, welche didaktischen Konsequenzen ich damals daraus gezogen habe.
Fallbeispiel R.
R. ist ein 10jähriger Knabe an der Sehbehindertenschule. Er hat ein Glaukom und etwa einen Visus von 0.05 und einen leichten Nystagmus.
Ich hatte noch nie einen Schüler, welcher die Einmaleins-Reihen dermassen schnell und richtig rauf- und runtersagen konnte.
Er hat aber grosse Mühe mit Sachaufgaben. Er ist – auch bei einfachsten Aufgaben – nicht fähig, zu einem Sachverhalt die entsprechende Rechnung zu finden. Gibt man ihm dann diese vor, kommt das rechnerische Resultat blitzartig, jedoch ist er dann wiederum nicht fähig, einen Antwortsatz zu bilden. Er weiss nicht, was er den jetzt ausgerechnet hat.
Als ich ihn wieder einmal aufforderte mir die Rechnung 3 x 2 mit Holzkugeln darzustellen, sagte er blitzartig: »das gibt sechs«. Ich bestätigte ihm, dass das richtig sei, aber möchte gerne, dass er mir mit den Holzkugeln zeige, was die Rechnung bedeute.
Ich hätte gerne gesehen, dass er die Holzkugel in folgender Art platzierte:
und mir erklärte: das sind zwei Kugeln, das sind auch zwei und das auch, also drei Mal zwei Kugeln und es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kugeln. So wie wir das schon oft gemacht hatten.
Er verstand zuerst gar nicht, was ich von ihm wollte, doch dann erinnerte er sich wahrscheinlich, dass er irgendetwas hinlegen sollte und ordnete die Kugeln folgendermassen an:
Als ich ihn dann fragte, wieviel 3 x 2 gebe, antwortete er sofort wieder 6. Ich fragte ihn dann aber, wie viele Kugeln, dass es er denn hingelegt habe und er zählte sie und kam richtigerweise auf 5. Er studierte lange und nach einer Weile ging ein Leuchten über sein Gesicht und er sagte: »Ich muss für das ›Malzeichen‹ auch noch eine Kugel hinlegen, dann stimmt es.«
R. hat also eine ausgeprägte kardinale Rechenschwäche. Nun möchte ich Ihnen einige Hypothesen über die Ursachen vorstellen:
Mit seinem Visus hat R. – wie sehr viele sehbehinderte und blinde Menschen – grosse Mühe mit der räumlichen Dezentrierung, bzw. in dieser Hinsicht Entwicklungsdefizite (die sich übrigens oft auch auf die soziale Dezentrierung auswirken).
Wegen seines Visus und des Nystagmus kann er Mengen, grösser als 4, nicht auf einen Blick erfassen. Er muss entweder ein Element ums andere fokussieren oder eins ums andere abtasten. Somit hat er keinen kardinalen Zahlbegriff, sondern nur einen ordinalen.
Dies zeigt sich auch in folgender Situation:
R. muss, als er Küchendienst hat, die Tische decken und dabei auf jeden Tisch vier Teller, vier Messer, vier Gabeln und vier Gläser auftischen.
Bei einem Tisch hat er bereits die vier Teller hingelegt und ist nun daran, die Messer hinzulegen. Nachdem er drei Messer hingelegt hat, frage ich ihn, wie viele Messer er nun noch hinlegen müsse. Er antwortet: »Noch vier.«
Dies zeigt auch wieder sein fehlendes Mengenverständnis (kardinales Verständnis). Er hat keinen Begriff von der Menge vier, sondern er zählt die Teller oder Messer mit Eins, Zwei, Drei, Vier (und meint eigentlich den ordinalen Aspekt: das Erste, das Zweite, das Dritte, das Vierte). Darum ist seine Antwort logisch: Wenn er schon das Messer Eins, das Messer Zwei und das Messer Drei hingelegt hat, muss er nun noch das Messer Vier hinlegen. Neben diesem, von seiner Sehbehinderung herrührenden, Aspekt, kommt noch dazu, dass er einen sehr autoritären Vater hat, der mit ihm, wegen seiner schlechten Noten in Mathematik, auch täglich das Einmaleins übt. Der Vater kann nicht begreifen, warum er so schlechte Noten hat, da er doch das Einmaleins so gut kann.
Didaktische Konsequenzen
Die didaktischen Konsequenzen sind mannigfaltig und es können hier nur ein paar Ideen skizziert werden. Es geht darum, immer wieder den ordinalen und kardinalen Aspekt der Zahlen, Mengen und Operationen gleichzeitig aufzuzeigen. Es müssen immer wieder didaktische Anlagen geschaffen werden, in welchen dieser Zusammenhang erlebt werden kann. Gut eignen sich z.B. bei den Einmaleinsreihen Übungen im Raum, bei welchen die Reihen abgeschritten werden können.
Eine Möglichkeit wäre es – wie oben, bei der Zweierreihe – in einem Korb immer zwei Äpfel zu legen und dabei bewusst zu zählen: »Ich nehme zwei Äpfel und legen sie in den Korb. Nun hat es zwei Äpfel im Korb. Ich nehme nochmals zwei Äpfel und nun hat es vier Äpfel im Korb usw.«
Oder man könnte bei einer Tafel Schokolade die Anzahl Teile in einer Reihe zählen: »In der ersten Reihe hat es vier Teile. In der zweiten Reihe hat es auch vier Teile, also in den zwei Reihen acht Teile usw.«
Bei Sachaufgaben muss der ordinale und kardinale Aspekt verstanden werden, d.h. eine Situation muss in ein mathematisches Modell codiert werden. Dazu muss die Situation ›analog‹ dargestellt oder aufgezeichnet und dann in eine ›digitale‹ Form gebracht werden. Dazu wird die Sachaufgabe in eine mathematische Aufgabe umformuliert. Nun muss, das passende mathematische Modell gefunden werden, z.B. eine ›Addition‹, eine ›Division‹ oder ein ›Dreisatz‹ (Proportion). Dann wird die Aufgabe im digitalen Modell gelöst und man erhält eine digitale (ordinale) Lösung. Diese Lösung muss nun wieder in eine analoge (kardinale) Lösung decodiert und durch einen Antwortsatz abgeschlossen werden.
Diese Beispiele mögen an dieser Stelle genügen.
2 Vortrag in einem Doktoranden-Seminar mit Prof. Grissemann an der Universität Zürich im SS 1985
3 Ich unterstelle diesen Lehrpersonen nun Mal etwas bösartig, dass es für sie effizienter (sprich einfacher) ist, für eine oder zwei Wochen die ›logischen Blöcke‹ hervorzuholen und dann alle diese Arbeitsblätter durcharbeiten zu lassen, dieses Material dann wieder in den Schränken zu verräumen und dann für die nächsten paar Wochen die ›Cuisenaire-Stäbchen‹ hervorzuholen und dann alle entsprechenden Arbeitsblätter durcharbeiten zu lassen. Aber Effizienz ist bei so etwas Grundlegendem wie der Zahlbegriffsentwicklung eben nicht das A und O.
4 Goethe [1808], S. 59; hvgh. durch HF
5 vgl. Ziehe (1975) und (1983)
Manche freilich müssen drunten leben ...6
Mehr Lebensqualität für behinderte Menschen durch besser ausgebildete Erwachsenenbildnerinnen.7
Manche freilich müssen drunten sterben, Wo die schweren Ruder der Schiffe streifen. Andre wohnen bei dem Steuer droben. Kennen Vogelflug und die Länder der Sterne. Manche liegen immer mit schweren Gliedern Bei den Wurzeln des verworrenen Lebens, Andern sind die Stühle gerichtet Bei den Sibyllen, den Königinnen, Und da sitzen sie wie zu Hause, Leichten Hauptes und leichter Hände.8
Hofmannsthals Gedicht aus dem Jahre 1896 strahlt einen Fin de siècle-Pessimismus aus, nicht unähnlich der postmodernen Endzeitstimmung am Ausgang unseres Jahrhunderts. Die Widersprüche in der Gesellschaft werden zwar noch wahr- aber als unabänderlich hingenommen und so geht es denn weiter:9
Doch ein Schatten fällt von jenem Leben
In die anderen Leben hinüber.
Und die leichten sind an die schweren
Wie an Luft und Erde gebunden
Ganz vergessener Völker Müdigkeiten
Kann ich nicht abtun von meinen Lidern
Noch weghalten von der erschrockenen Seele,
Stummes Niederfallen ferner Sterne.
Viele Geschicke weben neben dem meinen,
Durcheinander spielt sie alle das Dasein,
Und mein Teil ist mehr als dieses Lebens
Schlanke Flamme oder schmale Leier.
Die Schatten jedoch, die vom verworrenen Leben hinüberfallen zu den Sibyllen, den Königinnen, sind flüchtig. Wohl schrieb Stefan George nach Erhalt dieses Gedichts an Hofmannsthal: »Sie können kaum eine strofe schreiben die einen nicht um einen neuen schauer ja um eine neues fühlen bereichert.«10 Doch das künstlerische Schauern und das Schauern vor der Kunst wurde damals umso mehr kultiviert, je mehr sich gesellschaftliches Handeln als wirkungslos erwies. So schrieb Hofmannsthal:
Tobt der Pöbel in den Gassen,
ei, mein Kind, so lass in schrei’n.
Will die kalte Angst dich fassen,
spül sie fort mit heissem Wein!
Lass den Pöbel in den Gassen:
Phrasen, Taumel, Lügen, Schein,
Sie verschwinden, sie verblassen – Schöne Wahrheit lebt allein.11
Auch hierin nicht unähnlich der heutigen schaurigen Stimulierungslust mit kommerziell produziertem Video-Horror oder der täglichen Ration Hunger und Krieg an der Tagesschau. Genau wie damals führt mensch sich diesen Schauer zu Gemüte und geht zur Tagesordnung über, d.h. schaltet um zur luxuriösen Katzenfutterwerbung, der Fernsehschau oder zum Fussballspiel. Der heutige vereinzelte Mensch spürt solche kognitiven Dissonanzen nicht mehr oder hat gelernt damit umzugehen. Er wurde vom ›être solidaire‹ zum ›être solitaire‹.12
In solch einem gesellschaftlichen Klima ist es schwer von Lebensqualität für Behinderte zu sprechen. Im neuen Europa – und wohl auch im neuen Deutschland – wird kaum Platz sein für Alte, für alleinerziehende Mütter, für Behinderte. Das einzelne leistungsfähige, kaufkräftige, schöne Individuum steht im Zentrum des neu entfachten marktwirtschaftlichen Wahns. Die pessimistische, hoffnungslose Stimmung13 hat bereits die entsprechenden sonderpädagogischen Bücher hervorgebracht. Mit Blick auf die grosse Arbeitslosigkeit – die sich im neuen Deutschland noch massiv erhöhen wird14 – frägt sich Rudolf Bordel im zutiefst pessimistischen Vorwort des Buches ›Leben ohne Beruf?‹, ob es für den Behinderten noch sinnvoll sei, »weiterhin an nicht zu verwirklichenden Zielstellungen hinsichtlich seiner beruflichen Integration festzuhalten« 15 . Angesichts des offensichtlichen Zerfalls utopischer Energien in unserer Welt ist es mühselig, weiter von einer Welt zu träumen, in welcher auch den Behinderten und anderen Randgruppen ein Leben ermöglicht wird, das ihren Bedürfnissen entgegenkommt.
Ich wage es aber trotzdem, an Utopien festzuhalten. Nicht an negativen Utopien, die durch die real existierenden Verhältnisse bereits überholt sind –, sondern an Versuchen, die Richtung von möglichen positiven Veränderungen wenigstens zu denken. »Wenn utopische Oasen austrocknen, breitet sich eine Wüste von Banalität und Ratlosigkeit aus.«16
Ausrichtung der Behindertenarbeit auf die Lebenswelt
Auf die Gefahr hin, das Bild zu strapazieren, postuliere ich eine Ausrichtung der utopischen Energien auf die lebensweltlichen Oasen innerhalb des Systems. Bei solch einem lebensweltnahen Begriff der Behindertenarbeit stellen sich drei Hauptfragen:
Welche Traditionen kulturellen Wissens sind zu intensivieren oder zu kritisieren und welche neu sich herausbildenden Wertorientierungen sind von Bedeutung, um behinderten Menschen humane Lebensentwürfe zu ermöglichen und gesellschaftliche Marginalisierungsprozesse durch formelle und informelle soziale Kontrolle abzubauen? Hier geht es also um die Probleme der kulturellen Reproduktionsprozesse in den Lebenswelten.
Wie können die zwischenmenschlichen Beziehungen von Behinderten und Nichtbehinderten derart gestaltet werden, dass soziale Zugehörigkeit, Solidarität und soziale Unterstützung sich zu entwickeln vermögen? Dies sind Fragen nach den Prozessen der sozialen Integration der Lebenswelten. Unter dem Leitmotiv der Vergesellschaftung des Subjekts stellt sich die Frage, wie die Entwicklung sozialer und kommunikativer Kompetenzen und die Herausbildung personaler Identität von Behinderten und Nichtbehinderten gefördert werden kann, damit humane Formen des Zusammenlebens und des sozialen Umgangs miteinander möglich werden? Durch diese Frage werden die Reproduktionsprozesse der Sozialisation angesprochen.17
Dass bei der praktischen Beantwortung all dieser Fragen der Erwachsenenbildung für Menschen mit geistiger Behinderung eine zentrale Rolle zukommt, versteht sich von selbst. Ebenso muss es – gerade zum Aufbau von kommunikativen Prozessen zwischen Behinderten und Noch-Nicht-Behinderten – ein Ziel sein, diese Erwachsenenbildung sowohl formal als auch inhaltlich integrativ anzubieten. Darauf will ich hier nicht eingehen, sondern nur auf funktionierende Modelle, z.B. in der Schweiz im Kanton Bern, hinweisen.
Neben diesen Grundvoraussetzungen steht und fällt die Erwachsenenbildung – wie alle Bildungsbemühungen – mit der Qualität der Kursleitenden. Darum muss deren Fortbildung Priorität zukommen. Sie darf nicht – wie dies leider bisher geschehen ist – stiefmütterlich behandelt werden.
Fortbildung der Kursleitenden
Als erstes muss man sich fragen, wer denn diese Kursleitenden sind und welche Vorqualifizierung sie mitbringen. Kursleitende für die Erwachsenenbildung von Menschen mit geistiger Behinderung können aus drei verschiedenen Berufsfeldern stammen:
Sie sind Spezialisten auf irgendeinem Fachgebiet (z.B. Fotograf, Töpferin, Köchin oder Koch, Elektriker usw.) und daran interessiert, ihr Wissen an Behinderte weiterzugeben. Sie haben aber noch nie unterrichtet;
sie besitzen eine pädagogische bzw. erwachsenenbildnerische Ausbildung und Praxis (z.B. als Tanzlehrer, Werklehrerin, Sprachlehrerin, Medienpädagoge usw.), haben aber noch nie mit Behinderten gearbeitet;
sie besitzen eine sonderpädagogische Ausbildung und Praxis, haben aber noch nie mit Erwachsenen gearbeitet.
Im Hinblick auf eine integrative Erwachsenenbildung wäre es wünschenswert, vor allem Kursleitende aus den ersten beiden Bereichen zu gewinnen, denen dringend ein grundlegendes sonderpädagogisches Rüstzeug vermittelt werden muss. Auf absehbare Zeit aber, werden wir nicht auf die dritte Kategorie von Kursleiterinnen verzichten können, denen erwachsenenbildnerische Einstellungen und Methoden auf den Weg gegeben werden müssen.
Diese divergierenden Bedürfnisse können nur in einem Baukasten- oder Modulsystem abgedeckt werden, in welchem sich die Kursleitenden diejenigen Bausteine holen können, die sie benötigen. Ein solches Modulsystem muss drei Bereiche abdecken, die durch zusätzliche Möglichkeiten der Beratung und des Erfahrungsaustausches ergänzt werden:
Obwohl diese Bereiche aus Gründen der Darstellung getrennt werden, ist es klar, dass vielfältige gegenseitige Beziehungen bestehen. Zudem muss als übergreifende Zielsetzung der Fortbildung in allen drei Kompetenzbereichen die Vermittlung von Fachwissen mit der bewussten Verbesserung der Sozial- und Ichkompetenz verbunden werden. Es wird daher bei den Kursleitenden die Bereitschaft vorausgesetzt, für den eigenen Entwicklungsprozess und die weitere fachliche und persönliche Fortbildung selbst die Verantwortung zu übernehmen.
Trotz dieser inneren Verbindung können für die einzelnen Kompetenzbereiche Schwerpunkte festgelegt werden.
a) Erwachsenenbildnerischer Bereich
In diesem Bereich sollen die Kursleiterinnen in die Planung, Durchführung und Evaluation von Kursen eingeführt werden.
Sie sollen befähigt werden, die Bedürfnisse der erwachsenen Teilnehmenden zu erkennen und auf sie einzugehen. Besonderes Gewicht soll dabei auf das Erkennen von Gruppenprozessen gelegt werden. Weiter sollen sie lernen, flexibel und verständnisvoll auf schwierige Kurssituationen einzugehen.
Sie lernen mit den zentralen Inhalten einer modernen Erwachsenenbildung umzugehen, in welcher »Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten im Sinne des lebenslangen Lernens erworben, erneuert oder erweitert (werden). Die Selbstverantwortung des Menschen, sowie seine Verantwortung gegenüber dem Mitmenschen, der Gesellschaft und der Umwelt sind dabei wegleitend.«18
Selbstverantwortung bedeutet aber, dass die Kursleitenden lernen, folgende Punkte zu beachten:
In der Lernsituation müssen Spielräume für die selbständige Festlegung von Lernzielen, Lernzeiten und Lernmethoden vorhanden oder erschliessbar sein.
Der Lernende muss diese Spielräume wahrnehmen und tatsächlich folgenreiche Entscheidungen über das eigene Lernen treffen und diese wenigstens zum Teil im Lernhandeln realisieren, ohne dass er sich dessen stets bewusst sein muss!
19
Inwieweit diese Postulate bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung realisierbar sind, steht hier nicht zur Debatte. Doch, wenn nie über solche Prinzipien diskutiert wird, gehen auch mögliche Realisationen vergessen. In einem Klima des gegenseitigen Ernstnehmens kann es vielleicht gelingen, die eigene Situation wahrzunehmen und ohne Leistungsdruck lebensweltliche Kompetenzen zu ihrer Verbesserung aufzubauen, zu verstärken und umzusetzen. Vielleicht kann es gelingen, als ›nicht-schulbildungsfähig‹
etikettierte Menschen ›erwachsenenbildungsfähig‹ zu machen, indem die Erwachsenenbildung zu dem wird, was Schule von ihrem Begriff her schon je hätte sein sollen, aber nie gewesen ist, nämlich Musse (griechisch: σχολη).
b) Sonderagogischer Bereich
In diesem Teil der Fortbildung ginge es darum, Kursleitende, die, bisher noch nie mit Behinderten gearbeitet haben, mit den Erscheinungsformen der geistigen Behinderungen bekannt zu machen. Sie müssen auf eventuell auftretende schwierige Situationen vorbereitet und befähigt werden, durch Verstehen der oft eigenen Kommunikationsformen von Menschen mit geistiger Behinderung, deren Bedürfnisse zu erkennen und darauf einzugehen.
Weiter ginge es auch darum, sie mit den wichtigsten Konzepten der Sonderpädagogik, insbesondere mit dem Normalisierungsprinzip, vertraut zu machen. Dabei beharre ich auf dem mimetischen Normalisierungsbegriff, wie ich ihn an anderer Stelle ausgeführt habe, d.h. der »Angleichung an ideale allgemeine Lebensbedingungen unter Bewahrung und Beachtung der besonderen Bedingungen einer Schädigung«20 . In diesem Sinne ginge es darum, die Kursleitenden zu befähigen, die behinderten Kursteilnehmenden in ihrer Verschiedenheit als gleich Ernst zunehmen .
Sinnvoll scheinen mir dazu die Vorschläge des bourkinabischen Historikers Ki-Zerbo zu sein, der in seinen ›Strategien zum Kennenlernen‹ folgende Anleitung zur Begegnung zwischen Menschen verschiedener Kulturen gibt, die sich sehr wohl für die Begegnung von Behinderten und Nichtbehinderten modifizieren lässt:
1. Sieh! wie andersartig sind die ...
2. ... und doch sind wir alle von gleicher Art!
3. Indessen, dies und dies und jenes machen sie anders als wir.21
D.h. zunächst wird von der Feststellung der Unterschiede ausgegangen – alles andere wäre unaufrichtig –, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Unterschiede nicht gewertet werden.
Die Sonderagogik als »Anwältin des Verschiedenen« 22 muss den Kursleitenden das, was die Behinderten eben anders machen, bewusst werden lassen, ohne zu werten, ohne zu etikettieren, z.B. dass sie eventuell ein qualitativ anderes Lernverhalten besitzen. Dabei interessieren nicht die organischen, sondern die gesellschaftlichen Ursachen für dieses andere Lernverhalten, im Sinne Sohn-Rethels, dass nämlich die Warenform die
Denkformen bestimmt23. Das ist auch gemeint, wenn Christel Manske und ich davon sprechen, es gälte die geistige Behinderung zu erforschen und zu begreifen.
Konkret wird diese Besonderheit vor allem in fachdidaktischen Veranstaltungen umzusetzen sein.
c) Fachdidaktischer Bereich
In diesem Bereich sollen die Kursleitenden fachlich auf den neuesten Stand gebracht und dazu befähigt werden, ihre Kenntnisse methodisch und didaktisch gut aufzubereiten und darzubieten.
Eines der didaktischen Hauptprobleme in den Kursen für Erwachsene mit geistiger Behinderung sind die Diskrepanzen zwischen der kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklung. Aus diesem Grunde greifen verschiedene didaktische Konzepte, die von der Entwicklungspsychologie Piagets herkommen zu kurz 24 , da sich gerade in den erwähnten Diskrepanzen die Beschränktheit des piaget’schen Ansatzes zeigt, der bekanntlich von homogenen Entwicklungsstufen ausgeht.
Aus diesem Grunde eignet sich für die Kurse mit geistig behinderten Erwachsenen der Ansatz der kulturhistorischen Schule (Wygotski, Lurija, Leontjew, Galperin), wie er beispielhaft von meiner Kollegin Christel Manske praktiziert wird 25 . Auch dieser Ansatz geht von einer klaren Stufenfolge des Lernens aus:
Motivation
Orientierung
Handeln mit Gegenständen
Bildhafte Darstellung (Materialisation)
Lautsprachliche Darstellung (Verbalisation)
Gedankliche Erarbeitung der Handlung (Interiorisation)
Im Gegensatz zum Ansatz von Aebli werden die Stufen jedoch nicht gewertet bzw. hierarchisiert26 , was für den Umgang mit den genannten Diskrepanzen von grundlegender Bedeutung ist. Die Tätigkeitstheorie gibt uns eben genau darum ein so reiches didaktisches Instrumentarium in die Hand, weil sie – zumindest in ihrer ursprünglichen Intention – mehr als Didaktik ist, weil sie die Lernenden nicht instrumentalisiert, wie dies in den anderen Didaktiken, spätestens seit Pestalozzi der Fall ist.27
Neben den inhaltlichen Fragen stellt sich auch das Problem, in welchem institutionellem Rahmen diese Fortbildung geschehen soll. Von einem integrativen Standpunkt aus ist es klar, dass diese Fortbildung innerhalb des Fortbildungsangebots der allgemeinen Erwachsenenbildung zu geschehen hat, d.h. also geleitet durch die pädagogischen Arbeitsstellen der Volkshochschulen oder durch Dachverbände der allgemeinen Erwachsenenbildung (wie z.B. der ›Schweiz. Vereinigung für Erwachsenenbildung‹ (SVEB)), die für ihre Kursleitenden seit langem Fortbildung anbieten. Dies muss auf lange Sicht angestrebt werden, doch sind kurzfristig weder das Bewusstsein, noch die notwendigen Stellen, vorhanden, um den sonderagogischen und den fachdidaktischen Bereich abzudecken. Diese Fortbildungsbedürfnisse werden somit noch für einige Zeit segregiert befriedigt werden müssen, doch ist es unabdingbar, dass die Kursleitenden für Menschen mit geistiger Behinderung die erwachsenenbildnerische Fortbildung integriert, d.h. zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus der allgemeinen Erwachsenenbildung besuchen. Beide Seiten werden davon profitieren!
All diesen idealen Beschreibungen stehen noch viele Hindernisse entgegen, seien es solche prinzipieller Art oder solche, die unter Berufung auf Sachzwänge die Integration der Erwachsenenbildung von Menschen mit geistiger Behinderung in die allgemeine Erwachsenenbildung verhindern wollen.
Der utopische Geist muss sich vorwegnehmend von den Sachzwängen befreien, um jenen Weg zu weisen, auf dem die Sachzwänge überwunden werden können.28
Aus diesem utopischen Geist heraus – und damit schlage ich den Bogen zurück zu den Begrüssungsworten von Herrn Dr. Rückert – erwachsen aus der Bildung Menschen, die den oben geschilderten Geist der Unzeit zu behindern fähig sind, gegen den Ungeist der Zeit sich durchsetzen werden und eines Tages »leichten Hauptes und leichter Hände«29 gemeinsam mit uns oben an der Sonne leben, dort den Durchblick haben, aber auch wissen, wie etwas anzupacken ist30.
6 Vortrag gehalten am 23. Juni 1990 an der Tagung ›Durchblicken – Anpacken‹ der ›Gesellschaft zur Förderung der Erwachsenenbildung für Menschen mit geistiger Behinderung‹ in München
7 An dieser Stelle seien auch meine spontanen Vorbemerkungen abgedruckt, die im offiziellen Tagungsbericht nicht enthalten sind: »Bevor ich mit meinem Vortrag beginne, ist es mir ein Bedürfnis, vor diesem Auditorium etwas zu deponieren: Ich habe mir lange überlegt, ob ich es wagen soll, dazu etwas zu sagen, da ich mich damit sehr wohl in die Nesseln setzen kann. Da sich aber alle meine Vorredner gestern zur deutschen Wiedervereinigung geäussert haben, gestatte auch ich mir als Schweizer, als Nachbar, eine Bemerkung. Ich – und ich glaube dies gilt auch für ihre anderen Nachbarn – kann mich an dieser Wiedervereinigung nicht uneingeschränkt freuen, sondern ich habe auch Angst vor diesem neuen, grossen Deutschland ...! Darum bin ich froh, dass das erweiterte Präsidium der Gesellschaft beschlossen hat, sowohl die Tagungen als auch die Redaktion der Zeitschrift zwischen den deutschsprachigen Ländern zu rotieren und ich freue mich 1992 die Tagung in Bern organisieren zu dürfen. Mit diesem Beschluss hat das Präsidium bewiesen, dass er nicht nur Achtung vor unseren behinderten Mitmenschen, sondern auch Achtung vor den kleineren Staaten dieser Welt hat.
8 v. Hofmannsthal [1896], S. 54
9 Dabei gehe ich nicht auf die Diskussion ein, wen denn Hofmannsthal mit denjenigen drunten gemeint hat, schliesse mich aber eher der Meinung an, dass es für ihn nicht das Proletariat, sondern das Bürgertum war, hat er doch die demonstrierenden Arbeiter als Pöbel beschimpft; vgl. dazu sein Gedicht zum 1. Mai 1890, das aber in seinen ›Sämtlichen Werken‹ (1984) nicht enthalten ist, was mehr über die Herausgeber sagt, als über Hofmannsthal.
10 Brief Georges an Hofmannsthal, vom Januar 1896. (Boehringer (1938), S. 85
11 v.Hofmannsthal [1890], zit.n. Erdheim (1984), S. 112
12 Hofmannsthal konnte es sich zumindest noch vorstellen, einem einzelnen zu helfen: » nur mit einzeln kann ich etwas anfangen, einzeln vielleicht helfen, einzelne begreifen und glaube, auch nur darauf kommt es an. (in einem Brief an einen Freund; zit.n. Erdheim (1984), S. 113)
13 Der Schweizer Philosoph Hans Saner bemerkt in seinem neuesten Buch treffend Die Hoffnungslosen übernehmen sich an der Geschlossenheit ihrer Stimmung. Nicht ihr Blick für die Wirklichkeit erdrückt sie, sondern das Faktum, dass sie den Vergleich mit der Wirklichkeit meiden müssen, weil er die Geschlossenheit der Stimmung sprengen würde. In diesem Sinne ist Hoffnungslosigkeit ein ästhetisches Phänomen: eine Geschlossenheit der Stimmung. (Saner (1990), S. 171f)
14 Der ehemalige Soziologieprofessor und heutige Präsident des Arbeitslosenverbandes der DDR, Klaus Grehn, rechnet mit einem Anschwellen des Arbeitslosenheeres in der DDR von heute 100’000 auf mindestens 1,6 Millionen; in: Berner Zeitung vom 18. Juni 1990
15 Butzke/Bordel (Hrsg.) (1989), S. 10
16 Habermas [1984]b, S. 161
17 vgl. Bächtold (1989)
18 Gesetz über die Förderung der Erwachsenenbildung des Kantons Bern, Art. 2. Mit der Annahme dieses Gesetzes in der Volksabstimmung vom 10. Juni 1990 hat der Kanton Bern als einziger Kanton der Schweiz eine gesetzliche Grundlage für die Erwachsenenbildung, mit welcher »[...] insbesondere die Erwachsenenbildung [...] für benachteiligte Bevölkerungs- und Berufsgruppen« – und das trifft ohne Zweifel auf die Behinderten zu – gefördert werden soll.
19 vgl. Weinert (1982)
20 Furrer (1990)a, S. 12
21 Ki-Zerbo (1979), S. 15
22 Coradi (1989)
23 Sohn-Rethel [1976]
24 z.B. Aebli (1976)
25 Christel Manske publiziert unter dem Pseudonym ›Iris Mann‹. Ihre wichtigsten Bücher sind: (Mann, I. (1981)) und (Mann, I. (1990))
26 So schreibt Aebli zur Hierarchisierung seiner Stufen vom Handeln zum Denken, dass es das Ziel sei, »das mathematische Denken zu schulen und nicht Handfertigkeit zu treiben« (Aebli (1976), S. 160
27 Da es wahrscheinlich erstaunt, dass hier ein Schweizer Pestalozzi in einem Nebensatz so vernichtend kritisiert, sei eine Nebenbemerkung gestattet: Pestalozzis Leben und Werk ist ganz klar in zwei Phasen zu unterteilen. Die erste dauerte bis und mit seinem Aufenthalt in Stans und war geprägt durch eine unendliche Liebe zum Kind, ja zu den Menschen überhaupt. Während seines Wirkens im Waisenhaus in Stans, wo er 24 Stunden im Tag mit ›seinen‹ Kindern auf engstem Raum zusammenlebte, begann er zu verstehen, dass eine solche Liebe zum Kind nicht nur verzehrt, sondern auch gefährlich ist. Er begann dem pädagogischen Eros dadurch auszuweichen, dass er sich durch Didaktik vom Kind distanzierte. Er entwickelte in seiner zweiten Phase (nach Stans) eine Rechendidaktik, eine Lesedidaktik, eine Turndidaktik usw., für welche der Begriff der ›Instrumentalisierung‹ beinahe zu schwach ist. Erst jetzt aber wurde er für das Bürgertum brauchbar, das mit Hilfe seiner Didaktiken und unter ideologischem Rückgriff auf die Liebe seiner ersten Phase, die Köpfe der Kinder mit leeren Formeln füllte, in den Herzen das Realitätsprinzip einpflanzte und geschickte Hände für die Industriearbeit formte. (vgl. dazu Furrer (1989)b und (1989)c)
28 Saner (1990), S. 40
29 v.Hofmannsthal [1896], S. 54
30 Diese Bemerkung bezieht sich auf das Motto der Tagung ›Durchblicken - Anpacken‹
Die Peripherie der Peripherie
Entwicklung und Behinderung in der Dritten Welt31
1. Peripherie und Zentrum
Alle wichtigen entwicklungssoziologischen Theorievorschläge, die die heutige entwicklungspolitische Diskussion bestimmen, berufen sich auf den Weltsystem-Ansatz. Trotzdem kann nicht von einem einheitlichen Theoriegebäude gesprochen werden, sondern von verschiedenen konkurrierenden Betrachtungsweisen, die sich jedoch nicht gegenseitig ausschliessen, sondern sich komplementär zueinander verhalten.
Dies gilt insbesondere für die beiden Ansätze, die hier genauer betrachtet und zur Analyse der sozio-ökonomischen Situation der Behinderten beigezogen werden sollen, nämlich die Weltsystem-Theorie, wie sie am soziologischen Institut der Universität Zürich von Peter Heintz32 und Volker Bornschier 33 vertreten werden, sowie einzelner Theoriestränge der Dependencia-Theorie, wie dem Modell der ›self-reliance‹ von Samir Amin34 und der autozentrierten Entwicklung von Senghaas und seinen Mitarbeitendenen35.





























