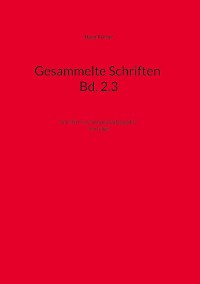Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Band 2.2 der Gesammelten Schriften enthält sämtliche Artikel und Essays aus den Jahren 1989 - 2014. Einen Schwerpunkt bilden dabei die Artikel aus der Zeitschrift 'Erwachsenenbildung und Behinderung'. Daneben enthält der Band auch verschiedene Artikel und Essays, die in unterschiedlichen Fachzeitschriften oder Schriftenreihen erschienen sind. Besonders zu erwähnen sind die beiden Essays 'Behinderte Bildung oder Bildung für Behinderte' und 'Wider die Globalisierung des Menschen'.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt Bd. 2.2
Teil II Essays und Artikel
Beiträge für die Zeitschrift ›Erwachsenenbildung und Behinderung‹
(1990 – 2014)
Behinderte Bildung oder Bildung für Behinderte (1990)
Computer als Werkzeuge für Behinderte (1991)
Völker hört die Signale (1993)
Livskvalitet – kulturelt set (1993)
Biografisches Lernen: Sein ist Werden (1994)
Biografisches Lernen: ›Wer bin ich?‹ (1994)
Der Engel der Behinderten (1995)
Körper und Kognition (1996)
Manipulation oder Information (1997)
Bei den Moorsoldaten (1997)
Geld oder Leben (1998)
Die Peripherie des ›global-village‹ (1998)
Wegweisend (1998)
altern a(k)tiv (1999)
Geist statt Geld (1999)
Ein trauriges Ende (1999)
Doppelt behindert (2000)
Bildung auch für Menschen mit schweren Beeinträchtigungen (2000)
Die Realität des Virtuellen (2002)
Mehrfach kompetent (2006)
»Was ist die Zeit? Ein Geheimnis – wesenlos und allmächtig« (2007)
Inklusion in der Erwachsenenbildung (2010)
Bildet Reisen? (2013)
Was heisst Kompetenzorientierung? (2014)
Projektbericht
(1992): Erwachsenenbildung von Menschen mit geistiger Behinderung im Kanton Bern
Verstreute Essays und Artikel (1989 – 2013)
Das dänische Sozialwesen für Behinderte (1989)
Die Dänischen Volkshochschulen (1989)
High-Tech für Behinderte (1989)
Abortion and Infanticide (1990)
Der Blindensturz (1990)
Der Idiot (1990)
Bildungsfernsehen für Behinderte? Ja! Aber ... (1991)
Wirklich schön (1991)
Mimesis oder die Jagd nach Begriffen (1992)
Die guten ins Töpfchen – die schlechten vors Kistchen
Nos attitudes à l’égard des personnes handicapées (1993)
Financement: modèles adaptés aux différents niveaux d‘une formation continue intégrative
Bildung für alle (1996)
Wider die Globalisierung des Menschen (2002)
Teil IIArtikel und Essays1
1 Die hier gesammelt wieder abgedruckten Artikel und Essays entstanden zu verschiedenen Zeiten und erschienen an verschiedensten Orten. Aus diesen Gründen kann es an einigen Stellen zu Wiederholungen von Gedanken kommen.
Beiträge in der ZeitschriftErwachsenenbildung und Behinderung2
2 Die Zeitschrift Erwachsenenbildung und Behinderung ist das Organ der ›Gesellschaft zur Förderung der Erwachsenenbildung für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.‹. Sie hiess zwischenzeitlich auch ›Internationale Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung‹ und hatte Sektionen in der Schweiz, Österreich, Südtirol, Ungarn und Tschechien. Diese Sektionen wurden anfangs des 21. Jahrhunderts aufgelöst und heute heisst sie ›Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung e.V., Deutschland‹. Die Zeitschrift wird immer noch herausgegeben, inzwischen im 27. Jahrgang.
Hans Furrer war in den 90er-Jahren Mitglied des Präsidiums der Gesellschaft und bis heute Mitglied des ›Grundsatzfragenausschuss für Erwachsenenbildung‹. Von 1997 – 2000 war er Redaktor der Zeitschrift.
Behinderte Bildung oder Bildung für Behinderte
Ein Essay über Sonderagogik aus der Sicht der kritischen Theorie3
Wenn postmoderne Pädagogen feststellen, dass es heute zu »einer Dekonstruktion der Subjektivität in einer Gesellschaft kommt, in der die autonome Lebenspraxis des einzelnen zunehmend eingeschränkt, bzw. überformt wird«4 und »so gesehen im Bereich des Individuellen zunehmend eine Als-ob-Kultur und ›Schein-Subjektivität‹ (entsteht), die auch in Bildungsprozessen nicht mehr einzuholen ist«, 5 bleibt einem anscheinend nichts anderes übrig, als wie sie resignierend vor diesem Tatbestand zu stehen oder in einer ›didaktischen Wende‹ zu versuchen, den Restbestand von ›Wirklichkeit aus zweiter Hand‹ zu retten.
Der von ihnen konstatierte Befund ist jedoch nicht neu, sondern wurde bereits vor dreissig Jahren von Adorno in seiner, Theorie der Halbbildung analysiert.6 Adorno aber ruft dazu auf, auch angesichts ihres Zerfalls, an Bildung festzuhalten 7 . Er tut dies, indem er — wie die postmodernen Pädagogen süffisant bemerken — »das bürgerliche Subjekt für eine historische Errungenschaft hält, die es in jedem Fall zu retten gilt«8. Heute sind wir aber in der bildungstheoretischen Diskussion — nicht zuletzt dank Habermas’ Theorie des kommunikativen Handelns — in der Lage, die widersprüchlichen Forderungen Adornos auf höherem Niveau wieder aufzunehmen.
Der Triumph der Halbbildung
Adorno versteht unter Bildung »nichts anderes als Kultur nach der Seite ihrer subjektiven Zueignung«9. Dabei betont er den Doppelcharakter von Kultur und Bildung:
Die philosophische Bildungsidee auf ihrer Höhe [...] hatte beides gemeint, Bändigung der animalischen Menschen durch ihre Anpassung aneinander und Rettung des Natürlichen im Widerstand gegen den Druck der hinfälligen, von Menschen gemachten Ordnung.10
Wird sie — wie dies in den letzten zwei Jahrhunderten geschehen ist — einseitig auf Geisteskultur und Anpassung reduziert, so verkommt sie zur Halbbildung.
Dabei ist Halbbildung ganz deutlich von Unbildung zu unterscheiden. Während Unbildung der Bildung vorausgeht, folgt die Halbbildung auf diese, sie ist ihr Zerfallsprodukt.
Unbildung, als blosse Naivität, blosses Nichtwissen, gestattete ein unmittelbares Verhältnis zu den Objekten und konnte zum kritischen Bewusstsein gesteigert werden kraft ihres Potentials von Skepsis, Witz und Ironie — Eigenschaften, die im nicht ganz Domestizierten gedeihen. Der Halbbildung will das nicht glücken.11
Sie hat ein entfremdetes Verhältnis zu den Objekten. Der Zugang zu ihnen ist nicht mehr unmittelbar, sondern vermittelt durch ihre Verwertbarkeit. Halbbildung ist misslungene Identifikation, sie ist »der vom Fetischcharakter der Ware ergriffene Geist«12.
Bildung als lebensweltliche Kategorie
An dieser Stelle setzt nun Habermas ein, indem er aufzeigt, dass Erkenntnis stets mit Interesse, Theorie stets mit ihrer praktischen Nutzbarmachung verknüpft ist. Halbbildung wird erzeugt, indem das ›System‹ einseitig Anpassung an seine Bedürfnisse fordert und Erkenntnis mit der Umsetzung seiner Interessen verknüpft. Indem das System durch die Schule — und die Ausweitung des schulischen Einflusses — immer grössere Bereiche der Lebenswelt seinen Interessen und seinen effizienzorientierten Strukturen unterwirft (Habermas nennt dies Kolonisation durch das System), werden Bildungsinhalte ihres Sinnes entleert und werden zu Bildungsgütern, zu Waren, die man erwirbt, um sie gegen Status oder direkt gegen Geld einzutauschen. Die Schule als staatliches Kolonisierungsprogramm zeigt sehr deutlich auf, wie sich diese Unterwerfung durch die beiden Habermas’schen Medien ›Geld‹ und ›Macht‹ in einer Fiskalisierung und Verrechtlichung des kolonialisierten Bereichs ausdrückt. Gelehrt wird, was verwertbar ist, und das erfolgreiche Durchlaufen der Kolonialisierung wird durch ein rechtlich gesichertes Zertifikat bescheinigt, das sich seinerseits wiederverwerten lässt.
Bildung als Ware
Der bedeutendste Vertreter der kritischen Theorie in der Schweiz, der Soziologe und Pädagoge Martin Graf, hat die konkreten Erscheinungsformen der Halbbildung in der heutigen Schule untersucht.13
Das Interessante an seiner Analyse ist, dass er für einmal nicht aufzeigt, was die Schule den Schülern gibt, sondern was sie ihnen vorenthält bzw. nimmt, d.h. er macht quasi die enteignete, andere Hälfte der Halbbildung deutlich. Die positive Formulierung einer solchen Bildung kann nun aber nicht einfach die Negation der Negation sein, da man dadurch wiederum nur eine Totalität erhielte. Nur indem man »dem Negativen ins Angesicht schaut, bei ihm verweilt«14 und an ihm arbeitet, kann man versuchen, »das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen«15 . Dieser Versuch der Aufsprengung am Besonderen ist aber bereits die Befreiung aus dem Negativen.
Das ist auch der Weg den Habermas einschlägt. In seiner Theorie des kommunikativen Handelns setzt er den Systemimperativen das solidarische Durchsetzen lebensweltlicher Interessen entgegen. Solches Handeln ist aber nur in lebensweltlichen Bereichen möglich und muss ständig wieder gegen die Einbindungsversuche des Systems verteidigt und durchgesetzt werden.
Lebenswelt contra System
Was Bildung einmal sein sollte, nämlich der Versuch, die Welt durch Erkenntnis so zu verändern, dass ein mit der Welt harmonisches und von Leiden befreites Leben möglich wird, kann nur noch in lebensweltlichen Bereichen angestrebt werden. Es genügt aber nicht — wie dies Adorno formulierte — nur »an Bildung festzuhalten, nachdem die Gesellschaft ihr die Basis entzog«16, sondern es gilt dem System und seinen Imperativen das Bildungsmonopol zu entreissen und Bildung dort geschehen zu lassen, wo sie noch möglich ist: in der Lebenswelt.
Was kann nun diese Erkenntnis für die Erwachsenenbildung von Menschen, die als behindert gelten, bedeuten? Dazu müssen wir erst versuchen, einen kritischen Behinderungsbegriff zu umreissen.
System und Behinderung
In der Begrifflichkeit der Habermas’schen Theorie liegt »eine Behinderung (dann) vor, wenn ein Individuum aufgrund eines Schadens die Kolonialisierung seiner Lebenswelt durch das System verstärkt erfährt und dadurch seine lebensweltlichen Reproduktionsprozesse deformiert werden«17.
Menschen, die als behindert gelten, sind den Kolonialisierungsmedien Geld und Macht noch viel ungehemmter ausgesetzt als Nicht-behinderte. Ihr Wert — und damit ihre Identität — wird in Prozenten der Leistungsfähigkeit Nichtbehinderter ausgedrückt und in der Rente direkt in Geld umgesetzt. Auf den Ämtern, beim Arzt, aber auch im Bekanntenkreis sind sie auf Wohlwollen angewiesen, d.h. aber mehr oder weniger Machtausübung unterworfen. Beides schlägt sich natürlich besonders stark in ihren Bildungsprozessen nieder.
Dies soll anhand der folgenden Matrix veranschaulicht werden, welche den Einfluss der beiden Kolonialisierungsmedien auf die Reproduktionsprozesse der kognitiven, sozialen und psychischen Strukturen schlagwortartig darstellt.
nach: Furrer (1986)a, S. 90
Diese Schlagworte können hier nicht ausführlich werden (vgl. dazu Furrer (1986)a, S. 91ff und 122ff), doch soll jedes Feld mit einer Bemerkung etwas näher erläutert werden:
Verwertbarkeit
Das Kolonisationsmedium Geld deformiert den Reproduktionsprozess der kognitiven Strukturen bereits seit der Kindheit dahingehend, dass das Individuum nicht das lernt, was es interessiert, sondern was verwertbar ist. Für Kinder, die als behindert gelten, zeigt sich ihre ›Nicht-Verwertbarkeit‹ vor allem darin, dass sie nicht in die ›normale‹ Kolonialisierungsagentur, sondern in eine spezielle Schule geschickt werden.
Technologisierung
Die fatalste Entwicklung im Bereiche der Technologisierung der Behindertenarbeit erleben wir zurzeit in der Diskussion um die pränatale Gendiagnostik. Geschädigte Individuen sind unmittelbare Opfer des technologischen — oder besser technokratischen — Machbarkeitswahns.18
Verdinglichung
Die zwischenmenschlichen Beziehungen werden durch das Kolonialisierungsmedium Geld massiv gestört. Seine Minderwertigkeit drängt den Geschädigten in die soziale Rolle des Bittstellers, des Bedürftigen, des Almosenempfängers. Diese Rollenverteilung dringt bis tief in die privatesten Beziehungen ein und verunmöglicht oder erschwert partnerschaftliche Beziehungen.
Hierarchisierung
Gesellschaftliche Macht gegenüber Geschädigten drückt sich sowohl in der Hierarchisierung der Beziehungen zwischen Arzt und Patient, Betreuer und Betreutem, Sozialversicherung und Versicherungsnehmer usw. aus, als auch in der Hierarchisierung der verschiedenen Schädigungen untereinander. So wollen funktionale Analphabeten nicht als geistig behindert gelten, Paraplegiker distanzieren sich von Menschen mit Muskelschwund usw.
Marketing-Charakter
Die einzige ›Verpackung‹ in welcher der Geschädigte sich — unter den gegebenen Bedingungen — erfolgreich auf den Markt werfen zu können scheint, ist diejenige des Mitleids. Mitleid aber distanziert von den Mitmenschen, die einen nicht als gleichwertiges Subjekt, sondern als Objekt des Mitleids betrachten. Zudem dient es vor allem dem Bemitleidenden und nicht dem Leidenden, der dadurch nur beleidigt wird.
Autoritärer Charakter
Ein Angelpunkt für eine gestörte Identitätsentwicklung geschädigter Kinder ist die durch die Schädigung erschwert zu durchlaufende ödipale Krise. Sowohl durch eine ablehnende Haltung der Eltern, als auch durch eine Mystifikation des Schadens und die daran geknüpfte übertriebene Fürsorge, kommt es zu ungünstigem Verlauf der ödipalen Krise und entweder zu Rollendiffusionen oder — was weit mehr der Fall ist — zu autoritären bzw. autoritätsgläubigen Handlungen.
Behinderung als Chance
Auf der anderen Seite aber — und dies ist eben die Dialektik der Halbbildung — sind verschiedene Reproduktionsprozesse bei Menschen, die als behindert gelten, noch nicht gänzlich dem System unterworfen. Unbildung — und damit unmittelbarer Zugang zu Objekten und Mitmenschen — konnte sich in der ›ökologischen Nische‹ der Behinderung den Sachzwängen des Systems und der Verformung zur Halbbildung entziehen. Die ›beschützenden Werkstätten‹ machen hierin ihrem Namen Ehre: Von vornherein als ›Arbeitskraft minderer Güte‹ definiert, konnten Menschen, die als behindert gelten, darin vor dem Zugriff der Kolonialisierungsmedien geschützt und lebensweltliche Qualitäten erhalten werden.
Von daher darf Integration und Normalisierung keinesfalls als Unterwerfung unter die gleichen und gleichmachenden Bedingungen des Systems verstanden werden, sondern es muss versucht werden, die lebensweltlichen Aspekte eines behinderten Lebens zu erhalten und gegen das System auszubauen.
Normalisierung darf nicht Einpassung in die inhumanen Zwänge des Systems sein, sondern ein Anstreben und Angleichen von Lebensbedingungen, die für alle Menschen — behinderte und nicht behinderte — mehr Lebensqualität versprechen, also das, was die kritische Theorie mit Mimesis meint.
Normalisierung als Mimesis
Aus philosophischer Sicht ist das Problem der Sonderagogik eine Konkretisierung der Dialektik von Allgemeinem und Besonderem. Jeder sonderagogische Ansatz kann von der Philosophie her erklärt werden, die ihm — bewusst oder unbewusst — zugrunde liegt, ob dies nun das medizinische Paradigma mit seiner Kantischen Klassifikation des Besonderen oder der Ansatz der philosophischen Anthropologie mit seiner Mystifizierung des Allgemeinen sei. Die kritische Theorie muss, mit ihrer radikalen Bejahung des Besonderen, für die Sonderagogik einen speziell geeigneten Ansatz bieten, der es endlich Wert wäre, dafür fruchtbar gemacht zu werden.
Adorno hat sich intensiv mit der Dialektik von Allgemeinem und Besonderem auseinandergesetzt. Sie trifft ins Zentrum der gesellschaftlichen Problematik, da Herrschaft stets in der Form des Allgemeinen auftritt bzw. Herrschaft sich in der Form des Allgemeinen (z.B. des Rechts) hinter demokratischen Prozeduren zu tarnen versucht.
Die Gewalt des sich realisierenden Allgemeinen ist [...] dem Wesen der Individuen konträr. [...] Das Allgemeine sorgt dafür, dass das ihm unterworfene Besondere nicht besser sei als es selbst. Das ist der Kern aller bis heute hergestellten Identität.19
An den verschiedensten Stellen macht Adorno immer wieder deutlich, dass nur die radikale Verneinung dieses ›Zwangs zur Identität‹ zur wirklichen Identität hinführen könne:
Wenn heute die Spur des Menschlichen einzig am Individuum als dem untergehenden zu haften scheint, so mahnt sie, jener Fatalität ein Ende zu machen, welche die Menschen individuiert, um sie in ihrer Vereinzelung vollkommen brechen zu können. Das bewahrende Prinzip ist allein noch in seinem Gegenteil aufgehoben.20
Für die Dialektik von Allgemeinem und Besonderem heisst dies nun aber — und dies erstaunt bei Adornos Betonung des radikal Besonderen nun doch —, dass das Besondere nur in der Mimesis, als der sich selbst treuen Nachahmung des Allgemeinen gerettet werden kann.
Damit drückt der Begriff der Mimesis genau das aus, was in der Sonderagogik unter Normalisierung zu verstehen wäre: Angleichung an ideale allgemeine Lebensbedingungen unter Bewahrung und Beachtung der besonderen Bedingungen einer Schädigung.
Da aber die Menschen heute gesondert werden, um sie in der Vereinzelung dem Allgemeinen besser unterwerfen zu können, müssen sie — ob behindert oder nicht — auf eine solche Normalisierung vorbereitet werden.
Bildung als Bewusstwerdung
Lebensweltnahe Bildungsarbeit mit Menschen, die als behindert gelten, — aber auch mit Nichtbehinderten — bestünde darin, lebensweltliche Kompetenzen aufzubauen, zu verstärken und umzusetzen. Darin kommt der Erwachsenenbildung ein besonderer Stellenwert zu. Damit sie als Erwachsenenbildung ihren Namen verdient und nicht wiederum zur Halbbildung verkommt, muss sie von den lebensweltlichen Interessen der Menschen ausgehen und solidarische Handlungsanweisungen vermitteln, um gegen die Kolonialisierungsbemühungen des Systems zu bestehen. Wie oben angedeutet, muss dabei von der negativ dialektischen Analyse Grafs ausgegangen werden. Dies kann im Folgenden an zwei Beispielen nur skizziert werden. In der Erwachsenenbildung für Menschen, die als geistig behindert gelten, muss dabei fruchtbar gemacht werden, dass diese in ihrer Sozialisation ihrer Interessen und Motivationen nicht völlig enteignet worden sind und so oft einen unmittelbaren, nicht verstellten Zugang zur Bildung haben können.
Bildung als Vermittlung solidarischer Handlungsanweisungen Sprache
In der Schule (wie in der Gesellschaft überhaupt) wird die mimetische Muttersprache über das Kolonisierungsmedium Macht zunehmend durch die normierte Vatersprache ersetzt. In diesem Prozess werden die Begriffe zunehmend abstrahiert und formalisiert und damit ihrer eigentlichen Funktion enteignet. Um ihnen ihre Kraft wieder zuzueignen, müsste ihre jetzige Beschränktheit ausgelöscht und der Prozess der Begriffsbildung ab ovo neu durchlaufen werden. Während dies in der allgemeinen Erwachsenenbildung sehr schwierig sein dürfte — aber eventuell über den Neuaufbau von Begriffen in einem darauf ausgerichteten Fremdsprachenunterricht erreicht werden könnte — kann in der Erwachsenenbildung für Menschen, die als geistig behindert gelten, an der weniger weit fortgeschrittenen Enteignung angeknüpft werden. In Kommunikationskursen oder Kursen zum Lesen und Schreiben kann ein Prozess der Begriffsbildung durch die Methoden Paulo Freires, die allgemein bekannt sein dürften, in Gang gesetzt werden. Durch ›generative Bilder‹, die an der konkreten Situation der Menschen, die als behindert gelten, anknüpfen, soll ein Bewusstwerdungsprozess in Gang gebracht, und so die, ›Kultur des Schweigens‹ durchbrochen und die Menschen, die als behindert gelten, zu kommunikativem Handeln befähigt werden.
Mathematik
Während die Enteignungen bei den Begriffen und der Sprache vorwiegend über das Medium Macht geschehen, übernimmt das Medium Geld diese Rolle in der Mathematik. Um dies in der ganzen Tragweite zu erfassen, muss auf die umfassende Analyse Sohn-Rethels verwiesen werden, in welcher er die Abhängigkeit der Denkformen von den Realabstraktionen des Tauschaktes aufzeigt21. Dieser — und damit der Machtaspekt des Geldes — spielte und spielt die zentrale Rolle, sowohl in der phylogenetischen wie der ontogenetischen Entwicklung des Zahlbegriffs. In beiden Prozessen wird im Abstraktionsvorgang der zur Zahl führt, der qualitative Aspekt des Zahlbegriffs ausgeblendet und das Resultat ist die Beliebigkeit des quantitativen Aspekts, quasi ein ›halbierter‹ Zahlbegriff.
In Erwachsenenbildungskursen für Menschen, die als geistig behindert gelten, zu den Themen Zahlbegriff oder ›Umgang mit Geld‹ muss die im Werk Piagets angelegte Dialektik von quantitativem und qualitativem Aspekt des Zahlbegriffs voll zum Tragen kommen und vor allem die normierende Bedeutung des Geldes durchschaubar gemacht werden. Auch hier kann wieder auf dem noch nicht so stark enteigneten und somit unverstellten qualitativen Zugang zu den Objekten und Begriffen vieler Kursteilnehmer aufgebaut werden.
Eine solche Erwachsenenbildung bedingt aber entsprechend ausgebildete und bewusste Kursleiter, eine Aufgabe, die vordringlich an die Hand genommen werden muss. Ihnen muss es gelingen — entgegen dem Diktum Adornos — zu zeigen, dass eine richtige Bildung in der falschen möglich ist.
3 erschienen in Erwachsenenbildung und Behinderung, 1/90, S. 8-13
4 Dewe et al. (1988), S. 402
5 Dewe et al. (1988), S. 402
6 Adorno [1959]
7 vgl. Adorno [1959], S.121
8 Dewe et al. (1988), S. 401
9 Adorno [1959], S. 94
10 Adorno [1959], S. 95
11 Adorno [1959], S. 104f
12 Adorno [1959], S. 108
13 vgl. Graf [1988]
14 Hegel [1807]a, S. 36
15 Benjamin, W. [1939], S. 701
16 Adorno [1959], S. 121
17 Furrer (1986)a, S. 103
18 vgl. dazu Furrer (1988)e und (1989)a
19 Adorno [1966]a, S. 306
20 Adorno [1946/47], S. 198
21 vgl. Sohn-Rethel [1976]
Computer als Werkzeug für Behinderte?22
Wenn Archäologinnen und Archäologen bei ihren Ausgrabungen auf Produktionsmittel früherer Zivilisationen stossen, schliessen sie daraus auf die damaligen Gesellschaftsformationen. Aus Tierfallen und Angelhaken schliessen sie auf Vorformen von Sesshaftigkeit, aus Getreidemühlen auf Ackerbau und mindestens saisonbedingte Sesshaftigkeit und aus bestimmten Steinbohrern, deren Herstellung kompliziert und langwierig gewesen sein muss, kann auf dauerhaftere Formen einer Arbeitsteilung und auf das Vorhandensein eines rudimentären Marktes geschlossen werden. In der Gesamtheit der vorgefundenen Werkzeuge einer Epoche liegt zeichenhaft die Ausprägung bestimmter gesellschaftlicher Beziehungen und Zusammenhänge vor.
Versuchen wir uns vorzustellen, welche Schlüsse bezüglich der gesellschaftlichen Verhältnisse Archäologinnen und Archäologen im Jahre 5000 ziehen werden, wenn sie in den Ruinen von Einfamilienhaussiedlungen oder Wohnblöcken auf die Überreste von Telearbeitsplätzen, auf Bildschirme und Modeme, auf immense Kabelnetze und zentrale Grossrechneranlagen stossen werden. Sie werden auf eine stark hierarchisierte, zentralistisch verwaltete und kontrollierte Gesellschaft von anonymen und isolierten Individuen mit extremer Arbeitsteilung schliessen. Sie werden sich wundern, ob und wie unter diesen Umständen so etwas wie ein Staatswesen funktionieren konnte. Sie werden sich fragen, wie in einer so strukturierten Gesellschaft die natürliche Reproduktion möglich war. (Vielleicht werden sie dann auch auf grosse industrielle Komplexe für die Invitro-Fertilisation stossen, in welchen man auf dem Telemarkt den Nachwuchs bestellen konnte, mit diversen Optionen auf den Grunddaten wie Geschlecht, Körperbau, Haar- oder Augenfarbe.) Und vielleicht werden sie in den Trümmern einer Bibliothek auf ein uraltes Buch aus dem Jahre 1950 stossen und dort lesen:
Kann man sich nicht eine Maschine vorstellen, die diese oder jene Art von Information, etwa Information über Produktion und Verkauf, sammelt und daraus als Funktion der menschlichen Durchschnittspsychologie und der in einem gegebenen Augenblick messbaren Mengen bestimmt, welches die wahrscheinlichste Entwicklung der Lage sein könnte? Könnte man sich nicht sogar einen Staatsapparat denken, der alle Systeme politischer Entscheidungen umfasst? Wir können von der Zeit träumen, in der die ›machine à gouverner‹ die gegenwärtige offensichtliche Unzulänglichkeit des mit der herkömmlichen politischen Maschinerie befassten Gehirns aus dem Wege räumen wird — zum Guten oder zum Bösen.23
Sie werden eventuell ... Nein, genug des apokalyptischen Szenarios! Mit diesen Beispielen wollte ich illustrieren, was Herbert Marcuse bereits 1964 – als die Möglichkeiten der modernen Telekommunikation und Informtik noch kaum absehbar waren – formuliert hat: »Heute verewigt sich die Herrschaft nicht nur vermittels der Technologie, sondern als Technologie.«24 Trotz dieser Einsicht stehe ich den modernen Technologien nicht nur negativ, sondern durchaus ambivalent gegenüber. So entstand dieser Aufsatz natürlich auch auf einem Textverarbeitungssystem, mit den Möglichkeiten der Ausarbeitung eines Konzepts mit Hilfe einer Gliederung. Ich hoffe auch, dass meine Texte sprachlich und formal gewonnen haben, seitdem ich sie mit Hilfe des Textverarbeitungssystems immer und immer wieder korrigieren kann, wenn ich mir auch bewusst bin, dass dadurch alle ersten Entwürfe unverbindlicher werden.
Ich ärgere mich aber, wenn die von mir angestrebte Einheit von Inhalt und Form, den scheinbaren Sachzwängen der verfügbaren Software zum Opfer fällt, wenn z.B. die Redaktion einer Zeitschrift sich weigert, die Fussnoten zu meinem Text dort zu platzieren, wo sie eben hingehören, nämlich an den Fuss einer Seite und diesen formalen Eingriff mit den Mängeln seines Textverarbeitungsprogramms zu begründen versucht.
Andererseits bin ich mir auch der Erleichterungen bewusst, die die neuen Konvertierungsprogramme für die Braille-Schrift bieten, vor allem wenn ich mir vorstelle, wieviel Zeit ich als Lehrer an der Blindenschule mit dem Schreiben von Braille-Texten jeweils ›verloren‹ habe. Doch war die Zeit wirklich verloren? War das mühsame Erlernen der Braille-Schrift nicht vielmehr Teil eines Prozesses der mimetischen Annäherung an meine sehbehinderten und blinden Schülerinnen und Schüler?
Ich sehe auch durchaus ein, dass umfangreiche elektronische Verkabelung durchaus Vorteile für die verschiedensten Formen von Behinderung bringen konnte. So ist es für Frauen und Männer mit einer Körperbehinderung dank Telegiro, Telemarkt, Telebanking und e-mail möglich, ihre sämtlichen Einkäufe und Zahlungen, ihre Korrespondenz und ihr Informationsbedürfnis vom Bildschirm aus abzudecken. Dabei werden immer raffiniertere Apparaturen zur Bedienung der Tastatur angeboten, oft sogar kombiniert mit den Regulatoren der Elektrorollstühle. Doch dient das den behinderten Menschen wirklich? Dient das nicht vielmehr uns Noch-nicht-Behinderten? Auf diese Weise werden nämlich diejenigen Menschen mit Behinderung, die durch die Maschen der pränatalen Gendiagnostik und der prä- und postnatalen Elimination geschlüpft sind, aus dem Verkehr und dem öffentlichen Bewusstsein gezogen. Ihnen wäre mehr gedient, wenn sich die Schalterbeamten auf der Post und der Bank, die Verkäuferinnen im Modegeschäft oder dem Lebensmittel-Grossverteiler mit den täglichen Problemen der behinderten Menschen auseinanderzusetzen hätten.
Trotzdem lasse ich mich durch eindrückliche Demonstrationen von den Vorteilen überzeugen, die die Möglichkeiten der Telebildung auch für die Erwachsenenbildung von Menschen mit geistiger Behinderung bieten. Ich gehe nach Hause und bereits auf dem Heimweg frage ich mich: ist nicht eines der Hauptprobleme auf diesem Gebiet, dass die Teilnehmenden an unseren Erwachsenenbildungskursen zuwenig miteinander kommunizieren? Warum soll ich da ein Werkzeug dazwischen schalten?
Andererseits lese ich im Bulletin der Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik: »Die Intelligenten werden dank der Technik immer intelligenter, die Dummen wegen dieser Technik immer dümmer.« 25 Es entsteht eine neue Art des Analphabetentums. Die pädagogische Norm der ›computer literacy‹ verlangt daher von mir, dass ich den geistig behinderten Kursteilnehmenden Möglichkeiten biete, mit dem Computer umzugehen.
Darum verwende ich den Computer trotz Bedenken als Werkzeug in Kursen für Erwachsene mit geistiger Behinderung und befürworte den computerunterstützten Unterricht an Sonderschulen. So sind heute bereits mehrere Programme auf dem Markt, welche in Schreibkursen für Menschen mit geistiger Behinderung auf spielerische Weise eingesetzt werden können und bei welchen zudem motorische Hürden des Schreibprozesses wegfallen.26 Auch zur Begriffsbildung existieren heute individuell anpassbare Lernprogramme, die sich ausgezeichnet als zusätzliche Werkzeuge für die Erwachsenenbildung eignen. Sie sollen und dürfen aber nur solange eingesetzt werden, als sie Werkzeug bleiben, ein Werkzeug, das wir beherrschen und von welchem wir uns nicht beherrschen lassen, nur solange sie den Unterricht der Lehrenden wirklich unterstützen und nicht dominieren.
Niemand kann uns diese für mich unabdingbaren Prämissen garantieren, doch glaube und hoffe ich, dass eine bessere Gewähr für deren Beachtung besteht, wenn die späteren behinderten Benutzerinnen und Benutzer bereits in die Planung und Realisierung solcher elektronischer Hilfsmittel einbezogen werden.
22 erschienen in: Erwachsenenbildung und Behinderung, 2/91, S. 11-13
23 Wiener [1950], S. 188f
24 Marcuse [1964]a, S. 173
25 Sturny (1986), S, 23
26 Z.B. das Auwiesel-Lese-Rechtschreibprogramm auf MS-DOS
Editorial27
Völker, hört die Signale ...
Liebe Leserin, lieber Leser
in diesem Heft finden Sie Beiträge zum Thema, ›Erwachsenenbildung international‹. Dabei schien es uns wichtig, Konzepte der Erwachsenenbildung aus mehreren Ländern vorzustellen. Aus Platzgründen haben wir uns auf Beiträge aus Dänemark, Grossbritannien und Frankreich beschränkt.
Nicht zufälligerweise steht der Beitrag von Claus Jessen an erster Stelle. Sein Verständnis von Integration, Segregation und Partizipation, mit besonderer Betonung des ›Rechts auf Verschiedenheit‹ scheint uns wegweisend nicht nur für den Umgang mit Randgruppen wie den Frauen und Männern mit Entwicklungsbeeinträchtigungen, sondern auch für das Zusammenleben verschiedener Nationen, z.B. in einem integrierten Europa.
Auch hier gilt es, die Verschiedenheit und die unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu respektieren. Das ›Recht auf Verschiedenheit‹ darf aber niemals absolut gesetzt werden — es ist nur gleichzeitig mit Solidarität zu verwirklichen (die Ereignisse in Südslawien sind dafür ein schreckliches Beispiel!).
Wie solche Solidarität gelebt werden kann, zeigen die Berichte über die neuen Wege der integrativen Erwachsenenbildungsangebote in Grossbritannien und über die grossräumig organisierte nationale Bewegung in Frankreich.
Im Praxisteil soll an einigen Beispielen gezeigt werden, wie die Begegnung mit dem Fremden auch für entwicklungsbeeinträchtigte Erwachsene Bildungswert erhält. Studienreisen sind dazu wohl eines der wichtigsten Mittel. Stärker auf das Individuum ausgerichtet ist der gegenseitige Kontakt zwischen Menschen mit Entwicklungsbeeinträchtigungen über die Grenzen hinweg.
Ist das Fördern des gegenseitigen Austausches, der Neugier für das Fremde, eine zukünftige Aufgabe der ›Gesellschaft zur Förderung der Erwachsenenbildung für Menschen mit geistiger Behinderung‹? Wird die ›Gesellschaft‹ Signale senden durch Europa, für Jung und Alt, ›Behindert‹ und ›Nicht-behindert‹?
Überlassen wir Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, die Antwort auf diese offenen Fragen. Schmieden und realisieren Sie Pläne im Rahmen eines Neuen Europas . . .
27 verfasst zusammen mit Eva Irmann; erschienen in Erwachsenenbildung und Behinderung 2/93, S. 1
Claus Jessen
Livskvalitet — kulturelt set
Lebensqualität — der kulturelle Ansatz28
In der dänischen Erwachsenenbildung können zwei Hauptziele unterschieden werden:
die Entwicklung einer persönlichen Identität als gleichberechtigtes Mitglied der Gesellschaft;
das Recht, das eigene Leben zu bestimmen und nach Lebensqualität zu streben.
Dies entspricht den allgemeinen Zielen einer demokratischen Gesellschaft und es ist nicht einzusehen, warum Bildung für Entwicklungsbeeinträchtigte andere Ziele haben sollte.
Die Integration von Personen mit Entwicklungsbeeinträchtigung in die dänische Gesellschaft ist umfassend, was die Garantierung gleicher Rechte in Bezug auf das gesellschaftliche Leben und die Bildung betrifft. Was aber noch fehlt sind diejenigen Aspekte, die dem Leben Lebensqualität geben. Für ›normale‹ Bürger und Bürgerinnen sind einige dieser Aspekte durch das Sozialsystem und die öffentliche Unterstützung der Bildungs- und Kultureinrichtungen gesichert. Für entwicklungsbeeinträchtigte Bürger und Bürgerinnen müssen spezielle Angebote geschaffen werden.
Lebensqualität ist ein vages Konzept und jedes Individuum hat seine eigenen Ansichten darüber. Es ist schwierig, nachprüfbare Kriterien für Lebensqualität anzugeben. Ein Aspekt, der zur Lebensqualität gehört, ist Kultur.
Seit 1985 organisierten behinderte Schüler und Schülerinnen jährlich ein Musik- und Theaterfestival und diese Aktivitäten spielten auch in Sonderbildungseinrichtungen für Erwachsene eine immer wichtigere Rolle. Dabei wurde die Notwendigkeit erkannt, zusammenzuarbeiten, Gleichaltrige zu treffen, Freundschaften und Liebesbeziehungen einzugehen, das Gefühl zu erhalten, einer Gemeinschaft anzugehören — und bemerkt zu werden.
Wie weit kann dabei innerhalb der bestehenden Kulturformen gearbeitet und gleichzeitig eine ›Sonder‹-Kultur entwickelt werden? Der kulturelle Imperialismus, insbesondere die kulturellen Standards der Lehrer und Lehrerinnen, waren schwierig zu überwinden und viele der Darbietungen auf den Festivals glichen eher Demonstrationen des sonderschulischen Prozesses als authentischem kulturellem Ausdruck. Die entwicklungsbeeinträchtigten Darsteller und Darstellerinnen traten eher als Objekte der Aktivitäten der Lehrer und Lehrerinnen auf, denn als Subjekte ihrer eigenen Interessen.
Um neue Wege der Kulturarbeit zu entwickeln, wurde die kulturorientierte Sondererziehung zum Thema eines Projektes der dänischen Sonderlehrergewerkschaft für das Schuljahr 1990/91. Es galt theoretische Grundlagen und praktische Methoden zu finden, um einen Unterricht auf kultureller Basis zu ermöglichen. Die Resultate dieses Projekts wurden 1991 publiziert29. Der vorliegende Artikel will die historischen und theoretischen Hintergründe dieses Projektes aufzeigen.
Sinnstiftung durch Kultur
Was heisst Kultur? Heisst es, sich schön anzuziehen und in die Oper zu gehen oder nach dem Fussballspiel in der Kneipe um die Ecke ein Bier zu stürzen? Sind es die Schönen Künste oder die Verpflichtungen des sozialen Lebens, die französische Küche oder der Leberkäse? Tatsachlich ist es all dies — und vieles anderes mehr. Ein Verständnis von Kultur, mit dem sich arbeiten lässt, muss sowohl die Lebensweise der Menschen als auch die Produkte der Schönen Kunst umfassen. Es gehören sowohl die Prozesse des täglichen Lebens mit ihren Normen, Gewohnheiten und Ritualen dazu, ihren Instrumenten und Organisationen als auch die Produkte der Literatur, der Musik und der bildenden Künste.
Kultur ist ebenso schwierig zu definieren wie Lebensqualität. Sie ist Bestandteil aller menschlichen Aktivitäten, sie ist überall – wie Luft – und wenn man glaubt, sie begrifflich gefasst zu haben, entgleitet sie einem — wie Luft.
Den verschiedenen Auffassungen von Kultur ist der Begriff des Sinns gemeinsam. Kultur ist die Summe der sinnvollen Antworten auf Probleme und Herausforderungen des menschlichen Lebens. Folglich kann der kulturelle Ausdruck einer bestimmten Bevölkerungsgruppe als die Manifestation ihrer spezifischen Lebenserfahrungen gesehen werden, die gleichzeitig hilft, diese Gruppe zu bilden und ihre Mitglieder mit sinnvollen Deutungen ausrüstet.30
Diese Bedingungen müssen im Bildungsprozess beachtet werden. Wenn wir lernen, ordnen wir unsere Beobachtungen in Mustern, die durch unser kulturelles Erbe geformt sind. Multikulturelles Lehren und Lernen ist darum so schwierig, weil die Lernenden den Stoff in anderen – aber ebenso sinnvollen – Kontexten ordnen, als die Unterrichtenden. Dies gilt insbesondere auch für Randgruppen mit unterschiedlichen Lebensbedingungen.
Gruppen formen ihren kulturellen Ausdruck in Übereinstimmung mit ihren ureigensten Lebenserfahrungen. Weil Entwicklungsbeeinträchtigte in ihrem Leben andere Erfahrungen machen, werden sie auch eigene kulturelle Ausdrucksformen finden. Erwachsenenbildungung für Frauen und Männer mit Entwicklungsbeeinträchtigungen hat diesen kulturellen Hintergrund zu respektieren und das Entstehen einer eigenen Kultur zu unterstützen. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur muss Teil des Unterrichts werden.
Historischer Überblick
Der Umgang mit Behinderten verlief auch in Dänemark in drei Etappen:
Am Anfang stand die Segregation, mit riesigen Heimen, in welchen die entwicklungsbeeinträchtigten Personen von der normalen Bevölkerung isoliert wurden. Ein wichtiger Aspekt der Isolation war es, die Gesellschaft – und ihre genetische Reinheit – vor der sexuellen und kriminellen Gefahr zu schützen, die in der Öffentlichkeit mit geistiger Behinderung verbunden wurde.
›Ein Leben unter so normalen Bedingungen als möglich‹ war das Motto der Etappe der Integration. Beeinflusst durch fortschrittliche Erziehungswissenschaft wurde Entwicklungsbeeinträchtigung als Resultat einer ungenügenden Bildung gesehen und Sonderschulen bekamen die Aufgabe, auf die Meisterung eines normalen Lebens vorzubereiten. Bereits Ende der 50er-Jahre wurden die Rechte der Entwicklungsbeeinträchtigten als Bürger und Bürgerinnen festgeschrieben. In den folgenden Jahrzehnten wurden enorme Anstrengungen unternommen, die notwendigen Rahmenbedingungen in den Bereichen der Bildung, der Arbeit und des Wohnens bereitzustellen. Heute verfügen Entwicklungsbeeinträchtigte über die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen Mitglieder der dänischen Gesellschaft — zumindest im Prinzip.
Gleichheit ist aber nicht nur eine rechtliche Angelegenheit. Gesetze und Bestimmungen, gesellschaftliche Organismen und Einrichtungen zur Verbesserung des Lebens Behinderter garantieren nicht bereits Lebensqualität. Die dritte Etappe auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben innerhalb einer Gemeinschaft von Gleichen, auf welches die Anstrengungen in Zukunft ausgerichtet sein müssen, ist.
Vergangenheit, Gegenwart und Probleme
Niemand will zurück zu den grossen Heimen, in welchen die Erfüllung der internen Strukturen mehr Bedeutung hatte als die Bedürfnisse der Insassen. Segregation machte die Entwicklungsbeeinträchtigten zu Aussenseitern ohne Rechte, zu Abfall der Industriegesellschaft, unnützen und überflüssigen Existenzen ohne Einfluss auf ihr eigenes Leben. Gesellschaftliche Möglichkeiten und Beschäftigung waren durch die Mauern beschränkt und die Rahmenbedingungen des täglichen Lebens waren keine Herausforderung zur persönlichen Entwicklung.
Andererseits gab die Segregation auch Sicherheit und Klarheit. Die täglichen Verrichtungen und die institutionalisierten Rollen aller beteiligten Personen gaben den Entwicklungsbeeinträchtigten eine unmittelbare Erfahrung eines sinnvollen Ganzen und der Kontext des gemeinsamen Verstehens ermöglichte den Aufbau eines gemeinsamen Geistes. Erinnerungen von Insassen und Personal aus Heimen zeigen eine spezielle institutionelle Kultur, die dem monotonen Leben Sinn gab. Geschichten wurden erzählt, Übernamen und Witze kursierten über das Personal, bestimmte Lieder wurden bei speziellen Gelegenheiten gesungen ...
Es ist klar: Segregation war Diskriminierung und eines der Ziele der Integration war es, diese zu beenden. Das ist nicht vollständig gelungen. Die Bildung von entwicklungsbeeinträchtigten Kindern findet heute im Regelschulsystem statt. Das hat zur Folge, dass sie innerhalb der Regelklassen vereinsamen. Entgegen den Absichten der Integration gibt dies vielen Kindern eine direkte Erfahrung ihrer Minderwertigkeit gegenüber den Klassenkameraden und -kameradinnen. Wann immer sie sich mit Mitschülerinnen und Mitschülern vergleichen, erfahren sie ihren Mangel und stets finden sie sich zusammen mit andern ›Versagenden‹ im Sonderunterricht ausserhalb des normalen Klassenzimmers. Diskriminierung gegenüber den ›Normalen‹, die sich auf Ungenügen gründet, ist offensichtlich und wird von den Kindern als solche empfunden. Um Misserfolgserlebnissen aus dem Weg zu gehen, haben sie gelernt, ihre Unfähigkeit vorbeugend auszudrücken. Es ist weniger blossstellend, zusammen mit gleichartigen ausserhalb der normalen Herausforderungen unterrichtet zu werden als ständig Minderwertigkeit zu erfahren.
Das Resultat dieses Prozesses wird in den Sonderbildungseinrichtungen für Erwachsene sichtbar. Dort finden wir junge Erwachsene, die jegliche Initiative verloren haben, Herausforderungen anzunehmen, weil ihre Schulerfahrung sie gelehrt hat, dass Herausforderung Minderwertigkeit heisst. Sie haben das Selbstvertrauen verloren und eine Identität der Unfähigkeit entwickelt, die sie vor Misserfolgen schützen soll.
Unbefriedigende Nebeneffekte können auch in der aktuellen Wohnsituation festgestellt werden. Die Heime wurden aufgehoben und ihre Mitglieder wurden in kleinen Wohngemeinschaften von 4-6 Personen in Wohngebiete verteilt. Oft konnten die Mitbewohner und Mitbewohnerinnen nicht selbst gewählt werden, es besteht kein Kontakt zu Nachbarn und die täglichen Erledigungen im Haushalt unterschieden sich kaum von den Zeitplanen eines Heimes, da sie ebenfalls auf den Arbeitsplänen des betreuenden Personals basieren.
Partizipation der Zukunft
Trotz grundlegender psychologischer Erfahrungen wurde Integration bisher mit Prinzipien verwirklicht, die aus der ›normalen‹ Gesellschaft und einem ›normalen‹ Lebensentwurf stammen. ›Normalität‹ wird unter diesem Gesichtspunkt zu einer Abstraktion und ›normal‹ wird zum statistischen Durchschnitt. Das Individuum wird unter dem Gesichtspunkt des Allgemeinen integriert und das Besondere wird ausgeklammert. Wenn Integration über allgemeine Begriffe verwirklicht wird, werden die besonderen Bedürfnisse übersehen.
Integration sollte ihren Ausgangspunkt bei den individuellen Bedürfnissen nehmen und z.B. das Bedürfnis respektieren, in der Adoleszenz unter Gleichartigen zu sein, d.h. das Recht auf die Einmaligkeit und Verschiedenheit zusammen mit anderen ›verschiedenen‹ Leuten der peergroup zu erfahren. Leben unter gleichen Bedingungen ist nicht dasselbe wie die Leugnung von Unterschieden — soziale Gleichheit hat ihre Wurzeln in der Verschiedenheit.