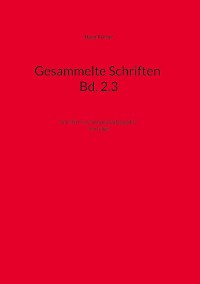Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Gesammelten Schriften enthalten alle zwischen 1969 und 2021 erschienen Schriften des Autors und umfassen alle seine Bücher, Essays, Artikel und Vorträge aus seinen verschiedenen Fachgebieten. Zum Teil sind auch bisher unveröffentlichte Werke und Manuskripte enthalten. Im Bd. 1 sind Beiträge zur Lehrer- und Berufsbildung, Didaktik, Kompetenz- und Performanzorientierung gesammelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt Bd. 1.2
II Didaktik
Bücher, Artikel, Vorträge, Essays
Das Berner Modell
(2009)
Vorwort des Herausgebers
Einleitung
Das Berner Modell
Driftzone
The psychological development of children and adolescents and its didactical consequences
(2016)
Didactical Concept of the Massawa Workers Training Centre
(2017)
III Kompetenz und Performanz
Ressourcen – Kompetenzen – Performanz
(2000)
Vorwort
Einleitung
Kompetenzen entwickeln (theoretischer Teil)
Das Ausbildungsportfolio (praktischer Teil)
Zeitkritische Schlussbemerkungen
Anhang: Exkurs A: Tätigkeitstheorie
Exkurs B: Linguistik
Artikel und Vorträge
(2001 – 2005)
Kompetenzen erfassen (2001)
Anerkennung und Validierung von Kompetenzen
Politische Opportunität oder identitätspsychologische Notwendigkeit (2005)
Ressourcenorientiert unterrichten – performanzorientiert prüfen
(2005)
Performanzorientiert Prüfen
(2017)
Essays
(2001 – 2021)
La compétence n’est pas une marchandise
Quelques pensées critiques sur la notion et la pratique de la reconnaissance et validation des compétences (2001/2010)
Vygotskij, Gramsci, Lukács, Brecht – un incontro che ha mai avuto luogo (2020)
Deutschsprachige Zusammenfassung
Warum Performanzorientierung?
(2021)
Literaturverzeichnis Bd. 1.1 und 1.2
Teil II
Didaktik
Das Berner Modell1
Ein Instrument für eine kompetenzorientierte Didaktik
Inhalt
Vorwort des Herausgebers
Einleitung
Das Berner Modell
Ein Instrument für eine kompetenzorientierte Didaktik
Driftzone
Der Bildungsbegriff als Grundlage der Didaktik
Kompetenz
Zur Kritik des Konstruktivismus in der Erwachsenenbildung
Die Pädagogik und Didaktik von Comenius
Wagenscheins Lehrkunst
Klafkis bildungstheoretische Didaktik
Lernen als Handlungsproblematik
Zone der nächsten Entwicklung
Holografisches Lernen
Edmund Kösels subjektive Didaktik
Chreoden
Morpheme
Generative Bilder
Der Habitusbegriff von Bourdieu
Die Teilnehmendenanalyse
1 Das ›Berner Modell‹ erschien 2009 im hep-Verlag als Bd. 40/41 der Reihe ›Aus der Praxis – Für die Praxis‹ der ›Akademie für Erwachsenenbildung‹ Schweiz. Einzelne Fehler wurde hier korrigiert und zwei Stellen auf den neuesten Stand gebracht.
Vorwort des Herausgebers
Liebe Leserin, lieber Leser
... von Berlin nach Bern
Die Schrift von Hans Furrer, die vor Ihnen liegt, habe ich während einer mehrtägigen Wanderung gelesen. Das mag dazu beigetragen haben, dass ich seine Ausführungen mit einem Reisebegleiter assoziiere, für eine kleine Städtereise von Berlin nach Bern, durch verschiedenartige ›didaktische Landschaften‹ führend. Es gibt Reiseführer, welche eine Auswahl der Sehenswürdigkeiten treffen und diese möglichst versachlichend beschreiben, andere, die eher persönliche Wertungen und Sichtweisen wiedergeben. Die vorliegende Publikation enthält beide Aspekte, sie ist sowohl informierend als auch anregend.
Hans Furrer stellt in dieser Publikation das von ihm entwickelte ›Berner Modell‹ vor, ein kompetenzorientiertes Planungsinstrument für Lehr-Lern-Prozesse, das auf dem ›Berliner Modell‹ von Heimann (1962) basiert. Der Autor verknüpft dessen Modell mit diversen neueren und älteren didaktischen Ansätzen und eigenen gesellschaftspolitischen Überlegungen. Er beschreibt nicht nur, sondern nimmt auch deutliche Setzungen vor, die sein elaboriertes Bildungsverständnis widerspiegeln. Seine Aussagen informieren und provozieren, sie regen zur Auseinandersetzung mit der Materie und dem Autor an, ganz im Sinne der ›Driftzone‹ nach Kösel, dem »Interaktions-Raum, in dem sich Lehrende und Lernende begegnen«2.
Ich wünsche Ihnen inspirierende Anregungen und neue Blickwinkel beim Driften durch die didaktischen Landschaften zwischen Berlin und Bern.
Donatus Berlinger
Redaktion Publikationen aeB Schweiz
2 Kösel (1993) S. 239
Einleitung
Un tableau, c’est un espace fini,
limité par un cadre;
il faut que l’infini y soit.3
Wozu ein neues Buch über die Didaktik der Erwachsenenbildung – ein Buch gar, das beansprucht, ein neues didaktisches Modell zu entwerfen? Gibt es nicht schon genug solche Modelle? – Der Grund ist ein rein praktischer und aus der Praxis der Ausbildung von Fachleuten der Erwachsenenbildung in Bern entstanden.
In unseren Ausbildungen haben wir uns während langer Zeit in der Basisausbildung auf das ›Berliner Modell‹4. gestützt, ein sehr einfaches und in der Grundstufe gut handhabbares Modell. In der Aufbaustufe wurden die Studierenden dann in andere Modelle eingeführt, etwa das Perspektivenmodell von Klafki5 oder die Subjektive Didaktik von Kösel, und sie wurden auch mit dem genetischen Lehren nach Wagenschein oder der Didaktik des selbstsorgenden Lernens nach Forneck und anderen Modellen bekanntgemacht.
Zunehmend begannen diese Modelle in einzelnen Aspekten unserem Bildungsverständnis zu widersprechen. Insbesondere konnten wir nicht mehr dahinterstehen, wenn in der didaktischen Planung von Lernzielen gesprochen wurde.
Etwas überspitzt gesagt, gehen mich als Unterrichtenden in der Planung die Lernziele der Lernenden gar nichts an. Die Lernziele – das heisst das, was die Teilnehmenden lernen wollen – sind etwas sehr Persönliches, und es liegt in der Verantwortung der Lernenden selbst, ob und was sie lernen wollen. In der Schweiz besteht eine zusätzliche Schwierigkeit darin, dass in den meisten Dialekten nicht zwischen ›Lernen‹ und ›Lehren‹ unterschieden wird – beides heisst bei uns ›Lehren‹.
Wenn wir in der Logik der Ziele bleiben wollen, so haben wir in der Planung höchstens Lehrziele oder Unterrichtsziele zu definieren. Es ist dann zu hoffen, dass die persönlichen Lernziele der Lernenden und die Lehrziele der Lehrenden nicht allzu weit voneinander entfernt sind. Sie müssen nicht unbedingt kongruent sein, denn eine gewisse Diskrepanz kann, im Sinne von ›Widerstand‹, durchaus lernwirksam werden. Liegen die Ziele aber zu weit voneinander entfernt, kann eine kognitive Dissonanz entstehen, und das Lernen wird blockiert.
Diese auf die Teilnehmenden zentrierte Sichtweise geht davon aus, dass Unterricht, auch wenn ich ihn noch so gut plane, unwirksam bleiben wird, wenn die Teilnehmenden nicht bereit, willens oder fähig sind, sich auf meinen Plan, meine Unterrichtsziele einzulassen. Ich muss die Lernsituationen so gestalten, dass sie für die verschiedenen Teilnehmenden die unterschiedlichsten Zugänge öffnen.
Der zweite Aspekt, der uns immer weniger befriedigte, war, dass all die genannten didaktischen Modelle nicht kompetenzorientiert sind. In weiten Bereichen der Bildungslandschaft, insbesondere auf der Sekundarstufe II, werden die Curricula heute meistens kompetenzorientiert formuliert. Ein didaktisches Planungsmodell hat sich dem anzupassen und Kompetenzen zu formulieren, die in einer Bildungssequenz zu entwickeln sind, bzw. Performanzen zu beschreiben, die eine Person am Ende der Bildungssequenz zeigen können sollte. Dies aber in vollem Bewusstsein, dass eine Kompetenz (bzw. Performanz) mit den unterschiedlichsten individuellen Ressourcen entwickelt werden kann. Viele Hinweise dazu habe ich dem interessanten Buch von Hansruedi Kaiser6 und dem Curriculum für die Fachangestellten Gesundheit des Kantons Solothurn entnommen, wenn ich auch nicht ganz mit deren Begrifflichkeit im Bereich der Kompetenzen und Ressourcen einverstanden bin.
Aus diesen Gründen habe ich sukzessive begonnen, am ›Berliner Modell‹ herumzufeilen, es den Erfordernissen meines Bildungsverständnisses und der Kompetenzorientierung anzupassen. Im Laufe des Jahres 2006 entstand so das, was irgendwann den Arbeitstitel ›Berner Modell‹ trug. Dieses Modell habe ich zunehmend verfeinert und ausgebaut, und wir haben es in der aeB in Bern im Unterricht verwendet. So waren zunehmend mehr und unterschiedliche Versionen des Modells im Umlauf, es wurde nötig, das Modell einmal auf seinem vorläufigen Stand auszuformulieren und zu publizieren. In der vorliegenden Veröffentlichung wird versucht, die Grundidee des ›Berner Modells‹ aufzunehmen. Die Lesenden sollen die Möglichkeit eines individuellen Zugangs zum Modell haben und es so weit vertiefen können, als es in ihrem Bedürfnis liegt. Deshalb der zentrale (›blaue‹) Teil dieser Publikation, der den Kern des ›Berner Modells‹ beinhaltet. Zusätzlich gibt es aber eine Driftzone, mit verschiedenen kleinen Abschnitten, die einzelne Aspekte des Modells vertiefen oder Zusammenhänge aufzeigen.
Auf diese Abschnitte wird mit dem -Zeichen und einer Seitenzahl verwiesen. Mit dem -Icon wird jeweils auf weiterführende Literatur hingewiesen.
Wiederholungen liessen sich bei einem solchen Aufbau nicht ganz vermeiden, doch habe ich versucht, sie auf ein Minimum zu beschränken. Die Abschnitte wurden bewusst nicht nummeriert, weil keinerlei Hierarchie vorgegeben werden soll. Die Lesenden sollen sich gemäss ihren Interessen durch die Texte lesen.
Ich danke der Akademie für Erwachsenenbildung (aeB Schweiz) für die Möglichkeit, diese Gedanken einer breiteren Öffentlichkeit zur Kenntnis zu bringen. Es handelt sich bei der Publikation aber nicht um ein offizielles Dokument der aeB – es sind meine Ansichten, die hier niedergeschrieben wurden. Dies betrifft insbesondere Gedanken über den Bildungsbegriff und andere Kapitel mit gesamtgesellschaftlichen Inhalten.
Die im engeren Sinne didaktischen Ideen jedoch werden in verschiedenen Angeboten des ›Berner Seminar für Erwachsenenbildung‹ (BSE) teilweise bereits in die Praxis umgesetzt. Darum danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen von des ›BSE‹ für ihr Mitdenken und ihre Bereitschaft, immer wieder Teile aus dem ›Berner Modell‹ auszuprobieren. Und insbesondere danke ich auch den Studierenden am ›BSE‹, die sich immer wieder vertrauensvoll auf Experimente eingelassen haben.
Ergänzung 2022:
Die Erfahrungen in den letzten zehn Jahre in den Masterlehrgängen an der aeB, bei der Ausbildung von Berufsfachschullehrern und insbesondere beim Aufbau von Berufsschulen in Myanmar (2012–2016) und seit 2017 in Eritrea und meine vertiefte Auseinandersetzung mit der ›Tätigkeitstheorie‹ haben mir gezeigt, dass das ›Berner Modell‹ zwar immer noch ein brauchbarer didaktischer Ansatz ist, jedoch grundsätzlich revidiert werden muss. Meine wichtigste Erkenntnis ist, dass ich heute nicht mehr von Kompetenzorientierung, sondern von Performanzorientierung spreche. Das beinhaltet vor allem, dass ich das Kompetenzmodell von Le Boterf quasi vom Kopf auf die Füsse stelle, was in dem zugegebenermassen etwas plakativen Satz zusammengefasst werden kann:
Kompetenz entsteht durch reflektierte Performanz
Dieser Gedanke wird in meinen neuesten Essays Warum Performanzorientierung? vertieft.
3 Weil ((1952), S. 97
4 vgl. Peterssen (1991), S. 82 ff
5 Klafki (1991), S. 270 ff
6 Kaiser (2005)
Das Berner Modell
Ein Instrument für eine kompetenzorientierte Didaktik
Didaktische Modelle sind Instrumente, deren sich Ausbildende bedienen können, um ihren Unterricht zu planen oder kritisch zu hinterfragen. Das Berner Modell basiert auf der Annahme, dass alle Unterrichtsprozesse – so unterschiedlich sie auch sein mögen – dieselbe Struktur besitzen.
Das Modell basiert ursprünglich auf dem bekannten ›Berliner Modell‹7 . Dieses ist aber noch eindeutig zielorientiert und musste also abgeändert werden, um der heutigen Kompetenzorientierung Rechnung zu tragen. Zugleich sollten auch andere didaktische Konzepte, insbesondere diejenigen von Klafki (S. →ff), Kösel (S. →) oder Krapf, aber auch Elemente aus älteren Bildungsansätzen wie Wagenschein (S. →ff), Wygotski (S. →ff) und Freire (S. →ff) eingearbeitet werden.
Im Folgenden wird das Berner Modell Schritt für Schritt entwickelt. Unsere Darstellung folgt dabei einer inneren Logik, doch lassen sich die einzelnen Schritte durchaus in anderer Reihenfolge durchführen. Dies umso mehr, als letztlich alle Elemente des Modells zusammenhängen und gegenseitig voneinander abhängig sind.
Ausbildende haben stets Entscheidungen zu treffen, und zwar in folgenden Bereichen:
Entscheidungsfelder
zu behandelnde Inhalte /Themen,
anzuwendende Sozialformen,
anzuwendende Methoden,
einzusetzende Medien.
Bei ihren Entscheidungen müssen Ausbildende aber auch gewisse Rahmenbedingungen und Voraussetzungen berücksichtigen:
Bedingungsfelder
infrastrukturelle, strukturelle und institutionelle Rahmenbedingungen,
persönliche (anthropogene) Voraussetzungen, das heisst individuelle Voraussetzungen, wie etwa die Kompetenzen bzw. Ressourcen, die einzelne Teilnehmende bereits mitbringen,
vorgegebene Curricula,
anzustrebende Kompetenzen, zu erwerbende Ressourcen.
Alle diese Elemente stehen in gegenseitiger Abhängigkeit. Sie unterscheiden sich voneinander hinsichtlich des Einflusses, den sie auf die Planung der Ausbildenden ausüben: Zum einen handelt es sich um Faktoren, welche die Ausbildenden durch ihre Entscheidungen beeinflussen können, zum andern um Gegebenheiten, an die sie sich mehr oder weniger anpassen müssen.
Zu den Bedingungs- und Entscheidungsfeldern werden im Folgenden Auswahlkataloge möglicher Fragen aufgeführt. Nicht immer ist allerdings eindeutig zu entscheiden, welcher Kategorie ein einzelnes Element angehört.
Bedingungsfelder
Thema
Im Hinblick auf das Thema besteht oft ein bestimmter Freiraum – der entscheidende Punkt einer didaktischen Analyse besteht darin, das vorgegebene Thema zu begrenzen, Bereiche auszuwählen und diese Auswahl zu begründen. Ideal wäre sogar, wenn nur die anzustrebenden Kompetenzen vorgegeben wären und die unterrichtende Person (idealerweise zusammen mit den Teilnehmenden) wählen kann, mithilfe welcher Themenbereiche sie deren Entwicklung initiieren will. Oft ist es sinnvoll, eine erste Auslegeordnung zu machen und mögliche Themenbereiche und eventuell verwandte Themen aufzulisten. Dies soll möglichst breit geschehen, um nicht schon in diesem Stadium didaktische Vorentscheidungen zu treffen.
Rahmenbedingungen
Gemeint ist der Kontext, innerhalb dessen die Bildungssequenz angesiedelt ist:
Wo findet die Bildungssequenz statt?
Sind die verfügbaren Räumlichkeiten für den Unterricht geeignet?
Wie sind die Unterrichtsräume ausgerüstet?
Wie steht es um die vorgegebene zeitliche Struktur?
Gibt es Vorschriften bezüglich Umgangsformen, Strukturen usw.?
Gibt es andere Punkte, die sich nicht verändern lassen?
Gibt es eine Aufsichtsbehörde oder Vorgesetzte Person, und welches sind deren Befugnisse?
Persönliche und soziokulturelle Bedingungen
In Betracht fallen hier die Voraussetzungen aller beteiligten Personen (das heisst der Teilnehmenden und der Ausbildenden):
In welchem Alter stehen die Teilnehmenden, wie ist ihr Entwicklungsstand?
Handelt es sich um Frauen oder Männer?
Wie gross ist die Klasse, und wie ist sie zusammengesetzt?
Welches sind die wahrscheinlichen Interessen, Bedürfnisse, Motivationen, Ansichten der Teilnehmenden?
Welches sind die Lebensbedingungen der Teilnehmenden? Hängen damit eventuell gewisse Ansichten, ihre Leistungsfähigkeit usw. zusammen? Ist die Gruppe diesbezüglich homogen oder heterogen?
Welches sind die Erfahrungen, welche die Teilnehmenden im Hinblick auf das Thema mitbringen?
An welchem Punkt ihrer Entwicklung steht die Gruppe? Wie ist das Gruppenklima? Gibt es formelle bzw. informelle Führung innerhalb der Gruppe?
Wie kommunizieren die Teilnehmenden untereinander, wie arbeiten sie zusammen?
Wie verhalten sich die Teilnehmenden gegenüber den Ausbildenden, gegenüber Autoritäten?
Welches ist der gewohnte Lernstil der Teilnehmenden?
Welches sind mögliche äussere Einflussfaktoren wie Herkunft, Sozialisation, Bildungsnähe (oder nicht), die einen Einfluss auf das Lernverhalten der Teilnehmenden haben? Was heisst das für die Planung?
Bei der Analyse der Teilnehmenden kann es hilfreich sein, deren Weiterbildungsverhalten in den verschiedenen Sozialisationsbedingungen zu beachten, wie sie in den Sinus-Milieus beschrieben sind (S. →ff).
Meist sind die Annahmen, die bei einer Teilnehmendenanalyse gemacht werden, rein hypothetisch, da oft zu wenig Angaben vorliegen. Trotzdem ist es sinnvoll, sich vorher über diesen Aspekt Gedanken zu machen.
Bei längeren Bildungssequenzen ist es sinnvoll und lohnend, für eine solche Analyse am ersten Tag genügend Zeit einzusetzen. Dazu können Stellsoziogramme durchgeführt oder die Fragestellungen und Interessen der Teilnehmenden erhoben werden.
Wo die Möglichkeit dazu besteht, kann es durchaus sinnvoll sein, durch eine vorherige schriftliche Umfrage mehr Angaben von den Teilnehmenden einzuholen, insbesondere was die Vorbildung und die Interessen an der geplanten Bildungsveranstaltung betrifft.
Curricula
Oft gibt es vorgeschriebene bzw. obligatorische Curricula, welche die Ausbildenden zum Gedanken verleiten könnten, es sei nicht mehr nötig, eine didaktische Analyse vorzunehmen. Doch auch solche Curricula lassen den Ausbildenden mehr Freiheit, als sie denken, insbesondere bei der Auswahl und Gewichtung der Themen.
Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Jede Bildungssequenz findet innerhalb eines breiten gesellschaftlichen Umfeldes statt, das wir im Sinne der Themenzentrierten Interaktion ›Globe‹ nennen wollen. Dieser ›Globe‹ hat meist grossen Einfluss, sowohl auf das Thema als auch auf die Rahmenbedingungen. So kann ein bestimmtes Thema durch die gesellschaftlichen Bedingungen im Trend liegen oder tabuisiert sein. Aber auch die Rahmenbedingungen werden durch das gesellschaftliche Umfeld geprägt, zum Beispiel kann die neoliberale Sparpolitik die infrastrukturellen oder personellen Bedingungen einschränken.
Als Raster für die Analyse der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eignen sich besonders die Leitfragen Klafkis (S. →ff.) zu den gesellschaftspolitischen Fragen und den epochaltypischen Schlüsselproblemen:
Wie weit ist die Bildungsveranstaltung für alle zugänglich, wenn nicht, warum nicht?
Können aus den Inhalten allgemeingültige Schlussfolgerungen gezogen werden?
Werden die verschiedensten Interessen und Fähigkeiten angesprochen?
Werden epochaltypische Schlüsselprobleme explizit oder implizit angesprochen?
Solche Fragen können wahrscheinlich an diesem Punkt noch nicht abschliessend beantwortet werden, doch ist es wichtig, dass sie in ihrer ganzen Breite mit allen Konsequenzen durchdacht werden, da sie ihrerseits auf die Auswahl der Themen beziehungsweise auf die didaktische Reduktion Einfluss nehmen.
Anzustrebende Kompetenzen und dazu nötige, mögliche Ressourcen
Welches sind mögliche Kompetenzen, die es zur Ausübung einer Handlung, zur Lösung eines Problems oder zum Meistern einer Situation braucht?
Welches sind mögliche Ressourcen, die benötigt werden, um eine bestimmte Kompetenz zu entwickeln?
...
In diesem Kontext soll einmal mehr erwähnt werden, dass es in einer bestimmten Situation, vor einem bestimmten Problem nicht nur eine Möglichkeit gibt, kompetent zu sein. Es sind verschiedene Arten zu handeln, verschiedene Verhaltensweisen möglich, und dementsprechend werden verschiedene Teilnehmende dieselbe Kompetenz mit ganz unterschiedlichen Ressourcen entwickeln.
Für die Unterrichtenden heisst dies, dass sie eine breite Palette von möglichen Ressourcen bereitstellen, die sie vermitteln oder deren Erwerb sie durch eine bestimmte didaktische Anlage ermöglichen wollen.
An diesem Punkt des ganzen Prozesses muss nochmals eine ressourcenspezifische Analyse der Teilnehmenden gemacht werden: Welche der erforderlichen Ressourcen bringen sie eventuell schon mit, welche müssen sie noch erwerben?
Bei der Analyse der zu entwickelnden Kompetenzen und zu erwerbenden Ressourcen hat sich das folgende Analyseblatt bewährt. Besonders wichtig ist dabei, dass immer von einer möglichst konkreten Situation ausgegangen wird, anhand deren die zu erwerbenden Ressourcen analysiert werden können.
Was das konkret heisst sei an einem Beispiel aus der Berufsbildung illustriert:
Thema: Elektrische Installationen in einer Küche Kontext: Elektromonteur 3. Lehrjahr
Typische Situation (Performanz)
Patrick, ein Lehrling im dritten Lehrjahr als Elektromonteur, geht mit dem Chef in ein Einfamilienhaus, in dem die Küche renoviert wird. Der Chef zeigt Patrick anhand eines Plans, wo Kühlschrank, Kochherd, Steckdosen usw. hinkommen. Er gibt ihm den Auftrag, mit der Mauerfräse Kanäle zu schneiden, die Rohre zu verlegen und die Steckdosen und Schalter zu montieren. Patrick fragt einiges nach und macht sich Notizen. Er fährt zurück in die Firma, stellt das notwendige Material zusammen, packt alles ins Firmenauto und fährt zurück auf die Baustelle. Dort bespricht er sich mit den anderen Handwerkern über die Reihenfolge der Arbeiten, schlitzt die Mauer auf, verlegt die Drähte, gipst die Kanäle zu und montiert die Steckdosen und Schalter. Dabei achtet er genau auf die verschiedenen Arten von Steckdosen mit unterschiedlicher Zahl von Phasen. Er räumt das Material weg, wischt und putzt den Arbeitsplatz, bevor er ihn verlässt. Er ist stolz auf die geleistete Arbeit.
Kompetenz
Nach Anweisung und mit der Hilfe eines Plans selbstständig eine Küche verdrahten, dazu Kanäle anlegen, Steckdosen und Schalter montieren und den Arbeitsplatz sauber verlassen.
Wissen
Elektrotechnisches Wissen
Installationswissen
Wissen über Normen
Wissen über Arbeitssicherheit
Fertigkeiten
Plan lesen
Handwerkliches Geschick (schlitzen, bohren, gipsen, montieren …)
Abläufe kennen
Auto fahren
Fähigkeiten
Vorstellungsvermögen
Kraft, Ausdauer
Kommunikation
Gewissenhaftigkeit
Selbstvertrauen
Stolz sein können
Externe Ressourcen
Notwendiges Material
Notwendige Werkzeuge
Auto
Normblatt
Entscheidungsfelder
Inhalte oder zu behandelnde Themen
Bei dieser Analyse ist es von grösster Wichtigkeit, dass wir alle Inhalte des Themas so breit wie möglich auslegen, ohne bereits zu zensurieren und einzuschränken. Dies ist dann die Aufgabe der didaktischen Reduktion.
Ebenso ist es für den späteren Unterricht notwendig, dass die innere Struktur des Themas durchleuchtet wird, es soll also untersucht werden, welche Inhalte zum Verständnis anderer Inhalte notwendig sind. Bei der didaktischen Reduktion kommt im Berner Modell die Morphemanalyse zum Einsatz (S. →ff).
Morphemanalyse
In der Linguistik – und von da stammt der Begriff des Morphems – sind die Morpheme die kleinsten sinntragenden Einheiten einer Sprache. Aus ihnen kann ein ganzes, spezifisches Wortfeld generiert werden. Genau darum geht es nun auch bei der Morphemanalyse in der Didaktik. Es müssen die kleinsten sinntragenden Elemente eines Themas gefunden werden. Die Morpheme sollten im Keim das ganze Thema enthalten, aus ihnen muss das gesamte Thema generiert werden können.
Eine möglichst umfassende Morphemanalyse gestattet es, das Thema auf einige wenige generative Morpheme zu reduzieren. Auf diese Weise können wir die Teilnehmenden in die Lage versetzen, ihren ganz spezifischen Zugang zum Thema zu finden, der ihnen selbst und den von ihnen mitgebrachten Ressourcen entspricht, und es ihnen ermöglicht auf ihre ganz individuelle Weise innerhalb der Morpheme und zwischen ihnen zu driften.
Eine geeignete Methode für die Morphemanalyse ist ein Brainstorming zum Thema: Die gefundenen Assoziationen werden auf Karten geschrieben, die dann nach Themenbereichen sortiert werden.
Methodische Aspekte
Sind die didaktischen Entscheide einmal gefällt, ist also das Was und das Warum klar, ergeben sich in vielen Fällen die methodischen Entscheidungen, das heisst das Wie, fast von selbst. Wenn klar ist, in welche Richtung die Reise gehen soll, ist der Weg (das griechische μέϑοδος bedeutet nichts Anderes als ›Weg‹ oder ›Weg der Untersuchung‹) beziehungsweise sind die Wege zu bestimmen, die eingeschlagen werden können.
Sozialformen
Welches sind die adäquaten Sozialformen für diese Teilnehmenden, für dieses Thema, für dieses Bildungsverständnis dieser konkreten Institution?
Bestehen Unvereinbarkeiten zwischen einer bestimmten Sozialform und diesem Thema?
Bestehen zeitliche oder infrastrukturelle Einschränkungen, welche die Verwendung bestimmter Sozialformen verhindern?
Methoden
Die Methoden beinhalten die Art und Weise, wie ein Thema angegangen wird:
Wie ist es möglich, unter Beachtung aller Bedingungen und Vorentscheidungen zu den zu erreichenden Kompetenzen zu kommen und dabei sein persönliches Bildungsverständnis zu leben?
Wie muss man sich verhalten, um unter Beachtung der persönlichen Voraussetzungen, Interessen und Bedürfnisse der Teilnehmenden die wichtigen Inhalte der Bildungssequenz zu erarbeiten?
Wie genau müssen wir Vorgehen? Was ist zu sagen, aufzuschreiben? Wie muss der Inhalt präsentiert werden? Welche Aufträge sind zu erteilen?
Müssen eventuell gewisse Entscheidungen modifiziert oder Methoden und Rahmenbedingungen oder Strukturen angepasst werden, damit sich der Inhalt sinnvoll bearbeiten lässt?
Medien
Welches Material, welche Medien stehen zur Verfügung? Gilt es eventuell aufgrund fehlender Medien gewisse Methoden anzupassen?
Stimmen die verfügbaren Medien mit den Voraussetzungen der Teilnehmenden, dem Inhalt und den anzustrebenden Kompetenzen überein?
Welche Aspekte, Charakteristiken oder Kontexte eines Themas sind für den Einsatz von bestimmten Medien geeignet bzw. nicht geeignet?
Mit welchen Medien können welche spezifischen Lernprozesse gefördert werden?
Worauf ist bei gewissen Medien zu achten?
Wichtigste Konsequenzen aus dem Berner Modell
Alle Elemente des Modells sind gegenseitig voneinander abhängig. Jedes Element muss in Bezug auf seinen Einfluss auf die anderen Elemente beachtet werden. Dies wird im Berner Modell durch die gegenseitig aufeinander verweisenden Pfeile dargestellt.
Das Modell fasst die Planung einer Bildungsveranstaltung als ein System von Entscheidungen auf, die untereinander verbunden sind. Jedes Element enthält auch Aspekte aller anderen Elemente. Eine Entscheidung in einem bestimmten Feld hat also auch Konsequenzen auf alle andern Felder. Wenn eine Entscheidung in einem bestimmten Feld getroffen wird, sind alle andern Felder noch einmal daraufhin zu überprüfen, ob die Entscheidungen immer noch kohärent sind.
Beim Treffen einer Entscheidung müssen die Rahmenbedingungen beachtet oder eventuell geändert werden.
Die verschiedenen Elemente der Bedingungs- und Entscheidungs-felder wurden hier in einer möglichen Reihenfolge dargestellt. Aber gerade weil sie gegenseitig voneinander abhängen, kann mit der Analyse auch an einem beliebigen anderen Punkt begonnen und können dann die anderen Aspekte angepasst werden. Die hier vorgestellte Reihenfolge ist aber in sich logisch; es wird deshalb empfohlen, sich zumindest anfänglich daran zu halten, nicht zuletzt, weil so weniger einzelne Punkte vergessen gehen.
Unterricht wird an seinen Resultaten und Konsequenzen bei den Teilnehmenden gemessen: Ressourcen wurden erworben oder nicht, Kompetenzen wurden entwickelt oder nicht. Diese Resultate beeinflussen die Analyse weiterer ähnlicher oder anderer Unterrichtssequenzen.
7 vgl. Peterssen (1991), S. 82ff
Driftzone
Der Bildungsbegriff als Grundlage der Didaktik
Kompetenz
Zur Kritik des Konstruktivismus in der Erwachsenenbildung
Die Pädagogik und Didaktik von Comenius
Wagenscheins Lehrkunst
Klafkis bildungstheoretische Didaktik
Lernen als Handlungsproblematik
Zone der nächsten Entwicklung
Holografisches Lernen
Edmund Kösels subjektive Didaktik
Chreoden
Morpheme
Generative Bilder
Der Habitusbegriff von Bourdieu
Die Teilnehmendenanalyse
Der Bildungsbegriff als Grundlage der Didaktik
Bildung zielt seit ihren Anfängen darauf hin, allen Menschen einen bewussten Zugang zur Kultur in all ihren verschiedenen Ausdrucksformen zu ermöglichen, damit sie ein umfassendes Verständnis von der Welt und der eigenen Stellung in ihr entwickeln können. Dadurch werden sie zu selbstbestimmtem Handeln und zu gesellschaftlicher Mitbestimmung befähigt. Bildung ist in diesem Sinne stets Allgemeinbildung, der gesellschaftliche Bedeutung zukommt. Deshalb geht sie in ihrem Anspruch über Wissen und Lernen hinaus und sollte jedem Menschen ein auf seinem Niveau umfassendes und für sein Leben bedeutsames Weltverständnis ermöglichen.
Die Verwendung der Wörter ›allen‹, ›all‹ und ›umfassend‹ soll an dieser Stelle auf Comenius (S. →) und den Begriff der Allgemeinbildung bei Klafki (S. →) verweisen. Heute wie damals ginge es darum die Menschen durch Bildung der Menschennatur näherzubringen, sie als menschliche zu verwirklichen.
Im ausgehenden 20. Jahrhundert wurde diese Idee der Bildung vor allem von Paulo Freire (S. →ff) vertreten. Bildung besteht für Freire darin, in der enthumanisierten Welt die Menschlichkeit für alle wieder herzustellen. Grosse Bedeutung kommt dabei dem Prozess der ›conscientização‹ (portugiesisch für ›Bewusstwerdung‹) zu, in dem die Menschen lernen, soziale, politische und wirtschaftliche Widersprüche zu erkennen und ihr Handeln auf die Veränderung der unterdrückerischen Verhältnisse auszurichten. Diese Veränderung muss aber nach Freire von den Benachteiligten ausgehen – er nennt sie ›Unterdrückte‹. Nur ihnen kann es gelingen, sich selbst ebenso wie ihre Unterdrücker zu befreien. Nun sind aber diese Unterdrückten nicht in der Lage, die Befreiung durch Bildung zu bewerkstelligen, weil sie durch das entmachtet und ohnmächtig gemacht wurden, was ihnen als Bildung angeboten wird, aber nichts ist als seichte Halbbildung.
Der Zürcher Soziologe Martin Graf nennt diesen Prozess, der bereits in den ersten Schuljahren weitgehend abgeschlossen ist, den ›Enteignungsprozess des Bildungssystems‹8 Er hat inzwischen in einer neueren Arbeit diesen Ansatz wieder aufgenommen und zusammenfassend dargestellt 9 . In der erstgenannten Arbeit zeigt er anhand von fünf Bereichen auf, wie die in die Schule Eintretenden enteignet werden:
Enteignungen an der eigenen Geschichte,
Enteignungen an den Interessen,
Enteignungen an der Sprache,
Enteignungen an Subjekt und Sache,
Enteignungen am Körper.
Dabei sind diese unterschiedlichen Enteignungen auf vielfältige Weise miteinander verschränkt. So gehen die Enteignungen an der eigenen Geschichte einher mit der Enteignung der aus dieser Geschichte stammenden Interessen und der Sprache, in der sie ausgedrückt werden. Die zunehmend leere Begrifflichkeit der Sprache trennt Begriff und Sache ebenso wie Subjekt und Sache. Sie trennt aber auch Erkenntnis von Erfahrung beziehungsweise Geist vom Körper.
Resultat dieser gezielten Enteignungsprozesse ist eine äusserst ungleiche Verteilung von Status und in unserem Zusammenhang insbesondere auch eine extrem ungleiche Verteilung der Weiterbildungsbereitschaft. Woher sollten denn die ihrer Interessen enteigneten Individuen die Motivation für Weiterbildung nehmen? Untersuchungen bestätigen10, was Erwachsenenbildungsfachleute seit Langem wissen: Weiterbildungsangebote werden vorwiegend von denjenigen Bevölkerungsschichten genutzt, die bereits einen hohen Bildungsstand aufweisen. Bildungsferne Schichten – oder besser gesagt, der Bildung entfremdete Schichten – sind kaum mehr in das Bildungssystem zu integrieren. Eine Erwachsenenbildung, die daran etwas ändern möchte, müsste durch ein echt bildendes Erwachsenenbildungssystem »sicherstellen, dass Weiterbildung jene Qualität aufweist, die sie gesamtgesellschaftlich als funktional ausweist«11. Funktional meint hier aber nicht kurzsichtige Effizienz und Gewinnorientierung, sondern eine nachhaltige Wirkung im Hinblick auf mehr Lebensqualität für alle. In einer lebens- und menschenfeindlichen Gesellschaft eine solche Erwachsenenbildung zu verwirklichen, ist schwierig. Sie kann aber letztlich nur über die öffentliche Qualitätsförderung und -sicherung bei den Kursleitenden geschehen.
Wie müsste nun aber eine solche Ausbildung für die Kursleitenden aussehen, damit diese in die Lage gebracht werden, bei den Kursteilnehmenden Wiederzueignungsprozesse in den verschiedenen Bereichen in Gang zu setzen? An dieser Stelle kann und soll dies nicht im Detail ausgepinselt, sondern es sollen Hinweise gegeben werden, in welche Richtung sich eine solche Ausbildung bewegen könnte.
a) Zueignung der eigenen Geschichte
Hier ist an erster Stelle der biografische Ansatz anzuführen. Mit der Erarbeitung der eigenen Bildungsbiografie können die entscheidenden Bruchstellen aufgezeigt werden, durch die das Lern- (und Lehr-)Verhalten bis in die Gegenwart geprägt wird. Gerade im Hinblick auf die anderen Enteignungsprozesse scheint es mir aber sinnvoll, dabei nicht ausschliesslich die klassische Methode der ›Histoire de vie‹ anzuwenden12 , sondern auch emotionale und körperliche Zugänge dazu mit einzubeziehen13.
b) Zueignung der Interessen
Ein Schlüsselbegriff zu diesem Aspekt ist derjenige der Orientierung an den Teilnehmenden. Diese darf aber nicht - quasi marktwirtschaftlich - auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden beschränkt bleiben, sie muss vielmehr bestrebt sein, deren Potenziale zu entwickeln und deren Erfahrungswissen als gleichberechtigt in den Bildungsprozess einzubeziehen. Ansätze zu einer solchen neuen Lernkultur finden wir bei Rogers und etwas aktueller bei Krapf. Ein Mangel der sich auf Rogers beziehenden Ansätze ist die Ausblendung des gesellschaftlichen Bezugs, der letztlich Bildung erst ausmacht. Aus diesem Grunde muss bei der Aneignung der Interessen auch auf Paolo Freire Bezug genommen werden. Sein Ansatz gewährleistet zudem gleichzeitig die Zueignung der Sprache.
Das Berner Modell versucht diesem Aspekt in allen Planungsschritten gerecht zu werden, sei dies in der Teilnehmendenanalyse (S. →f und S.107ff), der Analyse des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhangs (S. →) oder beim Aufspüren von geeigneten Morphemen (S. →ff).
c) Zueignung der Sprache
Eines der wichtigsten Prinzipien von Freires Ansatz ist es, dass Bildung im Dialog zu geschehen hat. Dialog bedeutet, dass Lehrende und Lernende zu Wort kommen und partnerschaftlich ihre Realität darstellen können. »Menschlich existieren heisst die Welt benennen, sie verändern«14. Dadurch kann die ›Kultur des Schweigens‹, die unter den Benachteiligten herrscht, aufgebrochen und durch Wertschätzung der eigenen Kultur ersetzt werden. Erst in dieser Wertschätzung kann die eigene, bisher unterdrückte Kultur kritisch hinterfragt und ihr Gehalt mit der herrschenden Kultur in fruchtbarer Weise verglichen werden. Unter Kultur sind hier natürlich nicht nur ›fremde‹ Kulturen gemeint, sondern auch Subkulturen in unserer eigenen Kultur.
d) Zueignung von Subjekt und Sache
In diesem Bereich müssten Fachdidaktiken15 entwickelt werden, die von den Alltagsbezügen, den lernbiografischen und menschheitsgeschichtlichen Zugängen zum Stoff ausgehen. Dazu könnte bei den didaktischen Modellen von Wagenschein (S. →ff) oder Rumpf angesetzt werden, die versuchen, Lerngegenstände in ihrer individuellen und gesellschaftlichen Entstehung und durch handelnden Nachvollzug derselben zu verstehen.
e) Zueignung des Körpers
Der Körper kann auf zwei Arten wieder in sein Recht eingesetzt werden. Einerseits, indem beim Lernen konsequent von der menschlichen Tätigkeit ausgegangen wird und dabei das Handeln im Lernprozess als wichtige und eigenständige Komponente und nicht nur als notwendig zu durchlaufendes und hierarchisch niedriges didaktisches Element betrachtet wird (zur Tätigkeitstheorie von Leontjew, Galperin u.a. vgl. die kurze Einführung bei Iris Mann16. Andererseits muss der Körper auch im Sinne der TZI in den Lernprozess einbezogen werden, und es muss auf seine Signale geachtet werden17.
Durch eine Ausbildung der Ausbildenden, die sich auf diese Prinzipien stützt, kann einerseits erreicht werden, dass die Öffnung des Bildungs- und Weiterbildungssystems auch von denen genutzt werden kann, die ihm aus den geschilderten Gründen fernstehen. Andererseits kann dadurch der postmodernen Beliebigkeit entgegengewirkt werden, indem auch angesichts des Zerfalls von Bildung an dieser festgehalten und ein kritisches Bildungsverständnis entwickelt wird.
Drei Dimensionen von Bildung
Um einem Bildungsverständnis, das diese Ansprüche erfüllen kann, etwas näher zu kommen, möchte ich versuchen, ein dialektisches Modell der Bildung zu entwickeln.
Nach diesem meinem Modell bewegt sich Bildung in drei Spannungsfeldern: zwischen ›Anpassung und Widerstand‹, zwischen ›Eigenem und Fremdem‹ und zwischen ›Ratio und Mimesis‹.
Anpassung und Widerstand
Bildung muss sich immer in einer Balance von Anpassung und Widerstand bewegen18. Hauptmerkmal dessen, was sich heute noch Bildungslandschaft nennt, ist deren stetes Verkommen zu einseitiger Qualifizierung, das heisst die ausschliessliche Zurüstung der Individuen für die ständig sich wandelnde Technologie der Arbeitswelt. Damit wird die gesellschaftlich und geschichtlich notwendige und nützliche Anpassung der Menschen an die naturwissenschaftlichen und technischen Errungenschaften der Moderne in ihr Gegenteil verkehrt. Der Standpunkt, von dem aus Bildung betrieben wird, wird so radikal gewechselt: Nicht mehr die immer bessere Beherrschung der Maschinen im Dienste der menschlichen Zueignung der Natur ist der Ansatzpunkt, sondern die immer effizientere Verfügbarkeit der Menschen für die Maschinen und die hochtechnologisierten Produktionsprozesse.
Erziehung zum Widerstand – wie sie unter anderem von Adorno gefordert wird – darf nicht einseitig aufgefasst werden. Sonst wird sie ihrerseits zur Halbbildung und birgt zudem die Gefahr in sich, dass die Individuen in ihren widerständigen Handlungen ›verheizt‹ werden. Bildung müsste sie zu Handlungen befähigen, in denen Anpassung und Widerstand sich in einem dialektischen Gleichgewicht befinden.
Eigenes und Fremdes
Bildung hat sich mit dem Fremden auseinanderzusetzen. Bliebe sie nur beim Eigenen, wäre keine Entwicklung möglich. Reine Persönlichkeitsbildung, ausschliessliche Beschäftigung mit sich selbst, seinen Gefühlen ist darum nicht nur falsch, sondern ein Ding der Unmöglichkeit. Die ›Wendung auf das Subjekt‹ darf nicht postuliert werden als Gegensatz zur ›Sachorientierung‹, denn zur Bildung braucht es einen Lerngegenstand, ein Fremdes, an dem sich das Selbst abzuarbeiten hat.
So zeichneten sich gerade sogenannt statische Gesellschaften, wie wir sie heute – im Zuge der Globalisierung – nirgends mehr finden, dadurch aus, dass das Fremde nicht etwa ausgegrenzt, sondern ignoriert wurde. Biologen, die eine ihnen bisher unbekannte Flora Afrikas untersuchten, stiessen bei der einheimischen Bevölkerung auf völliges Unverständnis, als sie nach den Namen gewisser Pflanzen fragten. Diese hatten keinen Namen, da sie weder Nutz- noch Heilpflanzen waren. Auch uns sind zum Beispiel die Bewohner irgendeiner fernen Galaxis nicht im soziologischen Sinn des Wortes fremd, sondern sie existieren für uns einfach nicht und haben darum auch keinen Namen. Gemäss Simmels berühmtem Exkurs über den Fremden ist dieser eben nicht einer, »der heute kommt und morgen geht, sondern [...] der, der heute kommt und morgen bleibt«19. Etwas kann uns nur fremd sein, wenn es wirklich Teil unseres Erkenntniszusammenhangs ist, ja, noch mehr: Das Fremde ist uns oft nur zu vertraut und kann uns deswegen Angst machen, weil es das verdrängte Eigene ist. Das Fremde wirklich vertraut werden lassen hiesse, seine eigenen Triebe und Bedürfnisse zuzulassen oder zumindest ihrer bewusst zu werden. Nur so kann das Fremde akzeptiert und ins Eigene integriert werden. Bildung bestünde darin, dass das Fremde für uns zum Anderen und zum Anderen für uns würde. Damit wird es auch konkret. Denn das Fremde ist ursprünglich immer allgemein. Totalitäres Denken zeichnet sich dadurch aus, dass es das zu erkennende Fremde mit dem Allgemeinen gleichsetzt – mit seinem Begriff oder gar mit seiner Bezeichnung – und ihm dadurch nicht nahe kommt. Damit wären wir bei der dritten Dimension von Bildung, die durch das Gegensatzpaar Ratio und Mimesis charakterisiert wird.
Ratio und Mimesis
Nicht durch identifizierendes und damit totalitäres Denken werden Bildungsprozesse initiiert, sondern es geht darum, möglichst nahe am Besonderen zu bleiben, ohne das Ganze aus dem Blick zu verlieren.
Bewusstlos gleichsam müsste Bewusstsein sich versenken in die Phänomene, zu denen es Stellung bezieht. [...] Entäusserte wirklich der Gedanke sich an die Sache, gälte er dieser, nicht ihrer Kategorie, so begänne das Objekt unter dem verweilenden Blick des Gedankens selber zu reden.20.
Natürlich ist es ein Ziel wissenschaftlicher Erkenntnis und damit auch der Bildung, Sachverhalte auf ihren Begriff zu bringen. Doch muss dies ein endloser dialektischer Prozess zwischen Ratio und Mimesis sein. Auszugehen ist dabei von einem Alltagsverständnis des zu erkennenden Sachverhalts und nicht von inhaltslosen und wesentliche Teile des Besonderen abschneidenden Definitionen aus noch so klugen Nachschlagewerken. Mit unserem Alltagsverständnis – unserem Interesse im ursprünglichen Sinn des Wortes – versuchen wir uns das Objekt zu erschliessen und so zu immer schärferen Begriffen zu kommen. Ein solches Herangehen meint die dritte Dimension von Bildung, die sich zwischen Ratio und Mimesis zu bewegen hat.
In Wörterbüchern wird Mimesis (μίμησις) als ›Nachahmung‹, ›Ähnlichkeit‹ oder ›Einpassung‹ in die Umgebung‹ umschrieben. Mimetisches Verhalten, wie es hier verstanden werden soll, ist aber mehr. Es versucht sich an den zu erkennenden Sachverhalt anzuschmiegen und trotzdem Distanz zu ihm zu halten, um seine Aura nicht zu zerstören. Es will sich um der Sache selbst willen ihr hingeben, ohne sich aufzugeben. Oder anders ausgedrückt: Es gilt, die aus der Widerspiegelung in der konkreten Praxis gewonnenen Begriffe wieder auf die Objekte anzuwenden, ohne sie ihnen gleichzumachen.
Weil der Begriff der Mimesis nicht sehr bekannt und schwer zu erklären ist, will ich hier noch zwei Beispiele dazu geben: Schiller beschreibt in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung einen Schwebezustand zwischen der sinnlichen Wahrnehmung und der begrifflichen Bestimmung, der etwa dem entspricht, was ich unter Mimesis verstehe. Dies ist aber ein Zustand, den viele als Bedrohung empfinden. Man weiss nicht, wohin es geht, was dabei herauskommt.
Zwar lässt die Schnelligkeit, mit welcher gewisse Charaktere von Empfindungen zu Gedanken und zu Entschliessungen übergehen, die ästhetische Stimmung, welche sie in dieser Zeit notwendig durchlaufen müssen, kaum oder gar nicht bemerkbar werden. Solche Gemüter können den Zustand der Bestimmungslosigkeit nicht lang ertragen und dringen ungeduldig auf ein Resultat, welches sie in dem Zustand ästhetischer Unbegrenztheit nicht finden 21
Interessant ist dabei auch der Zusammenhang, der deutlich wird, wenn der Etymologie des Wortes Ästhetik nachgegangen wird: αἴδϑησις (Aisthesis) bedeutet ›Wahrnehmung‹. Die ›ästhetische Stimmung‹ drückt hier ungerichtetes Wahrnehmen und Wirkenlassen aus. Es ist aber genau dieser Zustand der Schwebe, der Unbestimmtheit, den es in der Bildung auszuhalten gilt, sowohl von den Lernenden wie von den Unterrichtenden.
Eine der schönsten Veranschaulichungen dessen, was Mimesis meint, gibt Walter Benjamin in seinen Kindheitserinnerungen, wo er schildert, wie er bei der Jagd nach einem Schmetterling mit dessen Bewegungen eins wurde:
Je mehr ich selbst in allen Fibern mich dem Tier anschmiegte, je falterhafter ich im Innern wurde, desto mehr nahm dieser Schmetterling in Tun und Lassen die Farbe menschlicher Entschliessung an, und endlich war es, als ob sein Fang der Preis sei, um den einzig ich meines Menschendaseins wieder habhaft werden könne.22
So verhält es sich mit der Ratio und ihrer Jagd nach Begriffen. »Die scharfe begriffliche Fassung will Distanz herstellen. Aber gleichzeitig wird die Sache durch den Begriff getötet.«23 Das meint auch Wagenschein, wenn er fordert, die Phänomene zu retten (S. →f.).
In dieser Dimension von Bildung wird auch der Zusammenhang zwischen Erkenntnis und Liebe deutlich, wie er im Hebräischen durch das Wort (jada’) ausgedrückt wird, das im Alten Testament sowohl für Erkenntnis als auch für den Koitus verwendet wird: »Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger.«24. Echte Erkenntnis ist nur möglich, wo auch Liebe ist. Dies hat die moderne Naturwissenschaft zunehmend vergessen, indem es ihr um die Beherrschung und Kontrolle der Natur ging und nicht darum, sich ihr und ihren Gesetzen in Liebe und Wertschätzung anzunähern. Das Wissen um die Natur wurde im Haben-Modus angeeignet, die Produkte der Wissenschaft als Waren vermarktet.
Im Züge der allgemeinen Verwertbarkeit von Wissen wurde auch die Bildung diesem Gesetz unterworfen, und es ist ein weiteres Postulat der kritischen Theorie, genau diese Fehlentwicklung aufzuzeigen.
Bildung ist keine Ware
Bildung ist heute im Verfall begriffen, und es ist die Absicht der herrschenden politökonomischen (Un-)Kultur des Neoliberalismus, ihr noch den endgültigen Todesstoss zu versetzen. Dies geschieht aber nicht offen, sondern dadurch, dass man etwas Anderes, das nichts, aber auch gar nichts mehr mit dem ursprünglichen humanistischen Bildungsgedanken zu tun hat, kühn noch immer als Bildung bezeichnet. Grundaxiom der laufenden bildungspolitischen Debatte ist es, dass Bildung eine Ware sei wie jede andere auch.
Gemäss der klassischen Nationalökonomie und ihren Vorläufern – auf die sich die neoliberalen Bildungsökonomen berufen – besitzt jede Ware einen Gebrauchswert und einen Tauschwert25. Brot zum Beispiel besitzt für dessen Käufer Gebrauchswert, und darum ist er auch bereit, es für Geld einzutauschen. Für den Bäcker aber haben nur ein oder zwei Brote pro Tag Gebrauchswert, alle anderen Brote besitzen für ihn ausschliesslich Tauschwert, den er durch den Verkauf der Brote realisiert.
Der Tauschwert einer Ware bestimmt sich durch die in ihre Produktion investierte abstrakte Arbeit. Dies gilt auch für den Tauschwert der Ware Arbeitskraft. Da die neoliberalen Bildungsökonomen davon ausgehen, dass durch (Ausbildung der Tauschwert der Arbeitskraft erhöht wird, zeigt sich bei der Bestimmung dieses Werts, dass Bildung eher unter die Kategorie der Arbeit subsumiert werden müsste als unter diejenige der Ware, obwohl ein kleiner Teil von ›Bildung‹ auch in die ›Reproduktion‹ der Arbeitskraft eingeht, wie andere Gebrauchsgüter, Essen, Kleidung usw. Bereits aus dieser Argumentation wird deutlich, dass Bildung nicht einfach eine Ware beziehungsweise ein Konsumgut ist, sondern dass sie etwas mit Arbeit zu tun hat, dass Bildung zu erarbeiten ist. Damit wäre das Grundaxiom eigentlich bereits widerlegt, doch soll es – immer noch innerhalb der ökonomischen Kategorien – auch noch durch andere Überlegungen falsifiziert werden.
Wäre Bildung eine Ware, so könnte sie wirklich auf dem Bildungsmarkt ausgetauscht werden. Der Tauschvorgang auf dem Markt muss aber gewissen Kriterien genügen, damit er überhaupt vollzogen werden kann. Für einen geregelten Tauschvorgang muss erstens vorausgesetzt werden können, dass das Eigentum an einer Ware klar garantiert und feststellbar ist, damit es im Tauschakt von einer Person auf die andere übertragen werden kann.
Zweitens ist der Gebrauch der Ware während des Tauschvorgangs eingestellt. Darauf weisen die Plakate in den Supermärkten hin, auf denen steht: »Ware bitte erst nach Bezahlung an der Kasse konsumieren.«
Beide Voraussetzungen gelten nun aber für ›Bildungsgüter‹ grundsätzlich nicht: Einerseits ist das Eigentum der Bildung nicht gewährleistet – wenn Bildung ausgetauscht wird, verlieren die Bildenden sie nicht, sondern Bildung wird vermehrt. Andererseits ist es ja gerade ein Kennzeichen von Bildung, dass sie bereits während des Austauschvorgangs gebraucht, zum Beispiel kreativ verändert wird.
Was den Erwerb von Fertigkeiten angeht, so ist (zum Beispiel in schlechten Schulen) zumindest die zweite Voraussetzung oft erfüllt, werden doch dabei Techniken ohne momentanen Gebrauchswert als reine Tauschwerte in den Schülern deponiert, um sie zu einem gegebenen Zeitpunkt wieder abzurufen. Paulo Freire nennt diese Art der Wissensvermittlung die ›Bankier-Methode‹:
So wird Erziehung zu einem Akt der Spareinlage), wobei die Schüler das ›Anlage-Objekt‹ sind, der Lehrer aber der ›Anleger‹. Statt zu kommunizieren, gibt der Lehrer Kommuniqués heraus, macht Einlagen, die die Schüler geduldig entgegennehmen, auswendig lernen und wiederholen. [...] Sie haben zwar die Möglichkeit, Sammler oder Katalogisierer der Dinge zu werden, die sie aufstapeln. 26
Mit dermassen aufgestapelten Bildungsgütern und den entsprechenden Ausweisen können sie ihren Tauschwert auf dem Arbeitsmarkt erhöhen, gebildet sind sie deswegen aber noch lange nicht - im Gegenteil. Sie bleiben im besseren Falle ungebildet, im schlechteren werden sie halbgebildet. Der österreichische Pädagoge Konrad P. Liessmann geht in seinem 2006 veröffentlichten Buch Theorie der Unbildung noch einen Schritt weiter und spricht nicht mehr von Halbbildung, sondern konstatiert ein umfassendes Umsichgreifen der Unbildung.
Die Halbbildung nahm ihren Ursprung in der Dialektik der Aufklärung, wie sie von Horkheimer und Adorno analysiert wurde, als nämlich die Vernunft, die angetreten war, die Natur in den Dienst der Menschen zu stellen, diese selbst in ihren Dienst nahm und den Zielen ihrer instrumentalisierten Form unterwarf. Mit dem (inzwischen weltweiten) Sieg der Logik des Geldes wurden alle Bereiche des menschlichen Lebens – und das meint eben auch die Bildung – »der Allgegenwart des entfremdeten Geistes«27 unterworfen. Der philosophische Reduktionismus bemächtigte sich auch der Bildung, und in seinem methodischen Rigorismus zerstückelte er auch sie in Natur-, Geistes-, Sozial- und andere Wissenschaften, in Fachgebiete, in Vor- und Hauptstudien, in Module – die auf Französisch ehrlicherweise ›unités capitalisables‹ heissen, und auch bei uns werden sie zunehmend als ›crédits‹ kolportiert. Sie werden wirklich zu Waren, zu ›Bildungsgütern‹, die man sich aneignen, die man anhäufen, anwenden, anerkennen lassen und mit Gewinn anlegen kann. Die Bologna-Reform ist nur die letzte Konsequenz des Zerfalls von Bildung in einen reinen Tauschwert. Der Inhalt (das heisst der Gebrauchswert) ist völlig beliebig geworden, und so besuchen heute viele Studierende an unseren Universitäten die Seminare und Vorlesungen nicht mehr, weil der Inhalt sie interessiert, sondern weil es gilt, ECTS-Punkte zu sammeln. Das halb verstandene und zu Renommierwissen verkommene Auswendiggelernte wird zum modischen Kulturgut, zur Ware, die ihren konkreten Gebrauchswert für die Entwicklung der Menschen verliert und zum abstrakten Tauschwert für die Qualifizierung der Ware Arbeitskraft verkommt.
Auch Personen, die sich ernsthaft um Bildung bemühen, fehlt in der alles beherrschenden Massenkultur die Musse, die Bildung einfordert, da auch von ihnen verlangt wird, über die müssig vergeudete Zeit Rechenschaft abzulegen. In diesem Sinne gehört es zur Forderung nach Bildung, für alle Menschen Lebensbedingungen zu erkämpfen, die Musse und damit Bildung erst ermöglichen. Es wirkt heute wie ein Hohn, dass das Wort ›Schule‹ vom griechischen σχολή (skolä) stammt, was nichts Anderes als eben ›Musse‹ bedeutet. Es ist wohl so, dass zwar Bildung ein mehr an Lebensqualität verspricht, dass aber erst ein gewisses Minimum an Lebensqualität es erlaubt, sich Bildung zu erwerben.
Bildung als Menschwerdung
In diesem Sinne ist für mich Bildung auf mehrfache Weise
Menschwerdung:
Erstens gesellschaftlich, insofern Bildung erst dann ihre wahre Qualität gewinnt, wenn sie die gesamte Gattung, d.h. die ganze Menschheit, umfasst; individuell in dem Sinne, dass kein Mensch aufgegeben wird, dass allen Menschen Bildung ermöglicht wird.
Zweitens dadurch, dass durch Bildung der Auftrag weitergegeben wird, unsere Welt wieder menschlich zu gestalten, auf ein menschliches Mass zurückzuführen.
Drittens in dem Sinn, dass man sich selbst bewusst wird, was es bedeutet, Mensch zu sein, und Mensch zu werden als Ziel auch anstrebt.
Und viertens dadurch, dass man sich des Prozesses des Werdens der Menschheit – aber auch des eigenen Werdens und der Interdependenz dieser Prozesse – bewusst wird.
Darum sind heute angesichts des offensichtlichen Verfalls von Bildung paradoxerweise jene fortschrittlich, die konservativ an dem festhalten, was Bildung einmal wollte, nämlich an der Emanzipation der Menschen – und der Menschheit – vom Unbill der Naturgewalten und von der Unterdrükkung durch andere Menschen. Reaktionär ist, wer sich dem modernen Neoliberalismus beugt und seine Bildungskonzepte fortschrittsgläubig dem Qualifizierungsdruck und dem Effizienzdenken des Arbeitsmarktes anpasst.
Heydorn, H.J. (1980)b. Ungleichheit für alle. Zur Neufassung des Bildungsbegriffs. Frankfurt a.M.: Syndikat.
Graf, M./Graf, E.O. (2008): Schulreform als Wiederholungszwang. Zürich: Seismo.
Adorno, Theodor W. [1959]: Theorie der Halbbildung. In: Gesammelte Schriften, Bd. 8 (1972). Frankfurt a.M.: Suhrkamp
8 vgl. Graf [1988].
9 vgl. Graf/Graf (2008)
10 vgl. Bundesamt für Bildung und Wissenschaft (1989)
11 Forneck (1995), S. 10
12 vgl. z.B. Josso (1991)
13 vgl. Gudjons et al. (1992)
14 Freire [1968]b, S. 71
15 Das widerspricht scheinbar meiner verschiedentlich geäusserten Ansicht, dass es gar keine Fachdidaktik brauche, da ein grundsätzliches didaktisches Konzept auf jedes Fachgebiet angewendet werden kann. Grundsätzlich halte ich daran fest, doch hat die Erfahrung gezeigt, dass es für viele Fachlehrer sehr schwierig zu sein scheint, allgemein gültige didaktische Prinzipien auf ihr Fachgebiet zu übertragen. Darum will ich nicht puristisch sein und einem guten Fachunterricht zuliebe auch die Entwicklung von Fachdidaktiken befürworten, wenn sie denn nicht zu Rezeptbüchern entarten.
16 Mann (1990)
17 vgl. Cohn (1975)
18 vgl. Adorno [1959], S. 95
19 Simmel (1908)a, S. 509
20 Adorno [1966]a, S. 38)
21 Schiller [1795ff.], S. 636 Fn.
22 Benjamin [1933]a, S. 244
23 Furrer (1992)a, S. 18
24 Genesis 4,1
25 vgl. dazu Smith [1776], S. 27 und Aristoteles [um 350 v.u.Z.]a, S. 23f
26 Freire [1968]b, S. 57
27 Adorno [1959], S. 93
Kompetenz
In immer mehr Bildungsplänen, Curricula und Modulbeschreibungen werden nicht mehr Lernziele, Lehrziele oder Unterrichtsziele beschrieben und definiert, sondern es werden Kompetenzen festgelegt, die eine Person entwickelt haben sollte, wenn sie eine Bildungssequenz absolviert hat (bzw. Performanzen, die sie zeigen sollte). Dabei werden aber die Begriffe nicht immer ganz sauber unterschieden. Im Berner Modell halten wir uns an die Begrifflichkeit, wie sie vom französischen Arbeitspsychologen Guy Le Boterf verwendet wird.
Die Schweizerische Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Berufs- und Studienberatung hat an ihrer Herbsttagung 2005 verbindlich folgende Definition beschlossen:
Kompetenz wird hier verstanden als Möglichkeit, in (zu beschreibenden) Anwendungssituationen erfolgreich zu handeln. Kompetenz muss somit als Handlung(smöglichkeit) in Kontexten beschrieben werden. In der Ausbildung und durch Erfahrung erwerben wir die hierfür notwendigen Ressourcen, also Wissen, Fähigkeiten, Haltungen etc.28
Für zukünftige Diskussionen scheint es mir sehr wichtig, die Kompetenz als Möglichkeit einer Handlung zu definieren. So verfährt auch Le Boterf, wenn er die Kompetenz als potenzielle Performanz definiert. Beobachten (bzw. überprüfen) lässt sich damit nicht die Kompetenz, sondern nur die Performanz.
Ressourcen
Im Französischen hatte das Wort ›ressources‹ ursprünglich die Bedeutung von materiellen Mitteln oder Hilfsmitteln, auf die zurückgegriffen werden kann (›moyens de recours‹). Es stammt vom lateinischen ›resurgere‹ (›wieder aufrichten‹, ›wieder auftauchen‹) bzw. von ›surgere‹ (›sich zeigen‹, ‹zum Vorschein kommen‹). Ressource ist damit – entgegen den ersten Assoziationen – nur indirekt mit ›source‹ (›Quelle‹) verwandt, ein Wort, das seinerseits aus einem alten Partizip von ›sortir‹ (›herauslaufen‹) stammt.
Ressourcen sind also die Grundelemente, quasi die Ausstattung, auf die zurückgegriffen werden kann, um Kompetenzen zu entwickeln. Es werden die persönlichen Ressourcen (Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten) von den Ressourcen des Umfelds unterschieden. Ressourcen können gelernt beziehungsweise erworben oder aufgebaut werden.
Wissen
Als ›Wissen‹ werden aus Erfahrung, Vermittlung von Lehrpersonen oder Mitlernenden oder aus Medien erworbene Kenntnisse bezeichnet, die in der konkreten Situation abgerufen werden können.
Fertigkeiten
Fertigkeiten sind selbst oder durch Nachahmung erworbene und dann geübte Verfahrensweisen und Techniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen, richtige Handhabung eines Werkzeugs, Bedienung eines Computers oder Umgang mit Nachschlagewerken und anderer Literatur.
Fähigkeiten
Fähigkeiten sind verinnerlichte Werte und Haltungen wie Empathie, Wertschätzung, Beharrlichkeit oder Solidarität, verinnerlichte Verfahrens- und Verhaltensweisen wie Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität oder Teamfähigkeit und Eigenschaften wie körperliche oder geistige Belastbarkeit.
Ressourcen des Umfelds
Bei den Ressourcen des Umfelds handelt es sich um infrastrukturelle Gegebenheiten wie Werkzeuge, Software und Zugang zu Bibliotheken oder Netze von Beziehungen zu spezialisierten Fachleuten oder Beratungspersonen, auf die zurückgegriffen werden kann.
Eine genaue Analyse würde zeigen, dass es sich bei den Werkzeugen letztlich um vergegenständlichte und somit tradierbare Kompetenzen und bei den Beziehungsnetzen um personifizierte und damit austauschbare Kompetenzen handelt.
Kompetenz
›Kompetenz‹ stammt vom lateinischen ›competere‹ (›zusammenschlagen‹, ›zusammentreffen‹, ›gemeinsam erstreben›, ›entsprechen‹, ›zurückkommen auf‹, ...).
Der heutige Sinn wird aber durch einen Rückgriff auf das Grundverb ›petere‹ (›streben nach‹, ›zu erreichen suchen‹) deutlich. Unter ›Kompetenz‹ wird allgemeinsprachlich das Vermögen, etwas zu erreichen verstanden. Im Unterricht heisst das nun aber, in einer bestimmten Situation die dazu notwendigen Ressourcen zusammenbringen ›zusammenschlagen‹) zu können.
Der Begriff der ›Kompetenz‹ kann auch mit dem ›operationellen Schema‹ im Sinne Piagets verglichen werden. In einem Vortrag vom 18. November 1999 in Neuenburg – der Geburtsstadt und ersten Wirkungsstätte von Piaget – hat sich Le Boterf explizit auf Piaget berufen und Kompetenz mit dem operationellen Schema gleichgesetzt. In der auf Piaget Bezug nehmenden Literatur wird das operationelle Schema definiert als geistige Struktur oder Verhaltensmuster, das aus der Integration einfacherer, primitiverer Einheiten in ein erweitertes und komplexeres Ganzes entsteht. Dies entspricht auch der Bedeutung, in welcher der Begriff der ›Kompetenz‹ in der vorliegenden Publikation verwendet wird.
Kompetenz ist nun aber nicht etwas, was eine Person ein für alle Mal besitzt. Kompetenz kann nicht wie die Ressourcen erworben werden, sondern sie wird immer wieder neu entwickelt. Sie erweist sich erst in der konkreten Handlung und kann darum nur als Performanz unter Beweis gestellt werden, sie ist letztlich nichts Anderes als potenzielle Performanz.
Ein wichtiger Aspekt scheint mir noch darin zu liegen, dass eine Kompetenz, die ich wieder und wieder in eine Handlung umsetze, mit der Zeit zur Ressource werden kann. In einer komplexeren Situation kann es aber sein, dass ich wieder auf die ursprüngliche Kompetenz zurückgreifen muss. In der Tätigkeitstheorie wird das hirnphysiologisch so erklärt, dass
Handlungen, die funktionale Systeme darstellen, [...] bei auftretenden Schwierigkeiten die Tendenz (haben), sich zu entfalten. Führen sie jedoch mühelos zum Effekt, dann werden sie immer mehr verkürzt, bis sie misslingen; von diesem Zeitpunkt an werden die gehemmten Glieder wieder enthemmt, bis das System erneut einwandfrei funktioniert.29
Ein gutes Beispiel ist das Lesen. Für einen Erstklässler ist das Lesen bestimmt eine Kompetenz. Er muss dazu die verschiedensten Ressourcen wie Formdifferenzierung, Zuordnung von Formen zu Lauten, Komposition von Zeichen und Lauten, semantische Fähigkeiten u.a. mobilisieren und kombinieren. Für uns Erwachsene hingegen ist Lesen eine Ressource, die wir weitgehend automatisiert einsetzen. Bei ganz schwierigen deutschen Texten oder wenn wir zum Beispiel nach Bulgarien in die Ferien fahren und dort auf kyrillische Zeichen stossen, müssen wir das Lesen wieder als Kompetenz entfalten.
Performanz
›Performanz‹ stammt vom altfranzösischen Wort ›parformer‹ (›erledigen‹, ›vollenden‹), das seinerseits aus dem lateinischen ›perficere‹ (›vollenden‹, ›zustande bringen‹, ›vollziehen‹) hervorgegangen ist. Damit ist es auch verwandt mit ›perfekt‹, was der heutigen Bedeutung in der Sprachwissenschaft entspricht, wo Performanz den korrekten (perfekten) Gebrauch von Ausdrücken in einer bestimmten Situation meint. Die Unterscheidung zwischen Kompetenz und Performanz stammt aus der linguistischen Syntaxtheorie von Noam Chomsky30.
Anstelle von Performanz wird auch der Begriff ›Resultat‹ oder ›Leistung‹ verwendet. Wird unter Leistung auch das verstanden, was getan werden musste, um ein bestimmtes Ergebnis zu erhalten, wäre dagegen nichts einzuwenden, doch wird umgangssprachlich bei diesen beiden Begriffen zu sehr das Produkt ins Zentrum gerückt, während die Performanz das Agieren in der Situation betont. Wenn oben gesagt wurde, dass die Kompetenz einem Schema im Piaget’schen Sinn entspricht, könnte hier gesagt werden, die Performanz entspreche einer Tätigkeit im Sinne von Wygotski (S. →ff).
Diese Begrifflichkeit soll nun noch an einem Beispiel erläutert werden, und ich wähle zu diesem Zweck einmal eine ganz andere Situation, um nicht immer auf Beispiele aus Unterricht oder Beruf zurückzugreifen. Was ist denn die Kompetenz eines Eishockeyspielers, und welche Ressourcen braucht er dazu?
Differenzieren wir zunächst einmal die Ressourcen des Spielers:
Wissen
Eishockeytheorie, das heisst Wissen zu Spielaufbau, Taktik, Regeln, ...
Fertigkeiten
Schlittschuhlaufen, Stocktechnik, Schusstechnik, ...
Fähigkeiten
konditionelle Fähigkeiten wie Ausdauer, Schnellkraft, schnelle Erholungsfähigkeit, ...
kognitive Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Entscheidungsfähigkeit, Spielübersicht, Stellungsspiel, ...
koordinative Fähigkeiten wie Gleichgewicht, Reaktionsfähigkeit, Orientierung, Differenzierung der Handlungen je nach Situation, ... emotionale Fähigkeiten wie Begeisterung, Aggressivität, Gelassenheit, Beharrlichkeit, Zuversicht, Frustrationstoleranz, Teamfähigkeit, ...
Ressourcen des Umfelds
gutes Material (Schlittschuhe, Stöcke, Schutzausrüstung, ...), gute Betreuung, die ihm Ernährung und Erholung gewährleistet, Trainer und Coach.
Die Kompetenz besteht nun darin, dass der Spieler in einer bestimmten Situation die zur Bewältigung notwendigen Ressourcen abrufen und einsetzen kann.
Die Performanz zeigt sich im erfolgreichen Auftritt, indem der Spieler Tore schiesst, Pässe zuspielt, gut verteidigt und Gegentore verhindert, harte aber regelkonforme Checks anbringt, ...
All diese Ressourcen werden einzeln immer wieder geübt, und in den Trainings gestaltet der Trainer Übungsanlagen, in welchen der Spieler die Kombination der Ressourcen üben kann.
Genau dasselbe macht nun eine Person, die unterrichtet, indem sie didaktische Anlagen gestaltet, in denen die Lernenden sich die für eine zu entwickelnde Kompetenz notwendigen Ressourcen aneignen und kombinieren können.
Furrer, H. (2000)a. Ressourcen – Kompetenzen – Performanz. Luzern: aeB
Le Boterf, G, (1998). L’ingénierie des compétences. Paris: Les Éditions d’Organisation.
Evéquoz, G. (2004). Les Compétences clés. Rueil-Malmaison: Liaisons.
28 KBSB (2006)
29 Leontjew [1959], S. 373
30 vgl. Furrer (2000)a, S. 43 ff
Zur Kritik des Konstruktivismus in der Erwachsenenbildung
Der Genitiv im Titel dieses Kapitels ist sowohl als ›genitivus subjectivus‹ zu lesen, also im Sinne von Kritik, die durch den Konstruktivismus an der Erwachsenenbildung geleistet wird, als auch als ›genitivus objectivus‹, das heisst im Sinne von Kritik am Konstruktivismus in der Erwachsenenbildung. Mit dieser kurzen Zusammenfassung ist die Auseinandersetzung mit dem Konstruktivismus nicht etwa abgeschlossen, sondern hoffentlich erst richtig lanciert. An dieser Stelle soll geklärt werden, warum ich das Berner Modell nicht als ein konstruktivistisches auffasse.
Die Kritik des Konstruktivismus an den verhaltenspsychologischen und kognitivistischen Richtungen in der Erwachsenenbildung