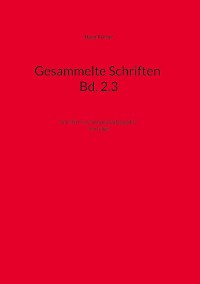9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Band 4.2 der Gesammelten Schriften sind alle Artikel und Vorträge zu Eritrea aus den Jahren 1974 - 2016 enthalten. Weiter enthält er verschiedenste Beiträge und politische Stellungnahmen zu Kambodscha, Indien und anderen asiatischen Ländern, sowie einige wissenschaftliche Arbeiten zur Sprache Tigrinya, den 'Bücherdruck im Orient' und zur 'Italienischen Kolonisation in Libyen'.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt Bd. 4.2
III Schriften zu Eritrea
Vorwort zu den Schriften zu Eritrea 2022
Äthiopien – das Volk kämpft gegen die feudal-faschistische Herrschaft
(
1974)
Der vergessene Krieg in Eritrea
(
1986)
Blinde im umkämpften Eritrea
(
1987)
Eritrea – Versuch einer eigenständigen Entwicklung
(
1987)
Aufbau des Schulwesens in Eritrea
(
1988)
Solomona – ein sozialpädagogisches Lehrstück
(
1988)
Von Adulis nach Asmara – die Geschichte Eritreas
(
1990)
Die vorkoloniale Geschichte
Der italienische Kolonialismus – ein Kolonialismus mit menschlichem Antlitz?
Eritrea als Zankapfel der Siegermächte
Der Preis der Liquidation
Der Anfang vom Ende
Der Machtwechsel in Addis Abeba – eine Chance für Eritrea?
Der strategische Rückzug
Entwicklungsmodell Eritrea – mit ›self-reliance‹ zur Prosperität
(
1990)
Der Ausweg aus der Abhängigkeit
Das Modell der self-reliance in Eritrea
Self-reliance statt Weltbank/IWF
(
1991)
I’m proud to be a teacher
(
2001)
»Ein wunderbares Land mit wunderbaren Menschen«
(
2004)
Tigrinya – eine Einführung
(
2006)
Reisebericht aus Eritrea
(
2015)
Projektskizze: Berufsbildung Eritrea
(
2016)
Stellungnahme zur Antwort des Bundesrates zur Interpellation Müller
(
2016)
Vorläufige Stellungnahme zum Bericht der COI-E
(
2016)
Opening Address at the Massawa Training Centre
(
2017)
Zweifacher Massstab für Eritrea
(
2016)
Dürre und Hunger in Äthiopien
IV Schriften zu Asien
Vietnam ›Venceremos‹
(
1970)
Mutige Kämpfe des indischen Volkes
(
1974)
Die Pläne des Sozialimperialismus in Asien werden scheitern
(
1975)
Indien – Vorposten des Sozialimperialismus
(
1975)
Für ein geeintes Korea
(
1975)
Nord- und Südvietnam: zwei Staaten – eine Nation
(
1976)
Kampuchea und Afghanistan
(
1980)
An die Teilnehmenden der ehemaligen Solidaritätsbewegung
(
1980)
Malaria-Tabletten für das kampucheanische Volk
(
1980)
Die Blockfreienbewegung
(
1981)
Kampuchea und Polen
(
1982)
Rechenunterricht im Demokratischen Kampuchea
(
1982)
Kampuchea-Konferenz in Paris
(
1982)
Interview mit Jan Myrdal
(
1983)
Malaria im Demokratischen Kampuchea
(
1983)
7. Gipfelkonferenz der Blockfreien
(
1983)
Vietnam setzt chemische und biologische Giftstoffe gegen das kampucheanische Volk ein
(
1984)
Gespräch mit Alt-Botschafter W. Sigg
(
1983)
Ausstellung von Kinderzeichnungen aus dem Demokratischen85 Kampuchea
(
1984)
Die aktuelle Lage in Kampuchea
(
1984)
HEKS: Anwalt der vietnamesischen Invasion
(
1985)
Indochina – 10 Jahre danach
(
1985)
Verachtung anderer Kulturen macht auch vor dem Kochbuch nicht halt
(
1986)
Kinderarbeit in Indien
(
1991)
Kinderarbeit bei uns
(
1991)
I have a dream
(
2015)
V Schriften zum übrigen Globalen Süden
Kulturrevolution in Libyen?
(
1973)
20 Jahre kubanische Revolution
(
1973)
Was will die Jugendspende Schweiz
(
1991)
Der Bücherdruck im Orient
(
2006)
Die italienische Kolonisation in Libyen
(
2007)
Report on the mission in Kenya July 15 – 31 2022
(
2022)
Literaturverzeichnis Bde. 4.1 und 4.2
Teil III
Schriften zu Eritrea(1974 – 2017)
Vorwort zu den Schriften zu Eritrea im Jahr 2016
Wenn ich in der ›Geschichte Eritreas‹ lese (vgl. S. 285ff) und gleichzeitig höre, dass Eritrea vor wenigen Tagen, am 12. Juni 2016, erneut von Äthiopien angegriffen wurde und auf einer äthiopischen Website lese, dass es dieses Mal »has to be final once and for all«, kommen mir die Tränen. Waren der ganze 30jährige Befreiungskampf (1961-1991) und die Entbehrungen seit dem letzten Krieg (1998-2000) umsonst gewesen?
Ich erinnere mich, wie ich in 1985 in den befreiten Gebieten unter der ständigen Bedrohung durch äthiopische Bomber die unglaublichen Bemühungen des eritreischen Volkes, ein unabhängiges Eritrea aufzubauen erlebt habe. Wie da unter schwierigen Umständen und unter einfachsten Bedingungen die Wurzeln für eine neue Gesellschaft gelegt wurden. Wie in der Region um Orotta, dem administrativen Zentrum des Widerstands, Spitäler, Schulen, Reparaturwerkstätten, Druckereien, Medikamente- und Schuhfabriken aufgebaut wurden und wie ich, trotz der andauernden Bombardierungen durch die Äthiopier, zuversichtliche Menschen sah, die daran glaubten, dass es ihnen gelingen werde, gegen den Willen der damaligen Supermächte USA und UdSSR, ein freies und selbstbestimmtes Eritrea zu erkämpfen und aufzubauen.
Bei der Lektüre wird mir wieder einmal bewusst, wie Eritrea in seiner ganzen Geschichte von der internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen, ja verraten wurde.
Das begann, als es nach dem Zusammenbruch der italienischen Kolonisation 1941, trotz der Befragung der Bevölkerung, die sich für die Unabhängigkeit aussprach, zu einem britischen Protektorat erklärt wurde. Das ging 1951 weiter als John Foster Dulles, der Aussenminister der USA, vor dem Sicherheitsrat der UNO die berühmt berüchtigten Worte sagte: »From the point of view of justice, the opinion of the Eritrean people must receive consideration. Nevertheless, the strategic interests of the United States in the Red Sea Basin and world peace make it necessary that the country has to be linked with our ally Ethiopia.« Und so geschah es denn auch und Eritrea wurde gegen seinen Willen von der UNO zur »autonomen Einheit Eritrea« innerhalb Äthiopiens. Trotzdem sagte die UNO kein Wort, als Äthiopien Eritrea 1962 widerrechtlich annektierte. Während des Unabhängigkeitskampfes stand das Land wiederum allein zwischen den Fronten des Kalten Krieges. Es kämpfte zuerst gegen das von den USA unterstützte und aufgerüstete äthiopische Kaiserreich von Haile Selassie und nach dessen Sturz gegen die von der Sowjetunion mit Beratern und mit kubanischen Piloten unterstützte Diktatur von Mengistu Haile Mariam. In dieser Zeit wurde es auch nur noch von wenigen Solidaritätsgruppen in Europa unterstützt, die ihrerseits von den prosowjetischen und pseudo-›linken‹ Gruppen angefeindet wurden. Ich erinnere mich an eine Radiodiskussion im Radio Lora, in welcher mich der bekannte Dritt-Welt-Autor Al Imfeld mit dem ›Argument‹ angriff, dass wir mit der Unterstützung Eritreas die Entwicklung ganz Afrikas gefährden würden, denn es sei eine »ein für alle Mal beschlossene Sache«, dass in Afrika die alten kolonialen Grenzen respektiert würden – wenn nicht, gerate der ganze Kontinent ausser Kontrolle. Der letzte Akt in diesem Drama war (und ist) es, dass sich Äthiopien weigert, die vom Internationalen Gerichtshof in den Haag festgelegten Grenze zwischen Äthiopien und Eritrea zu akzeptieren und seine Truppen aus Eritrea zurückzuziehen. Die Signatarmächte dieses Abkommens, die UNO, die EU und die OAU haben bisher nicht auf dessen Verletzung durch Äthiopien reagiert, sondern die USA und andere Staaten (insbesondere auch die Schweiz) hätscheln ihr Lieblingskind Äthiopien weiter. Wer sich all diese geschichtlichen Fakten vor Augen hält, kann wohl das tiefe Misstrauen der eritreischen Regierung gegenüber der internationalen Gemeinschaft verstehen. Die Eritreer wurden wirklich dauernd von der internationalen Gemeinschaft, und insbesondere den Grossmächten »verarscht« - dieses Wort sei mir gestattet, denn es kann nicht anders ausgedrückt werden.
Der neue Bericht der ›Commission of Inquiry for Eritrea‹ ist auf diesem Hintergrund zu sehen – ich will hier nicht darauf eingehen, aber habe eine vorläufige Stellungnahme dazu, mit in die Sammlung aufgenommen.
Noch etwas soll aber gesagt werden: Ich habe in den letzten Monaten und auch nach meinen beiden Besuchen in Eritrea vom September 2015 und Februar 2016 immer wieder gesagt, dass ich es auch nicht verstehe, warum Eritrea den ›National Service‹ nicht wieder auf seine gesetzlich vorgeschriebenen 18 Monate beschränke. Ich habe dies auch gegenüber eritreischen Ministern geäussert und jeweils die Antwort erhalten, man würde dies noch so gerne tun, aber die Bedrohungslage an der äthiopischen Grenze lasse es nicht zu. Leider hatten sie Recht – wie dies die neuesten Ereignisse zeigen.
Nachtrag 2022
Was niemand erwartet hatte, kam aus heiterem Himmel. Im Frühling 2018 wurde in Äthiopien mit dem 40jährigen Abiy Ahmed ein neuer Ministerpräsident gewählt, also jemand, der die ›Schande‹ der Niederlage und den Verlust Eritreas nicht miterlebt hatte. Es war auch das erste Mal in der Geschichte Äthiopiens, dass eine Person aus der Ethnie der Oromo in ein hohes Staatsamt gewählt wurde. Bisher wurde Äthiopien (bzw. Abessinien) immer von Amharen oder Tigrays regiert.
Am 5. Juni 2018 beschloss die äthiopische Regierung, das Grenzabkommen von 2002 zu akzeptieren und Badme an Eritrea zurückzugeben. Am 8. Juli 2018 wurden wieder diplomatische Beziehungen zwischen den beiden Ländern aufgenommen und ein Friedensvertrag geschlossen.
Die Freude der Völker auf beiden Seiten war riesig, tage- und nächtelang wurde auf den Strassen getanzt. Ebenso gross sind aber auch die Hoffnungen, vor allem des eritreischen Volkes und all derjenigen Personen in der übrigen Welt, die den Befreiungskampf und den Wiederaufbau Eritreas seit Jahrzehnten verfolgt und unterstützt hatten.
Mit entsprechenden Erwartungen flog ich denn auch im September und Oktober 2018 zu einem Einsatz im von der Schweiz unterstützten Massawa Workers Training Centre nach Eritrea. In meinen Gesprächen mit Eritreerinnen und Eritreern aus allen Schichten er Bevölkerung spürte ich eine grosse Erleichterung über den Friedensprozess – aber auch eine gewisse Skepsis, denn im täglichen Leben hat noch niemand eine wirkliche Veränderung erlebt.
Bis dann (und bis heute), hatte noch kein einziger äthiopischer Soldat das Land verlassen, Badme war immer noch besetzt. Dementsprechend war auch noch kein einziger Angehöriger des ›National Service‹ demobilisiert. Dies wird eine langwieriger und schwieriger Prozess sein – denn was soll mit all den Frauen und Männer geschehen, die bisher im nationalen bzw. zivilen Dienst gearbeitet haben. Es gibt auf dem Arbeitsmarkt keine Stellen für sie.
Was mich aber besonders erschreckt hatte, war das, was ich im Laufe der Öffnung der Grenzen erlebt habe: äthiopische Händler überschwemmen den eritreischen Markt mit billigen landwirtschaftlichen Produkten und zerstören den internen Markt in Eritrea.
Für mich als externem Beobachter entstand der Eindruck, dass das was Äthiopien auf militärischen Weg nicht gelungen war, nun wirtschaftlich geschieht: die Rückeroberung Eritreas.
Eine Hoffnung bleibt: Der UN-Sicherheitsrat hat am 14. November 2018 die wirtschaftlichen Sanktionen gegenüber Eritrea aufgehoben. Die kann sich positiv auf die Entwicklung Eritreas auswirken, sofern denn die eritreische Regierung, die entsprechenden innenpolitischen Massnahmen ergreift. Ihre bisherigen Reaktionen lassen hingegen daran zweifeln …
Für all die Eritreerinnen und Eritreer, die ich in den letzten Jahren schätzen und lieben gelernt habe, wünsche ich mir, dass der ›National Service‹ bald wieder auf die gesetzlichen 18 Monate begrenzt wird und sie in Ruhe und Frieden einer Arbeit nachgehen können und sich ihre wirtschaftliche Lage bessert.
Unser Berufsbildungszentrum in Massawa könnte in dieser Entwicklung eine wichtige Rolle spielen.
Inzwischen hat sich aber im Äthiopien eine unerwartete Entwicklung zugetragen. Der Friedens-Nobelpreisträger Abiy Ahmed hat sich seinerseits zu einem diktatorischen Herrscher entwickelt.
Nachdem die ›Tigray Peoples Liberation Front‹ (TPLF), die in Äthiopien während mehr als 20 Jahren an der Macht gewesen war, sich geweigert hat die Truppen aus den besetzten Teile Eritreas zurückzuziehen und offen die Loslösung Tigrays aus der äthiopischen Föderation androhte, hat Abiy Ahmed die Region Tigray durch eine brutale militärische Intervention daran zu hindern. Es gelang ihm auch Eritrea in diesen Konflikt einzubeziehen. Eritrea wollte einerseits in diesem Konflikt die tigrayischen Truppen aus den besetzten Gebieten vertreiben, was auch gelang. Zudem ging es der eritreischen Regierung aber auch darum, die mehr als realistische Gefahr einer Invasion durch die TPLF für immer zu verhindern. Während Jahren hatte die TPLF in all ihren Verlautbarungen die Schaffung eines ›Greater Tigray‹ zu schaffen, das weite Teile Eritreas umfasst hätte.
Wie sich dieser Konflikt weiter entwickelt ist zur Zeit nicht abzusehen, doch ist zu hoffen, dass die Bevölkerung aller beteiligten Länder und Regionen nicht zu sehr unter den Machtspielen der Mächtigen zu leiden haben.
Inzwischen hat sich die TPLF von den schweren Verlusten erholt und ist wieder erstarkt. In ihrer Logik heisst das aber auch, dass die Forderung nach einem ›Greater Tigray‹ wieder im Raume steht und die TPLF bereits versucht dafür diplomatische Unterstützung bei den USA und der EU zu finden. Nicht umsonst hat sie die für Ostafrika zuständige Diplomatin in der EU zu Gesprächen nach Tigray eingeladen.
Diese wieder aufgeflammte Bedrohung Eritreas durch die TPLF macht auch die Hoffnungen zunichte, dass der ›National Service‹ in absehbarer Zeit verkürzt oder gar abgeschafft wird.
Äthiopien – das Volk kämpft gegen die feudal- faschistische Herrschaft1
Im Februar erfasste eine Militärrebellion ganz Äthiopien. Sie ging von den Garnisonen in der Hauptstadt Eritreas, Asmara aus. Am 28. Februar besetzten Truppen in Kampfuniform die wichtigsten Gebäude der Hauptstadt Addis Abeba. Die Forderungen der Truppen umfassten:
Rückgabe der Ländereien, die die Regierungsmitglieder den Armen abgenommen und verpachtet haben;
Erhöhung des Grundsoldes von 100 auf 150 äthiopische Dollar im Jahr
die Regierungsmitglieder müssen erklären, wo sie ihre Gelder versteckt haben
Rücktritt der Regierung, da sie die Hungersnot und steigende Preise nicht beseitigen konnte
Auf den Druck der Rebellierenden bewilligte Kaiser Haile Selassie eine Sol-derhöhung auf 112 äthiopische Dollar und die Regierung trat zurück. Nach der Zusage Selassies, alle Forderungen der aufständischen Truppen würden erfüllt, wurde am 2. März die Rebellion beendet, die Belagerung der Städte aufgehoben, alle festgenommenen Beamten freigelassen und die Soldaten kehrten in ihre Kasernen zurück. Doch die Unruhe in Äthiopien war damit nicht beendet. Täglich kam es zu Demonstrationen, in denen Studenten und jugendliche Arbeitslose, das Land den Bauern, Rede- und Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Absetzung des neuernannten Ministerpräsidenten und weitgehende Demokratisierung forderten. Am 7. März begann ein viertägiger Generalstreik, von 90’000 gewerkschaftlich organisierten Arbeitern und Angestellten, der nach weitgehenden Zusagen der Regierung beendet wurde. Unter anderem konnten in diesem ersten Generalstreik in der Geschichte Äthiopiens ein gesetzlich garantierter Mindestlohn durchgesetzt werden!
Anstoss dieser plötzlichen Kämpfe ist die katastrophale Hungersnot in Äthiopien. Die jahrelange Dürre in einem grossen Gebiet Äthiopiens trocknete die Erde völlig aus, das Ausbleiben des Regens liess das Getreide auf den Halmen verdorren. Es konnte keine neue Ernte eingebracht werden. Die vielen kleinen Bauern, die immer an der Grenze des Existenzminimums dahinvegetieren, konnten infolge der erdrückenden Pachtzinse und Steuern an Feudalherren, Kirche und Staat keine Mittel aufbringen, Brunnen zu graben, Pumpen zu kaufen und das Grundwasser zur Bewässerung der Felder auszunützen. Das Ausbleiben der Ernte und die planmässige Hortung der Nahrungsmittel durch die Grossgrundbesitzer trieben die Preise für die Grundnahrungsmittel in die Höhe: der Preis von Hirse z.B. stieg in wenigen Wochen auf das Doppelte. Viele Bauern verloren in dieser Zeit, da die kärglichste Ernte ausfiel, ihre Existenzgrundlage, sie konnten die Pacht und Steuern nicht bezahlen und wurden arbeitslos. War vor der Dürre jeder vierte Äthiopier arbeitslos, so Anfang 1974 jeder zweite!
Doch gerade die Forderungen der Soldaten, Arbeitslosen und Studenten nach einer Agrarreform weisen darauf hin, dass nicht die Dürre, sondern die feudalen Verhältnisse in Äthiopien die Grundursache der elenden Lebensbedingungen des Volkes sind. Seit 1916 regiert Haile Selassie — der ›König der Könige‹, wie er sich selber bescheiden nennt — in Äthiopien. Dank seiner feudalfaschistischen Herrschaft und seiner Zusammenarbeit mit den Imperialisten, heute den USA, hat er das Land soweit gebracht. Dabei ist Äthiopien keineswegs arm, man schätzt, dass dieses Land, in dem Hunderttausende an Hunger gestorben und Millionen von Hungertod bedroht sind, allein den ganzen mittleren Osten ernähren könnte. Oft wird es die ›Kornkammer Afrikas‹ genannt. Aber in Äthiopien herrscht eine schmale Schicht von Feudalherren. Nur 0,1% der Bevölkerung besitzen 77% des bebauten Bodens. Die Kirche allein besitzt 20% des landwirtschaftlich nutzbaren Bodens. Eine ›Landreform‹ Selassies diente ihm dazu, seine Gefolgsleute mit neuen Pfründen zu beschenken, um sich ihrer Loyalität zu versichern: vom verteilten Land gingen 95% an die Elite an seinen Hof, in Ministerien, Kirche, Militär- und Polizeikasernen. Der klägliche Rest von 5% wurde an untere Beamte und als Alibi an einige Arme verteilt. Nur 0,1% des Bodens sind heute nicht in den Händen von Adel und Kirche. Die Bauern müssen auf fremdem Boden arbeiten und 75% ihrer Erträge als Pachtzinsen abliefern. Davon lebt die kleine feudale Parasitenschicht in unbeschreiblichem Luxus, während mehr und mehr Bauern ihren letzten Landbesitz verkaufen müssen, da sie die Steuern nicht bezahlen können. Um den Widerstand vor allem der Bauern gegen die feudalen Blutsauger Adel und Kirche zu verunmöglichen, hat Selassie ein faschistisches Regime errichtet. In Äthiopien gibt es keine Presse- und Meinungsfreiheit. Jede Versammlung und Parteibildung ist verboten. Das gewählte Parlament hat keinerlei Beschlussfähigkeit. Das Volk wird in tiefer Unwissenheit gehalten, 95% der Bevölkerung können weder lesen noch schreiben. Zur Absicherung seiner Herrschaft hat sich Selassie mit Hilfe der Imperialisten eine der grössten Armeen Afrikas und eine der modernsten Polizeitruppen aufgebaut: Äthiopien erhält mehr als 50% aller militärischen Hilfe der USA für Afrika, die Bundesrepublik Deutschland liefert Polizeiausrüstung in Werte von 30 Millionen DM und bildet in deutschen Kasernen äthiopische Polizei aus. Berater aus Israel, des Brückenkopfes der US-Imperialisten im Nahen Osten, unterweisen äthiopische Militärs und Polizeioffiziere in der Unterdrückung des Volkes.
Zum Dank dafür, dass die Imperialisten seine Herrschaft sichern, lässt ihnen Selassie freie Hand zur Ausplünderung der Rohstoffe des Landes, zur Ausbeutung des Volkes als billige Arbeitskräfte und lässt die Imperialisten Stützpunkte in seinem Land errichten. In Asmara befindet sich die grösste Militärbasis der USA in ganz Afrika und dem mittleren Osten, mit einer Besatzung von 3000 GIs.
Doch der Widerstand der Volksmassen gegen die Ausbeutung durch Feudalismus und Imperialismus wächst. In Eritrea, das von den äthiopischen Feudalisten besetzt wurde, kontrolliert die eritreische Befreiungsbewegung heute die Hälfte des Landes. In Äthiopien wurde 1971 die Nationale Befreiungsfront Äthiopiens gegründet, die den Kampf für den Sturz des feudalistischen Regimes und die Verjagung der Imperialisten aufgenommen hat. Die Volksmassen in Äthiopien und Eritrea werden ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen und die Totenglocke für die Imperialisten und ihren feudalen Knecht Selassie läuten!
1 erschienen in ›Rote Fahne‹ Nr. 4/74, S. 7/8; geschrieben zu einer Zeit, als der eritreische und äthiopische Widerstand noch gemeinsam gegen die Diktatur von Haile Selassie kämpften.
Der vergessene Krieg in Eritrea
Besuch im EPFL-Gebiet2
Seit nunmehr 25 Jahren, seit der Annexion durch Äthiopien im Jahre 1961, herrscht in Eritrea Krieg. Zuerst gegen das Imperium Haile Selassies und nun gegen das Regime von Mengistu Haile Mariam führten und führen eritreische Unabhängigkeitskämpfer einen unermüdlichen Kampf gegen die Besetzungsmacht. Symbol dieses vergessenen Krieges ist das Städtchen Nakfa. Diese alte Handelsniederlassung im Schnittpunkt der Karawanenstrassen vom Sudan in die Danakilwüste und vom Hochland ans Rote Meer hatte in den siebziger Jahren eine Bevölkerung von etwa 6000 Einwohnern. Nakfa war, als Hauptstadt der eritreischen Sahelprovinz, gekennzeichnet durch ein blühendes Leben mit mehreren Marktplatzen, mit Kirchen und Moscheen. Ja näher die Frontlinie in den Jahren 1975 und 1976 rückte, umso mehr hatte die Bevölkerung unter der äthiopischen Besetzung zu leiden. Viele Einwohner verliessen die Stadt, flüchteten in den Sudan oder in die bereits von der Eritreischen Volksbefreiungsfront (EPLF) kontrollierten Gebiete. 1977 gelang es den eritreischen Streitkräften, die beinahe entvölkerte Stadt einzunehmen. Aus Rache wurde Nakfa von der äthiopischen Artillerie und Luftwaffe dem Erdboden gleichgemacht. In verschiedenen grossangelegten Offensiven gelang es den äthiopischen Streitkräften, die über eine massive sowjetische Unterstützung verfügten, jedoch nicht, die Stadt zurückzuerobern. Heute ist die ehemals blühende Provinzkapitale eine Geisterstadt. Unterirdisch finden wir zwar noch Spitäler, Kasernen und Reparaturwerkstätten, in welchen aber, wegen der ständigen Gefahr von Bombardierungen, nur nachts gearbeitet wird.
Das Umschwenken der Sowjetunion
Heute verläuft die Frontlinie rund 15 Kilometer südlich von Nakfa. Doch auch hinter der Front finden wir, bis weit in den Süden Eritreas, befreite und halbbefreite Gebiete. Obwohl zurzeit an der Front relative Ruhe herrscht, finden jeden Morgen in der Dämmerung einige Scharmützel zwischen den sich hier auf Sichtweite gegenüberstehenden Truppen statt. Auf eritreischer Seite wird dabei vorwiegend mit mechanisierter Artillerie gekämpft. Sie umfasst Lastwagen, Schützenpanzer und auf Jeeps montierte Panzerabwehrraketen. Daneben besitzen die Eritreer auch einige Panzer, Amphibienfahrzeuge sowie leichte und schwere Artillerie. Der grösste Teil der Ausrüstung stammt entweder noch aus den frühen siebziger Jahren, als die EPLF noch die halbherzige Unterstützung der Sowjetunion genoss, oder wurde der heute von der Sowjetunion massiv aufgerüsteten äthiopischen Armee abgenommen. In ganz Eritrea begegnet man sowjetischen und tschechischen Lastwagen, Generatoren aus der DDR, polnischen Traktoren.
Besonders eindrücklich ist das ›Recycling‹ von Überresten äthiopischen Kriegsmaterials. In vielen Werkstätten, Küchen und Schulen findet man zu Gebrauchsgegenständen umfunktionierte Bestandteile von Granaten, Geschosshülsen usw. So tragen die eritreischen Schüler ihre Hefte und Schreibutensilien in den handlichen Munitionsbehältern der russischen AK47-Gewehre in die Schule. In einer mechanischen Werkstätte werden die Splittermäntel von Landminen serienmässig in Bestandteile für Generatoren umgearbeitet. Stolz zeigt uns ein Mechaniker ein aus Geschosshülsen gefertigtes Schlagzeug mit Trommeln, Pauken und Becken. Sein lakonischer Kommentar lautet: »sie sandten dies, uns zu töten, aber wir machen Musik damit!«
Spärliche Entwicklungshilfe
Immer wieder erstaunten das technische Know-how und die Erfindergabe der Eritreer. So findet man im ganzen befreiten Eritrea Lichtschalter, die aus gebrauchten Injektionsspritzen gefertigt werden. In Eritrea wurde ein einfaches, zusammenlegbares Mikroskop entwickelt, das heute in Grossbritannien speziell für die Dritte Welt zu einem geringen Preis produziert wird. Viele der eritreischen Flüchtlinge haben sich in Europa, im Nahen Osten oder in den USA weitergebildet und kehrten als Techniker oder Ingenieure in die von den Aufständischen beherrschte Gebiete zurück. So auch der 38jährige Hydroingenieur Muhammed, Leiter eines Landwirtschaftsprojektes in Himar. Hier wurden mit neuesten Bewässerungsmethoden der Wüste im letzten Jahr 60 Hektaren Kulturland abgerungen. Über 200 Nomadenfamilien des nahen ›settlement-camp‹ erhalten in Himar eine rudimentäre, mit Alphabetisierung gekoppelte landwirtschaftliche Ausbildung und ein Stück Land, auf welchem gemeinsam Durra-Hirse angebaut wird. Nächstes Jahr soll die Kulturfläche auf 200 Hektaren ausgedehnt werden. Solche Projekte finden sich in ganz Eritrea. Finanziert sind sie meist von Eritreern im Ausland und von nichtgouvernementalen Hilfsorganisationen. Offizielle Entwicklungshilfe tröpfelt nur spärlich in Projekte der EPLF-Gebiete. Für die Schweiz lauten die entsprechenden Zahlen für das Jahr 1985: 1,3 Millionen Franken Hunger- und Wiederaufbauhilfe, ausschliesslich von kleinen Hilfswerken und Solidaritätsorganisationen, davon allein 930’000 Franken vom Schweizerischen Unterstützungskomitee für Eritrea (SUKE), das ganz ohne Bundeshilfe auskommt. Diesem Betrag stehen 14,7 Millionen offizieller Bundeshilfe und 7,1 Millionen von privaten Hilfswerken für Äthiopien gegenüber.
Barfussärzte3
Das Hygiene- und Gesundheitswesen Eritreas ist wohl das am weitesten entwickelte in ganz Afrika. Mit einem weitverzweigten Netz von Barfussärzten, Krankenschwestern und Kliniken wird die gesamte Bevölkerung der EPLF-Gebiete erreicht. Ja sogar die Einwohner der besetzten Städte Asmara, Keren und Barentu überqueren nachts die Kampflinien, um in den mobilen Kliniken des Widerstandes versorgt zu werden.
Zum Gesundheitswesen ein Beispiel aus der Wüstenregion von Himar: In der weiten Kieswüste westlich von Nakfa wohnt inmitten einer kleinen Siedlung von Hedara-Nomaden der Barfussdoktor Emanuel Gheratu. Nachdem er eine sechsmonatige Ausbildung erhalten hatte, kam er vor drei Jahren hierher. Er ist für die Bevölkerung in einem grösseren Umkreis nicht nur Arzt, sondern Sozialarbeiter an Vertrauensmann im weiteren Sinne. Morgens gegen acht Uhr kommen die ersten Leute zu ihm, zum Teil von weit her: ein alter Mann, den er seit zwei Jahren gegen Tuberkulose behandelt, ein Schafhirte mit Zahnschmerzen, eine Mutter mit ihrem kleinen Mädchen, das gestürzt ist und ein Loch in der Stirn hat. Während Gheratu seine Injektionsnadeln zur Sterilisation vorbereitet, werden Neuigkeiten ausgetauscht. Eine EPLF-Kämpferin bäckt Brot für die Wartenden, und der Gehilfe des Barfussdoktors, selbst ein Nomade, bereitet mit Milchpulver Milch zu, die verteilt wird. Jeder Patient nimmt nach der Behandlung gratis seine Medikamente und oft noch einen Sack mit Milchpulver, Getreide oder Kichererbsen mit nach Hause. Sind alle Patienten versorgt, lässt der Barfussdoktor aus einem nahen Zelt eine verschleierte Nomadenfrau mit ihrem sechs Tage alten Mädchen kommen, um es zu untersuchen und zu waschen. Stolz präsentiert er uns das Mädchen und erzählt uns von seinem dreifachen Erfolg: So hat er als männliche ›Hebamme‹ geholfen, dieses Kind zur Welt zu bringen, hat erreicht, dass bei der Frau nach der Geburt nicht wieder die äusserst schmerzhafte und erniedrigende Infibulation (Zusammennähen der Schamlippen) durchgeführt wurde, und schliesslich ist das Waschen des Kindes selbst ein grosser Erfolg, da bei den Hedara die Babies traditionellerweise in den ersten 30 Tagen nicht mit Wasser in Berührung kommen dürfen.
Mitten in diese friedliche Szene platzt das Dröhnen eines Flugzeugs. Eine sowjetische MIG braust über uns durch das Tal. Niemand darf sich vom Fleck rühren, denn alles, was sich bewegt, wird bombardiert. Am Horizont wendet die MIG. In der Zwischenzeit gibt der Barfussarzt mit ruhigen Worten seine Anweisungen. Alle rücken eng aneinander unter die weitausladende Krone einer Tamariske. Noch einige Male braust das Kampfflugzeug über unser Versteck. Nur das Kamel, das draussen weidet, könnte uns verraten. In der Ferne hören wir die Detonationen der abgeworfenen Bomben.
Auswirkungen des Bombenkriegs
Die Auswirkungen des Kriegs sind überall sichtbar. In den Werkstätten sind die Arbeitskräfte mehr als zur Hälfte körpergeschädigt. Eine Untersuchung des Genfer Arztes J. G. Nicolet stellte 1983 in der Region von Orotta etwa 3000 schwer geschädigte Personen fest, eine Zahl, die sich angesichts der schweren Bombardierungen durch die äthiopische Luftwaffe in den letzten Jahren noch beträchtlich erhöht haben dürfte. Man findet die Körpergeschädigten praktisch überall integriert, in Radioreparaturwerkstätten, Uhrmacherateliers, Garagen, Druckerei und anderen Betrieben. Was auffällt ist, dass sie nicht nur in den Arbeitsprozess integriert sind, sondern auch sozial den Nicht-geschädigten gleichgestellt sind. Das mag mit dem hohen Prestige zusammenhängen, das ihnen als Opfer eines von der grossen Mehrheit unterstützten Unabhängigkeitskampfes zukommt.
Die einzige Gruppe von Kriegsgeschädigten, die bisher noch nicht erfolgreich integriert werden konnte, sind die Blinden – dies vor allem wegen fehlender blindengerechter Werkzeuge und Maschinen. Zur Zeit werden Blinde in einem speziellen Zentrum in Brailleschrift und in Musik unterrichtet. In grossen Teilen Eritreas sind Augenkrankheiten, wie Trachom und Xerophthalmie, weit verbreitet, obwohl von den Barfussdoktoren versucht wird, mit Tetracyclinsalbe und der prophylaktischen Abgabe von Vitamin A dagegen zu kämpfen.
Das System der Barfussärzte ist nur ein Teil des ›Eritrean public health programme‹. Daneben gibt es über zwanzig Health-Center, sechs Regionalspitäler und das Zentralspital in Orotta, das ›längste‹ Spital der Welt. Es erstreckt sich in einem Hochtal Norderitreas über etwa fünf Kilometer. Sämtliche Abteilungen sind unterirdisch untergebracht, da stets die Gefahr von Bombardierungen besteht. Zuletzt wurde das Spital im Juni dieses Jahres bombardiert. Es waren ein Todesopfer und über 20 Verletzte zu beklagen. In den drei Operationssälen wird jeden Tag ab sechs Uhr abends ununterbrochen bis in den Morgen hinein gearbeitet. Bei unserem Besuch wurde in einem Operationssaal gerade eine schwierige Ohrenoperation durchgeführt. Mit einfachen Mitteln wird Sterilität erreicht. Fast unglaublich mutet jedoch die pharmazeutische Produktion an. Mitten in der Steinwüste werden hier 14 Sorten Tabletten, verschiedene Sirups, Tinkturen und Salben hergestellt. Eine Abteilung produziert unter sterilen Bedingungen vier Sorten von Infusionen. Pro Nacht werden 400 Liter Infusionslösung hergestellt und verpackt. Die gesamte Produktion, Tabletten und Infusionen, wird mit modernsten Messinstrumenten aus der Schweiz auf ›internationalen Standard‹. geprüft. Auf diese Weise kann sich Eritrea mit einigen wichtigen Medikamenten bereits bis zu 50 Prozent selbst versorgen.
In einem Forschungszentrum in der Nähe von Orotta wurde von der Ärztin Azieb Fessaye und ihren Mitarbeitern ein Zusatznährmittel für Kinder, das sogenannte DMK, selbst entwickelt. 1984 wurde die Produktion dieses Mittel aus Durrha, Milchpulver und Kichererbsen (DMK) aufgenommen. In der Folge wurde weiter geforscht, und so besteht dieses Produkt heute zu 55 Prozent aus Durrha oder Weizen, je nachdem, was verfügbar ist, und aus 20 Prozent Kichererbsen, 10 Prozent Zucker, 10 Prozent Milchpulver und 5 Prozent Eipulver. Das Getreide und die Kichererbsen werden fein gemahlen und mit den anderen Bestandteilen gemischt und in 500-Gramm- und Kiloportionen abgepackt. Das Pulver muss im Verhältnis 1:3 mit Wasser gemischt und zehn Minuten gekocht werden. Zurzeit werden pro Monat 2000 Kilo davon hergestellt, was als Zusatznahrung für 5000 Kinder ausreicht.
Ausbildung von Kriegswaisen
Die mörderischen Bombardierungen durch MIGs treffen meistens Frauen, Alte und Kinder. Es gibt daher in Eritrea eine grosse Anzahl von Waisen und Halbwaisen. Nahe der sudanesischen Grenze, in Solomona, ist ein Waisencamp eingerichtet worden. Hier werden zurzeit 600 Waisenkinder im Alter von drei bis sieben Jahren erzogen. Über 100 Betreuer kümmern sich um deren körperliche und geistige Entwicklung. Daneben sind gegen 200 Personen mit Kochen, Waschen usw. beschäftigt. So ist es wirklich überraschend, mitten in der Steinwüste unter zwei Tamarisken eine Pastamanufaktur zu finden, die täglich 50 Kilogramm Teigwaren für die Kinder produziert. Die über sieben Jahre alten Kinder aus Solomona kommen in die sechsklassige ›Revolutionary School‹, wo sie in den Sprachen Tigrinya, Tigre, Englisch, Mathematik, Geschichte, Naturwissenschaften, Singen und Turnen unterrichtet werden. Nach der Absolvierung der sechsten Klasse werden sie zuerst in der Alphabetisierungskampagne eingesetzt und kehren nachher zurück in die ›integrierte Schule‹, das heisst, sie erhalten weitere theoretische Bildung, werden aber gleichzeitig in Werkstätten und Spitälern praktisch geschult.
2 erschienen in der Neuen Zürcher Zeitung vom 19.11.1986 S. 5
3 Die Eritreer lieben die Bezeichnung ›Barfussärzte‹ nicht, denn erstens seien sie nicht barfuss und zweitens stammt die Bezeichnung aus der chinesischen Kulturrevolution. Da er bei uns geläufig ist, halte ich hier an dem Begriff fest.
Blinde im umkämpften Eritrea4
1. Einführung
In der ehemaligen italienischen Kolonie Eritrea herrscht seit 25 Jahren, seit der widerrechtlichen Einverleibung Eritreas durch Äthiopien, Krieg. Es ist dies der längste Unabhängigkeitskrieg Afrikas. Es ist zudem ein Krieg, der nicht in das herkömmliche Ost-West-Muster passt. So wurde er doch zuerst gegen das von den USA unterstützte Kaiserreich Haile Selassies geführt, und nach dessen Sturz ging der Befreiungskampf gegen die nun von der Sowjetunion unterstützte Junta von Haile Mariam Mengistu weiter.
Heute wird der Kampf hauptsächlich von der Eritreischen Volksbefreiungsfront (EPLF) geführt, die grosse Teile Eritreas kontrolliert und in diesen Gebieten eine gut funktionierende Infrastruktur aufgebaut hat. Da die Eritreer von nirgends her offizielle Entwicklungshilfe bekommen, wurde die ›self-reliance‹ zum Prinzip erhoben. Dieses Prinzip des ›Vertrauen auf die eigenen Kräfte‹ finden wir in Eritrea auf Schritt und Tritt, sei es bei der Herstellung von Schuhen, von Medikamenten, von Damenbinden oder beim Recycling von äthiopischem Kriegsmaterial zu friedlichen Zwecken. Die einzige Hilfe, die die Eritreer erhalten, stammt von Solidaritätskomitees, privaten Hilfswerken und vor allem von den eritreischen Migranten in Europa, den USA und Australien.
Im Folgenden sei am Beispiel der Blinden aufgezeigt, wie solche autonome Entwicklung aussehen kann und wie sie von uns unterstützt werden kann, ohne dass dadurch neue Abhängigkeiten entstehen.
2. Blindenförderung im Kriegsgebiet
Nach einer Untersuchung des Genfer Arztes J. G. Nicolet aus dem Jahre 1983 gab es in der eritreischen Sahelprovinz in der Region rund um das Zentralspital von Orotta etwa 3000 Kriegsgeschädigte. Die Zahl dürfte sich wegen der massiven Bombardierungen der äthiopischen Luftwaffe in den letzten Jahren noch beträchtlich erhöht haben, sodass man heute mit etwa 5000 Geschädigten rechnet. Der grösste Teil dieser Opfer des nun 25jähigen eritreischen Unabhängigkeitskampfes sind Personen mit Amputationen und Para- oder Hemiplegie. Die meisten sind in den einfachen, technologisch angepassten Werkstätten integriert. Die Integration geht so weit, dass in einzelnen Betrieben wie der Druckerei, der Schuhfabrik und in den Autoreparaturwerkstätten mehr als die Hälfte des Personals Kriegsversehrte sind. Die einzige Gruppe von Geschädigten, die bisher mangels geeigneten Maschinen nicht integriert werden konnte, sind die Blinden.
Auch unter den Blinden sind viele Opfer des Krieges; sie haben durch Splitterbomben, Minen oder durch Napalm ihr Augenlicht verloren. Dazu kommen die Erblindungen durch die Augenkrankheit Trachom. Trachom ist eine Viruskrankheit, deren Übertragung durch Fliegen, Sandstaub, Schmutz und durch ausgetrocknete Schleimhäute infolge Vitamin-A-Mangels begünstigt wird.
Die vorwiegend nomadische Bevölkerung der Sahelprovinz wird durch das flächendeckende System der Barfussärzte medizinisch versorgt. Die Barfussärzte sind unter anderem darin geschult, eine Infektion mit Trachom im Frühstadium zu erkennen und mit Tetracyclin und Vitamin A zu behandeln. Kranke, die die Barfussärzte nicht behandeln können, werden in eines der sechs Regionalspitaler oder ins Zentralspital von Orotta überwiesen.
In der Augenklinik von Orotta werden monatlich 1200 Patienten ambulant behandelt. Die häufigsten Leiden sind auch hier Trachom mit all seinen Komplikationen sowie verschiedene Formen von Bindehautentzündungen. Weiter werden vom Augenarzt Dr. Desbelle und seinen Mitarbeitern monatlich etwa 80-100 Augenoperationen durchgeführt. Diese Zahl kann, namentlich bei grösseren militärischen Aktivitäten, beträchtlich nach oben abweichen. Der Augenklinik ist eine einfache Optikerwerkstätte angegliedert, in welcher ein in der Bundesrepublik Deutschland ausgebildeter Optiker konfektionierte und gebrauchte Brillengläser schleift und in ebenfalls gebrauchte Brillengestelle einpasst.
Bei bereits erblindeten Patienten wird versucht, sie in ihren Familien zu integrieren, ihnen einen sinnvollen Platz innerhalb der nomadischen Gesellschaft zuzuweisen. Dies wurde auch bei vielen erblindeten Widerstandskämpfern versucht, doch erweist sich dies als bedeutend schwieriger, stammen doch die meisten der Kämpfer aus Regionen, die noch zum Teil von den äthiopischen Besatzungstruppen kontrolliert sind. Dorthin können verwundete Widerstandskämpfer natürlich nicht zurückkehren, ohne harte Repressionsmassnahmen befürchten zu müssen. Aus diesen Gründen befinden sich heute 110 Blinde in einem Camp in einem Wüstental in der Nähe von Orotta. Leiter des Camps ist der 39jährige Ghebreberhan Eyasa, ein ehemaliger Lehrer aus Asmara. Als Kämpfer wurde er mehrmals verwundet und ist selbst geschädigt. Er besitzt an der rechten Hand nur noch den Daumen, den Ring-und den kleinen Finger. Er durchlief keinerlei Ausbildung in Sonderpädagogik, sondern hat sich alle seine Kenntnisse inklusive der Braille-Schrift im Selbststudium erworben.
Im Blindencamp von Orotta leben heute 20 Frauen und 90 Männer. Fünf der Frauen und 22 Männer sind verheiratet. Dabei gibt es keine Ehepaare, bei welchen beide Partner blind sind. Die verheirateten Blinden leben mit ihren Familien in eigenen Häusern und besitzen eigene Hühner und Ziegen. Mehl, Hülsenfrüchte, Tee und Zucker erhalten sie gratis von der EPLF. Für Extras wie zum Beispiel Zigaretten erhalten sie ein kleines Taschengeld. Die unverheirateten Blinden leben in gemischten Gruppen von etwa zwölf Personen mit andern Geschädigten zusammen. Auch sie besitzen eigene Hühner und Ziegen und erhalten die übrigen Lebensmittel und ein Taschengeld von der EPLF.
Bis vor drei Jahren wurden die Blinden mit dem Flechten von Matten, Körben und Stühlen, sowie mit dem Besenbinden beschäftigt. Ab etwa 1982 begann sich der Leiter des Blindencamps für die Braille-Schrift zu interessieren, konnte jedoch in den befreiten Gebieten niemanden finden, der Kenntnisse in der Braille-Schrift besass. Durch Zufall hörte er von einem blinden Eritreer in der Stadt Barentu, der die Braille-Schrift in amharischer Sprache beherrschte. Er beauftragte einige Guerilla-Kämpfer, diesen Mann in der noch von den Äthiopiern gehaltenen Stadt zu kontaktieren. Der Mann besass ein Schreibrähmchen und fünf Lehrbücher, die er den Kämpfern überliess. Der Leiter adaptierte nun die amharischen Schriftzeichen auf die wichtigste Sprache Eritreas, das Tigrinya. Die tigrinische Schrift besteht aus 259 Buchstaben. Somit reichen die Möglichkeiten der Braille-Schrift mit ihren Kombinationen von sechs Punkten nicht zur Darstellung aller Buchstaben aus. Deshalb müssen die Buchstaben des Tigrinya-Alphabets durch zwei oder drei Braillezeichen zusammengesetzt werden.5
Im Jahre 1985 konnte sich der Leiter weitere Schreibrähmchen und eine erste Braille-Maschine besorgen. Nun wurde die handwerkliche Arbeit bis auf wenige Ausnahmen gestoppt und intensiv Braille unterrichtet. Heute beherrschen alle 110 Blinden die Braille-Schrift in der Sprache Tigrinya. Zum Teil konnten die Leute vorher nicht lesen und schreiben und mussten in Brailleschrift alphabetisiert werden. Das Schreib- und Lese-tempo ist beachtlich, vor allem, wenn man bedenkt, dass ohne Kürzungen gearbeitet wird. Zwölf Blinde beherrschen auch die englische Braille-Schrift und stellen Übersetzungen vom Englischen ins Tigrinya her. Die bisher einzige Braille-Schreibmaschine ist den Lehrern und Übersetzern für die Herstellung von Lehrmaterial vorbehalten. Es ist beabsichtigt, einen grossen Teil der Blinden des Camps zu Blindenlehrern auszubilden und in der Alphabetisierungskampagne für die Blinden im ganzen Land einzusetzen.
Fünf der Blinden sind selbst Lehrer. Daneben gibt es zwölf sehende Lehrer, die aber zum Teil andere Körperschädigungen aufweisen, und 88 sonstige Angestellte zur Betreuung der Blinden.
Während am Morgen Unterricht in Braille, in Mathematik, Geschichte und Geographie erteilt wird, werden die Blinden am Nachmittag in Musiktheorie und auf traditionellen und modernen Instrumenten ausgebildet. Es existiert eine weit herum beliebte Kulturtruppe mit einem Orchester, einer Tanz- und einer Theatergruppe. Es besteht die Absicht, in nächster Zeit die handwerkliche und kleinindustrielle Arbeit auf höherem Niveau wiederaufzunehmen.
3. Einzelschicksale
Fissaha Miangisha ist ein 13jähriger Knabe. Sein Vater ist Kämpfer der EPLF, und Fissaha lebte mit seinen Geschwistern bei der Mutter in einem Dorf im Hochland. Im Frühjahr 1984 hütete er die Herde. Da wurde er bei einem Bombenangriff von MIGs durch eine Schrapnellbombe getroffen. Er wurde sofort ins nächste Regionalspital gebracht, doch war seinen Augen nicht mehr zu helfen; er verlor beide. Seine Mutter wartete auf ihn, bis Nachbarn ihr die schreckliche Nachricht brachten. Nun lebt sie zusammen mit ihrem Sohn hier im Blindencamp. Die Geschwister leben zum Teil im Internat der ›Zero-School‹, zum Teil bei Verwandten im Hochland.
Waini Ukbazgi ist 27 Jahre alt. Sie war Kämpferin in der Befreiungsarmee. 1978 wollte sie die Zivilbevölkerung vor einem bevorstehenden Artillerieangriff der Äthiopier warnen und wurde dabei selbst verwundet. Sie verlor beide Augen. Sie wurde zuerst während zwei Jahren in einem Regionalspital gepflegt. 1980 heiratete sie den heute 29jährigen Barfussdoktor Abraham, der sie gepflegt hatte. Sie versucht, ihrem Mann soweit als möglich im Haushalt zu helfen, sonst besorgt aber er alle Arbeiten. Ein erstes Kind verloren die beiden im Alter von 6 Monaten während der Hungersnot von 1984. Waini ist nun wieder schwanger und hofft, ihr Kind unter den nun verbesserten Bedingungen durchbringen zu können.
Habtemariam Ghebretensaie ist 30 Jahre alt. Er war Kämpfer in der Befreiungsarmee. Am 1. Januar 1978 versuchte seine Einheit, in Massawa einzudringen und dabei wurde er durch eine Mine verwundet. Er kam ins Zentralspital von Orotta und nachher ins Blindencamp. Hier lernte er auf Braille lesen und schreiben, was er vorher noch nicht konnte, und seit einem Jahr spielt er Gitarre in der Kulturgruppe der Blinden. Er ist verheiratet mit einer Braille-Lehrerin, und sie haben eine fünf Jahre alte Tochter, Sinner.
4. Hilfsmöglichkeiten
Das Schweizerische Unterstützungskomitee für Eritrea (SUKE) und eine Arbeitsgruppe des Instituts für Sonderpädagogik der Universität Zürich haben im Oktober 1986 die Bedürfnisse der Eritreer abgeklärt und integrierte Massnahmen auf drei Ebenen vorgesehen. Dabei soll aber nicht von europäischen Vorstellungen ausgegangen werden, sondern nur die autonome Entwicklung von angepassten Projekten unterstützt werden:
Zur Prophylaxe ist eine ausreichende Versorgung mit Vitamin A nötig. Dabei sollte das Vitamin A nicht einfach in konzentrierter Form abgegeben, sondern nach Möglichkeit einem Grundnahrungsmittel beigemischt werden. Dazu würde sich als erstes die von den Eritreern entwickelte Säuglingsnahrung DMK eignen. Sie wird wieder nach dem Prinzip der ›self-reliance‹ in Eritrea hergestellt und besteht aus 55 % Durrha-Hirse, 20 % Kichererbsen, die gemahlen und mit 10 % Zucker, 10% Milchpulver und 5 % Eipulver vermischt werden. Das Pulver wird in einem einfachen Produktionsbetrieb hergestellt, steril in Päckchen von einem halben und einem Kilo abgepackt, und es muss nur noch mit drei Teilen Wasser vermischt und zehn Minuten gekocht werden. Zur Zeit wird das DMK in einem Versuchsbetrieb hergestellt. Die momentane Produktion reicht für die Ernährung von 5000 Kindern, doch soll sie allmählich gesteigert werden. Von der Schweiz aus ist nun geplant, die Vitaminisierung dieser Säuglingsnahrung finanziell zu unterstützen.
Im augenärztlichen Bereich ist vor allem ein längerer Aufenthalt eines Schweizer Augenarztes zur Weiterbildung des Personals der Augenklinik von Orotta geplant. Zudem soll die Augenklinik durch Lieferung von Operationsinstrumenten und optischen Instrumenten unterstützt werden. Weiter sollen die Möglichkeiten abgeklärt werden, inwieweit auch augenärztliche Medikamente in der Medikamentenfabrik in Orotta hergestellt werden können. Diese Fabrik produziert zur Zeit 14 verschiedene wichtige Medikamente wie Aspirin, Chloroquin zur Malariaprophylaxe, INH zur Tuberkulose-bekämpfung, Sulfonamide und mehrere Sorten von Infusionen (Sole, Dextrose, Ringerlösung). Dabei ist Eritrea bei den wichtigsten Medikamenten zu 50 % und bei den Infusionen zu 100 % selbstversorgend, eine für ein Entwicklungsland fast unglaubliche Tatsache. Weiter sollen in der Schweiz gebrauchte Brillengläser und -gestelle zur Wiederverwendung in Eritrea gesammelt werden.
Die eigentliche Unterstützung für die Blinden soll auf zwei Ebenen verlaufen: Einerseits soll die Ausbildung in der Brailleschrift weiter gefördert werden. Dazu wurden bereits im Oktober 1986 drei Braille-Maschinen geliefert. Weitere solche Maschinen werden Ende 1987 nach Eritrea gesandt. Zur Herstellung von Unterrichtsmaterial wird eine Kopiermaschine für Braille-Texte gespendet. Andererseits müssen Möglichkeiten zur handwerklichen und kleinindustriellen Beschäftigung der Blinden geschaffen werden. Dabei stehen zwei Projekte im Vordergrund: eine Maschine zum Knüpfen von Seilen aus dem in Eritrea reichlich vorhandenen Sisal und die Integration von Blinden in eine vom italienischen Solidaritätskomitee geplante Seifenfabrik. Dabei sollen vorerst tierische Fette, später aber auch Kokos- und Palmöl verwendet werden. Die notwendige Natronlauge wird am Anfang importiert werden müssen, doch ist eine Gewinnung aus Natriumchlorid in Eritrea geplant. Die blindengerechten Maschinen zur Seifenfabrikation sollen von der Schweiz aus geliefert werden. Es soll nur relativ einfache Technologie verwendet werden, wie sie auch in unseren Blindenwerkstätten früher üblich war. Quasi nebenbei soll auch noch die kulturelle Arbeit im Blindencamp mit Instrumenten, Noten in Blindenschrift usw. unterstützt werden.
All diese Hilfe, die von der Schweiz aus geleistet werden soll, geschieht auf Begehren der Eritreer hin und entspricht deren Bedürfnissen. Die Hilfe soll in kurzfristigen Einsätzen zur Beratung und Einführung in die geplanten Aktivitäten bestehen und soll nur als ›Initialzündung‹ für die eigene selbständige Entwicklung gedacht sein. Nur auf diese Weise kann es gelingen, in Eritrea eine wirklich unabhängige Entwicklung weiterzutreiben und nicht neue Abhängigkeiten zu schaffen.
4 erschienen in Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete Nr. 56 (1987) 3, S. 492-495
5 Nachtrag 2022: Die Tigrinische Braille-Schrift, an deren Entwicklung auch Hans Furrer mitgewirkt hat, wurde leider nach der Unabhängigkeit vergessen – vor allem weil der Leiter der Blindenschule in Asmara sie selbst nicht kannte und er ausschliesslich auf Englisch unterrichtete. Seit einigen Jahren wird sie – neben Englisch – an der Blindenschulen wieder gelernt.
Eritrea – Versuch einer eigenständigen Entwicklung6
Eritrea, die ehemalige italienische Kolonie am roten Meer, erscheint nur selten in unseren Schlagzeilen und wenn, dann nur mit Sensationsmeldungen über Hunger und Krieg. Doch gäbe es aus diesem Land auch viel Positives zu berichten, wird doch dort trotz eines nun mehr als 26jährigen Krieges versucht, ein neues Entwicklungsmodell für die Dritte Welt zu verwirklichen.
Nachdem ich in Khartum all die bürokratischen Hindernisse für eine Reiseerlaubnis überwunden und endlich einen Platz im Flugzeug nach Port Sudan gefunden habe, sind die beiden grössten Schwierigkeiten zur Einreise in die befreiten Gebiete Eritreas überwunden. In Port Sudan werde ich von Paolos, dem Verantwortlichen der Eritrean Relief Association (ERA), der humanitären Hilfsorganisation Eritreas, empfangen und ins einfache ›guest-house‹ am Roten Meer gebracht. Im Nebengebäude befindet sich eine Rehabilitationsstation für schwer körpergeschädigte Opfer des grausamen äthiopischen Luftkrieges gegen die eritreische Bevölkerung. Die Opfer der Napalm- und Schrapnellbomben sowjetischer Herkunft erhalten hier einfache Prothesen.
Im befreiten Gebiet
Ich habe jedoch nicht lange Zeit, mich hier umzusehen, denn schon geht es mit einem Geländewagen auf die 300 km lange Reise ins Basisgebiet der eritreischen Unabhängigkeitsbewegung, der ›Eritrean Peoples Liberation Front‹ (EPLF).
Die gesamte Infrastruktur von Port Sudan bis an die sudanesisch-eritreische Grenze wird von der EPLF unterhalten. In der ehemaligen türkischen Hafenstadt Suakin befindet sich eine mit schweizerischer Hilfe aufgebauten Prothesenwerkstatt, in welcher die kriegsversehrten Männer und wenigen Frauen ihr Prothesen selbst herstellen und dabei durch ein Team von Physiotherapeuten im Gebrauch der Prothesen instruiert werden.
Daneben befindet sich hier eine riesige Reparaturwerkstätte für Lastwagen und andere Transportmittel. Hier sehen wir ein erstes Mal die ›Wodka-Cola-Camions‹ die wir in Eritrea überall antreffen werden und von denen die Versorgung sowohl der Zivilbevölkerung als auch der Truppen abhängt. Dabei handelt es sich um leistungsfähige Lastwagen, die aus einer robusten von den Äthiopiern eroberten russischen Karosserie mit russischem Getriebe bestehen, in welche ein starker amerikanischer Motor eingebaut wird. Von Suakin aus geht es durch Sand- und Steinwüste zur Grenze, die wir am ›Checkpoint Liberation‹ ohne viel Formalitäten passieren.
Gleich nach der Grenze leben die etwa 8’000 äthiopischen Kriegsgefangenen, die ebenfalls von der ERA versorgt werden und die eigene Schulen, Werkstätten und Kulturgruppen der verschiedenen äthiopischen Nationalitäten besitzen. Viele der gefangenen äthiopischen Soldaten lernten hier in Gefangenschaft in ihrer Muttersprache lesen und wurden ein erstes Mal mit der Kultur, der anderen äthiopischen Ethnien bekannt.
Unsere Reise führt nun aber weiter über imposante Passstrassen, die in den letzten Jahren von der EPLF gebaut worden sind – eine trägt den symbolischen Namen ›Never kneel down – Road‹. Auf der Passhöhe fahren wir durch einen engen in dem Felsen gesprengten Hohlweg. Auf meine Frage, ob denn hier eine gut platzierte äthiopische Bombe nicht den ganzen Nachschub für Eritrea blockieren würde, antwortet Paolos mit seinem trockenen Humor: »Ja, für einige Tage bestimmt; doch dafür wäre nachher der Durchgang breiter!«
Unsichtbare Häuser
Nun wird die Felswüste langsam immer belebter. Einige Nomaden ziehen mit ihren Kamelen dahin, und immer wieder sehe ich Kinder und Jugendliche mit Schulmaterialien unter dem Arm oder auf dem Kopf zielstrebig in eine bestimmte Richtung marschieren. Nach zehnstündiger Fahrt hält unser Toyota am Rande eines Felsentals, und Lalimba, unser Chauffeur, erklärt uns, wir seien da. Weit und breit kann ich aber nichts erkennen, was darauf schliessen lässt, wo wir angekommen sind. So wird es mir in den nächsten Wochen noch oft ergehen, da sämtliche wichtigen Gebäude in Eritrea entweder unterirdisch oder gut getarnt unter Bäumen errichtet wurden, um nicht den Bombenangriffen der äthiopischen MiGs ausgesetzt zu sein.
Orotta, wo wir angekommen sind, ist momentan das wichtigste Zentrum der eritreischen Widerstandsbewegung. Hier befindet sich das ›längste Spital der Welt‹, das sich in den verzweigten Felstälern um Orotta mit unterirdischen Operationsräumen, Kliniken und Laboratorien über etwa fünf Kilometer erstreckt. Hier fand im März 1987 auch der wichtige 2. Kongress der EPLF mit 1287 Abgeordneten aus ganz Eritrea statt.
Im ebenfalls unterirdischen ›guest-house‹ werde ich mit Josef bekanntgemacht, der mir in den nächsten Wochen konkret zeigen soll, was es bedeutet ›self-reliant‹ zu sein, das heisst, wie die Eritreer versuchen, eine wirklich unabhängige Entwicklung voranzutreiben.
Weitgehende Selbstversorgung
Als erstes besuchen wir die – natürlich ebenfalls unterirdische – Medikamentenfabrik. Dort werden heute 30 Sorten von Tabletten, Salben und Sirups hergestellt. Momentan werden bei den 14 wichtigsten Medikamenten etwa 60 Prozent des Bedarfs in Eritrea selbst hergestellt. Zurzeit beginnen die Versuche mit der Produktion von Antibiotika und von Vitaminen. Am eindrücklichsten ist jedoch diejenige Abteilung, wo unter absolut sterilen Bedingungen vier Sorten von Infusionen hergestellt werden. Eritrea ist bezüglich der Infusionen – ausser bei einigen ganz selten benötigten Spezialinfusionen – völlig selbstversorgend, eine Leistung, die kaum ein anderes Land der Dritten Welt aufweisen dürfte. Dabei spielen neben entwicklungspolitischen auch logistische Überlegungen eine Rolle. Beim Import von Infusionen wird über 99 Prozent Wasser importiert. Durch die Eigenproduktion der Infusionen kann diese Transportkapazität anderweitig genutzt werden.
In einem anderen Hochtal, etwa 20 km von Orotta entfernt, besuchen wir die Forschungslaboratorien für die Herstellung von Säuglingsnahrung. Unter Leitung des Ernährungswissenschafters Berhane Tekle sind hier 26 Frauen und Männer mit der Pflege der Hühner und der Herstellung der Säuglingszusatznahrung beschäftigt. Mit Hilfe von technisch einfachen Mühlen wird unter sterilen Bedingungen ein Pulver aus Durrha-Hirse, Kichererbsen, Zucker, Milch- und Eipulver hergestellt, das in Plastiksäcke verschweisst und für Kinder ab etwa sechs Monaten abgegeben wird. Das Pulver muss von den Müttern mit drei Teilen Wasser vermischt und wegen seiner Konsistenz mindestens zehn Minuten gekocht werden. Damit wird erreicht, dass die Kinder nicht durch schmutziges Wasser erkranken. Heute produziert das als Pilotprojekt gedachte Unternehmen etwa 1,5 Tonnen pro Nacht, was Zusatznahrung für ungefähr 5’000 bis 6’000 Kinder ergibt. Das Schweizerische Unterstützungs-komitee für Eritrea (SUKE) prüft zurzeit, ob eine Finanzierung der Vitaminisierung dieser Nahrung von der Schweiz aus sinnvoll und möglich ist.
Totgeschwiegener Krieg
In den nächsten Tagen besuche ich mit Josef noch Dutzende von Garagen, Spenglereien, Radio- und Uhrenreparaturateliers, Sanitätsstationen, Schulen und die zentrale Druckerei, wo das gesamte Lehrmaterial für die Schulen und die Alphabetisierungskampagne gedruckt wird. Überall das gleiche Bild: Frauen und Männer, die mit grossem Engagement und trotz der ständigen Bombardierungen am Aufbau des Landes arbeiten. Ich schwanke dauernd zwischen Wut und Bewunderung. Wut darüber, dass die Erfolge immer wieder durch den Krieg zerstört werden; Wut auch darüber, dass unsere Medien diesen Krieg totschweigen. Bewunderung für ein Volk, das dessen ungeachtet immer wieder aufbaut, was zerstört wurde, und aus der Not eine Tugend macht, indem es nun eine Wirtschaft einrichtet, die nicht von den Supermächten oder den Multis abhängig ist.
Die wichtigste Abhängigkeit. die in Eritrea noch besteht, ist diejenige auf dem Energiesektor. Obwohl vor der eritreischen Küste Erdöl vermutet wird, müssen wegen der Kriegssituation sämtliche Erdölprodukte eingeführt oder von den Äthiopien erbeutet werden. Aus diesen Gründen, wurden auch Versuche mit alternativen Energieformen begonnen. Im Zentralspital von Orotta wird ein Operationssaal mit Energie aus Windgeneratoren betrieben. Die zwei Sonnenkollektoren auf dem Dach des Operationstraktes müssen jedoch immer wieder zugedeckt werden, wenn äthiopische Flugzeuge auftauchen. Prekär ist – wie in der ganzen Sahelzone – die Brennholzsituation. Um eine weitere Abholzung und damit weitere Erosion zu vermeiden, versucht die ERA die Bevölkerung von den Vorteilen von zentralen Küchen und vor allem zentralen Bäckereien für das Fladenbrot zu überzeugen. Auch sonst wird recht ökologisch gewirtschaftet. Dies betrifft neben der Landwirtschaft vor allem das Recycling von praktisch jedem Abfallmaterial. Sowohl die Milchpulverbüchsen aus der Hungerhilfe, als auch die Trümmer von äthiopischem Kriegsmaterial werden zu Pfannen, Kochern, Musikinstrumenten verarbeitet. Die Lichtschalter in den ganzen befreiten Gebieten Eritreas bestehen aus gebrauchten Plastikspritzen der Ärzte: Das Licht geht an, wenn man die Spritze zusammendrückt!
Ein gutes Beispiel für das Recycling ist die Schuhfabrik, in welcher die Gummisandalen hergestellt werden, die von allen Eritreern, Kämpfern und Zivilisten, getragen werden. Mit einer hydraulischen Presse werden pro Nacht rund 500 Paar Schuhe in zehn verschiedenen Grössen hergestellt. Das Rohmaterial wird zur Hälfte aus gebrauchten Sandalen gewonnen. Dazu werden die alten Schuhe in einer grossen alten Waschmaschine gewaschen, dann in einer Art Fleischwolf gehackt und mit dem neuen Gummigranulat, das von den eritreischen Flüchtlingen in Italien gespendet wird, gemischt.
Gleichberechtigte Frauen
Ebenfalls aus Italien, von der Frauenorganisation der Flüchtlinge, wird die Fabrik zur Herstellung von Damenbinden unterstützt. Ihre Kapazität reicht aus, um alle Frauen der Armee, der Verwaltung und in den Flüchtlingslagern und Spitälern gratis mit zehn Binden pro Monat zu versorgen.
Die Existenz einer solchen Fabrik – in einer solch schwierigen Kriegssituation – sagt auch einiges aus über die Stellung der Frau in den befreiten Gebieten. Ein wichtiges Ziel der Landreform war es, auch den ledigen und verwitweten Frauen Zugang zum Landbesitz zu ermöglichen. In allen Werkstätten, Schulen. Dorfversammlungen und auch in der Armee finden wir die Frauen gleichberechtigt vertreten. Immer wieder erstaunen das selbstbewusste Auftreten der Frauen und die natürlichen Umgangsformen zwischen den Geschlechtern – dies nicht nur, wenn man sie mit der Situation zum Beispiel im Sudan vergleicht, sondern auch im Vergleich mit europäischen Massstäben. Auf meine Frage, ob die gleichberechtigte Stellung der Frau nicht nur eine Folge des Krieges sei und darum nach Beendigung des Krieges wieder aufhören würde, antwortet Chuchu, eine junge Lehrerin: »Für die Stellung der Frau ist es bedeutsam, dass der Krieg nun schon 26 Jahre dauert. So hat sich eine ganze Generation von Frauen und Männern an die neue Stellung der Frau gewöhnt. Dies kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.«
Unabhängigkeit von West und Ost
Die Bemühungen für eine neue Stellung der Frau, die konsequent durchgeführte Landreform, der Versuch einer Entwicklungspolitik der ›self-reliance‹ und auch die Anstrengungen auf kulturellem Gebiet zeigen, dass es den Kämpfern der EPLF nicht nur um eine territoriale Unabhängigkeit oder administrative Autonomie geht, sondern um den Aufbau einer neuen, von West und Ost unabhängigen Gesellschaft. Dies ist auch einer der Gründe, warum die Eritreer von niemandem unterstützt werden. Ihr Beispiel könnte ja Schule machen in der Dritten Welt. Der ehemalige tansanische Wirtschaftsminister, Abdul Rahman Babu, der Eritrea bereits zweimal besucht hat, äusserte sich zum eritreischen Experiment wie folgt: »Ich habe in Eritrea die Zukunft Afrikas gesehen – und sie funktioniert!«
Was Eritrea zu seinem Funktionieren aber von allem braucht, ist Frieden. Die Verantwortlichen der EPLF und der ERA sind sich in der Beurteilung der Lage einig. Sowohl die Dürre der vergangenen Jahre als auch die Heuschreckenplage des Jahres 1987 hätten sich unter normalen, das heisst friedlichen Bedingungen nicht dermassen verheerend auswirken können. Es gilt darum, alles zu tun, den Krieg in Eritrea zu beenden.
Die EPLF hat dazu schon verschiedentlich konkrete Vorschläge zur politischen Lösung des Konflikts gemacht, doch setzt die äthiopische Seite noch immer auf die militärische Lösung. Sie kann das trotz der katastrophalen militärischen und wirtschaftlichen Lage des Landes tun, solange sie massive Waffenhilfe aus der Sowjetunion und bedingungslose Hungerhilfe aus dem Westen erhält.
6 erschienen im ›Tages Anzeiger‹ vom 1. Oktober 1987, S. 65