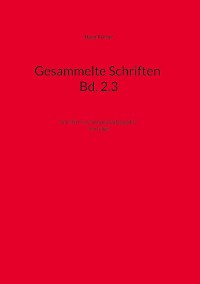Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Gesammelten Schriften von Hans Furrer enthalten alle seine zwischen 1969 und 2021 erschienenen Schriften aus seinen verschiedensten Fachgebieten. Der Band 2.1 der Gesammelten Schriften enthält die verschiedensten grundsätzlichen Beiträge des Autors zur Sonderpädagogik unter anderem seine Dissertation, seine Beiträge zur Gentechnologie und Behinderung und zur Sexualität von beeinträchtigten Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt Bd. 2.1
Vorwort zum Band 2
Teil I Grundsätzliches
Annäherungen an einen Behinderungsbegriff des kommunikativen Handelns
(
1986
)
Vorwort
I Der Begriff der Behinderung
II Das Menschenbild bei Marx
III Arbeit und Behinderung
IV Kritik des Arbeitsparadigmas
V Die Theorie des kommunikativen Handelns
VI Erste Annäherung an einen Behinderungsbegriff des kommunikativen Handelns
VII Lebenswelt und System
VIII Zweite Annäherung an einen Behinderungsbegriff des kommunikativen Handelns
Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer (1991
)
Vorrede
Ist Gentechnologie nicht vielmehr Gentechnokratie (1988
)
Der Mensch im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1989
)
Der Baum der Erkenntnis ist nicht der Baum des Lebens (1990
)
Fragmente zu einem Diskussionsbeitrag (1990
)
Ein Obligatorium der pränatalen Diagnostik verhindern (1990
)
Was heisst heute behindert sein, bzw. ein behindertes Kind zu haben? (1990
)
El sueño de la razón produce monstruos (1991
)
Didaktische und methodische Überlegungen zur Inklusion in der Erwachsenenbildung (2013
)
Die negative Dialektik der Inklusion (2021
)
Freundschaft – Liebe – Sexualität
(
1994
)
Vorrede
I Einleitung
II Grundsätzliche Überlegungen zur Sexualität
III Die psychosexuelle Entwicklung
IV Zusammenhänge zwischen verschiedenen Entwicklungsbereichen
V Sexualität und Entwicklungsbeeinträchtigung
Vorwort zu Band 2
Ein zentraler Aspekt meiner Arbeit war stets auch die Bildung von und mit kognitiv beeinträchtigten Erwachsenen. Ausgangspunkt war dabei der Aufbau und die Leitung der Volkshochschule für kognitiv beeinträchtigte Erwachsene im Kanton Bern von 1983 bis 1999, der heutigen ›Volkshochschule plus‹. Dabei war es mir wichtig, an dieser Volkshochschule nicht nur organisatorisch und administrativ tätig zu sein, sondern ich war von Beginn an auch als Kursleiter tätig. Diese Tätigkeit habe ich auch nach meinem Ausscheiden aus der Leitung der Volkshochschule weitergeführt und bis ins Jahr 2014 weiterhin Kurse geleitet, insbesondere Bildungsreisen in europäische Ausland. Auch diese Arbeit schlug sich einigen Artikeln nieder.
Weiter war es mir wichtig, dass die Kursleitenden in der Erwachsenenbildung mit entwicklungsbeeinträchtigten Menschen eine gute Ausbildung erhielten und habe darum in allen deutschsprachigen Ländern an der Aus-und Weiterbildung von Kursleitenden mitgewirkt.
In diesem Zusammenhang war (und bin) ich auch Mitglied der ›Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung‹ in Deutschland und einige Zeit auch im Präsidium der Gesellschaft und als Redakteur der Zeitschrift der Gesellschaft tätig.
Ein grosser Teil der in diesem Band gesammelten sonderpädagogischen Schriften kreist denn auch um die Bildung von entwicklungsbeeinträchtigten Erwachsenen.
Im Band 2.1 sind einige grundsätzliche Arbeiten, wie meine Dissertation zu einem Behinderungsbegriff des kommunikativen Handelns, einige Arbeiten über pränatale Diagnostik und Behinderung, zur Behinderten-Soziologie sowie ein grundsätzlicher Beitrag zur Inklusion gesammelt. Weiter enthält er auch das, zusammen mit Daniela Dittli herausgegebene Buch zur Sexualität von entwicklungsbeeinträchtigten Erwachsenen.
Im Band 2.2 sind alle meine Artikel in der Zeitschrift ›Erwachsenenbildung und Behinderung‹ erschienenen Artikel und verschiedene Essays zur Sonderpädagogik gesammelt, während der Band 2.3 alle meine Vorträge enthält, zu denen noch die entsprechenden Unterlagen gefunden werden konnten.
Die Arbeiten wurden grundsätzlich im Original übernommen. An einigen wenigen Stellen wurden aktuelle Anmerkungen gemacht und als solche gekennzeichnet.
Teil I
Grundsätzliches
Annäherungen an einen
Behinderungsbegriff
des kommunikativen Handelns
Dissertation 19861
Abhandlung
zur Erlangung der Doktorwürde
der Philosophischen Fakultät I
der Universität Zürich
vorgelegt von
HANS FURRER
von Lungern OW
1 Die Dissertation wurde bei Prof. Andreas Bächtold eingereicht und im Frühling 1896 mit dem Prädikat ›cum laude‹ angenommen.
Vorwort
a) Seit dem Wintersemester 1983 arbeitet am Sonderpädagogischen Institut der Universität Zürich eine studentische Arbeitsgruppe mit dem Thema ›Behinderte in der Dritten Welt2‹, die ihre Ergebnisse an verschiedenen Orten vorgestellt hat. Bei der Gründung der Arbeitsgruppe wurde, wie sich bereits beim Einführungsreferat von Prof. Dr. G. Heese herausstellte, fälschlicherweise ein gewisser Konsens darüber vorausgesetzt, was Behinderung sei. Im Interesse einer guten Zusammenarbeit wurde diese Begriffsklärung immer wieder unter den Tisch gewischt oder nur von Einzelnen einseitig unternommen. Grundsätzlichere Überlegungen zu einem Behinderungsbegriff für die Dritte Welt habe ich mir in einem Referat anlässlich der Pressekonferenz zur Eröffnung der Ausstellung ›Behinderte in der Dritten Welt‹ an der Universität Zürich gemacht. Im Folgenden sei ein längerer Auszug aus diesem Referat wiedergegeben, da es im Keime bereits viele der in der vorliegenden Arbeit entwickelten Gedanken enthielt, wenn auch noch begrifflich und systematisch mangelhaft:
Ausgehen möchte ich dabei vom Begriff der Behinderung, wie er heute in der wissenschaftlichen Literatur der ›Ersten Welt‹ gebräuchlich ist. Trotz der Vielfalt dieser Definitionen wird wohl keine der Situation in der Dritten Welt gerecht werden können. Ich möchte dies an zwei gegensätzlichen Definitionen der Behinderung darlegen. Die erste stammt von Wolfgang Jantzen:
Behinderung [wird] überhaupt erst existent, indem Merkmale und Merkmalskomplexe eines konkreten Individuums [...] aufgrund sozialer Interaktion und Kommunikation in Bezug gesetzt werden zu jeweiligen gesellschaftlichen Minimalvorstellungen über individuelle und soziale Fähigkeiten.3
Dieser von einem marxistischen Ansatz ausgehende Begriff der Behinderung greift in der konkreten Situation der Dritten Welt doppelt daneben, je nachdem, welche der verschiedenen ökonomischen Ebenen man betrachtet. So kann eine Person, die bei uns aufgrund ihrer Behinderung als ›Arbeitskraft minderer Güte‹, wie Jantzen sich aus/drückt, betrachtet würde, in der einfachen Agrargesellschaft, z.B. in einem Dorfe Westafrikas, als vollwertige Arbeitskraft angesehen werden. D.h. in einer solchen Situation gäbe es praktisch keine Behinderten. Betrachtet man hingegen die technologisch modernsten Produktionsweisen eines Dritt-Welt-Landes und ihre Minimalforderungen an das Individuum, so kämen wir zum Ergebnis, dass fast die gesamte Bevölkerung der Dritten Welt behindert ist.
Zu einem ähnlichen Resultat kommen wir, wenn wir die Definition von Gerhard Heese beiziehen:
Eine Behinderung liegt [...] vor, wenn einem Individuum eine Schädigung widerfuhr, und wenn daraus Lebenserschwerungen erwachsen und Entwicklungsdeviationen hervorgingen.‹4
Nach dieser Definition müsste wieder praktisch die gesamte Bevölkerung der Dritten Welt als behindert gelten, insbesondere dann, wenn, wie Heese dies vorschlägt, auch soziogenetische Schädigungen einbezogen werden: ›auch entwicklungsabträgliche Sozialisationsbedingungen können einen Menschen derart schädigen, dass das Ergebnis, die sozialkulturelle Deprivation, einem Organschaden im Gewicht durchaus gleichkommen kann‹5. Obwohl uns also auch dieser Ansatz begrifflich nicht weiterführt, möchte ich kurz hier verweilen, um seine Tragweite aufzuzeigen. ›Entwicklungsabträgliche Sozialisationsbedingungen‹ liegen in der Dritten Welt auf zwei Ebenen vor, nämlich auf der psychischen und der materiellen Ebene:
In den meisten Ländern der Dritten Welt finden wir heute Sozialisationsbedingungen, die es den Heranwachsenden nicht gestatten, eine Identität und damit eine intakte Persönlichkeit herauszubilden. Neben der Erziehung in ihrer Familie, im Dorf, die auch schon nicht mehr als zusammenhängendes Ganzes erfahren werden kann, erhalten sie in der nach europäischen Mustern geführten Schule eine Erziehung, die auf der Negation der traditionellen Kultur, auf der Negation aller Werte und Normen der vorschulischen Sozialisation beruht6. Das persönliche Vorankommen hängt ab von der Übernahme der ›weissen‹ Verhaltensnormen. Während die eigene Kultur als minderwertig, schwach und dem Zerfall geweiht erfahren wird, erfahren sie auf der anderen Seite täglich, dass sie die so erstrebenswerte weisse Kultur trotz aller Anstrengungen nie erreichen werden. In dieser Situation beginnen sie einen Komplex von Gefühlen aufzubauen, die von Scham über Selbsthass bis zu Fatalismus und Resignation reichen. Dass diese Sozialisationsbedingungen zu einer Persönlichkeitszerstörung führen, die nach Heese einem ›Organschaden im Gewicht durchaus gleichkommen‹, wird jeder bestätigen können, der sich einige Zeit in der Dritten Welt aufgehalten hat7.
Diese Formen der psychischen Behinderung haben wir in unserer bisherigen Arbeit [...] nicht behandelt. Wir haben uns auf den scheinbar weniger komplexen Sachverhalt der verschiedenen Körperbehinderungen beschränkt. Scheinbar weniger komplex, weil auch hier die konkreten ökonomischen oder politischen Verhältnisse für den Körperbehinderten völlig verschiedene Auswirkungen haben können. Dies sei kurz an einem der seltenen positiven Beispiele dargelegt:
Bei einem kürzlichen Besuch in den befreiten Gebieten des Demokratischen Kampuchea besuchte ich auch eine Prothesenwerkstätte, die von Kriegsverletzten selbst betrieben wurde. Was dabei auffiel, war nicht nur ihre gelungene Integration in die Dorfstrukturen, sondern vor allem ihr hohes Sozialprestige und ihr Selbstbewusstsein. Dies rührte wohl daher, dass sie ihre Behinderung im Gesamtrahmen des Kampfes gegen die vietnamesische Besatzerarmee in einen Sinnzusammenhang stellen konnten. Da sie bei der Verteidigung der materiellen und kulturellen Werte ihres Volkes verletzt und damit behindert wurden, stehen sie bei der Bevölkerung in hohem Ansehen, was ihre Behinderung mit weniger psychischen Folgen ertragen lässt.8
In dieser begrifflichen Ratlosigkeit blieben wir über längere Zeit stehen. Auch ich befasste mich nicht mehr weiter mit dem Versuch einer theoretischen Fassung des Behindertenbegriffs. Hingegen sah ich in meiner Praxis als Lehrer an der Sonderschule der Stadt Zürich für Sehbehinderte und Blinde immer klarer, worauf es bei einem Behinderungsbegriff nicht ankam, nämlich um die Feststellung der Schädigung. Immer bewusster wurde mir, dass Behinderungen stets mit einer mangelnden Ich-Identität verbunden sind, dass diese aber unabhängig von der konkreten Schädigung eintritt.
Da ich mich in der Zwischenzeit in verschiedenen Seminaren und Lesegruppen mit der Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas befasst habe, versuchte ich die Entwicklung der Ich-Identität und deren mangelnde Ausprägung bei meinen Schülern von dieser Theorie her zu begründen. Ein erstes Resultat stellte ich im Oktober 1985 an einer Tagung des VBS (Verband der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen) in Nürnberg zum Thema ›Sehbehinderung und Rechenstörungen‹ vor. Als ich aufgefordert wurde, im Wintersemester 1985 in der Arbeitsgruppe ›Behinderte in der Dritten Welt‹ ein Referat über den Begriff der Behinderung zu halten, entstand der erste Entwurf für die vorliegende Arbeit. Als Marxist war es mir klar, dass ich Behinderung, und gerade Behinderung in der Dritten Welt, nur von einem gesellschaftstheoretischen Ansatz her definieren konnte. Jedoch war mir der Ansatz von Jantzen, den ich durch Raffael Wieler kennengelernt habe, von jeher zu eng, insbesondere, da er nicht verhindert hat, dass Jantzen bezüglich der Situation in der Sowjetunion völlig undiskutable Ansichten hat. Nach den Erfahrungen mit meinen Schülern und dem Erfolg meines Referats in Nürnberg, war es für mich klar, dass ein Behinderungsmodell nicht an den Resultaten der Forschungen von Habermas vorbeigehen durfte, dies umso mehr, als auch Prof. A. Bächtold in seiner Vorlesung über Behindertensoziologie im Sommersemester 85 versucht hat, Elemente von Habermas’ Theorie in die sonderpädagogische Theoriebildung einfliessen zu lassen.
Die vorliegende Arbeit wurde angegangen mit dem Ziel einer Synthese der Ansätze von Jantzen und Lucien Sève mit der Theorie des kommunikativen Handelns von Habermas. Im Laufe der Arbeit habe ich mich, vor allem dank der Beratung von Prof. A. Bächtold, zunehmend vom Ansatz Sèves gelöst. Zur Theoriebildung aber war dieses ›Durchgangsstadium‹ äusserst wichtig, so dass es sich rechtfertigt, es in der endgültigen Arbeit zu dokumentieren.
In einem begriffsklärenden Kapitel sollen die Begriffe ›Behinderung‹ und ›Schädigung‹ auseinandergehalten werden (I). Im Weiteren soll als Erstes das Behinderungsmodell von Jantzen vorgestellt werden, und zwar indem zuerst das Menschenbild bei Marx resümiert (II) und dann gezeigt wird, wie daraus das Persönlichkeitsmodell von Sève und schliesslich das Behinderungsmodell von Jantzen hergeleitet wird (III). Dann sollen Einwände aus verschiedenen Richtungen gegen das Arbeitsparadigma formuliert werden (IV), um dann die Theorie des kommunikativen Handelns von Habermas vorzustellen (V), die von sich behauptet, dass sie aus der Aporie des Arbeitsparadigmas hinausführe. In einer ersten Annäherung (VI) wurde versucht, die Persönlichkeitstheorie von Sève mit der Theorie des kommunikativen Handelns zusammenzufügen. Da dies nicht in sich stimmig geschehen konnte, wurden die auch bei Habermas zentralen Begriffe Lebenswelt und System eingeführt (VII) und von daher eine zweite Annäherung an einen Behinderungsbegriff des kommunikativen Handelns entwickelt (VIII), die zum Abschluss an der Sehschädigung und an einem konkreten Fallbeispiel veranschaulicht wird.
Die vorliegende Arbeit stellt nicht den Anspruch, die aufgeworfenen Probleme abschliessend geklärt zu haben, sondern ihre Ausarbeitung hat gerade den Zweck, eine Diskussion über das vorgestellte Behinderungsmodell in Gang zu bringen und seine Schwachstellen aufzuspüren und zu korrigieren oder Fehlendes zu ergänzen. Insbesondere muss sich ein solches Modell in der Praxis der Sonderpädagogik bewähren, was einerseits ich selbst in weiteren Untersuchungen, z.B. über Teilleistungsschwächen sowie über den Komplex der Behinderten in der Dritten Welt beabsichtige und, so hoffe ich, andererseits auch andere Sonderpädagogen, angeregt von meinem Modell, unternehmen werden. Ein Faktor scheint mir aber noch sehr wichtig. Obwohl ich versucht habe, die gesellschaftliche Dimension von Behinderung aufzuzeigen, kann mir der Vorwurf gemacht werden, mich auf das einzelne Individuum konzentriert zu haben. Aus diesem Grunde sollte besonders in der allgemein gesellschaftlichen Komponente der Behinderung noch weiter geforscht werden, was ich z.T. mit meinen geplanten Untersuchungen über Behinderung und Identität in der Dritten Welt beabsichtige. Eine Gesellschaftstheorie, die sich in diesem Zusammenhange anbietet, ist das Modell, das zur Zeit am Soziologischen Institut der Universität Zürich unter der Leitung von Prof. Volker Bornschier ausgearbeitet wird. Es geht von zwei gegenläufigen Grundantriebskräften der gesellschaftlichen Entwicklung aus, vom Streben nach Gleichheit und vom Streben nach Effizienz, zwei Kräften, die sich auch bei der Integration Behinderter im Wege stehen. Hier wäre interdisziplinäre Forschung von Nöten!
In diesem Sinne möchte ich an dieser Stelle auch dem Soziologen Martin Graf für seine ständige Bereitschaft danken, anstehende Probleme mit mir zu diskutieren. Sein analytischer Geist brachte mir viele Anregungen. Auch mit meiner Frau, Elisabeth Furrer-Kreski, konnte ich vor allem Probleme der Sozialisation besprechen und sie verstand es, mir etliche psychoanalytische Zusammenhänge zu erschliessen. Zudem mussten sie und unsere Tochter Isabel mich in den letzten eineinhalb Jahren oft entbehren. Für ihr Verständnis möchte ich ihnen danken.
Prof. A. Bächtold danke ich für seine einfühlende Beratung; wir konnten wirklich einen ›herrschaftsfreien Diskurs‹ im Habermas’schen Sinne führen.
Ein besonderer Dank gehört auch Frau Burisch-Wieler, die das Manuskript aufmerksam durchlas und korrigierte.
b) Um den Leser nicht durch zu weitreichende Exkurse in der Rezeption der Hauptgedankengänge zu behindern, wurden solche meiner Ansicht nach wesentliche Seitenlinien der Argumentation in Fussnoten skizziert. Ebenfalls im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Arbeit, habe ich sämtliche Zitate in deutscher Sprache in den Text verarbeitet. Wo solche Übersetzungen nicht vorhanden, bzw. nicht zugänglich waren, habe ich selbst übersetzt. In solchen Fällen habe ich das Originalzitat jeweils ebenfalls in einer Fussnote beigefügt.
Bei den bibliographischen Angaben bin ich folgendermassen vorgegangen:
wenn aus der Erstausgabe zitiert wurde, ist das Erscheinungsjahr angegeben, z.B. Jantzen (1978).
wenn aus einer späteren Ausgabe oder aus einer Übersetzung zitiert wurde, habe ich in der Bibliographie das Erscheinungsjahr der Erstausgabe in eckigen Klammern vorangestellt, z.B. bei der
Phänomenologie des Geistes
Hegel [1807]a (1983) und im Text nur dieses angegeben, d.h. (Hegel [1807]a), um den historischen Kontext, in welchem der Text geschrieben wurde, deutlich werden zu lassen.
2 Ergänzung 2022: Der Ausdruck ›Dritte Welt‹ wird heute als nicht mehr korrekt angesehen und durch den Begriff ›Der globalisierte Süden‹ ersetzt. Dies mag einige Berechtigung haben, doch hat der Begriff ›Dritte Welt‹ eine wichtige (welt)politische Bedeutung, die beim neuen Begriff verloren geht (vgl. dazu die Begriffsklärung in meiner Lizentiatsarbeit zur ›Interdependenz von Schule und Ökonomie in den Ländern der Dritten Welt‹ (Furrer (1984)a). Aus diesen Gründen lasse ich ihn hier unverändert stehen.
3 Jantzen (1978), S .37
4 Heese et al. (1976), S .426
5 Heese (1981), S. 17f
6 Vorzügliche Darstellungen dieses Sachverhaltes geben Bosse (1979), Parin et al. (1963) und natürlich vor allem Freire [1968]b. Wer an konkreten Beispielen, vorwiegend aus Mali (Westafrika) interessiert ist, vgl. Furrer (1984)a.
7 Albert Memmi, selbst von zwei verschiedenen Kulturen zerrissen, vergleicht diese ambivalenten Gefühle des Selbsthasses und des Hasses auf den Kolonisator mit dem ambivalenten Verhältnis zu Spitznamen:
Beständig konfrontiert mit diesem Bild von sich, das ihm in den Institutionen wie bei jedem menschlichen Kontakt entgegengehalten und aufgezwungen wird, wie sollte er darauf nicht reagieren? Es kann ihm unmöglich gleichgültig und äusserlich bleiben wie eine Beschimpfung, die mit dem nächsten Windstoss wieder davonweht. Am Ende erkennt er es an, wie einen Spitznamen, der ihm zum verhassten, aber immerhin vertrauten Signal geworden ist. (Memmi [1966]b, S. 87)
Eine ebenfalls sehr anschauliche, belletristische Schilderung dieser Zerrissenheit gibt Paul Parin in seinem neuesten Buch, ›Zu viele Teufel im Land‹ (Parin (1985))
8 Furrer (1986)b
I Der Begriff der Behinderung
Von den verschiedenen Behinderungsmodellen ist auch heute immer noch, trotz massiver Kritik, das medizinische Modell das verbreitetste. Es schreibt einer Behinderung eine spezifische, im Patienten lokalisierte Ursache zu. Der Behinderte ist nicht mehr ein Subjekt, sondern ein mit einem Defekt behaftetes Objekt, ja er wird praktisch mit dem Defekt gleichgesetzt. Während das medizinische Modell vor allem noch in der Diagnostik, der Klassifikation und der Gesetzgebung angewandt wird, steht es in der sonderpädagogischen Theoriebildung unter stetem Beschuss. Ziemlich weit-gehend hat sich dort die Erkenntnis durchgesetzt:
Es gibt keine Behinderung ›an sich‹, – im ahistorischen, unpolitischen, beziehungslosen Raum. Behinderungen erschliessen sich für die Heilpädagogik als psychosoziales Funktionsnetz, nicht als ein ›Gegenstand‹.9
Darin aber, wie dieses Funktionsnetz strukturiert ist, unterscheiden sich die einzelnen Theorien der Behinderung noch sehr wesentlich. Immerhin ist eine, zwar nicht begriffliche, sondern sachliche Übereinstimmung festzustellen. Es wird in zunehmendem Masse unterschieden zwischen dem quasi ›objektiven‹ körperlichen, psychischen oder sozialen Schaden und dem daraus entstehenden Behinderungszustand. Im Folgenden werde ich mich an die Terminologie halten, wie sie Wieler, im Rückgriff auf Jantzen vorschlägt:
Schaden, Mangel, Defekt sind eindeutig bestimmbare Kausalfaktoren oder Kausalkomponenten, die einem pathogenen Sozialisationsprozess zugrunde liegen.
Schädigung oder Beeinträchtigung sind Ausdruck eines pathogenen Sozialisationsprozesses, der durch einen Defekt wohl eingeleitet sein kann, der sich aber zu jedem Zeitpunkt aus einem differenzierten Wechselverhältnis von Biologischen und Sozialem bestimmt.
Behinderung ist eine diesen Prozess definitorisch abschliessende und zusätzlich beeinflussende soziale Variable.
Störung ist als zusätzlicher Begriff dann von Nutzen, wenn er wie Behinderung als definitorische und zusätzlich beeinflussende soziale Variable verstanden wird. Er deckt jene Abschnitte des pathogenen Sozialisationsprozesses ab, die zwar sozial sichtbar werden, die Kennzeichnung ›Behinderung‹ aber noch nicht rechtfertigen.
10
Wenn nun z.B. Bleidick von »Bildungsbehinderung aufgrund von Sehschädigung, [...] Bildungsbehinderung aufgrund von Hörschädigung« usw. spricht11 , meint er in unserer Terminologie eigentlich Sehschaden, bzw. Hörschaden. Er verlegt daher die Ursachen für eine Behinderung auch ganz klar in das Individuum hinein. Aufgrund des im Individuum lokalisierten Schadens weisen diese »eine Erschwerung des Erziehungsprozesses in Richtung auf eine Störung der Bildsamkeit« 12 auf. Das Umfeld der geschädigten Individuen wird nicht berücksichtigt.
Auf der anderen Seite verlegt das Modell des Labeling Approach die Bedingungen für die Entstehung einer Behinderung ganz einseitig auf die Umgebung, die dem Geschädigten die Behinderung zuschreibt oder wie bei Häberlin in das System, das durch die Dysfunktionalität des Geschädigten behindert wird:
Ein unmittelbar beobachtbares abweichendes Merkmal eines Menschen wird dann zu einer gesellschaftlich anerkannten Behinderung, wenn durch das Merkmal gesellschaftliche Einrichtungen behindert werden.13
Oder:
ein Mensch ohne unmittelbar beobachtbares abweichendes Merkmal wird dann als Behinderter behandelt, wenn er eine wichtige gesellschaftliche Einrichtung stört«14.
Obwohl dieser Etikettierungsansatz für den Umgang mit Behinderungen äusserst fruchtbar war und wichtige Erkenntnisse gebracht hat, setzt er meiner Meinung nach die Ursachen für die Behinderung allzu einseitig in den Umweltbedingungen des Geschädigten fest und beachtet die aktive Rolle, die das Individuum im Identitätsfindungsprozess spielt, zu wenig. Ein Vorwurf, der sich, wie wir sehen werden (vgl. III.2), auch Jantzen gefallen lassen muss, der Behinderung definiert an den »jeweiligen gesellschaftlichen Minimalvorstellungen über individuelle und soziale Fähigkeiten«15.
Gegenüber den bisherigen Definitionen hat diejenige Heeses16 den Vorteil, dass sie aktive und passive Bedingungen für die Entstehung einer Behinderung aus einem Schaden berücksichtigt. Ein Schaden wird nach Heese dann zur Behinderung, wenn er Lebenserschwerungen und desintegrierende Elemente hervorruft. Im Einzelnen beschreibt Heese:
Lebenserschwerungen:
einmal als im dinglichen Bereich fassbare Lebenserschwerung
und weiter als intrapsychische Belastung
schliesslich als Summe sozialer Abhängigkeit
17
sowie desintegratives Verhalten der Umwelt und einmal:
über
Zuschreibung
dann über Ausschlusstendenzen [...] woraus in jedem Falle ein gewisses Mass an Marginalisierung entsteht.
18
Anders formuliert könnte man sagen, dass das geschädigte Individuum durch erschwerte Auseinandersetzung mit den drei Bereichen objektive Welt, soziale Welt und subjektive Welt in seiner Persönlichkeitsentwicklung behindert wurde. Damit ist auch die Einengung auf die reine Bildsamkeit19 wie sie aus dem verengten Gesichtsfeld der Heilpädagogik als Pädagogik, begreifbar ist, überwunden. Behinderung ist nicht nur ein Resultat der »Erschwerung des Erziehungsprozesses in Richtung auf eine Störung der Bildsamkeit«20 , sondern eine Erschwerung des Sozialisationsprozesses in Richtung auf eine Störung der Persönlichkeit.
Dies hat Jantzen bereits berücksichtigt – direkt, indem er von ›beschädigter Persönlichkeit‹ spricht, indirekt, indem er Behinderung ausdrücklich in Bezug auf ein Persönlichkeitsmodell definiert, nämlich in Bezug auf das Persönlichkeitsmodell von Sève. Die Beschränktheit dieses Persönlichkeitsmodells, und damit auch des Behinderungsbegriffs von Jantzen, rechtfertigt es, von einem erweiterten Persönlichkeitsmodell aus, die Definition von Behinderung nochmals anzugehen.
9 Kobi (1976), S. 1
10 Wieler (1982), S. 42
11 Bleidick (1983), S. 128
12 Bleidick (1983), S. 128
13 Häberlin (1978), S. 725
14 Häberlin (1978), S. 725
15 Jantzen (1977), S. 195
16 vgl. Heese (1981), S. 17ff
17 Heese (1981), S. 18
18 Heese (1981), S. 18f
19 vgl. Bleidick (1983) und Heese (1981)
20 Bleidick (1983), S. 128
II Das Menschenbild bei Marx
Es ist aus zwei Gründen schwierig, und dementsprechend oft und von verschiedenen Standpunkten her versucht worden, aus dem umfangreichen Werk von Marx und Engels ein detailliertes Menschenbild herauszukristallisieren.
Einerseits haben Marx und Engels ihr Menschenbild nie klar positiv formuliert, sondern wir finden Äusserungen dazu meist in Abgrenzung zu anderen Philosophen bzw. Ökonomen verstreut im ganzen Werk. Aus diesen meist negativ und oft polemisch gehaltenen Sequenzen kann nur mit grossem hermeneutischen Aufwand ein stimmiges, in sich geschlossenes Menschenbild zusammengesetzt werden.
Andererseits verschob sich der Schwerpunkt der Auseinandersetzung um das ›Wesen des Menschen‹ im Verlaufe der Entwicklung des Marxs’chen Gedankengebäudes, so dass zwei (evtl. sogar drei) Phasen unterschieden werden können. Vor allem dieser Sachverhalt hat zu den verschiedensten Interpretationen des Marx’schen Menschenbildes und zu grundsätzlichen Auseinandersetzungen geführt. Am bedeutendsten ist wohl dabei die Auseinandersetzung innerhalb der Kommunistischen Partei Frankreichs, mit den Wortführern Garaudy und Althusser, die kurz auf folgenden Nenner gebracht werden kann:
Die ›humanistische‹ Position Garaudys behauptet eine Kontinuität des Marx’schen Werks von den Frühschriften bis zum Kapital. Eine Kontinuität, deren wesentliches Element die bereits in den Frühschriften entwickelte These vom Menschen als dem ›Subjekt der Geschichte‹ ist. Im geschichtlichen Prozess wird der Mensch von den Auswirkungen der selbst produzierten Entfremdung gezwungen, den paradiesischen Zustand der Selbstverwirklichung wiederherzustellen.21
Demgegenüber postuliert die ›antihumanistische‹ Position Althussers einen radikalen Bruch zwischen den Frühschriften, die er als vormarxistisch bezeichnet, und den Hauptwerken, vor allem dem Kapital. Althusser behauptet, dass Marx sich 1845 völlig von der Problematik des ›menschlichen Wesens‹ abgewandt habe und dass in diesbezüglichen Textstellen in den späteren Werken, wie sie unter anderem von Garaudy angeführt werden, nur zeitweilige ideologische Überbleibsel zu sehen seien. Nicht mehr der Mensch, sondern die ökonomischen Strukturen stünden im Zentrum der Untersuchungen von Marx22; von diesen Positionen aus ist es dann nicht mehr weit zu strukturalistischen Auffassungen des Marxismus, wie sie von Godelier23 und Lévi-Strauss24 vertreten werden.
Ich werde im Folgenden eine Zwischenposition einnehmen, die aber wohl etwas näher bei Garaudy beheimatet ist, eine Position, wie sie ähnlich auch von Bloch oder von der Kritischen Theorie vertreten wird. Ich stelle zwar mit Althusser einen klaren Einschnitt in den Marx’schen Werken fest, der mit der Deutschen Ideologie25 vollzogen wurde. Im Gegensatz zu Althusser aber sehe ich darin nur eine radikale Änderung des Standpunkts der Analyse, deren Inhalt nach wie vor der Mensch darstellt. In den folgenden Abschnitten soll dies an den drei Phasen der Entwicklung des Menschenbildes dargestellt werden. Zuerst soll (1) das Menschenbild in den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten26 und anderen Frühschriften dargestellt werden, in welchen es Marx vor allem um eine Abgrenzung gegenüber dem idealistischen hegelschen Menschenbild geht. In den Feuerbachthesen27 und der Deutschen Ideologie geht es Marx um die Abgrenzung von abstrakten Auffassungen über das Gattungswesen Mensch, d.h. um den wirklichen, realen Menschen (2). In den Grundrissen 28 und dem Kapital 29 grenzt er seine Untersuchungen ein, indem er ›Realabstraktionen‹ wie Wert, Arbeit usw. analysiert (3). Von dieser Warte aus soll in einem letzten Abschnitt (4) eine dieser Realabstraktionen, nämlich die Arbeit als konstitutives Element des ›menschlichen Wesens‹, in ihrer Entwicklung betrachtet werden.
1. Das Menschenbild in den Frühschriften
In seinen Frühschriften, insbesondere in den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten30 , befasst sich Marx mit dem ›Wesen des Menschen‹. Marx verwendet hier noch die damals übliche hegelsche Terminologie, doch scheint es mir wichtig, sich nicht davon gefangen nehmen zu lassen; umso mehr, als Marx selbst sich bereits zwei Jahre später von dieser Terminologie distanziert:
Da dies damals noch in philosophischer Phraseologie geschah, so gaben die hier traditionell unterlaufenden philosophischen Ausdrücke, wie ›menschliches Wesen‹, ›Gattung‹ pp. den deutschen Theoretikern die erwünschte Veranlassung, die wirkliche Entwicklung zu missverstehen und zu glauben, es handle sich hier
wieder nur um eine neue Wendung ihrer abgetragenen theoretischen Röcke.31 Im Folgenden soll es darum gehen, den wirklich neuen Gehalt solcher Ausdrücke wie ›menschliches Wesen‹, ›Gattungswesen‹ usw. bei Marx aufzuspüren. Dabei stösst man auf die Schwierigkeit, dass Marx selbst diese Ausdrücke durchaus nicht einheitlich verwendete. Einerseits braucht Marx den Begriff ›Wesen‹ im Sinne von ›Lebewesen‹, z.B. wenn er den Menschen als Naturwesen definiert:
Als Naturwesen und als lebendiges Naturwesen ist er teils mit natürlichen Kräften, mit Lebenskräften ausgerüstet, ein tätiges Naturwesen; diese Kräfte existieren in ihm als Anlagen und Fähigkeiten, als Triebe; teils ist er natürliches, leibliches, sinnliches, gegenständliches Wesen ein leidendes, bedingtes und beschränktes Wesen, wie es auch das Tier und die Pflanze ist, d.h. die Gegenstände seiner Triebe existieren ausser ihm, als von ihm unabhängige Gegenstände; aber diese Gegenstände sind Gegenstände seines Bedürfnisses, zur Betätigung und Bestätigung seiner Wesenskräfte unentbehrliche, wesentliche Gegenstände.32
Bereits hier – im Ausdruck ›Wesenskräfte‹ – braucht Marx nun den Ausdruck ›Wesen‹ in seiner zweiten Bedeutung. Der Mensch ist also ein Lebewesen, wie Tiere und Pflanzen. Wesentlich, d.h. zur Unterscheidung seines Wesens vom Tier wichtig, ist, dass er
seine Lebenstätigkeit selbst zum Gegenstand seines Wollens und seines Bewusstseins (macht). Er hat bewusste Lebenstätigkeit. Es ist nicht eine Bestimmtheit, mit der er unmittelbar zusammenf1iesst. Die bewusste Lebenstätigkeit unterscheidet den Menschen unmittelbar von der tierischen Lebenstätigkeit Marx.33
In dieser zweiten Bedeutung des ›Wesens des Menschen‹ meint Marx quasi die differentia specifica, d.h. das, was die Gattung ›Mensch‹ von den anderen Lebewesen unterscheidet. Er braucht dafür später auch den Begriff der ›Natur des Menschen‹ und unterscheidet genau zwischen dem wirklichen, jetzt lebenden, verstümmelten Menschen und dem ›wahren‹ Menschen, dem Menschen, den es zu bilden gilt, nämlich den Menschen, der seinem Wesen entspricht. Dieser wahre Mensch ist nun aber bei Marx nicht wie bei Hegel ein Gedankenwesen, sondern ein Lebewesen, das sich konkret mit der Welt auseinandersetzt. Es ist das Wichtigste an den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten, dass sich Marx von dieser hegelschen Art der Abstraktion absetzt, für die ist
nur der Geist [...] das wahre Wesen des Menschen, und die wahre Form des Geistes ist der denkende Geist, der logische, spekulative Geist. Die Menschlichkeit der Natur und der von der Geschichte erzeugten Natur, der Produkte des Menschen, erscheint darin, dass sie Produkte des abstrakten Geistes sind und
insofern also geistige Momente, Gedankenwesen.34
In dieser Kritik an Hegel stützt sich Marx ganz vehement auf Feuerbach, von dem er sagt, dass er den »Begriff der Menschengattung aus dem Himmel der Abstraktion auf die wirkliche Erde herabgezogen«35 hat. Während sich also Marx in seinen Frühschriften in der Auseinandersetzung mit Hegel auf den Materialismus Feuerbachs stützt, greift er in der Auseinandersetzung mit dem mechanisch-materialistischen Element bei Feuerbach in den Feuerbachthesen und der Deutschen Ideologie auf die Dialektik Hegels zurück.
2. Die Wende seit der ›Deutschen Ideologie‹
Während Marx also mit Feuerbach gegen die idealistischen Abstraktionen Hegels argumentiert, wendet er nun, zusammen mit Engels, die Hegelsche Dialektik gegen Feuerbach und die anderen ›neuen deutschen Philosophen‹. In der folgenden Darstellung dieser Kritik will ich mich auf die Auseinandersetzung mit Feuerbach beschränken, »weil er der Einzige ist, der wenigstens einen Fortschritt gemacht hat und auf dessen Sachen man de bonne foi eingehen kann«36, denn er hat
den grossen Vorzug vor den ›reinen‹ Materialisten, dass er einsieht, wie auch der Mensch ›sinnlicher Gegenstand‹ ist; aber abgesehen davon, dass er ihn nur als ›sinnlichen Gegenstand‹, nicht als ›sinnliche Tätigkeit‹ fasst, da er sich auch hierbei in der Theorie hält, die Menschen nicht in ihrem gegebenen gesellschaftlichen Zusammenhänge, nicht unter ihren vorliegenden Lebensbedingungen, die sie zu dem gemacht haben, was sie sind, auffasst, so kommt er nie zu den wirklich existierenden, tätigen Menschen, sondern bleibt bei dem Abstraktum ›der Mensch‹ stehen.37
Das sind denn auch die zwei wesentlichen Punkte der Marx’schen Kritik an Feuerbach: dass er den Menschen nicht als tätiges Wesen auffasst und dass er nicht den wirklichen Menschen, sondern ein Abstraktum betrachte. Obwohl diese beiden Kritikpunkte dialektisch zusammenhängen, will ich sie hier analytisch trennen. Mit dem tätigen Menschen, d.h. mit der Arbeit als konstitutivem Element des Menschen, befasse ich mich weiter unten (II.4); an dieser Stelle will ich auf den zweiten Punkt der Kritik eingehen und versuchen, von daher ein positives Menschenbild zu entwickeln.
Diese Kritik konzentriert sich um den in der 6. Feuerbachthese formulierten Sachverhalt:
Aber das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Feuerbach, der auf die Kritik dieses wirklichen Wesens nicht eingeht, ist daher gezwungen [...] von dem geschichtlichen Verlauf zu abstrahieren [...], und ein abstrakt isoliert menschliches Individuum vorauszusetzen.38
Der Mensch darf nicht als geschichtsloses, quasi ewiges Wesen betrachtet werden, denn einerseits ändert sich der Mensch im Verlaufe seiner Geschichte, er ist das Produkt der Geschichte.
Dank der einfachen Tatsache, dass jede neue Generation die von der alten Generation erworbenen Produktivkräfte vorfindet, die ihr als Rohmaterial für neue Produktion dienen, entsteht ein Zusammenhang in der Geschichte der Menschen, entsteht die Geschichte der Menschheit, die um so mehr Geschichte der Menschheit ist, je mehr die Produktivkräfte der Menschen und infolgedessen ihre gesellschaftlichen Beziehungen wachsen.39
Andererseits aber, und diese Dialektik ist entscheidend, ist »die erste Voraussetzung aller Menschengeschichte [...] natürlich die Existenz lebendiger menschlicher Individuen«40, denn ›die Geschichte‹ tut nichts, sie führt keine Kriege, baut keine Städte und Fabriken, sondern es ist der tätige Mensch, der dies tut, der die Geschichte macht. Da der wirkliche, existierende Mensch aber selbst Produkt dieser Geschichte ist, ist er sein eigenes Produkt, so wie er seine Lebensbedingungen produziert, produziert er sich selbst. Dies gilt nicht nur für sein leibliches Wesen, sondern umso mehr für sein Bewusstsein. Denn »das Bewußtsein kann nie etwas anderes sein als das bewusste Sein, und das Sein der Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozess«41. In diesem Sinne ist eben, wie Marx dies bereits in den ›Pariser Manuskripten‹ 42 formuliert hat, »die Geschichte der Industrie das aufgeschlagene Buch der menschlichen Wesenskräfte, die sinnlich vorliegende menschliche Psychologie«43. Von daher ist es nur konsequent, wenn Marx und Engels postulieren:
Wir, kennen nur eine einzige Wissenschaft, die Wissenschaft der Geschichte. Die Geschichte kann von zwei Seiten aus betrachtet, in die Geschichte der Natur und die Geschichte der Menschen abgeteilt werden. Beide Seiten sind indes nicht zu trennen; solange Menschen existieren, bedingen sich Geschichte der Natur und Geschichte der Menschen gegenseitig.44
und vor allem der erste Teil der Deutschen Ideologie ist nichts anderes als der erste Versuch, diese Naturgeschichte des Menschen zu schreiben, der im
Folgenden skizziert werden soll:
Die Menschen unterschieden sich von den Tieren, indem sie begannen, ihre Lebensmittel zu produzieren; damit produzierten sie ihr materielles Leben, Im Verlaufe der Menschheitsgeschichte entwickelten sich die verschiedensten Formen von Eigentum. Auf das Stammeseigentum folgte das antike Staats- und Gemeindeeigentum. Dieses rief die Teilung der Arbeit hervor. Diese war im feudalen und ständischen Eigentum wieder kleiner (denn der Bauer und Handwerker erledigte wieder ›ganze‹ Arbeiten). Die ständige Landflucht der entlaufenen Leibeigenen zwang die Handwerker, Zünfte zu bilden. In ihnen bildete sich das noch urwüchsige Kapital. Erst durch den Handel, den Zusammenschluss von Städten und damit verbunden durch die Spezialisierung zwischen den Städten entstand bei Händlern und Manufacturiers mobiles Kapital. Diese Entwicklung spaltete zwar erst die verschiedenen Fraktionen, subsumierte sie aber umso stärker unter die Klasse, wie sie auch die Arbeiter subsumierte. In der Manufaktur, und erst recht in der Industrie, trat an die Stelle des patriarchalischen Verhältnisses das Geldverhältnis zwischen Arbeiter und Kapitalist.
In diesem Rahmen sieht Marx nun das Individuum, den wirklichen, konkreten Menschen. Er ist Produkt dieser von ihm selbst geschaffenen Bedingungen. Dabei unterscheidet Marx zwischen dem Individuum als Person und »insofern es unter irgendeinen Zweig der Arbeit und die dazugehörigen Bedingungen subsumiert ist«45, d.h. zwischen Individuum und Klassenwesen.
Diesem Unterschied zwischen Individuum und Klassenwesen, den Marx hier andeutet, rückt er in seinem Spätwerk, den ›Grundrissen‹ und dem ›Kapital‹ zu Leibe, indem er die ökonomischen Kategorien als Realabstraktionen einführt.
Die Gestalten von Kapitalist und Grundeigentümer zeichne ich keineswegs in rosigem Licht. Aber es handelt sich hier um die Personen nur, soweit sie die Personifikation ökonomischer Kategorien sind, Träger von bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen. Weniger als jeder andere kann mein Standpunkt, der die Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation als einen naturgeschichtlichen Prozess auffasst, den Einzelnen verantwortlich machen für Verhältnisse, deren Geschöpf er sozial bleibt, so sehr er sich auch subjektiv über sie erheben mag.46
Wie sich die Einführung dieser Realabstraktionen auf das Marx’sche Menschenbild auswirkte, soll im folgenden Abschnitt untersucht werden.
3. Die Realabstraktionen als grundlegende Kategorien
Wenn wir ein gegebenes Land politisch-ökonomisch betrachten, so beginnen wir mit seiner Bevölkerung, ihrer Verteilung in Klassen, Stadt, Land, See, den verschiedenen Produktionszweigen, Aus- und Einfuhr, jährlicher Produktion und Konsumtion, Warenpreisen etc. Es scheint das Richtige zu sein, mit dem Realen und Konkreten, der wirklichen Voraussetzung, zu beginnen, also z.B. in der Ökonomie mit der Bevölkerung, die die Grundlage und das Subjekt des ganzen gesellschaftlichen Produktionsakts ist. Indes zeigt sich dies bei näherer Betrachtung als falsch. Die Bevölkerung ist eine Abstraktion, wenn ich z.B. die Klassen, aus denen sie besteht, weglasse. Diese Klassen sind wieder ein leeres Wort, wenn ich die Elemente nicht kenne, auf denen sie beruhn, z.B. Lohnarbeit, Kapital etc. [...]. Finge ich also mit der Bevölkerung an, so wäre das eine chaotische Vorstellung des Ganzen, und durch nähere Bestimmung würde ich analytisch immer mehr auf einfachere Begriffe kommen; von dem vorgestellten Konkreten auf immer dünnere Abstrakta, bis ich bei den einfachsten Bestimmungen angelangt wäre. Von da an wäre nun die Reise wieder rückwärts anzutreten, bis ich endlich wieder bei der Bevölkerung anlangte, diesmal aber nicht als bei einer chaotischen Vorstellung eines Ganzen, sondern als einer reichen Totalität von vielen Bestimmungen und Beziehungen.47
Mit diesem Beispiel wollte Marx aufzeigen, warum er in seiner Analyse der politischen Ökonomie nicht mit der Bevölkerung, mit dem Klima usw. beginnt, sondern mit den strukturell einfachsten, aber darum auch abstraktesten Kategorien, wie Wert, Ware, Arbeit usw. Weiter wollte er aber damit auch zeigen, dass diese seine Abstrakta nicht irgendwo in den Wolken oder im Hirn eines Stubengelehrten entstanden sind, sondern dass sie ihre reale, konkrete Entsprechung haben; dass alle diese Abstrakta einen konkreten Bezug auf die bestimmte geschichtliche Situation haben, in welcher sie analysiert werden, in diesem Sinne eben Realabstraktionen sind.
Dies gilt nun auch für die Marx’sche Analyse des Menschen. Sie kann nicht bei den Menschen oder dem Menschen ansetzen, weil diese Begriffe andere Begriffe wie ›Bedürfnisse‹, ›Tätigkeit‹, ›Bewusstsein‹ usw. voraussetzen. Diese abstrakten Begriffe aber müssen ihrerseits wieder konkret, d.h. in der geschichtlichen, gesellschaftlichen Situation, auf den wirklichen, realen Menschen bezogen sein, sind also Realabstraktionen. Erst nach der Analyse dieser realen Abstraktionen kann der wirkliche Mensch wieder aus ihnen rekonstruiert werden. Diese Arbeit der Rekonstruktion des Menschenbildes aus seinen Realabstraktionen konnte von Marx nicht mehr, oder zumindest nur in Ansätzen, geleistet werden.
Die wohl bedeutendste und am besten analysierte Realabstraktion des Marx’schen Menschen ist die Arbeit. Der Begriff und seine Bedeutung für ein sein Menschenbild soll im folgenden Kapitel dargestellt werden.
4. Der Begriff der Arbeit im Marx’schen Werk
Auch in seinen Ausführungen über die Arbeit als konstitutives Element des Menschen können zwei Denkansätze festgestellt werden. In den Pariser Manuskripten, den Feuerbachthesen und auch noch in der Deutschen Ideologie betont Marx, vor allem im Rückgriff auf und in Abgrenzung von Hegel, den emanzipationstheoretischen Gehalt der Arbeit ebenso wie deren Unterdrückung durch die entfremdeten Arbeitsverhältnisse (4.1). In den ökonomischen Schriften, den Grundrissen und dem Kapital, untersucht Marx nun mit Hilfe der realabstrakten Kategorien der konkreten und abstrakten Arbeit vor allem diese entfremdete Arbeitssituation (4.2). Entlang diesen beiden Argumentationslinien soll auch im Folgenden der Arbeitsbegriff entwickelt werden.
4.1 Arbeit als anthropologische Kategorie
Um den emanzipatorischen Gehalt des Marx’schen Arbeitsbegriffs, den er im Rückgriff, aber auch in Abgrenzung von Hegel entwickelt, ganz deutlich werden zu lassen, soll in einem ersten Abschnitt die Entwicklung des Arbeitsbegriffs bis zu Hegel erläutert werden. Dies kann an dieser Stelle nur skizzenhaft geschehen, wäre jedoch einer ausführlicheren Untersuchung wert48.
4.1.1 Der vorhegelsche Arbeitsbegriff
In vielen einfachen Kulturen wird die Arbeit, die tätige Auseinandersetzung mit der Natur, ganz anders bewertet als bei uns. Sehr eindrücklich ist ein Beispiel, in welchem J. Liedloff49 aus den Urwaldgebieten des Orinoco in Venezuela berichtet, wie sie und ihre zwei italienischen Kollegen mit einigen Indianern in äusserst harter Arbeit ein schweres Kanu über Felsgestein hinweg an einem riesigen Wasserfall vorbei transportieren mussten, eine Arbeit, vor der sie sich schon Tage im Voraus gefürchtet hatten.
Die Italiener waren angespannt, verzogen das Gesicht und verloren bei allem die Beherrschung; sie fluchten ununterbrochen in der für Toskaner charakteristischen Art. Die übrigen, alles Indianer, unterhielten sich prächtig. Sie lachten über die Schwerfälligkeit des Kanus und machten ein Spiel aus dem Kampf, sie entspannten sich zwischen den Stössen, lachten über die eigenen Kratzer und waren besonders erheitert, wenn das Kanu beim Vorwärtsschwanken mal den einen, mal den anderen unter sich festnagelte. Der Betroffene, mit nacktem Rücken gegen den sengenden Granit gepresst, lachte vor Freude über seine Befreiung unweigerlich am lautesten, sobald er wieder atmen konnte. Alle verrichteten die gleiche Arbeit, alle erfuhren Mühe und Schmerz. Es gab keinen Unterschied in unseren Situationen, nur hatte uns unsere Kultur den Glauben eingepflanzt, eine derartige Kombination von Umständen stelle auf der Skala des Wohlbefindens ein unbezweifelbares Tief dar; dass uns in der Angelegenheit eine Wahl blieb, war uns gar nicht bewusst.
Die Indianer andererseits, denen ebenfalls nicht bewusst war, dass sie eine Wahl getroffen hatten, befanden sich in besonders fröhlicher Geistesverfassung und genossen das kameradschaftliche Zusammenspiel; und natürlich waren ihnen die vorangegangenen Tage nicht durch lang angestaute Beunruhigung verdorben worden.50
Dieser uns fremden Auffassung der Arbeit steht die abendländische Tradition des Arbeitsbegriffs entgegen. In der griechischen Antike bestand ein krasser Gegensatz zwischen dem Bereich der ökonomischen Tätigkeiten und denjenigen Tätigkeiten, die die politische Substanz der Polis ausmachten: beraten, richten, Krieg führen, ...
Der Bürger der griechischen Polis zeichnete sich dadurch aus, dass er diese gesellschaftlichen Tätigkeiten universell beherrschte und alternativ ausführen konnte. Die Handwerker und Bauern hingegen verrichteten die niedere und vor allem spezialisierte Arbeit. Ihre Tätigkeiten gehörten nicht zur gesellschaftlichen Kultur. Innerhalb dieser niederen Tätigkeiten bestand nun aber ein wichtiger Unterschied zwischen der landwirtschaftlichen und der handwerklichen Arbeit. In der landwirtschaftlichen Arbeit fügt sich der Mensch in einer quasi rituellen Handlung in die natürliche, ihm überlegene, göttliche Ordnung ein.
Es geht nicht darum, der Natur ihre Früchte zu entreissen, sondern darum, der Göttin Demeter zu helfen, das natürliche Gleichgewicht zu erhalten. In der landwirtschaftlichen Tätigkeit steht der Mensch in direktem Kontakt mit den Göttern, bildet sich an ihnen und steht durch seine Arbeit bei ihnen in grösserer Gunst.
Anders die Handwerker, deren Seele, in der griechischen Auffassung, verkümmert, weil sie stets im Schatten ihres Hauses sitzen, und deren Körper neben dem warmen Feuer verweichlicht. Ihre Tätigkeit ist rein instrumentell ausgerichtet, ja sie werden selbst zu Instrumenten in den Händen der Verbraucher ihrer Gegenstände. Dies drückt sich auch dadurch aus, dass die handwerklichen Tätigkeiten in zunehmendem Masse von Sklaven und Metöken51 ausgeführt werden. Handwerkliche Arbeit wird zunehmend zu Knechtschaft, zu Zwang.
Die beiden Momente des griechischen Arbeitsbegriffs, Arbeit als Knechtschaft und Arbeit als Ritual, verbinden sich in den Paulinischen Briefen mit der jüdischen Überlieferung der Arbeit als Strafe, wie sie seit der Vertreibung aus dem Paradies als Fluch über der Menschheit lastet.52
Diese Verbindung formuliert Paulus vor allem im 2. Brief an die Thessalonicher aus, in seiner Warnung vor dem Müssiggang, der Gott nicht gefällig ist. Er ermahnt diejenigen, die unordentlich wandeln und nichts arbeiten, sie sollten »mit stillem Wesen arbeiten und ihr eigen Brot essen«53.
Solche und ähnliche Formulierungen sind es, die von Luther und Calvin aufgenommen wurden und die die protestantische Berufsethik geprägt haben, ja zum Teil noch heute prägen. Der verheerende Einfluss, den dieses Gedankengut mittels des Pietismus eines Francke und Wichern und ihrer Erziehungsinstitutionen bis heute in der Pädagogik, und vor allem in der Heimerziehung, ausübten, rechtfertigt es, noch näher auf diesen Arbeitsbegriff einzugehen.
Luther knüpft genau an die griechisch-christlichen Formulierungen des Paulus an, wenn er fordert, dass die Menschen
nicht müssig gehen, da muss fürwahr der Leib mit Fasten, Wachen, Arbeiten und mit aller lässiger Zucht getrieben und geübt seyn, dass er dem innerlichen Menschen und dem Glauben und Gehorsam gleichförmig werde, nicht hindere noch widerstrebe.54
Dabei ist es egal, welche Arbeit einer leistet, denn »die Werke aber sind todte Dinge, können nicht ehren noch loben Gott«55. Die Arbeit wird somit ein Mittel, um dem ›inneren Menschen‹ die Herrschaft über den ›äusseren Menschen‹ zu sichern. In diesem Sinne hat auch in den pietistischen Rettungsanstalten Wicherns, z.B. im ›Rauhen Haus‹, die Arbeit als rastloses Tun die Zöglinge vor dem Müssiggang zu bewahren und die Aufgabe, den Charakter zu bilden, durch die »nach festen technischen Regeln geordnete Übung des Willens und der Hand«56. Im Gegensatz zu modernen Auffassungen der Arbeit scheint es mir wichtig, zu betonen, dass diese Bildungsfunktion der Arbeit rein instrumentell und nicht etwa im Sinne der Selbstverwirklichung gesehen wird, denn die Werke werden von der Person getrennt. Die Person erfüllt sich nicht in den Werken, sondern sie muss den Werken vorangehen: »Also dass allewege die Person zuvor muss gut und fromm seyn vor allen guten Werken«57 .
Im Anschluss an Math. 7.17f. entwickelt Luther weiter den Gedanken, dass wer im Glauben an Gott seine Arbeit verrichte, auch im Beruf Erfolg haben werde. Er geht dabei jedoch nicht so weit wie nach ihm Calvin, der postulierte, dass sich gerade in dem beruflichen Erfolg erweise, ob einer auserwählt sei oder nicht. So konnte der Einzelne sich seines Gnadenstandes versichern, wenn er durch asketische und methodische Lebensführung zu Gottes Ruhm arbeitend seine Reichtümer vermehrte. Der grosse deutsche Soziologe Weber hat einen grossen Teil seines Schaffens darauf verwandt, in diesem Arbeitsbegriff der protestantischen Ethik den Keim des ›kapitalistischen Geistes‹ aufzuzeigen.58
Im Gegensatz zu allen bisher betrachteten Arbeitsbegriffen beginnt sich seit der Aufklärung in der französischen Naturrechtslehre die Bedeutung der Arbeit für die Wirtschaft durchzusetzen. Arbeit wird zum alleinigen Rechtstitel auf Besitz. Obwohl sonst in der Physiokratie allein die Agrokultur produktiv ist, wird im späten Physiokratismus eines Turgot neben der landwirtschaftlichen Arbeit auch die Arbeit der Manufaktur als Quelle des Reichtums angesehen. Arbeit wird also bereits in der Physiokratie als wertschaffende Kategorie aufgefasst, eine Ansicht, die erst in der klassischen Nationalökonomie von Smith und Ricardo voll ausgeprägt wurde. Sie sahen in der menschlichen Arbeit jene Produktivkraft, die die Bewegungen der Wirtschaft vorantreibt. Erst durch die Vereinheitlichung der Arbeit, durch die zunehmende Industrialisierung gelang es den modernen Ökonomen, die Arbeit in ihrer Allgemeinheit und Abstraktion zu fassen. Die Leistung Smiths war es, dass er von den besonderen Formen der Arbeit abstrahiert und die reine Quantität der notwendigen Arbeitszeit ins Zentrum rückt. Er bestimmte
Arbeit schlechthin, weder Manufaktur, noch kommerzielle, noch Agrikulturarbeit, aber sowohl die eine wie die andere. Mit der abstrakten Allgemeinheit der Reichtum schaffenden Tätigkeit nun auch die Allgemeinheit des als Reichtum bestimmten Gegenstandes, Produkt überhaupt, oder wieder Arbeit überhaupt, aber als vergangene, vergegenständlichte Arbeit. Wie schwer und gross dieser Übergang, geht daraus hervor, wie Adam Smith selbst noch von Zeit zu Zeit wieder in das physiokratische System zurückfällt.59
Daraus folgerte Ricardo, dass die Arbeit die einzige wertbildende Kraft sei. Doch trotz dieser grundlegend neuen Ansichten bleibt der Arbeitsbegriff auch bei ihm instrumentell: Der Reichtum einer Gesellschaft besteht in ihrer Fähigkeit, in möglichst kurzer Arbeitszeit möglichst viele Gebrauchswerte zu schaffen. Die entscheidenden Anstösse zu einer Neufassung des Arbeitsbegriffs kamen aus dem philosophischen Werk Hegels.
4.1.2 Arbeit als Selbstverwirklichung des Subjekts
Das Grosse an der Hegelschen ›Phänomenologie‹ [...] ist also einmal, dass Hegel die Selbsterzeugung des Menschen als einen Prozess fasst, die Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, als Entäusserung und als Aufhebung dieser Entäusserung; dass er also das Wesen der Arbeit fasst und den gegenständlichen Menschen, wahren, weil wirklichen Menschen, als Resultat seiner eignen Arbeit begreift.60
Mit dieser berühmten Stelle aus den Pariser Manuskripten hat Marx das Zentrale am Menschenbild Hegels herausgearbeitet. Er bezieht sich damit auf Hegels Hauptwerk, die Phänomenologie des Geistes, in welchem Hegel schreibt:
Durch die Arbeit kommt es (das Selbstbewusstsein; HF) aber zu sich selbst. [...] welches nun in der Arbeit ausser es in das Element des Bleibens tritt; das arbeitende Bewußtsein kommt also hierdurch zur Anschauung des selbständigen Seins als seiner selbst.61
Diese Anschauung des Selbst ist aber kein plattes, delphisches ›Erkenne Dich selbst‹, sondern ein tätiges. Der Geist strebt danach, sich gegenständlich zu machen, sich im Anderen zu finden, zu erkennen indem er sich mit ihm zusammenschliesst, es verzehrt. Ein grossartiger und gewichtiger Gedanke, da »das Selbst diesen ganzen Reichtum seiner Substanz zu durchdringen und zu verdauen hat.62«
Marx relativiert nun aber die Grossartigkeit dieses Unterfangens, indem er aufzeigt, was Hegel wirklich unter veräussern, arbeiten usw. versteht. Nachdem er nochmals betont hat, wie wichtig der Beitrag Hegels zur Bestimmung der Arbeit als Wesen des Menschen ist, sagt er:
Die Arbeit, welche Hegel allein kennt und anerkennt, ist die abstrakt geistige. Was also überhaupt das Wesen der Philosophie bildet, die Entäusserung des sich wissenden Menschen oder die sich denkende entäusserte Wissenschaft, dies erfasst Hegel als ihr Wesen.63
Oberflächlich betrachtet scheint sich aber auch bei Marx in der hier zwar wirklich körperlichen Arbeit das Bewusstsein des arbeitenden Menschen zu vergegenständlichen, was oft mit der folgenden Stelle aus dem Kapital belegt wird:
Die Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und Natur, ein Prozess, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigne Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in einer für sein eignes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem er durch diese Bewegung auf die Natur ausser ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigne Natur. Er entwickelt die in ihr schlummernden Potenzen und unterwirft das Spiel ihrer Kräfte seiner eignen Botmässigkeit. Wir haben es hier nicht mit den ersten tierartig instinktmässigen Formen der Arbeit zu tun. [...] Wir unterstellen die Arbeit in einer Form, worin sie dem Menschen ausschliesslich angehört. Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln, und eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell vorhanden war. Nicht dass er nur eine Formveränderung des Natürlichen bewirkt; er verwirklicht im Natürlichen zugleich seinen Zweck, den er weiss, der die Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem er seinen Willen unterordnen muss.64
Dass Marx hier die Bewusstheit des Arbeitsprozesses so stark hervorhebt, steht damit im Zusammenhang, dass Marx an dieser Stelle auf die Produktion der Arbeitsmittel, der Werkzeuge hinauswill, dass es ihm also hauptsächlich auf den Unterschied zwischen menschlicher und tierischer Tätigkeit ankommt. Ganz anders schreibt er dort, wo es für ihn darauf ankommt, dass sich in der Arbeit eben nicht nur das Bewusstsein, der absolute Geist manifestiert, bzw. selbstverwirklicht, sondern dass sich der Mensch durch die Arbeit selbst konstituiert und zwar ganz konkret: »Die Bildung der 5 Sinne ist eine Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte.«65 Dies führt er am Beispiel des Ohrs aus:
Wie erst die Musik den musikalischen Sinn des Menschen erweckt, wie für das unmusikalische Ohr die schönste Musik keinen Sinn hat, kein Gegenstand ist, weil mein Gegenstand nur die Bestätigung einer meiner Wesenskräfte sein kann, also nur so für mich sein kann, wie meine Wesenskraft als subjektive Fähigkeit für sich ist, weil der Sinn eines Gegenstandes für mich (nur Sinn für einen ihm entsprechenden Sinn hat) grade so weit geht, als mein Sinn geht, darum sind die Sinne des gesellschaftlichen Menschen andre Sinne wie die des ungesellschaftlichen; erst durch den gegenständlich entfalteten Reichtum des menschlichen Wesens wird der Reichtum der subjektiven menschlichen Sinnlichkeit, wird ein musikalisches Ohr, ein Auge für die Schönheit der Form, kurz, werden erst menschlicher Genüsse fähige Sinne, Sinne welche als menschliche Wesenskräfte sich bestätigen, teils erst ausgebildet, teils erst erzeugt.66
Aber nicht nur die Sinne, sondern die Menschen selbst werden durch die Arbeit erzeugt.
Sie selbst fangen an, sich von den Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren, ein Schritt der durch ihre körperliche Organisation bedingt ist. Indem die Menschen ihre Lebensmittel produzieren, produzieren sie indirekt ihr materielles Leben selbst.67
In diesem Sinne widmet Engels auch ein ganzes Kapitel seiner Dialektik der Natur dem Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen.68
Bezüglich dieser Korrektur des Hegelschen Arbeitsbegriffs, in welcher Marx Hegel vom Kopf auf die Füsse stellt69, gilt es immer wieder zu betonen: In der ganzen Kritik an Hegel, in welcher Marx aufzeigt, dass durch die Arbeit das Bewusstsein sich nicht nur verwirklicht, sondern auch konstituiert, fällt nun Marx nicht einfach in einen platten, mechanischen Materialismus zurück. Dies wird besonders deutlich in den ›Feuerbachthesen‹, in welchen er ganz klar dem Hegelschen Idealismus den Materialismus gegenüberstellt, andererseits aber auch den Feuerbach’schen Materialismus mit der
Dialektik Hegels konfrontiert und so die Grundlage zum dialektischen Materialismus legt:
Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus (den Feuerbach’schen mit eingerechnet) ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird; nicht aber als sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv. Daher die tätige Seite abstrakt im Gegensatz zu dem Materialismus von dem Idealismus – der natürlich die wirkliche, sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt – entwickelt. Feuerbach will sinnliche – von den Gedanken-objekten wirklich unterschiedne Objekte; aber er fasst die menschliche Tätigkeit selbst nicht als gegenständliche Tätigkeit.70
Bereits bei Hegel, z.B. im berühmten Kapitel über Herrschaft und Knechtschaft 71 , und vor allem dann bei Marx wird deutlich, dass die Verwirklichung, Vergegenständlichung des Subjekts unter den heutigen Bedingungen so geschieht, dass ihm seine Produkte nicht nur als etwas Äusseres, Anderes, sondern als etwas Fremdes gegenüberstehen. Diesem Phänomen der Entfremdung soll im nächsten Abschnitt nachgegangen werden.
4.1.3 Der Begriff der Entfremdung
Nachdem Marx im ersten der ›Pariser Manuskripte‹ die konkreten Bedingungen der Arbeit, die Grundrente und das Kapital analysiert hat, gelangt er zum Schluss, dass unter den gegebenen ökonomischen Verhältnissen die Produkte der Arbeit zu Gegenständen werden, die dem Arbeiter fremd sind. Die Produkte seiner Arbeit gehören nicht mehr ihm, sondern er hat darin nur seine Arbeitskraft an den Kapitalisten veräussert. Die Produkte seiner Arbeit treten ihm als selbständige, ja feindliche Mächte gegenüber. Das führt dazu, dass