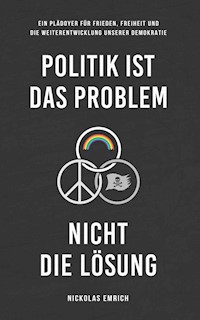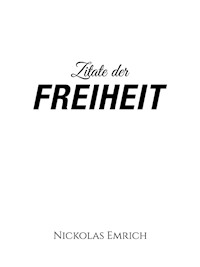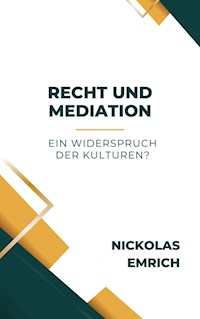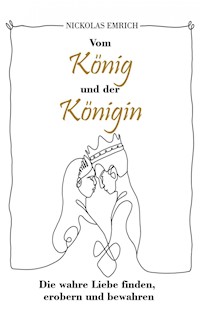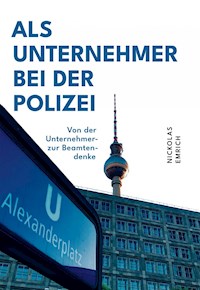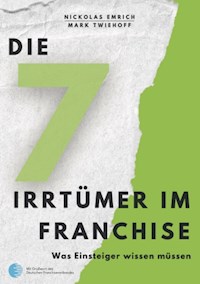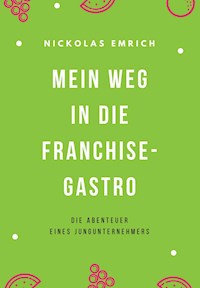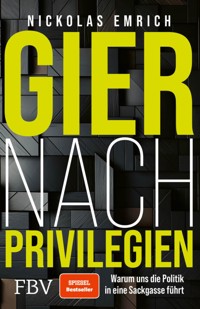
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fühlen Sie sich manchmal, als würden Sie in einer Gesellschaft leben, die vor Sonderrechten und Ungerechtigkeiten strotzt? Zahlen Sie am meisten drauf – und wissen es nicht einmal? Dann ist dieses Buch genau das richtige für Sie. "Gier nach Privilegien" enthüllt die erschreckende Wahrheit hinter dem undurchsichtigen Geflecht aus Privilegien, das unsere Gesellschaft durchzieht. Es deckt auf, warum Politiker, Beamte und sogar Sozialhilfeempfänger oft besser dastehen als der durchschnittliche Bürger – und welche versteckten Vorteile selbst die "Unprivilegierten" genießen. Dieses Buch ist kein trockenes Sachbuch, sondern eine fesselnde Reise durch die Abgründe des politischen Systems und der menschlichen Natur. Sie werden staunen, wie geschickt Politiker und andere Interessengruppen ihre eigenen Vorteile sichern und dabei nicht nur das Gemeinwohl aus den Augen verlieren, sondern es bewusst ignorieren, zu ihrem eigenen Vorteil. Sie werden aber auch lernen, wie Sie selbst das System durchschauen und sich gegen Ungerechtigkeiten wehren können. Bereiten Sie sich darauf vor, schockiert zu sein, wenn Sie entdecken: -Was das Geheimnis der Abgeordneten-Diäten und der üppigen Pensionen ist – und warum die wahren Kosten verschleiert werden -Wie Unternehmer, Beamte und sogar Sozialleistungsempfänger durch versteckte Vorteile und Steuerschlupflöcher profitieren -Weshalb der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Paradebeispiel für Ineffizienz und Verschwendung ist -Wie der Staat durch Subventionen und Regulierungen den Markt verzerrt und Innovationen ausbremst -Warum weniger Politik oft die bessere Lösung ist – und wie wir zu einer freieren und gerechteren Gesellschaft gelangen können "Gier nach Privilegien" ist mehr als nur eine Analyse des Ist-Zustands. Es ist ein Plädoyer für mehr Transparenz, Eigenverantwortung und einen schlankeren Staat. Es zeigt auf, wie wir zu einer gerechteren und freieren Gesellschaft gelangen können, in der Leistung belohnt und nicht bestraft wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Nickolas Emrich
Gier nach Privilegien
Warum uns die Politik in eine Sackgasse führt
Nickolas Emrich
Gier nach Privilegien
Warum uns die Politik in eine Sackgasse führt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Originalausgabe
1. Auflage 2024
© 2024 by Finanzbuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Anne Büntig
Korrektorat: Anke Schenker
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: Adobe Stock
Satz: Carsten Klein
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-782-2
ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-530-7
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-529-1
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Geleitwort
Einführung
I. Die Gesellschaft der Privilegierten
Unser ambivalentes Verhältnis zu Privilegien
Wie uns die Politik zu bestechen versucht: Das Prinzip der kleinen Geschenke
Privilegien schlagen Kompetenz, Fleiß und harte Arbeit
Ein »kleiner« Blick auf unsere Gesellschaft
Die Geschichte von Robin Hood
Der Unterschied zwischen privaten und staatlichen Privilegien
Die Kehrseite der Privilegien
II. Die Privilegien der Wirtschaft
19 Prozent Rabatt auf alles – außer Tiernahrung
Das Spiel der Unternehmer – bücken lohnt sich
Ein komplexes Konstrukt aus Regeln und Ausnahmen nützt denen, die es kennen
Staatliche Subventionen – nicht bestellt und trotzdem abgeholt
Konzerne sind wie kleine Staaten
Der Grund für Lobbyismus liegt im System
Staatlich geschützte (Berufs-)Gruppen
III. Die Privilegien anderer Interessengruppen
Der unverstandene Unterschied zwischen Positionen und Interessen
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände brauchen sich wie Tom und Jerry – und agieren genauso vorhersehbar
Arbeitnehmer in großen Konzernen und staatsnahen Unternehmen
Die regierungsnahen Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) und ihre Freunde
Mit Gottes und mit Staates Hilfe – die Privilegien der Kirchen
Die Krone der Schöpfung: Das deutsche Parteiwesen
Parteinahe Stiftungen – Nachwuchsförderung auf Kosten des Gemeinwohls
IV. Die Privilegien des Staates
Die ungeheure Macht, einfach entscheiden zu dürfen
Die Befugnis zur ungezügelten Expansion
Das Privileg, nicht effizient arbeiten zu müssen
Privilegien im Dienste des Staates
Die Gegenwart auf Kosten der Zukunft retten
Diplomaten – die Nullen im Straßenverkehr
Der teuerste Rundfunk der Welt
V. Die Privilegien der Politik
Gutes tun mit dem Geld anderer Menschen
Keine Mindestqualifikation, kein Einstellungstest und kein Praxisbeweis
Das Privileg, entscheiden zu dürfen – auch ohne Kenntnis und Betroffenheit
Über das eigene Gehalt bestimmen dürfen und dabei gut aussehen
Fast Track in der Besoldung – ohne Umweg an die Spitze
Das Privileg der dummen Vorschläge
Das Privileg der fehlenden Haftung
VI. Die Privilegien der Unprivilegierten
Sozialrecht einfach erklärt
Kleine Geschenke aus der Gießkanne
Mieter mit Heiligenschein
Einzelne Gruppen, die der Politik Aufmerksamkeit bringen
Ablenkung und Aufmunterung für Familien und Rentner
Bildung und Gesundheit für alle
Der Mindestlohn-Arbeiter
VII. Die wirklich Unprivilegierten
Menschen in Notlagen
Die Brutto-Netto-Lüge – der dumme Lohnarbeiter
Fazit: Politik ist das Problem, nicht die Lösung
Ich danke herzlich Prof. Dr. Oliver Pott, der mich auf dem Weg zu diesem Buch begleitet hat und mit dem ich Konzepte, Systeme und Ideen nicht nur zur Buchplanung, sondern auch zu Vermarktungsstrategien besprechen konnte.
Geleitwort
Dieses Buch zeigt in eindrucksvoller Weise, wie aus dem Rechtsstaat – die große Errungenschaft der liberalen Epoche: »Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich«, es gibt keine politischen Privilegien – nicht mit einem Schlag, sondern in vielen großen und kleinen Schritten und mit häufig seltsamen Begründungen ein neomittelalterlicher Privilegienstaat geworden ist. Auch im mittelalterlichen Staat gab es keine Rechtsgleichheit, sondern einen fein abgestuften, kaum noch überschaubaren Komplex aus Sonderrechten. Politik bestand aus einem ständigen Kampf um diese rechtlichen Bevorzugungen. Monstro simile – einem Ungeheuer ähnlich – beschrieb damals Samuel von Pufendorf das Deutschland seiner Zeit. Je nach politischer Durchsetzungsmacht, zur Not auch mit Gewalt, beherrschten ständische Körperschaften wie die Aristokratie (in sich wieder abgestuft), Bürger und Städte (dito), auch Bauernschaften, zudem hierokratische Gebilde (Priesterstaaten) die Szene. Heute sind dies politische Körperschaften (Regierung, Bürokratie, Parteien) und Verbände aller Art, auch öffentliche und private Unternehmen, die miteinander um einen Sonderanteil am Sozialprodukt oder um Vorrechte kämpfen. Einen Rechtsstaat im liberalen Sinn haben wir nicht mehr oder allenfalls noch in formaler Hinsicht (alles auf »legalem« Wege, ohne offene Gewalt). An der Spitze stehen eine Regierung und die regierenden Parteien, welche die Macht haben, sich selbst und ihr Ausführungsorgan, die Bürokratie, sowie öffentliche Unternehmen zu privilegieren. Hinzu kommen die diversen Interessenverbände, »pressure groups«, die durch Lobbying und Druck auf die Exekutive sich kaum mehr überschaubare Vorteile sichern. Von der Interessentenanarchie sprachen die Ordoliberalen ihrer Zeit, an der Spitze ein Mann wie Ludwig Erhard. Es war und ist das zentrale Anliegen liberaler Ordnungspolitik, deren Macht zurückzudrängen. Politik ist heute vor allem ein Verteilungskampf mit der Frage: »Wer wie viel«?
Noch mehr Umverteilungspolitik ist nach Meinung des Autors keine Lösung. Die Politik selber ist das Problem. Also heißt die Lösung: weniger Politik mit entsprechendem Rückzug des Staates, der Rückgabe von Verantwortlichkeit und Mitteln an die Privatgesellschaft und die Märkte. Dies war die Parole von Erhard, Reagan, Thatcher und der neuseeländischen Reformer, heute des neuen argentinischen Staatschefs Javier Milei, dessen radikale, aber erfolgreiche Parolen freilich auch belegen, wie weit eine Gesellschaft durch Inflation und Fiskalsozialismus heruntergekommen sein muss, bis sie auf solche vernünftigen Konzeptionen hört (womit aber deren Erfolg noch nicht verbürgt ist, da bereits so viele Bürger vom Staat abhängen).
Der besondere Vorzug dieses Buches ist die enorme Detail- und Hintergrundkenntnis des Autors, der sich seine Kenntnisse nicht allein aus der liberal-libertären Theorie wie die meisten kritischen Autoren, sondern aus unmittelbarer Anschauung als Jurist, Politiker, Polizist (!) und Unternehmer gezogen hat. Er hat sich als Unternehmer eine Unabhängigkeit verschafft, die ihm die Abfassung eines solchen imposanten Buches ökonomisch und zeitlich ermöglichte. Es gibt viele glänzende Kritiker von Staatsbürokratie, Wohlfahrtsstaat und Staatswirtschaft – von Mises und Hayek, über Röpke und Eucken bis zum unvergesslichen Wolfram Engels oder in unseren Tagen Rainer Zitelmann –, aber nur wenige, die wie Nickolas Emrich eigene Anschauung und eigenes Erleben mit klarem theoretischen Hintergrund verbinden. Dieses Buch ist ein Glücksfall, dem man jeden Erfolg wünschen muss und das manchem Leser die Augen öffnen wird.
Prof. Dr. Gerd Habermann
Berlin, Januar 2024
Einführung
Politik als das Salz in der Suppe
Mit der Feststellung, dass in weiten Teilen der Bevölkerung Unzufriedenheit über die Politik herrscht, lässt sich kein großes Erstaunen mehr erzeugen. Wir haben uns daran gewöhnt. Irgendwie geht es ja schließlich trotzdem weiter. Über Millionenbetrug bei Corona-Testzentren, die abgehobenen Pläne zur Erweiterung des Kanzleramtes, die ausufernde Aufstockung des Ministerialbeamtentums, die gescheiterte Pkw-Maut oder die Eskapaden rund um den Berliner Flughafen lächelt man nur noch müde. Trotz vielerlei Spekulation und Diskussion über die möglichen Ursachen ändert sich nicht wirklich etwas. Eine Mehrheit der Deutschen traut es laut einer Forsa-Umfrage keiner politischen Partei zu, kompetent mit den Problemen im Land umzugehen. 57 Prozent der Befragten gaben dabei an, dass weder die Regierungs- noch die Oppositionsparteien dazu in der Lage seien. Immer wieder wird gefragt, wie eine bessere Politik möglich sei. Ich glaube, schon in der Frage liegt ein Fehler. Wenn das Essen jedes Mal versalzen ist, sollte man nicht nach besserem Salz fragen, sondern nach weniger Salz verlangen. Auch Politik wird nicht besser, wenn man immer mehr macht. Wenn Politik Probleme nicht löst, sollte man nachdenken, ob eine andere Politik wirklich wirkungsvoller ist oder ob die Abwesenheit von Politik das Problem lösen könnte. Ich habe in meinem Vorgängerbuch Politik ist das Problem, nicht die Lösung bereits einen Finger in die Wunde gelegt. Nun möchte ich gerne noch einen zweiten Finger in die Wunde legen. Denn obwohl ich bereits Lösungsvorschläge aufgezeigt habe, möchte ich in diesem Buch einen bestimmten Aspekt herausgreifen, der ganz besonders am gesellschaftlichen Zusammenhalt nagt: die Privilegien.
Ein Privileg ist ein Vorrecht, das einer Person oder einer Personengruppe zugestanden wird. Der Begriff setzt sich aus den lateinischen Wörtern privus (besonders) und lex (Gesetz) zusammen. Mit anderen Worten: Es geht um Sonderrechte beziehungsweise um Bevorzugung. Sonderrechte sind dabei keineswegs grundsätzlich etwas Schlimmes. Der Notarzt, der zum Einsatz fährt, hat etwa das Sonderrecht, sich nicht an die Regeln der Straßenverkehrsordnung halten zu müssen. Dies ist mit Nachteilen für die übrigen Verkehrsteilnehmer verbunden, die rechts ranfahren und Platz machen müssen, bringt aber entscheidende Vorteile für den Patienten. Auch die Polizei genießt dieses Recht gleichermaßen, sofern sie zu einem eilbedürftigen Einsatz fährt, nicht aber, um eine Pizza schnell zur Wache zu befördern (was glücklicherweise außerhalb von Filmen selten vorkommt). Doch woher kommen solche Privilegien?
Privilegien als Produkt der Politik
Es gibt zwei verschiedene Arten von Privilegien: gewillkürte Privilegien und gesetzliche Privilegien. Erstere kann man quasi »kaufen«. Ich kann arbeiten (oder erben) und mir ein umwerfend stylisches Auto kaufen. Oder mir im Urlaub statt des schnöden Standardzimmers eine atemberaubende Suite gönnen. Oder in eine Fortbildung investieren, die sich jemand anderes nicht leisten kann. Daneben gibt es durch Gesetz gewährte Privilegien. Etwa, um ein zwei Jahre zurückliegendes Beispiel zu nennen, als »normale« Fluggäste eine Maske tragen mussten, während kein solches Gesetz für den Regierungsflieger der Luftwaffe galt. Ebenso beispielsweise, dass Bundestagsabgeordneten eine Pauschale für ihre mandatsbedingten Ausgaben zugestanden wird, während Selbstständige jeden Beleg einzeln sammeln müssen, den sie steuermindernd absetzen wollen. Damit will ich dies übrigens nicht kritisieren, im Gegenteil. Die maskenfreien Flüge der Regierungsmitglieder fanden zu einem Zeitpunkt statt, zu dem in anderen europäischen Ländern längst keine Maskenpflicht mehr galt, gerne hätte man das »Privileg« also allen zukommen lassen können. Auch wäre es sicherlich eine große Entlastung, wenn Selbstständige ein Wahlrecht zwischen der Erfassung bestimmter Belege oder einer Pauschale für Geschäftsessen und Reisekosten hätten. Das Problem ist also vielmehr, dass die guten Ideen auf einige wenige Profiteure beschränkt werden.
Diese Privilegien der zweiten Kategorie entstammen Gesetzen, sie sind also verbriefte Privilegien. Diese Gesetze werden von der Politik gemacht. Dies ist der Grund, warum jede Schlagzeile, die von solchen Privilegien berichtet, die Politikverdrossenheit erhöht, wenn sie sachlich nicht zu rechtfertigen sind. Kaum jemand kritisiert das Recht des Notarztes, mit Blaulicht zum Einsatzort fahren zu dürfen, während die Besserstellung eines Regierungsfluges gegenüber dem zivilen Linienverkehr viele Menschen zu dem Schluss kommen lässt: »Alle sind gleich, aber manche sind gleicher.«
Die Politik gewährt solche Privilegien aber nicht nur sich selbst. Die gesamte Gesellschaft ist durchzogen von Privilegien für bestimmte Gruppen. Subventionen für bestimmte Wirtschaftszweige, Steuervorteile für ein bestimmtes Verhalten, Pension statt Rente für Beamte, Immunität für Diplomaten, lukrative neue Posten für Parteifreunde – an zahlreichen Stellen steuert die Politik die Gesellschaft mit Privilegien. Während private Privilegien nur Ausdruck einer individuellen Verschiedenheit aufgrund unserer Entscheidungen sind, tangieren die gesetzlichen Privilegien die Gleichberechtigung und damit das Gerechtigkeitsgefühl vieler Menschen. Wir können und wollen nicht ergebnisgleich sein, sonst wären wir keine Individuen, dennoch möchten wir natürlich vor dem Gesetz gleich behandelt werden und zumindest vonseiten des Staates die gleichen Chancen erhalten. Deshalb etwa kann eine private Firma per Handschlag einstellen, wen sie will, während der Staat Aufträge und Beamtenstellen ausschreiben muss. Wann immer dies missachtet wird, herrscht Wh2illkür.
I. Die Gesellschaft der Privilegierten
Unser ambivalentes Verhältnis zu Privilegien
Die meisten Menschen lieben Privilegien – emotional betrachtet. Wer geht nicht gerne an der langen Schlange eines angesagten Clubs vorbei, weil er gute »Connections« hat? Während dieses Beispiel harmlos ist, weil es dem privatrechtlichen Kontext zuzuordnen ist, wird es unschöner, wenn mancherorts mit einem guten Draht zu Ämtern oder Politik ein Antrag beschleunigt oder gar der Ausgang des Antragsverfahrens positiv beeinflusst werden kann – zumindest als Außenstehender würde man dies missbilligen. Eigene Privilegien werden dennoch geliebt und gerechtfertigt. Ich will mich da nicht ausnehmen und habe selten einen Menschen erlebt, der eigene Privilegien kritisch reflektiert oder hinterfragt. Die Privilegien anderer sieht man gleichwohl kritischer. Im Ergebnis ist unser Verhältnis zu Privilegien sehr zwiespältig. Kaum jemand schämt sich für Privilegien, die meisten sind sogar stolz darauf. Wer hat nicht schon Sätze gehört wie:
»Bei uns ist nie etwas zu tun. Ich schreibe nur zwei bis drei Mails am Tag, den Rest der Zeit mache ich Privatsachen und buche Urlaub.«
»Ich kenne da jemanden, der das möglich macht.«
»Ich bin mit Vitamin B an meine Stelle gekommen.«
»Mit meinem Altvertrag zahle ich kaum Miete.«
»Ich bin schon lange nicht mehr kündbar.«
»Ja, das Gesetz ist zwar ungerecht, aber ich profitiere davon.«
»Mein Steuerberater kennt da einen guten Trick.«
Die Liste ließe sich sicher endlos fortsetzen. Menschen freuen sich über das Ausnutzen einer Lücke, die sie besserstellt mindestens genauso sehr wie über den Erfolg von echter Anstrengung. Das ist zweifelsohne durchaus menschlich. Wer von uns freut sich nicht über ein Geschenk, ein kostenfreies Upgrade oder – wer Monopoly kennt – den berühmten »Bankirrtum zu Ihren Gunsten«? Genauso menschlich ist es auch, sich darüber zu ärgern, wenn nur die anderen Spieler metaphorisch solche positiven »Ereigniskarten« ziehen und man selbst leer ausgeht. Gibt es zu viele extrem privilegierend wirkende Ereigniskarten im Spiel, wird mit der Zeit einigen die Lust am Spiel vergehen. Im echten Leben ziehen wir keine Ereigniskarten, sondern haben Gesetze. Diese Gesetze entstehen durch Politik. Westliche Politik mit ihrem Nudging-Gedanken arbeitet immer mehr mit Privilegien. Die Politik kommt meines Erachtens nicht darauf, dass genau solche Privilegien für einen Großteil der herrschenden Unzufriedenheit mit der Politik verantwortlich sind.
»Es ist erstaunlich, dass Menschen, die glauben, dass wir es uns nicht leisten können, für Ärzte, Krankenhäuser und Medikamente zu bezahlen, irgendwie glauben, dass wir es uns leisten können, für Ärzte, Krankenhäuser, Medikamente zu bezahlen und dazu noch eine staatliche Bürokratie, um dies zu verwalten.«
Thomas Sowell
Unser politisches System lebt vom Fordern von Privilegien. Fast jede Forderung einer gesellschaftlichen Gruppe kann man unter diesem Aspekt beleuchten. Selbst die Klimakleber fordern Privilegien. Ihre Forderungen kann man nachlesen. Es geht ihnen nicht um weniger Massentierhaltung oder den Erhalt von Naturschutzgebieten. Dafür hätte ich durchaus Sympathie. Nein, sie wollen, dass das 49-Euro-Ticket wieder 9 Euro kostet. Sie wollen 40 Euro sparen, die andere Menschen bezahlen sollen. Sie fordern nicht einmal, die Qualität des Bus- und Bahnverkehrs zu verbessern. Es handelt sich um Leute, die überwiegend in Städten wohnen und deren Ziel es ist, sich für noch weniger Geld in einen noch volleren Bus zu quetschen. Zahlen müssten das dann diejenigen, denen es zu voll ist und die daher auf andere Verkehrsmittel ausweichen. Wer gern im Kollektiv untergeht, hat dann zumindest das Privileg, die Beförderung (fast) geschenkt zu bekommen. Daher sind diese Menschen aus meiner Sicht auch keine Umweltschützer, sondern Lobbyisten.
Wie uns die Politik zu bestechen versucht: Das Prinzip der kleinen Geschenke
Nun ist diese Entwicklung leider nur die Spitze des Eisbergs. Die Politik hat die Bürger über lange Zeit dazu erzogen, ihre Wünsche und Sorgen an die Politik zu richten und für angeblich förderliches Verhalten belohnt zu werden. Aus diesem Geiste sind Projekte wie die »Abwrackprämie« und andere unfassbar teure Markteingriffe geboren worden, die auf Kosten aller recht willkürlich manche bevorzugt und manche benachteiligt haben. Wer damals sowieso einen Neuwagen kaufen wollte, konnte die Prämie einfach mitnehmen, wer es dagegen einen Monat zu früh gemacht hatte oder gerade einen Gebrauchtwagen verkaufen wollte, gehörte ungewollt zu den Verlierern dieser Subvention. Andere Maßnahmen sind eher unbedeutend, etwa der Kulturpass für Jugendliche. Auch dies ist ein »kleines Geschenk« der Regierung, in diesem Fall 200 Euro Kulturguthaben für alle 18-Jährigen. Früher haben die Großeltern solche Geschenke gemacht, heute muss man eine App herunterladen und lernt schon früh, sich an den schenkenden Staat zu gewöhnen. Im Gegensatz zu den Großeltern hat der Staat dieses Geld nicht erwirtschaftet, sondern natürlich durch Steuern eingenommen. Hinzu kommen die Kosten für die Bürokratie. Die Staatsministerin für Kultur und Medien, die das Projekt zu verantworten hat, möchte schließlich auch etwas verdienen, ganz zu schweigen von ihrer späteren Pension. Die App muss natürlich auch programmiert werden, etwas Budget für Pressearbeit und Werbung darf auch nicht fehlen und ohne Beamte für Konzeption und Planung geht sowieso nichts. Die Großeltern hätten wahrscheinlich weniger Verwaltungskosten verursacht, hatten das Geld aber möglicherweise nicht mehr übrig, weil die Steuerlast hierzulande recht hoch ist.
»Der Interventionismus wird zu einem Wettlauf der einzelnen Interessenten und Interessengruppen um Privilegien. Die Regierung wird zu einem Weihnachtsmann, der Geschenke verteilt. Doch die Beschenkten müssen die Gaben, die sie empfangen, doppelt bezahlen. Dem Staat stehen keine anderen Mittel zum Schenken zur Verfügung als solche, die er dem Einkommen und dem Vermögen der Untertanen entnimmt.«
Ludwig von Mises
Die Großeltern kommen dafür aber vielleicht in den Genuss anderer staatlicher Privilegien, etwa je nach Region vergünstigte Zugtickets oder Museumskarten. Man sollte sich bewusst machen, dass ein Privileg keinesfalls bedeutet, dass man im Leben insgesamt privilegiert wäre. Selbst arme Menschen haben Privilegien. Ich benutze das Wort »Privileg« hier wertfrei. Es ist erst einmal nur eine Bevorzugung. Wer Bürgergeld bezieht, kann über einen Wohnberechtigungsschein mehrere Hundert Euro monatlich bei der Miete sparen, bekommt in vielen Städten ein deutlich günstigeres Nahverkehrsticket und zahlt beispielsweise beim Deutschen Theater nur 3 Euro statt 48 Euro für eine Eintrittskarte. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte nicht gegen arme Menschen hetzen, sondern das gesamte Geflecht aus Privilegien entflechten und in diesem Buch darlegen. Ein Bürgergeldempfänger erhält eben nicht nur etwa 500 Euro Bürgergeld, sondern neben den Kosten für Wohnung und Krankenversicherung auch zahlreiche kleine Vergünstigungen. Dieser Mensch fühlt sich sicherlich nicht privilegiert, dennoch wird auch er mit kleinen Geschenken bedacht. Nebenbei sei dennoch kritisch angemerkt, dass dieses Vorgehen natürlich sehr intransparent ist. Würde man die Vergünstigungen und andere Subventionen wie durch einen Wohnberechtigungsschein addieren, käme man möglicherweise je nach Fall auf einen nicht uninteressanten fiktiven Nettolohn, den man lieber nicht laut aussprechen sollte.
»Der Staat hat keine andere Geldquelle als das Geld, das die Menschen selbst verdienen. Wenn der Staat mehr ausgeben möchte, kann er dies nur tun, indem er Ihre Ersparnisse leiht oder Sie stärker besteuert. Es nützt nichts, zu denken, dass jemand anderes zahlen wird – dieser jemand sind Sie. Es gibt keine öffentlichen Gelder – es gibt nur Steuergelder!
Wohlstand wird nicht durch die Erfindung immer großzügigerer öffentlicher Ausgabenprogramme entstehen. Sie werden nicht reicher, indem Sie ein weiteres Scheckbuch bei der Bank bestellen. Keine Nation wurde jemals wohlhabender, indem sie ihre Bürger über ihre Zahlungsfähigkeit hinaus besteuerte. Wir haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass jeder Cent, den wir an Steuern einholen, sinnvoll und weise ausgegeben wird.«
Margaret Thatcher
Die kleinen Geschenke sind aber nicht immer absolut klein, nur relativ. Es gilt daher das Prinzip: Kleine Geschenke für die Kleinen, große Geschenke für die Großen. Auch die Wirtschaft soll kein Freund des freien Marktes werden, sondern ebenso den Staat als wohlwollenden Weihnachtsmann anerkennen und bestenfalls schätzen lernen. Der Staat als freundlicher Schiedsrichter, der auch mal nebenbei ein Tor schießt, wenn er gerade günstig steht – und in der Halbzeitpause noch Freibier verteilt. So etwa beim geplanten Intel-Werk: 10 Milliarden Euro schießt der Staat dazu, 3.000 neue Arbeitsplätze sind angedacht. Das sind immerhin stolze 3,3 Millionen Euro Subvention pro Arbeitsplatz. Das fällt für mich aber ebenfalls in die Kategorie der »kleinen Geschenke«. Man passt sich bloß der Größe des Beschenkten an, das Prinzip dahinter bleibt auch hier das gleiche.
Privilegien schlagen Kompetenz, Fleiß und harte Arbeit
Der Fehlanreiz für Bürger und Wirtschaft gleichermaßen lautet: »Geld verdient man nicht, Geld beantragt man.« Nicht, wer am produktivsten ist, sondern wer die Spielregeln (und ihre Ausnahmen) am besten versteht – und sein Leben vorausschauend danach ausrichtet –, fährt die größte Ernte am Buffet der Privilegien ein. Gerade ehrliche Menschen frustriert das. Langfristig hilft es aber nur, dieses System zu verstehen, um es zu ändern.
»Der fundamentale Trugschluss im Wohlfahrtsstaat, welcher sowohl in die Finanzkrise als auch zum Verlust der Freiheit führt, liegt im Versuch, Gutes auf Kosten anderer zu tun.«
Milton Friedman
Abgesehen von der persönlichen Ausgangslage gibt es Entscheidungen im Leben, die determinieren, ob unser Lebensweg langfristig in eine eher privilegierte Position mündet oder nicht. Die Schule verrät einem recht wenig bis gar nichts dazu. Das ist insofern nicht verwunderlich, als man dort auch wenig über Steuern, Recht und wirtschaftlichen Erfolg lernt. Auch über Politik erfährt man kaum etwas. Das, was dort gelehrt wird, ist bestenfalls Geschichte und Staatsorganisation. Nach Auswendiglernen des Ist-Zustandes bleibt da wenig Zeit für einen kritischen Blick. Viele junge Menschen verlassen das staatliche Bildungswesen daher ziemlich staatsgläubig, was wohl durchaus auch im Sinne des Erfinders ist. Dabei entscheidet die Weichenstellung als junger Mensch – leider – deutlich mehr über die zukünftige Stellung und den zukünftigen Wohlstand als Kompetenz, Fleiß und harte Arbeit. Bestimmte Gruppen profitieren nämlich deutlich häufiger von der Beschaffenheit des politischen Systems als andere. So viel kann ich verraten: Als Vollzeit-Arbeitnehmer, der Einkommensteuer entrichtet, in die gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung einzahlt, den Rundfunkbeitrag abführt und Waren und Dienstleistungen überwiegend bei Unternehmen einkauft, die ebenfalls nach dem deutschen Modell Steuern und Sozialabgaben zahlen, gehört man definitiv nicht zu den Privilegierten. Das ist vermutlich keine Überraschung. Unter Beachtung der gesetzlichen Spielregeln etwas »aufzubauen« ist sehr schwer. Auch wenn das in den Industrieländern »Jammern auf hohem Niveau« sein mag, beschränkt sich der Zweck des Arbeitens in vielen Fällen auf bloße Existenzerhaltung, obwohl das durchaus verwundern mag, wenn man sich hierzulande das durchschnittliche Niveau der Personalkosten anschaut. Es ist kein Geheimnis: Zwischen Brutto und Netto liegen oft Welten. Doch was viel fieser und dagegen kaum jemandem bekannt ist: Auch das Brutto taugt nicht als Vergleichswert. Dank einiger Privilegien gibt es gesellschaftliche Gruppen, deren Brutto einigermaßen unauffällig und angemessen erscheint, die sich aber bei gleicher Arbeit problemlos in doppelter Geschwindigkeit ein gutes Leben aufbauen können. Die eigentliche Arbeit ist somit nur der erste Faktor in der Gleichung, der zweite Faktor sind immer die Spielregeln, also die vorherrschenden Gesetze und die in ihnen enthaltenen Privilegien, die, wenn sie einmal existieren, nur selten wieder abgeschafft werden. Dies ist der Teil der Politik, der einen fast immer persönlich betrifft.
»Oben hat sich eine neue Aristokratie breitgemacht, die aus staatlich geduldeten, quasimonopolistischen Halbunternehmern, führenden Managern staatsnaher Betriebe und höheren Staatsbediensteten besteht; unten lebt eine umsorgte Klientel Staatsabhängiger, die längst von einem leistungslosen Grundeinkommen profitieren, auch wenn es nicht so genannt wird; und dazwischen schuftet eine unternehmerisch erzogene Mittelklasse, die schwindende Gruppe der Nettosteuerzahler, die ohne alle Privilegien auskommt und die ihre Werte, Hoffnungen und Lebensträume gerade schwinden sieht.«
Peter Sloterdijk
Einige dieser Privilegien habe ich selbst kennengelernt. Nach dem Studium wurde ich sofort Unternehmer. Ich schloss mich einem Franchisesystem an und verkaufte mit einem kleinen Team gesundes Essen in einem Einkaufscenter. Keine Sekunde bin ich zuvor Arbeitnehmer gewesen. Es ist landläufig bekannt, dass man als Unternehmer mehr Spielraum bei der Gestaltung seines Nettos hat. Das kann ich definitiv bestätigen. Obwohl mein Brutto nicht unbedingt höher war, als wenn ich mich hätte anstellen lassen, konnte ich doch wesentlich mehr Netto für mich selbst herausholen. Zu den Details, den Privilegien der Wirtschaft, komme ich im nächsten Kapitel. Ich will das Ergebnis gar nicht kritisieren, im Gegenteil, ich wünsche mir, dass dieses Privileg seinen Charakter als Privileg verliert und diese Freiheiten nicht eingeschränkt werden, sondern noch mehr Menschen zur Verfügung stehen. Daher fordere ich auch keine bessere Politik, sondern weniger Politik. Diesen Zusammenhang verstehen Sie aber möglicherweise erst, wenn Sie auch die nachfolgenden Gedanken des Buches gelesen haben – oder Sie haben bereits mein Buch Politik ist das Problem, nicht die Lösung gelesen, dann ist Ihnen dieser Gedanke vermutlich bekannt.
Nach etwa vier Jahren als Unternehmer – obwohl es sehr gut lief – bewarb ich mich bei der Polizei. Dies tat ich einerseits aus dem jugendlichen Drang heraus, etwas zu erleben, andererseits kam für mich eine Anstellung als Arbeitnehmer nicht infrage. Auf gar keinen Fall wollte ich in die Sozialkassen einzahlen. Das kann man sicherlich als egoistisch bezeichnen, aber ich hätte mich sonst als Idiot gefühlt. So erlebte ich eine spannende und gut bezahlte Ausbildung und musste die gewohnten Privilegien nicht aufgeben. Zu den Privilegien der Beamten schreibe ich in einem späteren Kapitel mehr. Auch hier sind es nicht die Menschen, die ich kritisiere, sondern die fehlende Logik im System, die allein auf Besitzstandswahrung beruht. Ich versuchte, diese Gegebenheiten in meinem Leben zu berücksichtigen. Wenn alle so agieren würden, hätte die Gesellschaft ein Problem.
Ein »kleiner« Blick auf unsere Gesellschaft
Ich möchte an dieser Stelle eine fiktive Geschichte erzählen, die ich bereits in meinem Buch Zitate der Freiheit genutzt habe. Stellen wir uns einmal vor, wir sind auf einer Insel. Auf dieser Insel leben genau zwei Menschen. Beide sind zum gleichen Zeitpunkt dort gestrandet, beide haben nichts. Der eine baut eine Hütte, sammelt Nahrung, legt Vorräte an. Der andere genießt die Sonne, isst, was er findet, schläft am Strand. Dann brechen schlechte Zeiten an, die Nahrung wird knapper, die Nächte kälter. Eines Tages kommt mit dem Schiff ein Anwalt (möglicherweise ein Sozialdemokrat) auf die Insel. Da sich in unserem Beispiel nun drei Personen auf der Insel befinden, kann man jetzt von einer Gruppe sprechen. Der Dritte könnte auf die Idee kommen, Gesetze für diese junge Gemeinschaft zu entwerfen, die das Zusammenleben erleichtern sollen. Für diese hochwertige Arbeit möchte er ein Drittel der Erträge aller Inselbewohner. Da der eine nichts hat, muss er auch nichts abgeben. Der andere gibt ein Drittel seiner Vorräte. Um die Ungleichheit zu bekämpfen, ordnet der Regelmacher (nicht Regenmacher) an, dass der eine seine Vorräte mit dem anderen teilen müsse. Von den verbliebenen zwei Dritteln gibt der eine Inselbewohner also dem anderen ein weiteres Drittel ab. Nun haben alle ein Drittel. So haben wir einen Arbeiter, einen direkten Subventionsempfänger und einen indirekten Subventionsempfänger, den man Politiker nennen könnte. Das geht so lange gut, wie der wertschöpfende Part das Spiel nicht durchschaut und seine Arbeit einstellt.
»Hätte die politische und syndikalistische Kaste nicht den Vorwand ›soziale Umverteilung‹ als legitimierende Begründung ihrer maßlosen Abzockerei, so könnte sie bei den Bürgern nicht mehr als 15 bis maximal 20 Prozent an Steuer- und Abgabenbelastung durchsetzen.«
Roland Baader
Damals schrieb ich noch scherzhaft: »Ähnlichkeiten zu unserer Gesellschaftsform sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.« Doch ich gebe zu: Das war gelogen. Natürlich ist die Welt nicht ganz so einfach wie diese kurze Geschichte. Dennoch bringt sie vereinfacht auf den Punkt, wie unsere Gesellschaft aktuell funktioniert: Wenn ich viel arbeite, muss ich viel Geld an die Regierung zahlen. Wenn ich aber nicht arbeite, zahlt die Regierung viel Geld an mich. Und noch besser ist es, man gehört zu denen, die die Regeln machen oder sie durchsetzen. Ja, das ist sehr provokant formuliert, aber wir schauen uns die Details noch näher an.
Die Geschichte von Robin Hood
Als ich in jungen Jahren zum ersten Mal die Geschichte von Robin Hood hörte, war ich entsetzt. Ich konnte der Geschichte überhaupt nichts abgewinnen. Jemand raubt Menschen aus und verschenkt das Raubgut dann willkürlich an andere? Was ist daran denn heldenhaft? Ich wollte selbst gern erfolgreich werden und fand eine Figur, die mit Gewalt Gleichmacherei betreibt, keineswegs sympathisch oder das Ergebnis irgendwie erstrebenswert. Für mich war das einfach nur ein Räuber, also letztlich ein Krimineller. Gleichwohl die Existenz von Robin Hood nicht belegt ist, geht man inzwischen davon aus, dass der aus einfachen Verhältnissen stammende Robin Hood es in Wirklichkeit auf habgierige Adlige abgesehen haben soll, also keineswegs einfache arbeitende Handeltreibende ausgeraubt hat. Der Adel war vielmehr die damalige Herrscherklasse, er nahm also nicht von den Reichen und gab es den Armen, sondern nahm es dem Staat und gab es der Bevölkerung. Ob diese Abwandlung nun historisch korrekt ist, mag dahingestellt bleiben, zumindest für mich macht ihn das aber gleich deutlich sympathischer. Heute ist das System leider umgekehrt perfektioniert. Der Staat nimmt dem Bürger sehr viel.
»Kein Betrüger und kein Bankräuber der Geschichte hat je die Ersparnisse des Volkes so sehr geplündert wie die Fiskalpolitik dirigistischer Regierungen.«
Ayn Rand
Wenn man vom Netto noch den Rundfunkbeitrag, die Kfz-Steuer, Energiesteuern, die Umsatzsteuer und den Steueranteil in der Miete abzieht, dann gehen erst mal 60 Prozent des Erwirtschafteten an den Staat. Zumindest für die Kranken- und Rentenversicherung gibt es eine messbare Gegenleistung, dennoch ist die Dienstleistung »Staat« in ihrer Gesamtheit recht teuer geworden. Dies liegt keineswegs am Straßenbau und Schulwesen, besonders teuer sind die Privilegien, die das politische System im Laufe der Zeit hervorgebracht hat. Deswegen sage ich, der Staat soll es nicht besser machen, sondern er soll weniger machen.