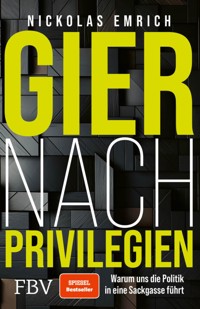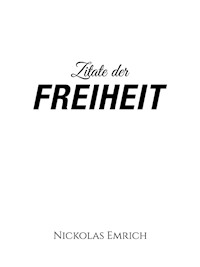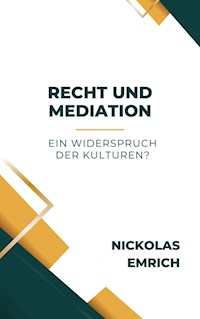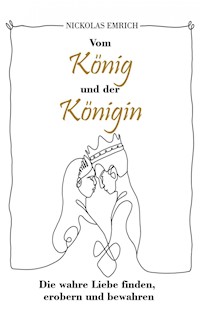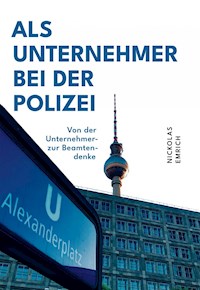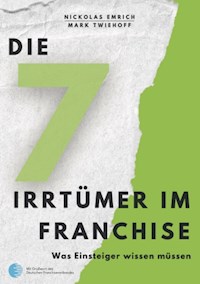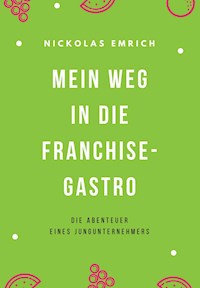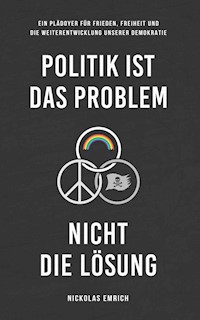
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer nach Schlagzeilen im Bereich Politik sucht, findet vor allem negative Nachrichten. Politik befindet sich permanent im Streit und im Gerangel um Posten, Richtungen und die gewünschte öffentliche Wahrnehmung. Wer als Berufspolitiker hochkommen und gesehen werden will, muss oft erst polarisieren, sich eine Bühne schaffen. Das kann einem als Zuschauer gewaltig auf die Nerven gehen, wenn man das politische Theater und seine Spielregeln erst einmal durchschaut hat. Wäre es nicht schön, wenn auf der ganzen Welt die Politik mal eine Pause machen würde? Wenn die Elfenbeintürme dieser Welt einfach alle gleichzeitig leerstehen würden und das Mitteilungsbedürfnis der politischen "Elite" ausbleibt? Eine Welt ohne Politik – ist das eine Illusion? Oder einfach nur zu entspannt und friedlich, um wahr sein zu können? Wenn Krieg nach Carl von Clausewitz die bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, ist dann Frieden durch die bloße Abwesenheit von Politik möglich? Dieser Überlegung möchte dieses Buch auf den Grund gehen und wird dabei selbst ungewollt politisch. Mit einer klaren Haltung, aber dennoch differenziert. Die These des Autors ist: Die Welt ist gar nicht so schlecht, sondern nur die Menschen, die die Macht beanspruchen. So ist das Buch letztlich ein Plädoyer gegen das Regiert-werden, für mehr Eigenverantwortung und weniger politische Polarisierung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Politik ist das Problem, nicht die Lösung
Ein Plädoyer für Frieden, Freiheit und die Weiterentwicklung unserer Demokratie
Nickolas Emrich
© 2022 Nickolas Emrich
ISBN Softcover:978-9916-9851-2-0
ISBN Hardcover: 978-9916-9851-1-3
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
Gedruckt von Amazon Media EU S.à r.l.
‚5 Rue Plaetis, L-2338, Luxemburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Infinitas Media OÜ, Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estland.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitende Überlegungen
1. Meine bisherigen Erfahrungen
a) Meine ersten politischen Eindrücke und ihre Konsequenzen
b) Probieren geht über Studieren – die Einstiegsdroge Hochschulpolitik
c) Politik nach Piratenart – ich kam, sah und (k)enterte
d) Neues Studium, neues Glück – auch politisch gesehen
e) Erlebnisse aus der echten Parteipolitik: Politischer Versuch macht klug – (k)ein gutes Ende
2. Meine Zwischenbilanz
3. Mein vorläufiges Fazit
a) Die Menschen machen lassen
b) Der Gemeinschaft Grenzen setzen
II. Das Positive an unserem aktuellen Staatswesen
1. Recht mit Verfassungsrang
2. Rechtsstaatlichkeit
3. Gleichheit vor dem Gesetz
4. Macht auf Zeit
5. Gewaltenteilung
6. Vielzahl an Akteuren
7. Meinungsfreiheit
III. Herausforderungen des aktuellen demokratischen Systems
1. Tendenz zu Ausdehnung und Aktionismus
2. Demokratie spaltet
3. Die Annahme, Obrigkeit sei notwendig
4. Prinzip der Parteilichkeit als Systemfehler
5. Negativauslese Parteienpolitik
6. Fehlende Betroffenheit
7. Macht ist in sich gefährlich
IV. Ausnahmen
1. Marktversagen
2. Irrtum des Autors
V. Fazit
I. Einleitende Überlegungen
Bevor ich zu den Thesen dieses Buches komme, möchte ich meine bisherigen Erfahrungen, Überlegungen und Schlussfolgerungen schildern, die mich letztlich veranlasst haben, zu dem Ergebnis zu kommen, Politik sei das Problem, nicht die Lösung. Diese sind sehr subjektiv und nur als Einleitung zu verstehen. Eine tiefergehende Beschäftigung mit einzelnen Gesichtspunkten erfolgt erst in den darauffolgenden Kapiteln. Insbesondere Kapitel III. handelt von den Aspekten, die aus meiner Sicht ausschlaggebend dafür sind, dass in der Politik selbst, wie sie derzeit gelebt wird, ein eigenständiges gesellschaftliches Problem steckt. Zuvor werde ich, damit der Fokus nicht ausschließlich negativ ist, in Kapitel II. auch die positiven Aspekte unseres Staatswesens benennen. Ziel des Buches ist eine konstruktive Kritik. Es geht mir nicht darum, zu meckern, sondern Fehler im System aufzuzeigen – im Wissen, dass nicht alle meine Annahmen richtig sein müssen. Dennoch werde ich meine Auffassungen strukturiert darlegen, sodass Sie hoffentlich die Chance haben, meine Gedanken nachzuvollziehen. Zum Schluss gehe ich noch auf Ausnahmen ein und ziehe ein Fazit, falls Sie bis dahin nicht bereits selbst eines gezogen haben. Danach können Sie selbst entscheiden: Ist Politik das Problem, nicht die Lösung?
1. Meine bisherigen Erfahrungen
Auch wenn ich als Person eigentlich unwichtig für dieses Buch bin, möchte ich trotzdem erzählen, welche Erfahrungen mich zu den Überlegungen dieses Buches geführt haben. Diesen Teil können Sie jedoch auch überspringen.
a) Meine ersten politischen Eindrücke und ihre Konsequenzen
Anders als viele Jugendliche damals war ich schon früh neugierig, was das politische System betrifft. Viele entdecken das Thema für sich ja erst im Alter, haben es sich also reiflich überlegt, sollte man meinen, aber ich war schon in jungen Jahren äußerst interessiert, was sich hinter politischen Gruppierungen, ihrer Arbeit und ihrem Engagement verbirgt. Daher besuchte ich mit noch jungen 16 Jahren mein erstes Treffen der Grünen Jugend in Berlin-Kreuzberg, um hier einmal hinter die Kulissen zu schauen. Die bunte Versammlung einer Reihe junger Menschen traf sich in einem ehemaligen Ladenlokal und ich gesellte mich an einem Abend einfach mal dazu. Die Stimmung war locker, man unterhielt sich über dies und das, zwar ergebnislos, aber dennoch ziemlich engagiert, wie mir schien. Als das offizielle Treffen seinem Ende zuging, kam plötzlich Leben in die Bude und alle waren schwer damit beschäftigt, eine Reihe von fleckigen und überaus verdreckten Matratzen aus dem Ladenlokal vor selbiges auf den Bürgersteig zu zerren. Auf diesem unappetitlichen Matratzenlager machten es sich alle bequem, man drehte die Musik auf, Hochprozentiges machte die Runde und es wurde geraucht, gelacht und gequatscht. Beschwerden von Anwohnern wurden ignoriert und mir war die Situation etwas unangenehm, allen anderen aber scheinbar nicht. Sie schienen sich prächtig zu amüsieren. Zumindest meine Begleitperson, ein guter Freund, fand nach intensivem Austausch über die Berliner Queer-Szene noch einen Bettpartner für den Abend, aber auch er verzichtete auf eine Mitgliedschaft. Alles in allem ein witziger Abend, aber ich hatte dennoch keine Ambitionen, ihn zu wiederholen. Mein erster Ausflug in die Welt der Politik blieb an dieser Stelle eine Eintagsfliege. Zu einem zweiten Treffen bin ich nie erschienen.
Mit 18 startete ich einen erneuten Versuch, diesmal bei den JuLis, den Jungen Liberalen. Auch hier besuchte ich eine abendliche Veranstaltung, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen waren. Man war ja schließlich immer auf der Suche nach engagierten Mitstreitern. Bereits optisch war diese Veranstaltung eine komplett andere Welt. Die hoffnungsfrohen jungen Mitglieder waren zwar auch bunt, aber lange nicht so alternativ und freakig, dafür aber nahezu ausnahmslos bekleidet mit pastellfarbenen Poloshirts und farblich darauf abgestimmten Hosen oder Röcken. Allesamt offensichtlich aus gutem Hause, strahlte schon ihre Garderobe eine gewisse Kostspieligkeit aus, teure Uhren und Schmuck rundeten diesen Gesamteindruck ab. Ihre Münder verkündeten selbstsicher Leistungsträgersprache, obwohl wahrscheinlich keiner von ihnen bisher selbst maßgeblicher Leistungsträger war. Stattdessen bezogen sie ihre Selbstsicherheit aus dem Vermögen ihrer Eltern und dem voraussichtlichen Erbe, das ihnen selbstverständlich zustehen würde.
Fasziniert von ihrer Selbstverliebtheit und ihrem hohen Anspruchsdenken blieb ich ihnen einige Zeit treu, half sogar beim Wahlkampf, indem ich Flyer und Gummibärchen vor Berliner Schulen verteilte. Parallel machte ich mich schlau über das Wesen von Parteien und staunte nicht schlecht, wie wenige Unterschiede es zwischen Parteien und Vereinen gab. Im Grunde genommen entsprechen Parteien Vereinen, denn Parteienrecht ist aus dem Vereinsrecht geboren und erwachsen, also eine Fortführung desselben. Somit sind Vereine und Parteien aus demselben Holz geschnitzt, sowohl was das typische Vereinsleben mit seinem Vereinscharakter, seinen Sozialstrukturen und auch seinen Intrigen betrifft. Will also heißen: Um in Deutschland Gesetze machen zu können, muss man erst einmal als erste Hürde einem Verein beitreten. Hier ist man dann voll und ganz mit Selbstbeschäftigung beschäftigt. Es gibt eindeutige Hierarchien und Kungeleien, und auch handfeste Intrigen sind gerne Teil der Beschäftigungstherapie, die die gemeinsamen Zusammenkünfte maßgeblich kennzeichnet. Ich kam also nicht umhin, den Zusammenkünften eine gewisse Vereinsmeierei zu unterstellen, denn alle nahmen sich außerordentlich wichtig, maßen ihrer Betätigung einen übertriebenen Wert zu und verzettelten sich gerne in versteckten Machtspielchen, statt offen sachlich zu bleiben.
Des Weiteren fand ich heraus, dass man, um in der Politik erfolgreich zu sein, ziemlich sesshaft sein musste. Pläne, die häufige Umzüge vorsahen, waren eher kontraproduktiv, denn wenn man es einmal geschafft hatte, sich in seinem Bezirk oder auf Landesebene hochzuarbeiten, bedeutete ein Ortswechsel gleichzeitig das Karriereende, da man die einmal erkämpfte Position mit seinem Wegzug kampflos räumen musste, um dann anderswo wieder von vorne anzufangen. Wollte man hier etwas erreichen, musste man also vor Ort bleiben. Selten umzuziehen ist also ein wichtiges Selektionskriterium. Kein Witz. Das kam mir mit meinem natürlichen Bewegungsdrang nicht wirklich entgegen, daher beendete ich mit dieser Erkenntnis dann schlussendlich meine politische Mitarbeit bei dieser Gruppierung.
b) Probieren geht über Studieren – die Einstiegsdroge Hochschulpolitik
Bisher waren meine beiden Erfahrungen einerseits zwar spannend, aber nicht sonderlich befriedigend. Zwischenzeitlich spielte ich auch mit dem Gedanken, mich näher mit der SPD zu beschäftigen, verwarf ihn dann aber wieder.1* Zumindest war Gerhard Schröder der Kanzler meiner Kindheit und ich mochte ihn, auch wenn man das heutzutage ja kaum noch sagen darf, da er inzwischen nicht mehr so populär ist. Aufhören war für mich zu diesem Zeitpunkt dennoch keine Option, daher wechselte ich zu Beginn meines Jurastudiums erneut das Lager. Grün hatte ich schon, gelb auch und als der RCDS (der der CDU nahestehende Ring Christlich Demokratischer Studierender) an meiner Hochschule Leute für engagierte Mitarbeit suchte, meldete ich mich. Diesmal dann also in das schwarze Lager. Ich bekam eine sehr herzliche Einweisung und das Gefühl, dass hier Inhalte mehr zählen als soziale Machtspielchen. Aber ich musste nach kurzer Zeit erkennen, dass dem nicht so war. Hier warf mir der aus Bayern kommende Vorsitzende gerne Stöcke zwischen die Beine, wenn ich nicht genau seiner Meinung war und entpuppte sich relativ schnell als ziemlich herrschsüchtig und ausgesprochen machtgeil. Unsere erste offizielle Mitgliederversammlung endete in einem ziemlichen Desaster, jedenfalls für mich. Sie fand in einem eigens dafür angemieteten Saal in einer entfernten Burg statt, in der wir auch in Zweierzimmern untergebracht waren. Das Treffen war anfangs launig und informativ, man begegnete sich freundlich und auf Augenhöhe, diskutierte sachlich und mit interessanten Positionen und Argumenten, bis der Honigwein ins Spiel kam. Er machte die Runde, erst feucht-fröhlich, dann enthemmt, gegen Ende exzessiv. Das Ergebnis dieses Abends konnte sich in meinem Fall sehen und riechen lassen, denn mein mir zugeteilter Zimmerpartner kotzte anschließend unser gemeinsames Badezimmer voll. Das war deswegen umso verstörender, weil er es war, der den gesamten Abend keine Gelegenheit ausließ, zu betonen, dass er aus „gutem Hause” stammte, sein Vater steinreich war und ihm dadurch „alle Türen offenstanden”. Diese aufgesetzte Blasiertheit unterstrich er, als er beim Bezahlen der Getränke affektiert mit einem Zweihundert-Euro-Schein wedelte, um anschließend alle guten Manieren in unserem Badezimmer förmlich auszukotzen. Diese hemmungslose Maßlosigkeit auf jedwedem Gebiet sowie die Machtspielchen und Intrigen des Vorsitzenden kotzten mich an, diesmal im übertragenen Sinne, und ich beendete meine Mitarbeit im RCDS.
c) Politik nach Piratenart – ich kam, sah und (k)enterte
Hatte mein bisheriges politisches Engagement dazu geführt, dass ich einen gewissen Überdruss an den hier herrschenden Strukturen und damit verbundenen sozialen Reaktionen und Rollen verspürte, so hielt es mich allerdings nicht davon ab, politisches Engagement auch weiterhin zu versuchen, auszuprobieren und zu perfektionieren. Allerdings nicht mehr, indem ich einer bereits existierenden Gruppierung beitrat, sondern indem ich an der Uni etwas Eigenes auf die Beine stellte. Also gründete ich die „Piraten-Hochschulgruppe” und war damit zugleich ihr Vorsitzender.
Gründer und Chef in Personalunion, da konnte einfach nichts mehr schiefgehen, dachte ich.
Für die Piratenpartei hegte ich schon seit geraumer Zeit eine gewisse Sympathie. Sie war eine recht junge Partei, noch nicht so verbraucht und verknöchert, hatte spannende Ideen wie etwa „Liquid Democracy”. Die Piraten waren äußerst digitalaffin, hatten sich die Bürgerrechte hoch auf ihre Fahnen geschrieben, waren eher unkonventionell und liberal eingestellt und, weil sie recht neu und jung waren, waren sie in meinen Augen ideal, um studentische Politik zu verkörpern. Und es gab sie noch nicht an meiner Hochschule. Also, her mit einer/meiner Piraten-Hochschulgruppe, die ich, dank guter Bekannter und einiger Überzeugungsarbeit, schnell und erfolgreich zusammenstellen konnte und die anschließend Einzug ins studentische Parlament hielt. Natürlich gab es anfangs Widerstand gegen diese neue Gruppe. Wie immer war das herrschende Etablissement zunächst dagegen. Etwas Neues wird immer misstrauisch beäugt.
Widerstände mochte ich immer schon, geben sie einem doch das Gefühl, dass es sich lohnt, zu kämpfen. Und das konnte ich. Rhetorisch äußerst versiert konterte ich Gegenargumente, Angriffe und Proteste meistens geschickt und vor allem mit Sachargumenten und so gelang es mir, mich und meine Gruppe Stück für Stück durchzusetzen, sodass ich später sogar, welch Wunder, die Opposition verließ und in den AStA-Vorstand gewählt wurde. Durch eine Listenkombination mit der Grünen Hochschulgruppe zogen wir sogar in den Senat der Universität ein, was zuvor nur den großen Gruppen möglich war. Während dieser turbulenten Zeit habe ich viel dazulernen dürfen. Vor allem, was die Interna der politischen Arbeit angeht. So lernte ich beispielsweise bestimmte Spielregeln kennen, die eigentlich immer zum Einsatz kamen. Woran ich mich gewöhnen musste: Für jeden Mist wurden teure Rechtsgutachten beauftragt, selbst wenn man mit gesundem Menschenverstand und kurzer Recherche recht schnell selbst zu einem Ergebnis kommen konnte.
Ohne Gutachten wurde vieles schlicht nicht akzeptiert und das Geld war ja schließlich da. Webseiten wurden mitunter zum vierfachen Marktpreis beauftragt. Man wusste nie, ob aufgrund von Korruption, Faulheit oder Dummheit. Selbst wenn das kritisiert wurde, entlasteten sich die betreffenden Personen einfach in der nächsten Legislatur mit der eigenen Koalitionsmehrheit – und erklärten mit einem Mehrheitsentscheid Unrecht zu Recht. Zudem störte mich die extrem ausgeprägte Mitnahmementalität. Jede Bewirtung sollte bezahlt werden, selbst der Umtrunk nach den Sitzungen wurde von manchen eingereicht. Auf der Weihnachtsfeier versuchten viele, die Kosten wirklich maximal auszureizen, bestellten gefühlt alles auf der Speisekarte und ließen die Hälfte davon übrig. Die Rechnung wurde schließlich übernommen. Ich verstand, welche Denkkultur durch Beiträge gefüllte Geldtöpfe auslösen, und dass es eigentlich nur logisch war, dass in diesem Umfeld immer mehr solcher Absurditäten gedeihen konnten, die dann beispielsweise in solchen Geschichten gipfeln, wie wir sie dann in den Medien etwa beim rbb-Skandal sehen durften, bei dem Luxusbewirtungen ebenfalls eine Rolle spielten. Auch wenn dies natürlich viel größere Dimensionen waren als das, was ich hier erleben durfte, gibt es in Deutschland etliche gesetzlich vorgeschriebene Geldtöpfe für öffentlich-rechtliche Interessenvertretungen oder Kammern, die meist durch politische Gremien mit zahlreichen lukrativen Posten verwaltet werden und viele sinnlose Reise- und Bewirtungskosten produzieren.
Als Vertreter einer politischen Gruppierung (hier ist es eigentlich egal, welche) beschäftigt man sich hauptsächlich mit der Verwaltung in eigener Sache: Man ist bestrebt, sich gegen andere abzugrenzen und bestätigt sich in dieser Haltung andauernd aufs Neue. Selbstbeschäftigung ist Programm und in erster Linie geht es immer ums Geld und dass hier möglichst viel für einen selbst herausspringt. Man beantragt Gelder (Aufwandsentschädigungen, Fahrtkostenzuschüsse u. v. m.) und bekommt sie. Außerdem ist man bestrebt, leider genau wie in der „großen” Politik, Komplexität maßgeblich zu reduzieren und sich in der Regel nur mit Meinungen, Themen und Inhalten zu beschäftigen, die der eigenen Meinung sowieso schon entsprechen. Störendes wird einfach ausgeblendet, denn es schmälert die eigene Bedeutung und Wichtigkeit, die es mit aller Macht zu demonstrieren und zu verteidigen gilt.
Oder, um es mit einem Zitat des deutschen Journalisten und Buchautoren Gabor Steingart zu formulieren: „Deutsche Parteifunktionäre [baden] in der Pfütze der Tagespolitik, die sie selbst als Ozean der Weltgeschichte empfinden.”
Genau so war es auch bei uns.
Die wichtigsten Spielregeln für politisches Engagement
Erziele maximalen Konsens: Du kannst es keinem wirklich recht machen, das aber möglichst vielen.
Rede viel um den heißen Brei herum, aber so, dass es keiner merkt.
Überhaupt: Rede viel, bleibe aber nichtssagend.
Delegiere Aufgaben – je undurchsichtiger, desto besser.
Deine Hauptverantwortung: Verantwortlich sind immer die anderen.
Die Position der eigenen Gruppe muss um jeden Preis verteidigt werden.
Du bist in einer anderen Welt! Verhalte dich dementsprechend.
ff
d) Neues Studium, neues Glück – auch politischgesehen
Nach einigen erfolgreichen Jahren als Unternehmer beschloss ich, meinen Kindheitstraum zu verwirklichen und Polizeikommissar zu werden. Also alles auf Neustart. Mit Beginn des dafür notwendigen Studiums an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin war ich erneut Student. Als wären die Lehren der letzten Male nicht genug, konnte ich auch hier meine Finger nicht davonlassen, erneut auf der politischen Bühne der Studierendenschaft in Erscheinung zu treten. Zunächst trat ich unangekündigt während der laufenden Legislatur als AStA-Referent für Hochschulpolitik an und wurde unerwartet vom Studierendenparlament sogar im ersten Anlauf gewählt. So bekam ich schnell einen ersten Eindruck. Das Spiel war das gleiche, bloß ging es hier um weniger Geld, denn die Hochschule war kleiner und das Budget dadurch geringer. Auch hier dominierte eine von der Realität abgekoppelte Beschäftigung mit sich selbst und seiner scheinbaren Macht.
Die „Machthaber” waren eine Gruppe rund um ein herrschsüchtiges Pärchen, die über eine Mehrheit verfügte. Auf dieser Ebene ist das eigentlich völlig lächerlich – ich möchte gar nicht wissen, wie „wichtig” sich Leute fühlen, die auf höheren Ebenen agieren, bei denen es (leider) sogar berechtigt ist, sich wichtig zu fühlen, da sie tatsächlich mit großer Macht ausgestattet sind. Da mein erster Einblick war, dass alle Posten nach einem System der Günstlingswirtschaft vergeben wurden, ich aber leider sehr schlecht im Einschleimen bin und bei der ersten Wahl offenbar einfach nur Glück bzw. einen günstigen Überraschungsmoment hatte, gründete ich eine eigene „Partei”: Die „Liste junger Kommissaranwärter”. Weil es an der Hochschule viele davon gab, hatte meine Liste regen Zulauf und verzeichnete bald eine ganze Reihe von neuen, engagierten Mitgliedern. So zogen wir nach der nächsten Wahl erfolgreich ins Studierendenparlament ein.
Dort waren wir natürlich erstmal nur Opposition, denn meine neue Gruppe rief naturgemäß erstmal wenig Begeisterung bei denen hervor, die es sich im System bequem gemacht hatten. Das kannte ich ja bereits. Als der Vizepräsident des Parlamentes zurücktrat und kein Nachfolger bereitstand, stellte ich mich zur Wahl. Das schmeckte der mehrheitsstellenden Gruppe überhaupt nicht. Zum „Glück” meldete sich eine junge Frau aus dem ersten Semester, die fragte, welche Aufgaben mit dem Amt verbunden seien. Sofort wurde diese auf den Wahlzettel gesetzt. Sie sagte zwar noch: „Ich wollte eigentlich erst wissen, worum es geht. Für Fotos könnte ich zur Verfügung stehen, aber mehr Zeit...” Dann wurde sie unterbrochen. Sie solle sich nicht sorgen, das klappe schon, Geld gebe es auch. Dann wurde die Wahl begonnen, noch bevor sie darauf etwas erwidern konnte. Ich stand sinnbildlich mit offenem Mund da. Man brach offensichtlich alle Regeln, nur um Leute von außen zu verhindern, die wissen, wie man das Spiel spielt. Die junge Studentin gewann die Wahl, noch bevor sie realisierte, wozu sie da gedrängt wurde, allerdings mit einem sehr knappen Ergebnis. Als sie in der laufenden Legislaturperiode dann tatsächlich nur für ein paar Fototermine erschien und ansonsten durch Abwesenheit glänzte, kam Unruhe in die Koalition. Die nächsten Wahlen standen an und es formierten sich neue Wahllisten aus den Reihen der Unzufriedenen. Ein paar Treffen später und wir hatten „den Laden übernommen”. Die Erfahrungen aus Hagen waren sehr hilfreich.
In der darauffolgenden Legislatur2* wurde ich zum Präsidenten des Studierendenparlamentes gewählt, in der nächsten (die Legislaturen sind an den Hochschulen sehr kurz) zum AStA-Vorsitzenden. Im Rahmen dieser Tätigkeit fielen mir eine Reihe von Missständen auf, beispielsweise die Tatsache, dass viele Kosten einfach zu hoch waren und die Anzahl der Referenten auch deutlich zu hoch war. Das wollte ich ändern. Also machte ich weiter, koalierte mit meiner liberal geprägten „Liste junger Kommissaranwärter” mit dem sozialökologischen Bündnis (eine Hochschulgruppe, die im Spektrum zwischen SPD und Grünen zu sehen ist) und nahm die Sache in Angriff.
Wir halbierten unsere Bezüge, deren Höhe einfach nicht mehr zu rechtfertigen war. Wir begrenzten die Zahl der Referate von 17 auf 10 und nutzten ohne Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit auch nur 8 davon. (Bereits die Nachfolger reizten die maximal zulässige Zahl dann allerdings wieder aus und die Nachfolger der Nachfolger einige Jahre später setzten die Grenze wieder auf 12 herauf, dennoch wirkt die Reform noch bis heute.)
Wir senkten die Kosten für die AStA-Referenten von jährlich über 80.000 auf unter 20.000 Euro, ohne dass es zu nennenswerten Einschränkungen kam oder dadurch ein Angebot gekürzt werden musste. Die Einsparungen, die von den Beitragszahlern (in diesem Fall den Studierenden, denn es handelt sich um einen Pflichtbeitrag) entsprechend weniger in Form von Gebühren erhoben werden mussten, konnten von diesen dann für Bücher, Essen oder Kleidung ausgegeben werden. Oder um feiern zu gehen. Im Grunde war mir das auch egal, Hauptsache, das Geld ist wieder bei den Studierenden, sehr zu ihrer und auch meiner Freude. Immerhin konnten 60.000 Euro jährlich gerettet werden. Nur eine kleine Summe, wenn man anschaut, was in der großen Politik verschlungen wird, aber trotzdem war ich durchaus stolz darauf. In einer politischen Dimension war es vielleicht nicht viel Geld, manch Rundfunkrat zahlt dies pro Monat an seine Mitglieder aus. Dennoch hat es mich gefreut.
Zudem haben wir die Amtszeit auf ein halbes Jahr verkürzt, so dass untätige Referenten ohne Abwahl zur Hälfte der Legislatur des Parlamentes ausgetauscht werden konnten. Diese Neuerung war sehr wertvoll, um Karteileichen, die nur das Geld mitnahmen, deutlich schneller austauschen zu können. Mein Fazit: Jeder Cent, den die Studis mehr haben und diese „Politiker” weniger, ist den Kampf wert. Es war eine andere Welt, die oft mit den echten Problemen nichts zu tun hatte, eine Art „Bubble”, auch wenn das Wort damals noch nicht in Mode war – und nur die wirklich guten Leute waren nicht wegen des Geldes dort.
Mit all diesen „Reformen” machte man sich natürlich nicht nur Freunde, ganz im Gegenteil. Es rief Gegner und Neider auf den Plan und es regte sich Widerstand, ganz so wie in der „großen Politik”. Das ging sogar bis hin zu konkreten Verleumdungen, nach denen ich studentische Hilfskräfte unter Druck setzen und herablassend behandeln würde. Das konnte ich unmöglich so stehen lassen, daher setzte ich mich zur Wehr. In einer Zusammenkunft der wichtigsten Vertreter der Koalition legte ich schonungslos alles offen, was ich hatte. Zum Glück kommuniziere ich fast ausschließlich per Mail oder Sprachnachricht, da so alles dokumentiert war. Dabei wurde schnell klar, dass an den gegen mich gerichteten Verleumdungen nichts dran war, im Gegenteil. Alle im Raum empfanden meine Kommunikation als extrem höflich, unterstützend und wertschätzend, nachdem ich nahezu alle dienstlichen Kommunikationsverläufe offengelegt hatte. Alles andere hätte mich gewundert, denn ich versuche immer, Menschen in ihrer subjektiven Wirklichkeit abzuholen, Verständnis zu zeigen und einen gemeinsamen Konsens anzustreben. Ich gebe mir auch immer sehr viel Mühe, Dinge zu erklären. Ein Verfahren gegen die Initiatoren wurde wegen „geringer Schuld” eingestellt. Verständlich auf dieser unwichtigen Ebene. Dennoch war dies ein Sieg für mich, da die Staatsanwaltschaft damit nach dem Befragen aller Zeugen und dem Abschluss der Ermittlungen zumindest indirekt feststellte, dass nach Aktenlage wohl tatsächlich gegen mich intrigiert worden war, sonst lautet der Einstellungsgrund nämlich: mangels Tatverdacht. Diejenige, die das Vorgehen gegen mich angeschoben hatte, war eine Referentin mit einem sehr merkwürdigen Verhaltensmuster. Sie stellte zuvor schon eine ähnliche Behauptung in Bezug auf zwei Mitarbeiterinnen des Prüfungsamtes auf, über die sich angeblich ständig Studierende bei ihr als Referentin beschweren würden. In Wirklichkeit gab es dann nur eine Einzelperson, die sie überredet hatte, das zu sagen. Nachdem ich diese und weitere Intrigen abwehren konnte, wurde ich fast einstimmig für meine dann letzte Amtszeit wiedergewählt (die nur noch halb so lang war, denn einer meiner Reformpunkte war ja die Halbierung der Amtszeit) und war meinen Unterstützern auch sehr dankbar dafür.
Dennoch zeigte mir diese unschöne Episode, dass politisches Engagement schnell in einem Hexenkessel münden kann, da es immer gegenläufige Interessen gibt und die Intrige als probates Einsatzwerkzeug gern genutzt wird. Man tut also gut daran, sich zu hüten und für den Extremfall gegen alles gewappnet zu sein. Ein Erfolg war es trotzdem, denn wir hatten es geschafft, alle Punkte unserer Reform durchzusetzen.
Somit war dies fast ein positiver Berührungspunkt mit Politik, auch wenn ich einige Monate nach meinem Ausscheiden doch noch einmal von meiner ehemaligen Koalition enttäuscht wurde, als sie im Hochschulwahlkampf mit Verweis auf ihre Ämter für ihre Wahlliste geworben und Ergebnisse der Arbeit in den Exekutivämtern in einem Atemzug mit den Aktivitäten ihrer Liste genannt hatte. Eine Vermischung, auf die ich allergisch reagiere. Das Bundesverfassungsgericht würde dies eine „Verletzung der Neutralitätspflicht” nennen, bloß, dass dies auf dieser niedrigen Ebene leider niemanden interessiert.
Ich habe das dennoch sehr persönlich genommen, denn auch wenn man „am Hebel sitzt”, muss man das Recht meiner Meinung nach immer als imaginären Vorgesetzten im Kopf haben. Aus einer Machtposition heraus gegen das Recht zu handeln ist aus meiner Sicht die absolute Todsünde, egal wie klein und unbedeutend diese Ebene auch sein mag.
Auch in der großen Politik wird leider immer öfter einfach „ausprobiert”, ob etwas noch gerade so von den Gerichten getragen wird oder nicht. Auch Horst Seehofer und Angela Merkel sind schon wegen Verletzung der Neutralitätspflicht vom Verfassungsgericht gerügt worden, leider hat dies de facto keine Konsequenzen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass man dieses Phänomen auch im AStA, dem „Politik-Kindergarten”, erleben darf. Irgendwie driftet leider selbst das kleinste, unwichtigste System irgendwann von „Recht vor Macht” zu „Macht vor Recht” ab, wenn niemand von außen regelmäßig auf die Finger klopft.
Darauf komme ich noch zurück.
e) Erlebnisse aus der echten Parteipolitik: Politischer Versuch macht klug – (k)ein gutes Ende
Wie dem auch sei, mit meiner Zeit als Kommissaranwärter an der Hochschule für Wirtschaft und Recht endete dann auch automatisch mein politisches Engagement. Zunächst war ich im Schichtdienst auf der „Alexwache" aktiv, wechselte dann in ein Berliner Kommissariat und war seit 2019 Fachlehrer für Eingriffsrecht an der Polizeiakademie Berlin. Hier juckte es mir allerdings wieder in den Fingern, noch einmal politisch in Erscheinung zu treten. Irgendwie vermisste ich scheinbar die alten „Spielchen” rund um Macht, Selbstbeschäftigung, Widerstände und Intrigen, Meinungsmache und Sympathiepunktesammeln.
Ich traute mich nochmal, in eine Partei hineinzuschnuppern: Die Freien Wähler. Warum? Weil sie versprachen, anders sein zu wollen, angeblich bürgernah, sachorientiert, unideologisch. Auch waren sie noch relativ jung und standen nach eigenem Bekunden für eine Politik „von unten” mit gesundem Menschenverstand und Sinn für Gerechtigkeit. Alles Werte, die ich mit gutem Gewissen unterschreiben würde und zu dem Zeitpunkt auch gerne praktizieren wollte. Zunächst gründete ich in Berlin die Jugendorganisation der Freien Wähler, die Jungen Freien Wähler Berlin, und wurde deren Vorsitzender, später wurde ich auch noch Geschäftsführer im Landesvorstand der Freien Wähler Berlin und gestaltete maßgeblich das neue Parteiprogramm mit. Meine Arbeit kam gut an, die von mir geschriebene Satzung der Jungen Freien Wähler Berlin wurde von den Jungen Freien Wählern Sachsen direkt als Vorlage übernommen, auch mein Bezirkssatzungsentwurf setzte sich schnell durch.
Zusammen mit meinem Freund und Mitstreiter Bayram entwarf ich über 100 Memes und bebilderte Social-Media-Beiträge, um die Jungen Freien Wähler in Fahrt zu bringen. Doch der Frieden hielt nicht lange, irgendwann bemerkte ich die ersten Ungereimtheiten, die mir zunächst einfach nur quer im Magen lagen. Wie dort darum gestritten wurde, einen im bildlichen Sinne noch nicht gebackenen Kuchen zu verteilen, war leider einfach nur episch.
Von angeblich gekauften Stimmen bis zu absurden Verleumdungen (zum Glück nicht gegen mich) war alles dabei, um das Vereinsleben auf Trab zu halten. Im Fazit muss ich leider sagen, dass ich dort die übelsten Menschen getroffen habe, die ich jemals kennenlernen durfte. Wie in letzter Sekunde versucht wurde, Freunde und Bekannte, die zuvor nichts gemacht hatten und auch nie aktiv waren, auf die Liste zu bringen, konnte man nur mit heruntergefallener Kinnlade bestaunen. Ebenso die Feigheit und fehlende Standhaftigkeit der meisten Mitglieder, die über diese Probleme nicht sprechen wollten, weil es schlecht „für die Partei” sei. Auch eine Unterstützerin, die übrigens heute als Berufspolitikerin Mitglied eines Landtages ist und von der ich damals sehr viel hielt, hatte diese Argumentation angenommen und hielt diesen Leuten die Treue, da dies besser für die Partei sei – und lobte die Drahtzieher sogar öffentlich in ihrer Rede auf dem Parteitag – wider besseren Wissens. Sie stellte sich auf die Seite derer, gegen die in naher Zukunft wegen Verleumdung und falscher Versicherung an Eides Statt noch Strafverfahren eingeleitet würden, weil sie loyal zur Partei sein wollte. Doch genau dadurch werden Probleme nicht gelöst. Mir platzte erneut der Kragen. Nicht, weil ich mich nicht wehren konnte, sondern weil mir diese ganze politische Showbühne mit ihren selbstgemachten Inszenierungen dermaßen gegen den Strich ging und ich mit diesem Theater nichts mehr zu tun haben wollte.
Die „demokratischen Prinzipien” bei den Jungen Freien Wählern waren leider nicht besser. Diese wählten in Bayern ihre Bundesspitze, während dort ein Beherbergungsverbot galt. Man kann sich vorstellen, wie die Mehrheitsverhältnisse bei dieser Mitgliederversammlung ausgesehen haben. Der neue Vorstand bestand fast nur aus Bayern und Hessen. Dann kam plötzlich noch der Verdacht rassistischer Tendenzen im Berliner Landesvorstand auf, nachdem eine Vielzahl von Bewerbern mit migrantisch klingenden Namen begründungslos abgelehnt wurde. Ich war entsetzt. Mit Rassisten wollte ich auf gar keinen Fall etwas zu tun haben, auch wenn leider bis heute unklar ist, wer für die Ablehnungen verantwortlich war und welche Gründe genau dahintersteckten. Trotz vehementer Nachfragen wollte sich der damalige Vorsitzende der Freien Wähler Berlin nicht dazu äußern. An dieser Stelle zog ich endgültig einen Schlussstrich unter mein politisches Engagement, weil ich das politische Spiel, so wie es bei uns gespielt wird, insgesamt als unehrenhaft und eher destruktiv empfand. Mit den Verfehlungen des damaligen Vorsitzenden musste sich dann im Folgejahr die Strafjustiz befassen. Wichtige Mitglieder der ersten Stunde verließen die Partei wieder. Übrig blieb ein Team, das nicht einmal mehr fehlerfreie Beiträge veröffentlichen konnte.
Ich will an dieser Stelle den Leser nicht damit nerven, diese unwichtigen Geschichten im Detail zu erzählen. Zumindest waren wir so „wichtig”, dass wir die Schlammschlacht in den lokalen Medien austragen konnten. Nachdem ich noch meinen Mitstreiter Bayram erfolgreich vor dem Schiedsgericht3* vertreten und verteidigt hatte und der Landesvorsitzende endlich zurücktrat, verließ ich das Schlangennest wieder. Auch eine neue Partei ist leider immer noch eine Partei. Gewisse Probleme stecken einfach tief in der Struktur des Systems. So zum Beispiel, dass man sich in Vereinen organisieren muss und Vereinskulturen leider oft zu diesen Problemen neigen. Selbst in der Großstadt fühlt man sich in den meisten Parteien wie in einem Kleingartenverein, in dem es darum geht, Machtspielchen zu spielen. Das Paradoxe war, dass ich keinesfalls zu blöd oder zu naiv war, solche Spielchen zu spielen. Eigentlich war ich sogar sehr gut darin und habe mich am Schluss auch immer erfolgreich verteidigen können. Für jeden Schlag, den ich einstecken musste, habe ich zwei neue verteilt. Aber ich finde das gesamte politische Spiel destruktiv und unehrenhaft. Es ist aus meiner Sicht nicht richtig.
Es bringt keine guten, loyalen Menschen hervor, sondern benutzt sie als Mitspieler auf der politischen Bühne. Hier sind sie in der Regel Marionetten, die machtgeil nur auf ihre eigenen Vorteile bedacht sind. Nicht das gut funktionierende große Ganze und ergebnisorientierte Machbarkeit stehen im Zentrum ihrer Bemühungen, sondern die selbstverliebte Inszenierung von Person und Position. Und bei einem solchen Spiel wollte ich absolut kein Mitspieler mehr sein. Schluss, Ende, aus.
2. Meine Zwischenbilanz
Nach meinen bisherigen Ausflügen in die Politik begann ich, mir Gedanken über das Wesen der Politik zu machen. Ich betrat also eine Art Metaebene und stellte mir folgende Frage: Wieviel Politik ist überhaupt notwendig und wie sollte diese Politik dem Menschen idealerweise dienen? Hierbei ging es mir weniger um eine politische Richtung, also rechts oder links, ökologisch wertvoll versus konservativ bewahrend oder maximal sozialverträglich, sondern eher um eine grundsätzliche Haltung und die daraus resultierende Frage: Wie viel Politik braucht man eigentlich überhaupt?
Hier kam ich schnell zu dem Schluss, dass für mich weniger mehr ist, dass ich eigentlich für eine Politik mit weniger Politik bin. Die Abwesenheit von Politik schien aus meiner Sicht das Beste zu sein. Ich mochte Linke und Konservative beide nicht wirklich, denn beide mischen sich gerne in das Leben anderer Leute ein, wenn auch mit anderen Zielen, und es war genau das, was ich nicht mochte. Denn in meinen Augen bedeutet Politik auch immer eine Form von Herrschaft, denn sie sagt uns, wo der Hase langläuft und was wir dafür zu tun und zu lassen haben. Herrschaft ist in meinem Verständnis auch immer gleichbedeutend mit Gewalt und Gewalt finde ich falsch. Auch meint Herrschaft immer Einmischung, denn sie legt Richtlinien für das individuelle Verhalten fest, definiert richtig und falsch im Rahmen ihres Grundverständnisses von „Gemeinwohl, Zusammenhalt und Freiheit”.
An dieser Stelle will ich bislang politisch Erreichtes nicht kleinreden: Unser politisches System in Deutschland, Europa und anderen entwickelten Gebieten ist nicht per se schlecht, im Gegenteil, es wurde vieles erreicht, gerade in den letzten Jahrzehnten. Wir haben eine verbesserungswürdige, aber funktionsfähige Demokratie, es herrscht Gewaltenteilung und das Recht auf individuelle Freiheit, freie Meinungsäußerung und Selbstbestimmung. Das war tatsächlich einmal ganz anders. Aber manchmal denke ich, dass Freiheit bei uns tatsächlich mit einem etwas größeren F geschrieben werden könnte. Es ist freier als anderswo, aber es ist noch nicht frei genug. Vieles wird bei uns durch Pflichten geregelt. Dazu gehört die Schulpflicht, man ist steuerpflichtig, es gibt die Meldepflicht und die Ausweispflicht. Nicht zu vergessen, die Pflicht, Rundfunkbeträge zu entrichten. Und die Pflicht zur Renten- und Arbeitslosenversicherung für Angestellte.
Weitere Pflichten werden gerade heiß diskutiert, wie etwa die Rentenversicherungspflicht für Selbständige, die Impfpflicht oder die Pflicht für junge Menschen, ein soziales Jahr zu absolvieren, welches zurzeit noch freiwillig ist. Oder ein Pflicht-Ticket für den ÖPNV. Es gibt den Hang vieler Menschen, das unerwünschte Verhalten anderer kriminalisieren zu wollen. In den USA sind ganze Gefängnisse gefüllt mit Menschen, die Drogen konsumiert haben und erwischt wurden. Historisch gilt dies auch für Homosexualität, wenn man bedenkt, was Homosexuellen durch staatliches Gesetz in der Vergangenheit angetan wurde. Das können sich junge Menschen in Europa kaum noch vorstellen, dass Homosexualität staatlich untersagt war. Ein gutes Beispiel dafür, dass ein Gesetz nicht immer Gerechtigkeit bedeutet. Der Staat kann auch Unrecht in Gesetzesform gießen – und hat dies auch schon oft getan. Nach der Phase der Sanktionierung folgte dann noch eine Phase der Diskriminierung. Erst mit dem im Oktober 2017 in Kraft getretenen „Eheöffnungsgesetz” ist es auch gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt, zu heiraten. Davor war das nicht möglich, sie konnten lediglich eine eingetragene Lebenspartnerschaft schließen, waren also nicht gleichgestellt, sondern „irgendwie anders”, ein Status, den ganz klar die Politik mit ihren Regeln und Gesetzen zu verantworten hatte und der mit Sicherheit noch bis heute nachwirkt.
Wie bei allen Gesetzen gibt es oft klare Befürworter und erbitterte Gegner. Die Befürworter argumentieren in der Regel mit dem Schutz und Wohl der Gesellschaft, die Gegner wollen sich nicht vorschreiben lassen, was sie zu tun und zu lassen haben. Die nachfolgende Feststellung ist natürlich nicht wissenschaftlich, aber ich habe oft bemerkt, dass sich viele Menschen merkwürdig uneinig sind, d. h. ohne roten Faden von Thema zu Thema springen und mal so und mal anders entscheiden. Da gibt es Leute, die explizit gegen eine Corona-Impflicht sind, aber mit einer Wehr- bzw. Dienstpflicht liebäugeln – oder umgekehrt. Oder sie ärgern sich über zu hohe Sozialabgaben, befürworten aber andererseits die Rentenversicherungspflicht für Selbstständige. Oder sie sind gegen Rundfunkbeiträge, aber finden ein Pflicht-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr ganz toll.
Viele Menschen suchen sich je nach Thema einfach eine neue Meinung aus. Das kann man natürlich machen. Man sucht sich das heraus, was für einen selbst das Beste ist – und fordert das. Konsequent ist es aber nicht. Die Grundfrage dahinter, nämlich nach Kollektivismus oder Individualismus, wird oft nicht reflektiert. Es geht darum, ob man Menschen mit Gesetzen zu etwas zwingen sollte – oder eben nicht.
Viele schauen, was für sie nützlich ist und haben im Ergebnis einen total wirren Meinungscocktail. Wer die Wehr- oder Dienstpflicht für alle fordert, sollte sich aber nicht beschweren, wenn plötzlich eine Impfpflicht gilt. Wer Zwang im Sinne der Mehrheit in einer Sache befürwortet, sollte sie nicht in einer anderen Sache ablehnen, bloß weil es ihn dort plötzlich betrifft. Das heißt nicht, dass man nicht für sich selbst unterschiedlich entscheiden kann: Natürlich kann man sich gegen ein soziales Jahr, aber für eine regelmäßige Corona-Schutzimpfung entscheiden. Ich finde aber, zumindest hinsichtlich der Ausübung von Zwang in Form eines Gesetzes sollte man sich entscheiden. Will man, dass sich der Einzelne im Zweifel der Gesellschaft unterordnen soll oder dass die persönliche Freiheit des Individuums im Mittelpunkt steht? Ich vertrete ganz klar letzteres.
Manche sind auch konsequent gegenteiliger Meinung, z. B. Frank Appel, der sagt: „Wir haben eine Schulpflicht. Wir hatten lange auch eine Wehrpflicht. Deswegen bin ich schon seit längerer Zeit ein Befürworter der Impfpflicht.” Das finde ich zumindest konsequent, auch wenn ich die gegenteilige Ansicht vertrete. Zum Schluss lautet die philosophische Frage dahinter: Kollektivismus – ja oder nein?
Ich sehe derzeit eine gefährliche Entwicklung zugunsten des Kollektivismus. Die Schutzpflichten des Staates werden bis in das allgemeine Lebensrisiko hinein ausgeweitet.
Natürlich ist es gut, dass das menschliche Zusammenleben durch bestimmte Regeln und Gesetze geregelt wird, um so dem Chaos, Verbrechen und anderen unerwünschten Zusammenstößen vorzubeugen und auf diese Weise ein gewisses Maß an Sicherheit zu garantieren. Dennoch erfordert dies aus meiner Sicht nicht, alle Lebensbereiche einheitlich zu regeln. Ich bin für die Legalisierung von Cannabis, obwohl ich kein Konsument bin und nie eine Affinität zu Drogen hatte, denn mir geht es um die Freiheit, nicht darum, meinen Lebensstil durchzusetzen. Ich war aber auch immer für Ehe für alle, obwohl ich heterosexuell und somit nicht betroffen bin. Ich halte es für fatal, wenn man immer nur schaut, was einen selbst persönlich betrifft. Ich trete für die Freiheit anderer ein, damit andere es vielleicht irgendwann für mich tun können. Obwohl ich niemals ohne Sicherheitsgurt fahren würde, könnte man meinetwegen auch die Gurtpflicht abschaffen. Das ist vielleicht ein etwas extremes Beispiel, da es sich beim Gurt in Kraftfahrzeugen offensichtlich um etwas Sinnvolles handelt. Ich will damit nur sagen, dass ich selbst hier der Freiheit den Vorrang einräumen würde. Wer den Gurt nicht anlegt, weil er den Sinn erkennt, sondern weil er das Verwarnungsgeld von 30 Euro so sehr fürchtet, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen.4* Was das Fordern von gesetzlichem Zwang angeht, leidet die Gesellschaft aus meiner Sicht an einer dissoziativen Identitätsstörung, da gleichzeitig manche gesellschaftliche Bereiche liberalisiert werden, während andere stärker reglementiert werden. Die Frage nach der Freiheit ist aber die eigentliche Systemfrage, die kaum jemand dahinter reflektiert. Ich plädiere für die Freiheit, denn andere Menschen sind mir in einem positiven Sinne egal – ich wünsche ihnen das Beste, aber fühle mich nicht für sie zuständig.
Natürlich sind Regeln, Vorschriften und Gesetze wichtig, die das menschliche Miteinander regeln und Mord, Totschlag und das Schlimmste verhindern, keine Frage. Aber auch hier kommt es auf die richtige Dosis an: Ein Zuviel davon kann als Gängelung empfunden werden und missachtet die Freiheit des Einzelnen, die ja auch im Grundgesetz verankert ist.
„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.” - Jean-Jaques Rousseau
Zu viele Regeln, Pflichten und Gesetze wirken hier eher kontraproduktiv, da sie ein Handlungskorsett von außen aufzwängen und die individuelle Freiheit massiv beschneiden. Wer dem Menschen durch Pflichten und Vorschriften möglichst viel verbietet und ihn maßregelt, traut ihm wenig zu und hindert ihn an seinen Entfaltungsmöglichkeiten. Ein „starker Staat” sollte daher seine Bürger nicht in erster Linie einschränken und sanktionieren, sondern befähigen, ermutigen und motivieren. Vielleicht kommt ja Großes dabei raus und der Bürger ist von seinen individuellen Fähigkeiten selbst berauscht und wird regelrecht „high” ob seiner eigenen Fähigkeiten. Die Freiheit dazu sollte er haben, andere „Highs” sind bei uns regel- und gesetzeskonform eher schwieriger zu erlangen. Noch ist Cannabis, anders als in vielen anderen Ländern, bei uns illegal, aber vielleicht ändert sich dieses Verbot auch bei uns bald. Wieder ein Gesetz weniger, was vermutlich nicht schlecht wäre, wie ein Blick ins benachbarte Holland offenbart.
„Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, ist es notwendig, kein Gesetz zu machen.” - Montesquieu
Die Thematik der Drogenfreigabe ist eine wichtige Trennlinie zwischen Freiheitlichen und Konservativen. Der grundlegende Unterschied besteht in der Einsicht, dass die Frage danach, was man persönlich mag oder ablehnt, nichts damit zu tun hat, was legal und was illegal sein sollte. Dies übertrage ich auf alle anderen Themen. Meine persönliche Meinung zu einem Thema sollte nichts damit zu tun haben, wie ich politisch dazu stehe. Ich muss kein Gesetz für andere fordern. Ich kann für mich richtig entscheiden und sollte nicht fordern, dass dies auch für alle gelten müsse. Das ist mein roter Faden gegen „Meinungs-Hopping”.
3. Mein vorläufiges Fazit
Ist mit weniger Staat mehr Staat zu machen? Diese Frage stellen sich viele angesichts einer wachsenden Bürokratie, einer gefühlt permanent überlasteten Verwaltung und immer wieder neuen politischen Kapriolen und Verordnungen und weiterer politischer Machtspielchen.
„Es ist erstaunlich, dass Menschen, die glauben, dass wir es uns nicht leisten können, für Ärzte, Krankenhäuser und Medikamente zu bezahlen, irgendwie glauben, dass wir es uns leisten können, für Ärzte, Krankenhäuser, Medikamente zu bezahlen und dazu noch eine staatliche Bürokratie, um dies zu verwalten.” - Thomas Sowell
a) Die Menschen machen lassen
Die Haltung für die Freiheit ist dabei eigentlich die einfachste politische Einstellung, die es gibt, und doch ist sie für viele am schwersten zu verstehen.