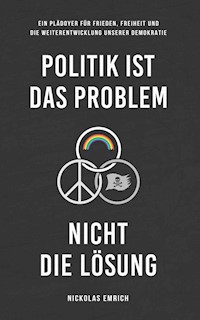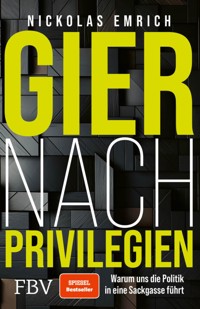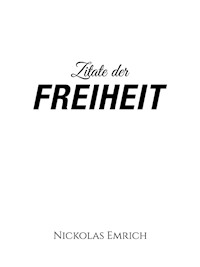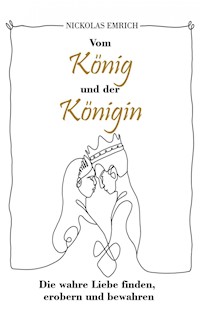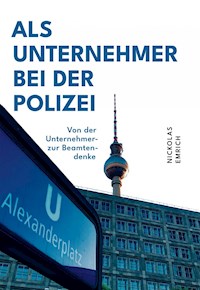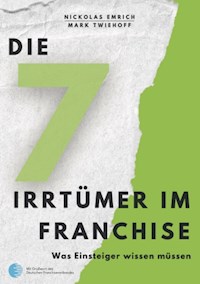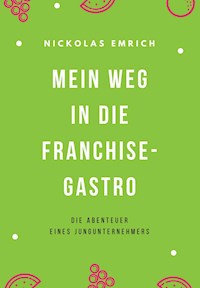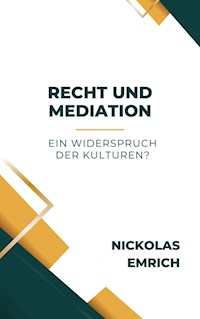
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Mediation ist ein noch recht junges und flexibles Verfahren der Konfliktbeilegung, die Struktur der staatlichen Gerichtsbarkeit dagegen ein über viele Generationen gewachsener Koloss, der mitunter altmodisch und archaisch wirken kann. Dennoch verfolgen beide auf den ersten Blick das gleiche Ziel – das eine Verfahren privatrechtlich, das andere hoheitlich. In diesem Buch geht es darum, die Denkkulturen und Methoden der beiden Verfahren miteinander zu vergleichen. Innovation gegen Tradition – ist es so einfach? Was können die beiden Systeme voneinander lernen? Was können Mediation und klassische Rechtsfindung durch richterliche Anwendung von geschriebenem Recht leisten und welche Rolle nehmen sie aktuell und in der Zukunft ein? Das Buch beschreibt und vergleicht die Prinzipien der Mediation und des Gerichtswesens. Ein interessanter Aspekt hierbei ist die Kommunikation und die Bedeutung der gewaltfreien Kommunikation in der Mediation als entscheidender Unterschied zur juristischen Kommunikation. Die Beachtung oder Missachtung der gewaltfreien Kommunikation im konservativen Prozessablauf ist dabei ein wesentlicher Gesichtspunkt, der eine kritische Betrachtung erfährt. Der Autor zeigt insbesondere auf, welche Innovationsimpulse die Mediation dem herkömmlichen Gerichtsverfahren geben könnte, welche Denkweisen der Jurisprudenz sich verändern sollten und welche Gesetzesänderungen möglich wären, um im Interesse aller Beteiligten eine bessere Konfliktlösung zu erreichen, die Zeit und Geld spart und zudem deutlich nervenschonender wäre. Im Ergebnis ist es ein Plädoyer für die weitere Erforschung der Mediation, welches sich auch ohne Vorkenntnisse in Recht oder Mediation erschließt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 94
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nickolas Emrich
Recht und Mediation – ein Widerspruch der Kulturen?
© 2022 Nickolas Emrich
ISBN Hardcover 978-9949-7404-9-9
ISBN Softcover 978-9916-9849-0-1
Distribution im Auftrag des Autors:
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Infinitas Media ÖU, Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estland.
Inhaltsverzeichnis
A. Einführung
I. Rechtssystem in Deutschland
II. Entwicklung der Mediation in Deutschland
1. Allgemeine Entwicklung
2. Herausforderungen für die Mediation in Deutschland
III. Überblick über die Mediation
IV. Gegenüberstellung der Verfahrenskulturen
1. Struktur und Ablauf beider Verfahren
2. Potenziale und Grenzen von Mediations- und Gerichtsverfahren
3. Umgang mit Recht in der Mediation
B. Prinzipien der Mediation im Vergleich zur ordentlichen Gerichtsbarkeit
I. Grundsatz der Selbstverantwortlichkeit
II. Grundsatz der Neutralität und Unabhängigkeit des Mediators
III. Grundsatz der Vertraulichkeit
IV. Grundsatz der Freiwilligkeit
V. Grundsatz der Informiertheit
VI. Erstes Fazit zu den Kulturen beider Verfahren
C. Weitere Aspekte der Mediation im Vergleich zum rechtsförmigen Verfahren
I. Zielsetzung des Verfahrens
II. Zugang zum Verfahren
III. Konflikt
1. Konfliktdefinition
2. Konfliktgegenstand
3. Konfliktbeteiligte
4. Konfliktarten
5. Konfliktlösung
IV. Rolle und Stellung des Verfahrensleiters
V. Experten des Konflikts
VI. Harvard-Methode
1. Trennung der Beziehungs- von der Sachebene
2. Abwendung von (Rechts-)Positionen und Hinwendung zu Interessen
3. Optionen und Lösungsfindung
VII. Auswirkung von Macht
VIII. Umgang mit Gewalt
IX. Akzeptanz der Vielfalt wahrgenommener Wirklichkeiten
X. Synchronisation
1. Inhalt der Synchronisation nach Ponschab/Schweizer
2. Synchronisation-fördernde Methoden in der Mediation
XI. Mediative Allianz
XII. Zweites Fazit zu den Kulturen beider Verfahren
D. Kommunikation in der Mediation und im Recht
I. Allgemeines
1. Relevanz der Formen der Kommunikation
2. Kommunikative Techniken des Verfahrensleiters
II. Gewaltfreie Kommunikation
1. Gewaltfreie Kommunikation in der Mediation
2. (Gewaltfreie) Kommunikation im Rechtsstreit
III. Fazit zum Vergleich der Verfahrenskulturen
E. Schlussfolgerungen und Erkenntnisgewinn
I. Bereicherung durch die Übernahme mediativer Elemente in rechtsförmige Verfahren
II. Ausbau des (staatlichen) Mediationsgebots
III. Potenziale der Integration mediativer Elemente
IV. Potenziale für ein verändertes Konfliktverständnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1
Präferenz von Mediations- und Gerichtsverfahren im Rechtsstreit
A. Einführung
Die staatliche Gerichtsbarkeit und die Mediation werden, auch wenn sich beide mit Konflikten befassen, oft als gegensätzliche Systeme dargestellt. Viele Einleitungstexte zum Thema Mediation beginnen mit einem Vergleich, das Rechtssystem sei vergangenheits- und positionsorientiert, die Mediation dagegen zukunfts- und interessenorientiert. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass den beiden Verfahren strukturell eine grundsätzlich andere Denkkultur zugrunde läge. Auch wenn die Mediation und das ordentliche Gerichtsverfahren grundsätzlich die Lösung eines Konfliktes und damit das gleiche Ziel verfolgen, weisen beide doch erhebliche Unterschiede auf.
Die Mediation ist als Verfahren eher privatrechtlich, das Gerichtswesen dagegen hoheitlich organisiert, wobei Letzteres auch eine wesentlich längere Tradition aufweist als die Mediation. Die Mediation erlebte erst ab der Einführung des Mediationsgesetzes (MediationsG) im Jahr 2012 quasi einen Entwicklungsschub, der aber nach einer Studie des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung Speyer wohl – gemessen an der Akzeptanz und der Nachfrage nach Mediationsverfahren – ins Stocken geraten ist und vor der „ernsten Herausforderung“ steht, dass Betroffenen für die Inanspruchnahme von Mediationsverfahren schlicht die Bereitschaft fehlt.
In der vorliegenden Arbeit soll es nun darum gehen, beide Verfahren zu analysieren und die hervorgebrachten Kulturen miteinander zu vergleichen. Die zugrunde liegende Forschungsfrage kann damit wie folgt formuliert werden:
Inwiefern stellt sich das Mediationsverfahren gegenüber der ordentlichen Gerichtsbarkeit als vorteilhaft dar und wo können dadurch gegebenenfalls Reformbedarfe bzw. Regelungslücken im herkömmlichen Gerichtsverfahren identifiziert werden?
I. Rechtssystem in Deutschland
Das deutsche Rechtssystem beinhaltet eine Vielzahl unterschiedlicher und oftmals nicht klar voneinander abgrenzbarer Rechtsgebiete, für die aber – nach der Tradition des Römischen Rechts – eine Abgrenzung zwischen dem öffentlichen Recht als dem ius publicum und dem Privatrecht als dem ius privatum gebräuchlich ist.1 Dem Privatrecht sind dabei alle Normen zuzuordnen, welche die Rechtsbeziehungen des einzelnen Bürgers und privatrechtlicher Vereinigungen zueinander regeln und ihre bestehenden Rechte, Pflichten und Freiheiten festlegen. Grundlage dazu bildet das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) mit allen Sonderprivatrechten, die unter anderem im Gesellschafts-, Handels- und Arbeitsrecht normiert sind.
Dem öffentlichen Recht gehören demgegenüber unter anderem die Bereiche des Strafrechts, des Steuer- und Abgabenrechts sowie das Völker-, Europa- und das deutsche Staats- und Verfassungsrecht an.2 Im Rahmen des rechtswissenschaftlichen Studiums wird das Strafrecht allerdings als eigenständiger Rechtsbereich neben dem öffentlichen Recht und dem Zivilrecht behandelt, also nicht unter das öffentliche Recht gefasst.
Das deutsche Rechtssystem zeichnet sich zudem durch die Hierarchisierung seiner Rechtsquellen aus, wobei das Grundgesetz und das Europarecht die für das Privatrecht höchste Rechtsquelle bilden und durch einfachgesetzliche Rechtsquellen und Rechtsverordnungen ergänzt werden. Diese Rechtsquellen sind geschriebene, objektive Rechtsquellen und bilden die Grundlage für Ansprüche und Rechtspositionen, die Streitparteien in einem Verfahren gegeneinander geltend machen können.3 Diese Geltendmachung unterfällt im deutschen Rechtssystem den Vorschriften betreffend die Darlegungs- und Beweislast sowie der Geltung der Instanzenzüge, womit das hierarchische Durchlaufen der verschiedenen Gerichtsebenen jeweils im Straf-, Zivil- und Verwaltungsprozess gemeint ist.4
Charakteristisch für das deutsche Rechtssystem ist auch die Rollenverteilung von Anwalt und Richter im Gerichtsprozess: Der Richter ist nach § 42 ZPO zur Unparteilichkeit verpflichtet, während der Anwalt gerade parteilich sein muss und allein den Interessen seines Mandanten verpflichtet ist. Damit korrespondiert die Aufgabe des Richters als alleiniger Entscheidungsträger, wohingegen dem Anwalt keine Entscheidungskompetenz zukommt5 sowie die kontradiktorische Natur im Klageverfahren,6 in dem der Richter als entscheidungskompetente Person über die Ansprüche der Parteien entscheidet.
Die meisten Normen der VwGO, die das richterliche Handeln bestimmen, sind auf eine Entscheidung über die Klage durch Urteil ausgerichtet (explizit § 107 VwGO);7 zivilprozessrechtlich normiert § 160 Abs. 3 Nr. 6 ZPO drei mögliche Entscheidungsformen, von denen das Urteil regelmäßig infolge einer mündlichen Verhandlung ergeht8 und die Form nach § 313 ZPO einhalten muss.
Das Mediationsverfahren unterscheidet sich vor allem durch die ihm zugrunde liegenden Prinzipien der Mediation, wie sie auch in § 1 MediationsG niedergelegt sind, vom traditionellen Gerichtsverfahren. Diese Unterschiede – aber auch Parallelen – sind im weiteren Verlauf der Arbeit noch aufzuzeigen und mögliche sinnvolle Kombinationsoptionen zu diskutieren.
II. Entwicklung der Mediation in Deutschland
1. Allgemeine Entwicklung
Die Geschichte der Mediation in Deutschland ist – im Vergleich zur alternative dispute resolution in den USA – wesentlich jünger und unterliegt aufgrund der unterschiedlichen Rechtssysteme des Common Law und des Civil Law unterschiedlichen Entwicklungstraditionen bzw. rechtsdogmatischen Gedanken und letztlich vor allem der Rechtssetzung des EU-Gesetzgebers.
In Deutschland hat die moderne Entwicklung der alternativen Streitbeilegung erst später begonnen und ist auch sehr viel langsamer vorangeschritten als in den USA. Es bestanden zwar schon lange Formen alternativer Streitbeilegung und dies sowohl außergerichtlich als auch gerichtsintegriert. Derartige Verfahren waren jedoch meist ohne Erfolg und wurden daher auch häufig nach kurzer Zeit wieder abgeschafft.
Eine erste ausführliche Beschäftigung mit alternativen Streitbeilegungsverfahren fand im Bereich der Rechtssoziologie statt. Nachdem die Bundesregierung den modernen Gedanken der alternativen Streitbeilegung aufgegriffen hatte, wurden neue Verfahren eingerichtet und geregelt, sodass mittlerweile diverse Möglichkeiten der Streitbeilegung zur Verfügung stehen. Auch in den Bereichen der Rechtsforschung und -lehre, der Anwaltschaft und der Wirtschaft hat sich die alternative Streitbeilegung – ähnlich zu den USA – mittlerweile in universitären Kursen etabliert.
Wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Mediation in Deutschland hatte vor allem das Mediationsgesetz.9 Es ist seit dem 26.07.201210 in Kraft und basiert – neben den positiven Erkenntnissen aus verschiedenen Modellversuchen in den einzelnen Bundesländern – auf Initiativen der Europäischen Union auf dem Gebiet der alternativen Streitbeilegung und der in diesem Kontext verabschiedeten Mediationsrichtlinie:
Im Oktober 2004 hat die EU-Kommission einen Vorschlag einer Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen vorgelegt, den das Europäische Parlament im Rahmen der ersten Lesung am 29.03.2007 durch legislative Entschließung angenommen hat. Nach zahlreichen Überarbeitungen und zeitlichen Verschiebungen billigte das Europäische Parlament in seiner Sitzung am 23.04.2008 den gemeinsamen Standpunkt des Rates der Europäischen Union, woraufhin am 24.05.2008 die Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen (EU-Mediationsrichtlinie) im Amtsblatt veröffentlicht wurde11 und am 13.06.2008 in Kraft trat.12
Zielsetzungen der Richtlinie sind zum einen die Erleichterung des Zugangs zur alternativen Streitbeilegung und zum anderen die Förderung der gütlichen Lösung von Konflikten. Erreicht werden sollen diese Ziele durch einen harmonisierten Rechtsrahmen, der Rechtssicherheit und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mediation und Gerichtsverfahren garantiert, durch Maßnahmen zur Qualitätssicherung und durch eine stärkere Vernetzung von Gerichts- und Mediationsverfahren.13
Die Richtlinie entstand mit der politischen Motivation, den Bürgern einen erleichterten Zugang zur Justiz trotz des wachsenden grenzüberschreitenden Warenverkehrs zu gewährleisten. Obgleich der Verbraucherschutz hierbei eine große Rolle spielte, bezieht sich die Mediationsrichtlinie aber ebenso auf Unternehmer.14
Die Mediationsrichtlinie war von den Mitgliedstaaten nach Art. 12 EU-Mediationsrichtlinie bis zum 21.05.2011 umzusetzen; Deutschland ist dieser Verpflichtung (Art. 288 Abs. 3 Hs. 1 AEUV) durch das benannte Mediationsgesetz am 27.07.2012 im Wesentlichen aufgrund dreier Kontroversen erst nach Ablauf der Frist nachgekommen.15
Für die richtlinienkonforme Ausgestaltung des Mediationsgesetzes hatte das Bundesjustizministerium schon im Jahre 2008 das Hamburger Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht mit der Ausarbeitung eines rechtsvergleichenden Gutachtens zur Mediationspraxis in anderen Staaten beauftragt.16 Der im September 2008 in Erfurt abgehaltene 67. Deutsche Juristentag17 sowie die vom Bundesjustizministerium schon im April 2008 eingesetzte interdisziplinäre Expertenkommission18 lieferten dem deutschen Gesetzgeber ebenfalls Erkenntnisse, die in den Gesetzesentwurf einflossen.19
Ein wesentlicher Streitpunkt waren im Gesetzgebungsverfahren die unterschiedlichen in Betracht kommenden Formen der Mediation, welcher erst im Vermittlungsausschuss von Bundestag und -rat durch einen Kompromiss beigelegt wurde.20
Die Umsetzung der Mediationsrichtlinie durch das Mediationsgesetz wurde durch das Schrifttum vor allem in Bezug auf (1) den Umgang mit der gerichtsinternen bzw. -nahen Mediation, (2) den § 253 ZPO und (3) die Kosten der Umsetzung kritisiert.21
2. Herausforderungen für die Mediation in Deutschland
Nach einem Bericht des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung Speyer über die Entwicklung der Mediation in Deutschland22 aus dem Jahr 2017 steht diese aber „vor ernsten Herausforderungen“ in dem Sinne, dass die Anzahl der durchgeführten Mediationsverfahren in Deutschland „stagniert“.23 Untersucht hatte das Speyer Institut in einer Onlinebefragung die Auswirkungen des Mediationsgesetzes und befragte dazu 1.244 in Deutschland tätige Mediatoren. Ergebnis der Umfrage war, dass mehr als zwei Drittel der befragten Mediatoren – 67 % – im Jahr 2016 weniger als fünf oder gar keine Mediationsverfahren durchführten.24 Etwa die Hälfte aller Mediationsverfahren wurde nach Angaben des Forschungsberichts in Organisationen durchgeführt, wobei die geschätzte Zahl an in Deutschland durchgeführten Mediationsverfahren bei rund 7.000 bis 8.500 pro Jahr liegt.
Der Bericht zeigt auch, dass die Mediation in der juristischen Praxis noch lange nicht die Verbreitung und Akzeptanz findet, wie es für förmliche Gerichtsverfahren der Fall ist: Die Mediation wird zumeist nur in Nebentätigkeit oder „ausnahmsweise“25 ausgeführt und 61 % der befragten Mediatoren beklagen die geringe Bekanntheit der Mediation in der Öffentlichkeit.26
In Relation zur tatsächlichen Anzahl der in Deutschland tätigen Mediatoren sei die Nachfrage nach Mediation zu gering, wofür die geringe Bekanntheit der Mediation in der Öffentlichkeit und die damit einhergehende geringe Nachfrage nach Mediationsverfahren als ursächlich genannt werden.
Schließlich gaben die befragten Mediatoren auch an, einem hohen Wettbewerbsdruck vor allem durch „Telefon-Mediation“ ausgesetzt zu sein; diese ist oftmals von Rechtsschutzversicherungen abgedeckt und findet bei dem eine Mediation nachfragenden Betroffenen mehr Anklang als Mediationsverfahren, die beispielsweise von Mediationsverbänden organisiert werden und für die Betroffenen aber eine Förderung durch die Mediationskostenhilfe vorsehen.27 Die Hauptgründe für die geringe Zahl der in Anspruch genommenen Mediationsverfahren sehen die Autoren der Studie dann auch nicht in der Finanzierung der Mediation, sondern in der Zustimmung der Parteien zur Durchführung der Mediation. Dies kommt (implizit) in der folgenden Aussage zum Ausdruck: