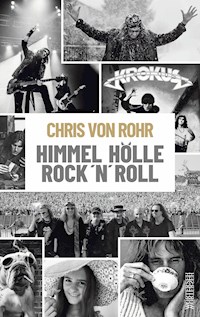Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Giger Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist eine grosse, buntgemischte Liebeserklärung an das Leben in all seiner Vielfalt und Pracht – gleichzeitig aber auch präzise, gespiegelte Betrachtungen der Konflikte und Reizthemen, die uns alle immer wieder beschäftigen. Hier ist jemand, der sich nicht nur zu sich selbst, sondern zu Mensch und Welt Gedanken macht. Nicht jeder, der hier geboren wurde, hat sich bereits für das Leben entschieden. Chris von Rohrs Texte sind wie Musik, die uns Kraft geben, die Komfortzone zu verlassen und etwas zu wagen – sei es im Denken oder im Handeln. Die Texte wecken auch den Freigeist und Rebellen in uns, der sich nicht mehr mit Halbwahrheiten und Trostpflaster zufrieden geben will. "Wo ist das Abenteuer in unserem allzu kurzen Leben?, fragt Chris von Rohr. "Am Schluss wollen wir doch alle sagen: Wir haben gelebt, geliebt, gewonnen, verloren, aber zwischendurch vielleicht auch mal den Himmel berührt."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Chris von Rohr
Götterfunken
Chris von Rohr
Götterfunken
Giger Verlag
1. Auflage 2015© Giger Verlag GmbH, CH-8852 AltendorfTel. 0041 55 442 68 48www.gigerverlag.chLektorat: Monika Rohde, LeipzigUmschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie, ZürichLayout und Satz: Roland Poferl Print-Design, Kölne-Book: mbassador GmbH, BaselPrinted in Germany
ISBN 978-3-905958-67-6eISBN 978-3-907210-48-2
VERMÄCHTNIS
»Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium,wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum!«
Diese Zeilen hat Friedrich Schiller verfasstund Beethoven in seiner letzten vollendeten Sinfonievertont.
»Götterfunken« steht symbolisch für Gottes Geschenkan den Menschen – DAS LEBEN. Es sind jene Artvon Funken gemeint, die Menschen ihre göttliche Herkunfterkennen lassen. Danach ist man kein Blinder, dermit anderen Blinden über das Leben debattiert,sondern ein lebendig Glücklicher, derdas Ewige erkannt hat im Leben.GRIECHISCHE GÖTTERLEGENDEUM PROMETHEUS
Für alle neugierigen,entflammten Leidenschaftler und jene,die es noch werden.
INHALT
Verlassen von der Zeit (I)
Sommertraum
Quartierpiraten
Digitale Demenz
Buchstabensuppe
Die Ritter der Kokosnuss
Christkinderland
Wüstenwinter
Gleichmachermurks
Gartenzauber
Liebe und Kartoffeln
Der Imageterror
Die Zwangserneuerer
Hymne an Hesse
Falsche Sicherheit
Wenn das Pendel schlägt
Die Krippewelle
Die Unerwünschten
Die rollenden Steine
Ein Hoch auf das, was uns vereint
Menue Küdersack
Akzeptanz des Bösen
Honig- und Giftpfeile
Merci Genie!
Kind entwendet durch Schreibtischbehörde
Und es war Sommer
Der Steuerblues
Traumberuf Musiker
Verantwortung – Ehrensache!
Vergrobung allenthalben
Rauchzeichen
Flaschen leer – Steuern hoch!
Danke Montreux, danke Claude!
Die Energieblender
Jahresschätze
Es starb die Zukunft
Rom, wir kommen!
Struppelpeter for President!
Trinke Wein im Vollmondschein
Therapie im Stundenhotel
Nah- und Fernsehen
Fitalin
Welcome to Amerika
Wertprämie statt Herdprämie
Beerenstark
Die Schweiz ist fertig!
Hurricane Season
Die ewige Wunschliste
Gottfriedstutz
Politgebet
Es war eine Mutter
Das Unwort
Schule in Ketten
London calling
Spital ohne Herz
Darfs noch etwas schärfer sein?
Gar nicht rassig!
Die Reizdiät
Sounds fürs Leben
Verlassen von der Zeit (II)
Danksagung
Literaturverzeichnis
Götterfunken
VERLASSEN VON DER ZEIT (I)
Die Zeit, die Zeit! Sie ist in aller Munde und zwischen den Buchdeckeln, aber mich hat sie verlassen. Keine Zeit! Diese Geliebte scheint uns im 21. Jahrhundert lebende Erdbewohner allesamt im Stich zu lassen und an sämtlichen Radarfallen busslos vorbeizubrausen. Mein Sinnieren und Recherchieren darüber war so faszinierend, dass ich mich unmöglich auf nur eine Kolumne beschränken kann.
Im Gegensatz zu Peter Bichsel kenne und wünsche ich mir keine Langeweile, aus der dann etwas entsteht und mir das Gefühl eines langen Lebens gibt. Nein, mein Leben gleicht eher einem Roller-Coaster-Ride, inklusive dem etwas schwerfälligem Anlauf. Mit siebzehn Jahren war ich ein in den Tag hineinwandelnder Hippiefreak in Neuenburg. Ich lernte Französisch, ein paar andere eher unnütze Dinge und verbrachte viel Zeit mit der akustischen Gitarre. Hätte mir damals jemand erzählt, dass ich 45 Jahre später ein striktes Zeitmanagement brauchen würde, um meine »Work-Life-Balance« im Griff zu haben und nicht auszubrennen, dann hätte ich gelacht. Wie ändern sich doch die Zeiten – wer sind sie überhaupt, die Zeiten?
Zeit ist alles: Luxus, Tyrann, Heiler und Leben. Sich Zeit zu nehmen, kostet Geld. Das sagt die Wirtschaft. Vom Piepsen des Weckers friert es mich an den Zähnen. Und doch muss ich den Halunken am Bettrand grummelnd akzeptieren, darf nicht schlafen, bis ich von selber damit fertig bin. Bedauerlicherweise lassen sich Brot und Früchte nicht im Schlummer verdienen. Abends hingegen, wenn mein Kopfkino die farbigsten und anregendsten Filme startet, soll ich gefälligst abschalten und schlafen. Tatendrang, hau ab, du kommst ungelegen! Weshalb kann der Tag überhaupt nicht mit dem Abend anfangen? Am Ende des Tages scheint mein geistiger Werkraum viel üppiger gefüllt zu sein Ich denke über eine Volksinitiative nach.
Ich erlebte traurige, kranke und herzschwere Zeiten, in denen ich gern in die Hände geklatscht hätte, um im Spiel des Lebens drei Jahre vorzurücken – in der Hoffnung, dass die Zeit geheilt hat und ich bis dahin vielleicht den Bachelor in Sachen Weisheit geschafft hätte. Doch so läuft das nicht. Sie lässt sich gern Zeit mit dem Heilen von Wunden, die Zeit, und wir haben die Musse dafür verloren. Wir finden zu wenig Zeit, Verluste zu beklagen und sie zu Grabe zu tragen. Das wirkt ausserdem uncool. Brüche und Schicksalsschläge betrachtet der Trendsetter als Chance zur Neuorientierung und Ausgestaltung des Lebenslaufs. Ausgeleierte Lismersocken werden fröhlich entsorgt und durch anpassungsfähigere und durchlässigere intelligente Fasern ersetzt. Wir besitzen ferngesteuerte Backöfen, sensible Sonnenschütze, die sich selber aus- und einfahren, alleskönnende Smartphones, jedoch keinen Geschirrflickomaten.
Das sollte jetzt eine Streicheleinheit sein für all die ewiggestrigen Schwerenöter, Melancholiker und Scherbenhaufenproduzenten, die ich von Herzen mag. Da kommt mir das Lied von Mani Matter in den Sinn: Mir hei e Verein, i ghöre derzue. Gibt es nicht auch noch den Verein derer, die die Zeit totschlagen müssen, die Metzger der Zeit? Gibt es solche, die nach einer Beschäftigung Ausschau halten – im gleichen Augenblick, in dem ich den Finger auf den Zeiger der Uhr drücken möchte, damit sie mir eine Verschnaufpause gönnt? In dem Augenblick, wo ich der Welt den Stecker ziehen möchte, suchen andere den Starterknopf. Menschen, die aus purer Langeweile ins Virtuelle abdriften oder online »Freunde« suchen, um »Spass zu haben«.
Zeitgenossen aller Gattungen streben nach den unterschiedlichsten Dingen, um die Zeit zu geniessen – aber jeder ist auf seine Weise ihrem Galopp untergeordnet. Der Mensch ist Anschauungsmaterial der Vergänglichkeit, welche zugleich plagend und barmherzig ist. Wir können die Zeit nur im Geiste aushebeln. Wenn wir uns Geschichten erzählen aus der Vergangenheit, dann löst sie sich für einen Atemzug auf. Ich liebe diese zeitlosen Momente! Am häufigsten erlebe ich solche, wenn ich Musik mache. Da gerate ich in einen Fluss, der mich wegträgt aus dem Sekundentakt. Dieses Vertieftsein in etwas, das man liebt, ist vielleicht das erhebendste Gut der Menschen. Kinder können das noch bestens in ihrem Spiel. Neugierig, witzig, leichtfüssig, frei, herzoffen, urvertraut und voll da. Eine arglose, in die Natur hinaus ergänzte, erweiterte Freudigkeit.
Ich kann es kaum erwarten, in den »Mouse-Room«, mein Einstern-Zimmer im Süden Kretas einzuchecken und alles andere auszustecken. Dort, wo die Zeit noch nicht dem Rasertum verfallen ist, kann ich meine Seele schweben lassen, die Sterne betrachten, mit meinem Tochterherz braune, ausgetrocknete Erde bewandern, ins vom Sommer gewärmte Salzwasser springen, Berge von griechischem Salat verspeisen, Raki trinken, Gespräche mit einheimischen Zeitzeugen führen, ein paar Akkorde auf der Gitarre schrummen, ein Hemingway-Buch lesen und immer wieder das Meer betrachten, bis die Zeit wieder zu mir zurückfindet und sich für eine kleine, luxuriöse Ewigkeit reumütig in meinen Schoss legt. Wie damals in Neuenburg.
SOMMERTRAUM
Alles schön ruhig und friedlich. Die Hälfte des Landes ist weg. Fühlt sich an wie Neunzehnhundert-Blumenkohl. Sommer! Du hast mich gelehrt, dich zu packen, wenn du endlich mal wieder zu Gast bist hierzulande. Dein magischer Zauber hält nur kurz und schon bist du wieder weg.
Ich entspanne auf einer orangefarbenen Luftmatratze. Der See liegt spiegelglatt und flimmernd vor mir. Die Sonne brennt mit voller Kraft herunter und spiegelt einen blauen, von gross geballten, schneeweissen Sommerwolken durchzogenen Himmel. Hinter mir entfernt sich langsam das schattige Wiesenufer mit seinen tief hängenden Trauerweiden. Mit dem Ufer bleibt auch das zurück, was mich dort umtreibt und beschäftigt. Je weiter ich in diesen See hineingleite, die Gerüche, die Farben und Geräusche aufnehme, desto fremder und unbegreiflicher wird das eben noch Gewichtige. Die Sonne prickelt auf meiner Haut, wohlig bis tief in die Knochen hinein, und ein laues Lüftchen umschmeichelt mich. Liebe Leser, so muss sich die Ankunft im Paradies gestalten …
Daheim liegen Notizblöcke voller guter und schlechter Ideen, an die 50 unbeantwortete E-Mails, Briefe, inflationäre Werbebroschüren, Rechnungen, die fällig sind, Einladungen, die ich ablehnen muss, aufgeschlagene Magazine, Zeitungen, Bücher und ein Haufen waschfälliger Kleider. Alle diese Dinge erscheinen mir hier auf dem See plötzlich fremd, überflüssig – einer verirrten, grotesken
Welt zugehörig, der ich heute entkommen bin und mit der ich zunehmend meine Mühe habe. Es ist die busygoing-nowhere-Falle – zu viel machen, reden und studieren – zu wenig freies Leben. Ich weiss, dass es vielen Menschen auf diesem Planeten so geht, nur tröstet mich das wenig.
Wenn ich hier und jetzt in diesen vieltausendjährigen, tiefblauen Himmel blicke, die Wolken gelassen vorbeiziehen sehe, wenn diese Berge, so majestätisch, kühn und unverrückbar klar vor mir stehen – wie kann es da sein, dass daneben all dieser lumpige Alltags-Bagatell-Kram der Trostpflaster-Konsumwelt noch ihre Relevanz hat? Warum lassen wir uns da bloss immer wieder so reinziehen? Die fragwürdige Kunst eines jeden Tages ist doch heute, die Perlen im ganzen Ramsch zu finden, der uns umgibt und angeboten wird. Doch selbst die Lüge dient der Wahrheit und die Schatten löschen die Sonne nicht aus, vor allem nicht im Sommer. Auf geht’s …
Wieder zu Hause, fragt mich meine liebe Tochter, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr ins nahe liegende Kloster zu gehen. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen nach dem See. Eine braungekleidete Kapuzinernonne öffnet uns freundlich die Pforten. Lange dunkle Gänge führen in den Innenhof. Ein paar Schwestern machen im Halbschatten ein Kartenspiel. Wir zwinkern ihnen zu und ich glaube, sie freuen sich, zwei so bunte, streunende Hunde in ihren Mauern zu sehen. Es fühlt sich gut und sehr kühl an. Die Kirchen und Klöster sind ja eigentlich die Erfinder der Aircondition … nur liess es sich nicht patentieren.
Wir lassen uns den umwerfend schönen Garten zeigen. Wie man mir berichtete, durfte man früher hier nur unter strenger Strafe aus den Klosterzellen darauf herunterblicken. Zu gross waren wohl die Verführungskraft und die Ablenkung all der prächtigen, alten Rosen, Hortensien, Lindenbäume und dem berauschenden Jasmin und Lavendel. Das passte nicht zur streng auferlegten Kasteiung der jungen Nonnen – obwohl sich eigentlich Gott, oder wie wir es nennen wollen, in dieser wunderbaren Natur, in all den Blüten, Früchten und Düften so gross und stark offenbart.
Wir ergreifen die Gelegenheit und nehmen auch noch am anschliessenden Vesper, dem liturgischen Abendgebet, teil. Da sitzen fünfzehn ältere Nonnen im Halbkreis in einem holzgetäfelten Raum in engen, unbequemen Chorstühlen und lobpreisen mit wackligem aber herzvollem Gesang Gottvater, Gottsohn und den heiligen Geist – fern von der Aussenwelt und ohne Nachkommenschaft. Far out! Ein wirklich spezieller Moment, den ich mit meiner Tochter erleben durfte.
Spätnachts im Bett sinniere ich über diesen Tag, das Erlebte, über die Vergänglichkeit und ob jetzt ich oder die Nonnen etwas im Leben verpasst haben … Wie lange mag mein Tochterkind wohl noch so schöne Ausflüge mit mir machen? Ist meine neue Songidee dazu himmlisch genug? Ganz leise hallt ein Ferngewitter. Mein Haus liegt zwischen drei Klöstern und auch morgen werde ich wieder von einem ihrer Glöcklein geweckt werden. Die wunderbaren schwarzen Kirschen und Aprikosen warten auf dem Tisch und ich bin frohgemut, dass sich ein weiterer Sommertag ankündet. Ich möchte unbedingt noch die Gefilde goldener und rauschender Ähren besuchen, bevor sie die Sense oder der Mähdrescher bald schon zu sich holt. Und schliesslich bitte ich noch den grossen Manitu, er möge mir Ruhe, Durchlässigkeit und Kraft geben. Ich meine damit die Art von Kraft, die uns wieder mehr eins sein lässt mit dem Schöpfer und die uns in den Schoss der Natur zurückführt. Oh Sommer, tust du mir gut!
QUARTIERPIRATEN
Die Sonne nickte dem Städtchen Solothurn freundlich zu und ich spielte mit meiner Tochter vor dem Haus Strassenfussball. Immer mehr Kinder kamen dazu. Jemand brachte die Idee, die Quartierstrasse abzusperren, um ungestörter zu spielen. Dieser erst zaghafte Wunsch wuchs rasch zu der Massnahme heran, von motorisierten Eindringlingen einen Wegzoll zu verlangen. Ich fand das grossartig und freute mich diebisch darüber, wieder einmal etwas zu tun, das, mit dem strengen Auge des Gesetzeshüters betrachtet, nicht ganz lupenrein war. So unterstützte ich das Vorgehen natürlich von ganzem Herzen.
Strassenarbeiter hatten in der Nähe ein paar orange-weisse Gummihütchen zurückgelassen. Die eigneten sich hervorragend als Tore und Strassenblockade. Ein Junge fuhr seinen Traktor auf und das Nachbarmädchen ein Märitkörbchen auf Rädern. Strassensperren sind sonst etwas Widerliches. Diese hier war aber wunderbar hübsch anzusehen und offenbar anziehend. Sie zog weitere Aktivisten aus ihren vier Wänden heraus. Schliesslich waren etwa zwölf Kids in guter Spiellaune zugegen. Das Spiel verschob sich sachte vom Fussball zum Wegelagerertum. Man spähte mehr nach dem nächsten Auto, als sich fürs nächste Goal reinzuhängen.
Etwa alle sieben Minuten fuhr eines vor. Es folgte die kecke Ansage der Kids: »Das kostet einen Franken, dafür gibt’s freie Fahrt und einen Krokus-Totenkopfaufkleber.« Die Reaktionen der Fahrer fand ich spannend: Je billiger die Karrosse, desto grosszügiger fiel das Passiergeld aus. Aus einem Lada – eh, einem Škoda – wurden drei Franken herausgereicht, ein Toyota generierte vier und eine witzige Rostlaube sogar fünf Stutz. Der Driver des noblen Flügeltüren-Mercedes mit Beifahrerdekoration hingegen konnte dem Spiel nichts Lustiges abgewinnen. Die Sorge um sein Prestigegeschoss war gross und in seiner Welt wird wohl andersherum gespielt. Er war die motzende Ausnahme, die den anderen Autofahrern zu entsprechend mehr Ansehen und Beifall verhalf.
Da erschien meine frühere Lebenspartnerin mit einer Schüssel Tiramisu auf dem Platz und wir setzten uns mit all den Kids an meinen Gartentisch und schlemmten wie die Räuber. Rundum zufriedene Gesichter. Ich fühlte mich in die Zeit zurückkatapultiert, wo das Blabla vom Ernst des Lebens noch nicht in meine Ohren drang. Ich fragte mich, was Kinder durchleben, bevor sie in die konfuse, hektische Erwachsenenwelt eintauchen, von der wir meinen, sie sei reifer. Ausgetreten aus dem Land der Könige und Elfen, wo man doch viel mehr wusste, als die Erwachsenen – die kennen ja nicht einmal mehr Geheimverstecke. Ja, wirklich: »Werdet wie die Kinder.«
Kinder stellen Fragen. Sie begehren auf, wenn sie etwas nicht verstehen und bevor die Sache nicht bereinigt ist, geht nichts mehr. Da werden sie zum bockigen Grautier. Dafür sind sie wiederum Meister im Verzeihen und Frieden machen, wenn der Gegenstand der Differenzen diskutiert und jeder Beteiligte angehört wurde. Ich beobachte da eine erstaunliche Sachlichkeit und Akzeptanz, die in den Politstuben der Erwachsenen oft schmerzlich fehlt.
Eine bittere Bilanz. Manche Erwachsene greifen tief in den Köcher, um ihre Giftpfeile abzufeuern. Das gemeinsame Streben nach dem Guten, nach Frieden und Unversehrtheit für alle scheint als vordergründiges Motiv unpopulär zu sein. Wir sind Höhlenbewohner mit Flatscreens und digitalisierten Keulen. Wir zertrümmern uns gegenseitig die Schädel und Seelen – wofür? Für einen lumpigen Haufen Geld, etwas Mobiliar und abstruse Ideen.
Kinder sind noch sehr Anteil nehmend. Mitleid, Neugier, Staunen, Freude, Leidenschaft und Mut kommen mir in den Sinn, wenn ich überlege, womit mich Kinder beeindrucken. Diese Lebendigkeit hat ihren Preis. Kinder wuseln herum, sobald sie wach sind und sie fordern unsere physische und psychische Präsenz, bis sie ihre Äuglein wieder schliessen. Oft bleibt nach einem ereignisreichen Tag für Erwachsenenaugen ein buntes Chaos zurück, wenn der Kindermotor endlich einen leeren Akku vermeldet – und der Feierabend verschiebt sich in die dunkle Nacht. Ein erfülltes Kinderherz schmiert den elterlichen Bewegungsapparat und auch sein Hirn. Wer Kinder betreut, muss verhandeln, besänftigen, Lösungen finden und Fragen beantworten. In Sekundenschnelle wechselt sich Philosophisches mit Sachfragen ab: Darf ich? Warum denn? Warum denn nicht? Hat Käthi auch Kinder? Warum hat sie denn keine? Warum kriegen denn nur Frauen Kinder? Warum ist der Himmel blau?
Das ist geistig anstrengender als das Tippen am stimmlosen Bildschirm. Neumütter und Neuväter stellen fest, dass sie vorher sackweise Zeit gehabt haben, ohne es zu merken und zu nutzen.
Hochgeschätzte Kinder, ihr seid unverzichtbare Fitnesstrainer und Vorbilder in Menschlichkeit und Lebensfreude. Wir brauchen euch!
DIGITALE DEMENZ
Ferienplanung. Die Eltern haben auf dem Stubentisch eine Landkarte ausgebreitet und bringen sich in Stimmung für die bevorstehende Reise. Der kleine Sprössling juckt hinzu, wirft einen interessierten Blick auf das Papier und versucht umgehend, es mit Daumen und Zeigefinger auseinanderzuziehen, um die Ansicht zu vergrössern. Erst einmal Gelächter … dann beschleicht die Anwesenden ein mulmiges Gefühl. Ist der Junge bemerkenswert gelehrig oder hat ihn bereits im Vorschulalter die digitale Demenz heimgesucht?
Die Diskussion darüber, ob der digitale Fortschritt ein Gewinn ist oder nicht, finde ich müssig. Ich profitiere selber gerne von diesen leuchtenden Hilfsmitteln und Werkzeugen. Als Neohippierocker, der sich neben der Bühne auch gern ohne GPS in den Wiesen und Wäldern aufhält, bin ich jedoch bestrebt, dem digitalen Wahn Paroli zu bieten und die gesunde Balance zu finden. Ich hoffe, damit meinem Geist und Körper einen guten Dienst zu erweisen. Einmal mehr macht die Dosis das Gift. Glauben Sie mir: Ich freue mich wahrlich darüber, dass meine Waschmaschine mir den Gang zu Waschbrett und Zuber erspart. Dennoch sitze ich nicht stundenlang davor, um ihr beim Schleudern zuzusehen. Umso mehr erstaunt es mich, wie achtlos viele Menschen das echte Leben dem digitalen Pulsschlag opfern.
Spazierende Eltern schieben ihre Kinderwagen mit gesenkten Häuptern durch Stadt, Park und Spielplatz. Nicht etwa, um sich auf Augenhöhe mit den Kids zu unterhalten, sondern weil sie sich offensichtlich permanent ihrem Bekanntenkreis mitteilen wollen. Bei den neuen, riesigen Smartphones benötigt man oft beide Hände, um sie zu bedienen. Folglich ist der Handysüchtige praktisch gezwungen, das Babycabrio mit dem Bauch zu schieben, und das möglichst erschütterungsfrei. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich auch dieses Problem mittels digitalen Spielzeugs lösen lässt und das Kind ferngesteuert spazieren fährt. Unterdessen kann Mama der Kollegin das süsse Filmchen weiterleiten, welches der Kollege ihr geschickt hat. Und sie können sich gegenseitig per Wazäpp entzückte »Jööös« zusenden, weil das Zeichentrick-Bärli oder -Kätzli auf dem Display so putzig trällert.
Der Nachwuchs sieht auf seiner Spazierfahrt andere Dinge: Zum Beispiel zwei Hunde, die sich beschnuppern und begrüssen. Die Vierbeiner tun das natürlicherweise. Sie sind nicht im Besitz eines Smartphones und holen sich ihre Informationen über das andere Wesen auf diesem Weg. Sie wissen von nun an, ob sie den Kollegen Lumpi riechen können oder nicht. Die Eigenart des digitalen Sozialkontaktes ist ja, dass man gar nicht mitbekommt, welcher Körpergeruch den anderen umgibt. Die digitale Welt stinkt nicht.
Das Buch Digitale Demenz von Manfred Spitzer zeigt uns, wie nahe und gefährlich die digitale Sucht ist. Er mag die Sache etwas überspitzen – nomen es omen – aber sicherlich ist Doc Spitzer nicht einer, der haltlos Wände mit dem Teufel bemalt. Der bekannte Hirnforscher bringt alarmierende Fakten. Wer einem Kindergartenkind erlaubt, am Computer zu spielen, wer seinem Teenager gestattet, jeden Tag Stunden mit Spielkonsole und in Online-Netzwerken zu verbringen, fügt dem Nachwuchs vor allem Schaden zu. Erwachsene haben fertige, entwickelte Gehirne, Kinder nicht. Nachgewiesen sind Aufmerksamkeits-, Schlaf- und Lesestörungen, Ängste, Übergewicht, Gewaltbereitschaft und Abstumpfung.
Die Empfehlungen für achtsame oder überforderte Eltern: Leben Sie die Dosis und ihre Werte klar vor. Was andere Kinder in der Schule und der Freizeit machen, muss mein Kind nicht unbedingt auch machen. Keine Technik im Kinder-und Jugendzimmer, sonst verlieren die Verantwortlichen sämtliche Kontrolle über Konsum und Missbrauch. Und die wichtigste Botschaft: Es geht nicht darum, nur Spass zu haben, sondern Spass zu haben bei Aktivitäten, an denen man wachsen kann.
Wenn jemand besonders viele virtuelle »Freunde« hat und sich durch zahlreiche Einträge auf sozialen Plattformen auszeichnet, dann tut er mir fast leid. Welcher Schmachtlappen vernachlässigt schon seine Liebsten und setzt sich mausbeinallein vor den Computer, um an seinen diversen Profilen zu schrauben? Wie egal müssten mir Heim und Garten, Leidenschaften, Beruf und meine Freunde sein, wenn ich derart im Netz hänge? Ja, ich bin ein hausbackener Mensch, denn das alles ist mir heilig. Bin ich nun schon wieder modern und rebellisch? Mein Slogan für die Youngsters heute: Schockiere deine Eltern – Lies ein Buch! Eines aus Papier!
BUCHSTABENSUPPE
Buchstaben ziehen mich seit jeher in ihren Bann. Ich halte diese Erfindung der Menschheit, mit Linien in verschiedenen Formen zu kommunizieren, für genial. Obschon wir lediglich 26 Lettern zur Verfügung haben, sind wir in der Lage, damit einen emotionellen Tsunami loszutreten und Stimmungen zu transportieren, die wir, objektiv gesehen, doch gar nicht in dieses Gewusel von Zeichen packen können. Und doch geht es – grosses Kino! Ein befreundeter Verleger nennt mich einen Stilisten – das gefällt mir. Ich probiere immer wieder, dem Inhalt eine gewisse Farbe und Rhythmus beizumischen. Musikalisch ausgedrückt: Den Sprachswing. Phasenweise gelingt es.
Unsere ganz persönliche Art, wie wir aus den einzelnen Lauten Wörter formulieren und daraus Sätze komponieren, liefert auch ein Bild davon, wie es in unserer Seele aussieht. Obwohl ich das im Text gar nicht beschreibe. Das Schreiben und Lesen hat eine metaphysische Dimension. So kann mich nach der Lektüre eines Buches, eines Interviews oder der Kolumne eines anderes Schreibakrobaten gar das Gefühl heimsuchen, den Verfasser zu kennen, ich fühle mich ihm seelenverwandt und ginge am liebsten etwas mit ihm schlürfen … kennen Sie das?
Kürzlich paarte sich das Buchstabenwunder in den Tiroler Bergen mit einem anderen sinnlichen Grossereignis im Leben des Menschen – dem Essen. Ich fand folgendes Angebot auf der Kinderkarte: Teller und Besteck zum Krachmachen – 0.00 Euro.
Sprache kann uns – einerlei, ob in gesprochener oder geschriebener Weise – auf einen Schlag aufheitern, entzücken und beflügeln. Ebenso vermag sie uns binnen eines Atemzugs aus der Bahn zu werfen oder vibrieren zu lassen. Jeder von uns erinnert sich an eine unfeine Bemerkung, die sich schmerzhaft in die Seele gebrannt hat und auch nach Jahren nicht verschwinden will. Andererseits trage ich verbale Schätze in mir, lieb und teuer. An denen halte ich mich in Zeiten des Zweifelns fest.
Sprache ist offensichtlich ein Machtinstrument. Manchmal, wenn ich in einer Zwickmühle bin, wo eine schwierige Situation eine Reaktion von mir erfordert, mache ich erst ein Gedankenspiel: Welches wäre die direkteste und niederschmetternste Antwort, die ich geben könnte? Was weiss ich zu sagen, das sitzt? Danach überlege ich mir die witzigste oder charmanteste Antwort, die ich auf diese unangenehme Sache geben könnte.
Normalerweise wähle ich ehrlichen, ungeschönten Klartext, wobei die Haltung des Empfängers schon eine Rolle spielt. Muss ich jemanden fadengerade aufklären, auf seinen Platz verweisen oder will ich ihm eher Mut machen und den Sand von den Schultern klopfen? Meist finde ich so meinen Weg.
Bereits Grundschulen und Eltern müssen sich heute mit dem Thema Cybermobbing befassen. Das Internet wird als beinahe rechtsfreier Raum für allerlei Schimpf und Schmutz benutzt. Wer dem verbalen »Nahkampf« nicht gewachsen oder zu feige ist, dem bieten sich einschlägig platte Formen an, um Dreck hinter dem Gesicht hervor auf den Bildschirm zu schleudern. Das ist oft nicht schön und grausam.
Ich gebe mit meiner Art zu kommunizieren vieles von mir preis. Sprache ist eine individuelle Stil- und Charakterfrage. Ebenso wie die Art zu gehen, die Schrift oder die Kleidung es sind. Auch in der Sprache zeigt sich, ob ich eher ein Trendsetter und Wiederkäuer bin oder ein eigenständiger Anwender. Ich liebe es, mit der Sprache zu spielen und hie und da gelang mir ein Volltreffer. Die Ausdrücke »Dumpfgummi« und »Blockflötengesichter« verbreiten viel Freude und »Meh Dräck« wurde gar zum Wort des Jahres gekürt. In unseren Songs hingegen bevorzuge ich Englisch. Ich suche Ausdrücke, die Google und YouTube, in dieser Zusammensetzung, noch nicht kennen. »Hoodoo Woman«, »Dög Song«, »Bedside Radio«, »Easy Rocker«, »Long Stick Goes Boom« …
Der begnadete Künstler David Bowie, der die Popund Modewelt revolutionierte, sagte mal: Würde Gott zu den Menschen sprechen, täte er das auf Deutsch. Das könnte stimmen, denn es gibt kaum eine Sprache, die einerseits so dramatisch verspielt und andererseits so zackig präzis ist. Die schönsten deutschen Wörter für mich sind: Geborgenheit, Sternenstaub, Morgenland, Schmetterling, Fernweh und Vergissmeinnicht. Sie beschreiben auf unglaubliche Art ein Gefühl, für das ich sonst kein Wort kenne. Pure Musik! Aber auch »lieben« ist wunderschön, weil es nur ein »i« von »leben« entfernt ist. Und »Lust« beschreibt aufs Vortrefflichste diesen Zustand. »Hafenkran« tönt etwas härter – ist es auch. Übrigens: wenn man diesen wunderbar stolzen, verlebten Kran schon unbedingt in Zürich hinstellen musste, warum liess man ihn dann nicht auch mindestens ein paar Jahre da stehen? Er hätte dem herausgeputzten Zürich sicher nicht geschadet. Der perfekte Kontrast zu den Limmatquai-Kafis, Sonnenbrillenshops und Nobelboutiquen.
Wussten Sie übrigens, dass Vanille aus dem lateinischen Vagina abgeleitet ist und Klavier ursprünglich aus Schlüssel hervorging? Fabelhafte Etymologie! Dann gibt es noch die unübersetzbaren Wörter, jene, die einmalig sind in einer bestimmten Sprache. Besonders angetan bin ich von den schönen japanischen Zeichen die Komorebi bedeuten. Das heisst: Das Sonnenlicht, das durch die Bäume scheint. Das Zusammenspiel von Blättern und Sonne. Wunderbar! Oder im Spanischen: Sobremesa: die Zeit, in der man sich mit Menschen austauscht nach einer Mahlzeit.
Im Indonesischen gibt’s das Wort Jayus – das steht für einen schlecht erzählten Witz, der überhaupt nicht funny ist. Und im Hawaiianischen sagen sie Pana Po’o, was den Akt beschreibt, wenn du etwas vergessen hast und dich am Kopf kratzt. Im Schwedischen steht Mangata für die glimmernde Reflektion des Mondes auf dem Wasser und die Inuit sagen Iktsuarpok, wenn sie ungeduldig sind und schauen, ob jemand kommt. Waldeinsamkeit beschreibt das Gefühl wenn du allein im Wald bist, verbunden mit der Natur.
Natürlich hat Nietzsche recht, wenn er sagt, dass Wörter nicht alles sagen können. Sie sind nur Symbole für Beziehungen zwischen Sachen und Menschen. Sie können nicht die absolute Wahrheit ausdrücken.
Das mag sein, aber sie beschreiben etwas kraftvoll und auf wunderbare Art und Weise. Wer dazu mehr wissen möchte, dem empfehle ich das grossartige Buch von Guy Deutscher, Im Spiegel der Sprache, in dem der Linguist den Zusammenhang einer Sprache und ihrer Sprecher verdichtet. »Ich spreche Spanisch zu Gott, Italienisch zu den Frauen, Französisch zu den Männern und Deutsch zu meinem Pferd.«
Die scherzhafte Vermutung Karls V., dass verschiedene Sprachen nicht in allen Situationen gleich gut zu gebrauchen sind, findet wohl auch heute noch breite Zustimmung. Doch ist sie aus sprachwissenschaftlicher Sicht haltbar? Sind alle Sprachen gleich komplex oder ist Sprache ein Spiegel ihrer kulturellen Umgebung – sprechen »primitive« Völker »primitive« Sprachen? Und inwieweit sieht die Welt, wenn sie »durch die Brille« einer anderen Sprache gesehen wird, anders aus?
Dieses Buch von Guy Deutscher ist eine sagenhafte Tour durch Länder, Zeiten und Sprachen. Auf seiner Reise zu den aktuellsten Ergebnissen der Sprachforschung geht man mit Captain Cook auf Kängurujagd, prüft mit William Gladstone die vermeintliche Farbblindheit der Griechen zur Zeit Homers und verfolgt Rudolf Virchow in Carl Hagenbecks Völkerschau auf dem Kurfürstendamm im Berlin des 19. Jahrhunderts. Mitreisende werden mit einer glänzend unterhaltsamen Übersicht der Sprachforschung, mit humorvollen Highlights plus unerwarteten Wendungen und klugen Antworten belohnt.
»Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt« (Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus), stimmt, und ich bin – alterseidank – längst niemandem mehr ausgeliefert, der mir nicht passt und nicht gut tut. Meine Ohren führe ich an Orte, wo eher meine Lachfalten gefördert werden denn die Sorgencanyons. Sonst bin ich wohler daheim mit einer guten Buchstabensuppe. In dem Sinne: Salem Aleikum, gehen wir in Frieden, aber gehen wir … mindestens 10 000 Schritte pro Tag, empfiehlt Hausdoktor Ali Mabulu.
DIE RITTER DER KOKOSNUSS
»Danke, dass Sie an der Zukunft der Schweiz mitwirken«, meinte der neue Bundespräsident bei seiner Neujahrsansprache.
Ich lag auf meiner Denkercouch und sinnierte darüber, was der Bundespräsident uns damit sagen wollte. Zwei Riesenraben flogen am Fenster vorbei. Ich nahm ein paar abgelegte Artikel der letzten Wochen zur Hand und staunte, was da alles drinstand.
Das Bundesgericht verfügte, dass private Weihnachtsbeleuchtungen um ein Uhr abzuschalten seien – Achtung! – ab dem sechsten Januar schon um 22 Uhr! Eine Bündner Gemeinde will ein Verbot von Gartenzwergen durchsetzen und Hobbyfeuerwerker müssen ab jetzt einen teuren Kurs besuchen, wenn sie Raketen in den Himmel steigen lassen wollen.
Ich könnte hier 50 Seiten lang den kleinen und grossen Regulierungswahn aufführen. Es grüssen die Ritter der Kokosnuss! Oder anders gesagt: Ich sehe Zeichen von Übermut und trunkener Abgehobenheit, während ein Grossteil der Welt am Taumeln und Ächzen ist.
Mit anderen Worten, der Staat mischt sich zunehmend dort ein, wo er nichts zu suchen hat: Wir regulieren uns zu Tode und machen keinen Schritt mehr ohne Juristen und Anweisungshandbuch. Eine Welt zum Schreien, ohne nennenswerte Liberalisierungen.
Erstaunt es da, dass das Verwaltungswesen mehr wächst als die Privatwirtschaft? Jemand muss diesen Irrwitz ja erfinden, bearbeiten und durchsetzen. Der Personalzuwachs der letzten Jahre bei Bund, Kanton und Gemeinden bewegt sich im fünfstelligen Bereich. Auch im nächsten Jahr soll die Staatsquote weiter ansteigen. Nur wenige denken an die Folgen dieser Fehlentwicklung. Man schaue nur mal nach Frankreich. Es erstaunt mich immer wieder, wie wenig wir Bürger uns darum kümmern, wie die sauer verdienten Steuergelder eigentlich eingesetzt werden. Man akzeptiert es einfach als »verlorenes« Geld, als notwendiges Übel, zu dessen Verwendung wir eh nix mehr zu melden haben. Die Puppenspieler lassen ihre Puppen tanzen und die Falschen bereichern sich schamlos.
Ich betrachte das Treiben in Bern hie und da aus nächster Nähe. Folgendes ist mir aufgefallen: Selten hört einer dem anderen richtig zu. Eine richtige, vertiefte Debatte findet kaum statt. Fast jeder geht mit vorgefasster Meinung ans Rednerpult und liest meist parteigetreu vom Zettelchen ab. Andere verstecken sich während dieses 50-%-Jobs hinter dem Laptop, lesen Zeitung oder gucken auf ihr Handy. Als ich das zum ersten Mal sah, war ich konsterniert – was soll das? Ist das seriöse Arbeit, für die man 130 000 Franken plus fette Zusatzvergütungen pro Jahr bekommt? Und dann diese ewige Unruhe? Ich stellte mir vor, wie es wäre, wenn ein Privatunternehmen, ein Fussballklub oder eine Band solche respektlosen Meetings abhalten würde? Könnte dabei etwas Konstruktives herausschauen?
Schmunzeln musste ich, als letzthin ein geschätzter Kolumnenkollege etwas überspitzt einen Berufspolitiker fragte, ob er wirklich glaube, dass es sich bei der Politik beziehungsweise der Angewohnheit, allen Geld zu versprechen, dabei aber nur Kosten zu verursachen, tatsächlich um einen ehrbaren Beruf handle, der entlöhnt werden müsse. Und ob es denn nicht reichen würde, wenn wir den Parlamentariern einfach die Reise- und Verpflegungskosten vergüten würden. Die Antwort des Parlamentariers können Sie sich vorstellen, liebe Leser. Mitwirken könnte auch mal genaues, selbstkritisches Hinschauen sein!
Ich lese auch von Staatsstellen, die für das tägliche Kopieren von Dokumenten 7000 Franken pro Monat bekommen und von dem Führungschaos beim Bundesamt für Strassen. Die meisten Ämter können über ihre Leistungen und damit über ihr Budget frei entscheiden. Was die Arbeit tatsächlich kostet und ob für Preisgünstigkeit und Effizienz gesorgt wird, durchschaut längst niemand mehr und es wird eh meist nur die teuerste, aber längst nicht beste Variante bevorzugt. Siehe das Informatik-Insieme-Debakel, wo Insidergeschäfte, Filz und mangelnde Transparenz einen Fehleinkauf forcierten. Den Steuerzahler kostete das 102 Millionen Franken. Als wäre das nicht schon beunruhigend genug, werden parallel dazu Schulden angehäuft, als gäbe es kein Morgen. Sparen, das sollen gefälligst die anderen oder im dümmsten Fall halt die zukünftigen Generationen.
Nein, es reicht nicht mehr, nur die Abzocker in der Wirtschaft an den Pranger zu stellen und masszuregeln. Wir müssen jene Hochmütigen in der Politik, die hart verdientes Geld arg- und schamlos abkassieren und verschleudern, genauso kritisch angehen und kontrollieren. Je schneller, desto besser, denn ihr Treiben wird zunehmend dreister und die Leistung nicht besser. Dazu schaden sie all jenen, die einen respektablen, kräftezehrenden Herzblutjob im Staatswesen machen.