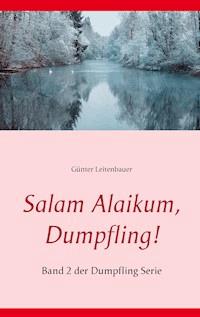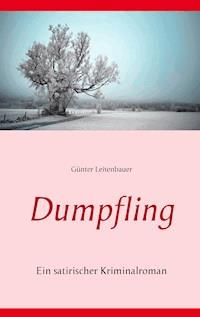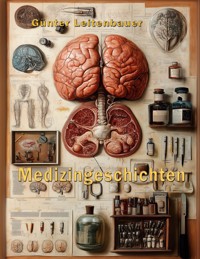Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Felix ist ein seltsamer Junge. Was er angreift, ist in Lebensgefahr. Als er sich seiner Fähigkeit mit etwa sieben Jahren das erste Mal bewusst wird, taucht ein junger Priester auf, der ihn behutsam in die Möglichkeiten einführt, die ihm diese Gabe bietet. Aber auch eine geheime Sektion im Vatikan hat von Felix Wind bekommen und versucht, ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Dazwischen steht Annabell, Felix' große Liebe. Wird sie das sich abzeichnende Unheil abwenden können?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort des Autors
Geschichten zu schreiben ist ein wenig wie Kochen. Man geht auf einen Flohmarkt und sieht einen alten Topf. Der kostet nicht viel, also nimmt man ihn mit. Er landet in einer Lade und wartet auf seinen Einsatz. Die Zeit vergeht, nichts passiert. Dann sieht man irgendwo Süßkartoffeln. Man hat noch nie etwas mit Süßkartoffeln gekocht, weiß aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund, dass sie genau zu diesem und in diesen alten Topf passen und kauft sie. Zuhause legt man sofort los. Die Kartoffeln werden geschält, der Käse vorbereitet – es soll ein Gratin werden – und man beginnt zu kochen. Man fügt Zutaten hinzu; man lässt sich treiben. Dann weiß man plötzlich, dass noch genau ein Gewürz fehlt, und auch welches. Irgendwas Scharfes, Würziges! Und irgendwann ist der Süßkartoffelgratin fertig, von dem man am Anfang nur eine vage Vorstellung hatte. Der jetzt doch ganz anders wurde, aber trotz allem gut, vermutlich besser als wenn man das ursprüngliche Rezept eingehalten hätte. An das man sich sowieso nicht mehr erinnert. Also mal kosten!
Ganz ähnlich schreibt sich ein Buch. Jedenfalls in meiner Wortküche. Ich lasse mich treiben, ihr lasst es euch hoffentlich schmecken!
Diese Geschichte ist natürlich rein fiktiv. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die anderen nur Unglück bringen, zumindest hoffe ich es nicht. Okay, okay, manche Regierungen und ihre Mitglieder ausgenommen!
Andererseits – was weiß man schon? Wenn sich also in eurer Umgebung Unglücksfälle häufen, dann denkt daran: Felix ist unterwegs!
Günter Leitenbauer, Jänner 2017 bis Februar 2018
“Touch-a touch-a touch-a touch me
I wanna be dirty
Thrill me, chill me, fulfill me
Creature of the night“
(The Rocky Horror Picture Show)
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1: Freitag, 13. März 1964
Kapitel 2
Kapitel 3: April 1964
Kapitel 4: 2016 / 1970
Kapitel 5
Kapitel 6: 1970
Kapitel 7: 2016 / 1970
Kapitel 8: Herbst 1971
Kapitel 10: Weihnachten 1971
Kapitel 11: Frühjahr 1972
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14: 1974 - 1976
Kapitel 15: Juni 1977
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24: Mai 1978
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 28
Kapitel 27
Kapitel 29
Kapitel 30: 2017
Epilog
Prolog
Ein Sommerabend im Jahr 1963
Es juckte!
Er griff unter den Bund seiner Hose, um sich zu kratzen, zog die Hand wieder hervor und roch daran, wie das Männer so machen, wenn sie alleine sind (oder zumindest glauben, dass sie niemand beobachtet). Verdammt, er hatte den Geruch dieser Frau noch immer an sich, was seiner Gattin wohl kaum entgehen konnte, wenn er sich dann zu ihr ins Bett legen würde. Frauen riechen den Duft einer anderen an ihrem Mann selbst dann noch, wenn schon lange jeder Bluthund verzweifelt aufgegeben hätte.
Das Jucken machte ihm Sorgen. Er würde sich doch wohl keine neuen Bewohner in die gute Stube geholt haben? Das fehlte noch! In seine Hose hatte niemand einzuziehen, den er nicht persönlich dazu eingeladen hatte!
Um seine nach außen intakte Ehe nicht zu gefährden, die, wenn man es nüchtern und mit etwas mehr Insiderwissen betrachtete, de facto schon ziemlich am Ende war (wie die meisten intakten Ehen, warf sein Advokatus diaboli ein), zweigte er mit seinem alten Fiat daher an der nächsten Kreuzung ab und nahm statt des direkten Heimwegs einen schmalen Feldweg, der zwar in keiner Karte verzeichnet war, ihn aber alsbald zu einem kleinen Teich bringen würde. Es war eine laue Sommernacht hier in Oberösterreich, und der Mond grinste hinter den Wolken hervor, als wollte er ihm sagen: „Na Alter? Zuerst dreigängig auswärts essen gehen und dann ein schlechtes Gewissen wegen der Kalorien?“ Und es waren in der Tat drei saftige Gänge gewesen. Eine Leistung, zu der er bei seiner Frau niemals in der Lage gewesen wäre. Fast bedauerte er es, dass er damit vor ihr nicht angeben durfte. Es würde der Guten nicht schaden zu wissen, was für einen Hengst sie da im Stall hätte, wenn sie nur ein bisschen weniger frigide wäre!
Er musste ein Bad im Teich nehmen. Ein Handtuch hatte er immer im Auto, man weiß ja nie, nein, präziser muss es heißen: Mann weiß ja nie!
Der immer noch stolze Lover parkte also am Ufer des kleinen, zwar etwas trüben aber ansonsten sauberen Gewässers, stieg aus dem Wagen, zog sich hastig aus – es war spät und schön langsam würde sich seine Frau wohl fragen, warum er heute so lange nicht nach Hause kam – und ging ins angenehm kühle Wasser. Es war schon ziemliches Pech, dass er beim Aussteigen, ohne es zu bemerken, den Ganghebel in den Leerlauf drückte, aber das wäre ja noch nicht so schlimm gewesen, wenn er zumindest die Handbremse ordentlich angezogen hätte. Oder vielleicht hatte er das auch, und das Ding versagte einfach. Natürlich gab es damals noch keine akustische Warnung, wie sie moderne Autos heutzutage haben. Piep, piep, du hast das Licht angelassen! Piep, piep, du bist nicht angeschnallt! Piep, piep, das Handschuhfach ist offen! Piep, piep, du hast deinen Hosenstall noch offen! Piep, piep, du riechst nach Schlampe! Piep, piep, hast du dein Testament gemacht?
So aber setzte sich der Wagen, als der Mann gerade ins samtig weiche Teichwasser stieg, in Bewegung, fast als wollte er sich an ihn anschleichen wie Winnetou an die feindlichen Comanchen in einem Roman von Karl May, und rollte, immer schneller werdend, in Richtung des Teichs, wobei er auf der feuchten Wiese nach guter, alter Indianerart kaum ein Geräusch machte. Er drückte Halm um Halm nieder und beschleunigte weiter, blieb aber langsam genug, damit sich wenigstens die Grillen alle noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.
Der Mann war keine Grille. Er war ein Hengst, der seine besten Jahre – eigentlich alle seine Jahre – jetzt hinter sich hatte.
Genau in dem Moment, als er sich bis zum Nabel im seichten Wasser stehend am Unterleib wusch, vernahm er hinter sich ein leises Knirschen, als der Wagen den Kies am Ufer des Teichs erreichte, und drehte sich um.
Manchmal hätte man gern die Sprungkraft einer Grille.
Das letzte, was der bemitleidenswerte Pechvogel sah, bevor ihn sein eigenes Auto unter Wasser drückte, waren die Scheinwerfer, die er angelassen hatte, um beim Baden etwas Licht zu haben. Wäre er weniger müde gewesen, und hätte er die zwei oder drei Glas Sekt nicht getrunken, dann hätte er das schwankende Licht vielleicht als Anzeichen einer sich nähernden Gefahr interpretiert, aber in seinem Alter hat Sex, vor allem wenn er über die volle Amateurdistanz von drei Runden geht, nunmal zur Folge, dass ein Mann danach wirklich entspannt ist. Und eben auch ein kleinwenig schläfrig.
Das Letzte, was er sah, als er schon unter dem Wagen lag und verzweifelt nach Hilfe gurgelte, waren die Scheinwerfer seines Fiats. Du hast heute kein Glück. Er sah die Lichter auch noch, als er so vergeblich wie panisch versuchte, sich zu befreien. Du hast heute überhaupt kein Glück! Ein letztes Gurgeln.
Dann gingen die Lichter aus. Zuerst die des Wagens, als das eindringende Wasser einen Kurzschluss verursachte, und dann die des Mannes. Bei vollem Bewusstsein zu ertrinken ist kein schöner Tod, aber er würde keinem mehr davon erzählen können.
Als die letzten Reste von Luft aus seinen Lungen entwichen waren (Du hattest heute genaugenommen sogar ziemlich beschissenes Pech!), und sich diese mit dem Wasser des Teichs gefüllt hatten, hatten sich die Wellen an der Oberfläche bereits wieder beruhigt und der Mond grinste hämisch auf einen Teich, in dem erst nach einigen Tagen ein Spaziergänger mit seinem neugierig herumschnüffelnden Hund den bedauernswerten Mann, oder vielmehr das knapp unter der Wasseroberfläche gut sichtbare Auto, entdecken würde.
Es war schon fast eine Gnade, die das Schicksal dem Bedauernswerten als letzte Wiedergutmachung widerfahren ließ, ihn nie mit dem Wissen zu belästigen, dass er in dieser Nacht einen Sohn gezeugt hatte, der nicht nur ihm kein Glück bringen würde.
Vorsichtig formuliert.
1
Freitag, 13. März 1964
Waltraud schrie.
Dass eine Geburt schmerzhaft sein konnte, hatte sie schon vorher gewusst, aber wer so etwas noch nicht selbst erlebt hat, kann sich keine Vorstellung davon machen, wie irrwitzig diese Schmerzen sind. Am ehesten kann man das vielleicht noch damit vergleichen, in einem mehrstündigen Versuch einen Tennisball zu scheißen, fiel ihr zwischen zwei Wehen ein, worauf sie sogar kurz lachen musste, nur um von der nächsten Wehe sofort und gnadenlos für diesen Anflug von Galgenhumor bestraft zu werden. Das Allerschlimmste an der Sache war jedoch, dass sie genau wusste, dass demnächst die nächste Schmerzwelle heranrollen würde, in einer Regelmäßigkeit wie eine Dünung am Atlantik. Dass sie genau wusste, diese würde noch schlimmer sein, weil jede zuvor immer noch schlimmer gewesen war. Dass sie genau wusste, dass die Abstände immer kürzer und die Erholungspausen immer weniger ergiebig sein würden. Und dass sie eben nicht wusste, wie lange dieser ganze, verdammte Mist noch dauern würde.
„Pressen Sie!“, befahl die Hebamme. „Und wenn die Wehe vorbei ist, ruhig atmen und die Pause zur Erholung nutzen.“
„Als wenn ich das nicht wüsste, du blödes Arschloch!“, dachte sie sich. Waltraud war keine ordinäre Frau, sie hätte sich zu jeder anderen Gelegenheit über die Ausdrücke entrüstet, welche ihr jetzt in den Sinn und teilweise auch über die Lippen kamen. Aber eine Geburt ist eine Sache, bei der Frauen ihren Humor verlieren und auf eine Art und Weise zu fluchen beginnen, die man sonst eher von Fußballfans eines Unterligavereins kennt, wenn sonntags der Schiedsrichter mal wieder für die Gegenmannschaft pfeift. Vermutlich war das der Grund, warum die Väter jahrhundertelang draußen warten mussten und erst in den letzten Jahrzehnten mitleiden dürfen, können, sollen – und angeblich auch wollen. Sagen zumindest die Frauen. Das war praktisch die Maut, die Männer für den kurzen Ritt auf dem Motorrad der Ektase zu entrichten hatten, wenn sie zu stur waren, ihr bestes Stück mit einem Gummihelm zu schützen. Oder vielleicht auch nur in ihrer Erregung darauf vergaßen. Wenn der Schwanz steht, steht eben auch das Hirn.
Mit Waltraud litt kein Mann mit. Das war in den Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts auch noch nicht üblich. Zudem war der Erzeuger ihres Sohnes – sie wusste instinktiv, dass es ein Sohn werden würde – schlicht und einfach nicht zur Stelle. Gott verfluche ihn, wer immer das auch war, man konnte sich ja unmöglich alle merken. Eine neue Wehe donnerte herein wie ein Tsunami und hinderte sie an weiteren Gedanken. Verpiss dich, du verdammtes Luder!
Waltraud führte ein, wie man ein klein wenig verharmlosend sagen könnte, promiskuitives Leben. Sie hatte keine Ahnung, wer als Erzeuger (Vater wollte sie ihn unbewusst nicht nennen, nicht einmal in Gedanken) in Frage kommen könnte. Dazu hatte es im letzten Sommer zu viele Nächte mit zu vielen Männern und vor allem mit viel zu viel Alkohol gegeben. Wobei manchmal der Alkohol die Männer zur Folge hatte und noch öfter die Männer den Schnaps, weil ersteres die Auswahl erleichterte und zweiteres über eine wieder einmal schlechte Auswahl hinwegtröstete. Sie hätte ein Buch schreiben können, wie unfähig und wenig einfühlsam viele Männer im Bett oder auf der Rückbank oder, sei’s drum, auch auf dem Klo einer drittklassigen Spelunke waren. Wobei das mit dem Klo ja meistens noch ging, keine Ahnung warum. Vor allem auf der Rückbank war es oft einfach nur enttäuschend, anscheinend hatte die Krone der Schöpfung es im Auto nicht nur beim Fahren eilig, nein, Autos schienen ihnen generell Stress zu machen!
Und manchen dieser Kreaturen war es dann auch schlichtweg egal, was die Frau beim Sex empfand, wenn sie denn überhaupt etwas dabei spürte. Man musste ja schon froh sein, wenn einer nicht noch fragte ob er gut war, nachdem sie ihm gerade einen geblasen hatte! Der Alkohol hüllte über diese Unzulänglichkeiten der Männer eine besänftigende Decke, dachte sie. Sicher hatte eine Frau den Schnaps erfunden, vierzigprozentig! Vermutlich eine Ägypterin mit irgendeinem dämlichen Machoarsch von Pharao als Mann oder sowas in der Art. „Aua, verpiss dich, du Miststück!“ Das galt der nächsten Wehe, und diesmal schrie sie es laut heraus.
Die Abstände der aus dem Nirgendwo hereinbrechenden Schmerzwellen wurden stetig kürzer, die Wehen selbst immer heftiger. Als wenn da drinnen ein Sturm wüten und die Schmerzen aufpeitschen und an eine Steilküste werfen wollte, wo sie die Felsen hochjagten um dann in eine Gischt aus feinen Nadelstichen zu zerplatzten. Selbst die Hebamme hätte auf eine diesbezügliche Frage zugeben müssen, dass es eine besonders schwere Geburt war, was sie aber Waltraud weder sagte noch sich anmerken ließ. Hebammen sind berufsbedingt einiges gewohnt – auch, immer Zuversicht auszustrahlen, egal, wie verzwickt die Lage ist. Und diese hier war in der Tat verzwickt, im Sinne des Wortes. Dieses Baby hatte einen ziemlich großen Kopf für das zierliche Becken der Gebärenden. „Wenn das nur gut geht“, dachte die Hebamme, die sich langsam mit dem Gedanken anfreunden musste, dass ihr geplantes Rendezvous mit diesem so unverschämt gutaussehenden Freund ihrer Bekannten heute wohl platzen dürfte. Naja, wäre sowieso wieder nichts daraus geworden. Das mit den Männern klappte bei ihr einfach nicht. Verdammt, man sollte der armen Frau den Rest ersparen und das Baby mit einer Sectio holen, dachte sie beim nächsten Schrei Waltrauds.
In einem christlichen Krankenhaus der 1960er Jahre war aber eine Geburt mittels Kaiserschnitt das allerletzte Mittel und wurde nur angewendet, wenn die werdende Mutter schon halb tot war. So ein wenig wie damals bei Cäsar, von dem dieser Eingriff angeblich ja den Namen hat, dachte die Hebamme, und den man, wenn man der Legende trauen darf, ohne Rücksicht auf die Mutter dieser aus dem Leib geschnitten hatte, was zwar der Sohn aber natürlich nicht die Mutter überlebte. Also ließ man Waltraud gebären und dabei langsam krepieren, wie Frauen es seit tausenden von Jahren taten, obwohl ein Kaiserschnitt vermutlich ihr Leben hätte retten können.
Die nächste Wehe, und mit ihr eine gewaltige Willensanstrengung Waltrauds, die genau spürte: „Jetzt oder nie!“, brachte endlich den Kopf des Knaben – es war wirklich ein prächtiger, kleiner Bursche, wie sich gleich zeigen sollte – zum Vorschein. Und dann ging es sehr schnell.
Das Baby kam.
Die Mutter schrie.
Das Baby schrie.
Im Kopf der Mutter platzte ein Aneurysma. Das ist eine kleine Ausbuchtung einer Arterie an einer Stelle, wo die Gefäßwand etwas zu dünn war, und die sie schon seit ihrer Kindheit unerkannt mit sich herumgetragen hatte, das aber ohne die große Anstrengung bei der Geburt wohl auch in fünfzig Jahren nicht aufgerissen wäre. Niemand konnte etwas dafür. Es war einfach Pech. Manchen Leuten platzte ein Autoreifen, manchen der Gartenschlauch beim Bewässern der Radieschen, manchen nur der Kragen – und Waltraud eben ein großes Blutgefäß im Kopf. Peng! Bewusstlos!
Waltraud lebte noch eine knappe Stunde, dann war der kleine Felix, wie ihn die Schwestern in der Klinik genannt hatten, Vollwaise. Er hatte seiner Mutter trotz seines Namens kein Glück gebracht.
*
Helmut und Bettina waren auf die Butterseite des Lebens gefallen. Das junge Ehepaar hatte einfach alles, was man sich wünschen kann. Helmut arbeitete bei einer großen Bank im Wertpapiergeschäft und war erfolgreich, was ihn schon mit seinen gerade erst dreißig Jahren zum Abteilungsleiter hochgespült hatte. Er hatte ein goldenes Händchen oder ein feines Näschen (oder beides) für im Aufstieg begriffene Unternehmen und mit einigen klugen, wenn auch etwas waghalsigen Investitionen ein kleines Vermögen verdient. Seine Eltern wären stolz auf ihn gewesen, aber sein Vater war vor einigen Jahren an Krebs gestorben, hatte damit seiner Mutter das Herz gebrochen und sie kein Jahr später in den ewigen Ruhestand nachgeholt.
Bettina hatte Helmut auf einer von seiner Bank gesponserten Vernissage in der städtischen Galerie kennengelernt. Die Bank förderte immer wieder junge Künstler, die Anlass zur Hoffnung gaben, es irgendwann zu berühmten Malern oder Bildhauern zu bringen. Sie kaufte jedes Mal einige Kunstwerke zu einem Spottpreis – oder verlangte sie überhaupt als kostenlose Gegenleistung für die Ausrichtung der Ausstellung. Auf diese Art war die Bank in den Besitz einer recht ansehnlichen Kunstsammlung gelangt. Die Rechnung war einfach: Wenn es nur einer von zehn Künstlern schaffte, dann waren zehn Prozent aller Bilder nach einigen Jahren oder Jahrzehnten eine Menge wert. Und das Beste daran war, dass man das auch noch als Werbungskosten absetzen und in der öffentlichen Wahrnehmung als Kunstförderer dastehen konnte.
Bei dieser Vernissage vor vier Jahren war Helmut gerade mit dem ausstellenden Künstler in ein Gespräch vertieft, in dem ihm dieser langatmig den Sinn in seinen Werken erklären wollte und Helmut, durch in regelmäßigen Abständen sich wiederholendes Nicken Verständnis heuchelnd, in diesem potthässlichen Mist, den der selbsternannte Künstler produzierte, genau gar keinen Sinn erkennen konnte. Helmut war zwar durchaus weltoffen, aber manchmal hatte er das Gefühl, dass die moderne Kunst ihren Hauptzweck darin sah, den klügeren Menschen vor Augen zu führen, wie man weniger kluge aber sich für sehr modern und gewandt haltende Menschen für dumm verkaufen konnte. Für einen Bankmanager eigentlich eine unverzichtbare Eigenschaft, dachte er und lächelte, was dem Künstler erneut einen Motivationsschub verpasste und seine Begeisterung zur Selbstdarstellung weiter anstachelte.
Diese Gedanken zur modernen Kunst behielt er aber heute besser für sich, dachte Helmut, als ihm der Typ gerade mit offensichtlich nach dem Zufallsprinzip aus dem Hut gezauberten, intellektuell klingenden Fremdwörtern eine „Installation“ erklärte, von der Helmut zuallererst gedacht hätte, dass wohl die Putzfrau vergessen habe, ihre Reinigungsutensilien wegzuräumen.
Der junge Mann, der später zu einem gefeierten Star in der österreichischen Szene werden sollte, versuchte Helmut nahezubringen, dass das Wesen der modernen Kunst, im Gegensatz zur althergebrachten, eben sei, dem Beobachter die Freiheit zu lassen, in seinem Werk das zu erkennen, was er erkennen wolle; und noch viel mehr als das: Nämlich den Beobachter damit selbst zu einem Teil der Kunst zu machen, ihn also in den Schaffensprozess hineinzuziehen. Also quasi den Beobachter beim Beobachten zum allumfassenden Thema der Kunst zu machen, die Kreation des Künstlers sozusagen von einer objektiven, narrativen Kunstebene auf eine subjektive erfassende Empfindungsebene zu transferieren. Sei das nicht wahrhaft faszinierend? Ja, ja, natürlich, so hatte ich das noch gar nicht betrachtet. Wieder ein Nicken.
(Herr, bitte erlöse mich!)
Helmut war dankbar wie ein Verdurstender für einen Schluck Wasser, als ihn Bettina, die seine Agonie richtig einzuschätzen schien, mit einem leeren Sektglas in der Hand von diesem Langeweiler befreite. Sie tat einfach so als wären sie alte Bekannte, schnappte sich Helmut am Ellbogen und zog ihn mit sich zur Sektbar.
Der Künstler wandte sich, scheinbar weder beleidigt noch beeindruckt, weil eben wahre Künstler in ihrer eigenen Welt leben, sodass sie solche Kleinigkeiten nicht einmal wahr- geschweige denn übelnehmen, umgehend einem neuen Opfer zu, einem älteren Herrn, der die Vernissagen der städtischen Galerie gerne wegen der immer großzügigen Buffets besuchte und in der folgenden Stunde lernte, dass es im Leben auf Dauer nichts gratis gibt. Aber schon rein gar nichts! Und auf keinen Fall diese hervorragenden Lachsbrötchen hier! Denn ihn befreite über sechzig Minuten lang keiner aus den Fängen des wie ein Wasserfall quasselnden und dennoch nichtssagenden Kunstschaffenden. Dafür wusste er danach ... ja was eigentlich? Auch nicht mehr als vorher. Außer, dass er in Zukunft bei solchen Feiern den Künstler nicht aus den Augen lassen würde, wenn er sich bei einer Ausstellungseröffnung am Buffet den Bauch vollschlüge. Zehn Meter Sicherheitsabstand. Mindestens! Und vorher Knoblauch essen, das würde ihm solche Idioten vielleicht vom Leibe halten.
„Danke für die Rettung! Das war in letzter Minute, sonst hätte er mich buchstäblich totgelangweilt.“
Helmut stieß mit seinem Sektglas vorsichtig an das seiner Befreierin, was etliche Kohlendioxidbläschen in beiden Gläsern dazu veranlasste, an die Oberfläche zu streben, um sich anzusehen, was da los war, um dann entweder vor Neugier zu platzen oder sich mit sinkender Begeisterung wieder nach unten treiben zu lassen.
„Keine Ursache! Ich habe ja gespürt, wie Sie unter dem Monolog dieses Langeweilers litten. Und es heißt zu Tode gelangweilt, oder?“, erwiderte sie mit einem koketten Lächeln. Nein, eigentlich war es nicht kokett, es war einfach sympathisch, offen und direkt und damit umso verführerischer für einen Mann, dem man selten in dieser Form begegnete, schon gar nicht als Frau. Die Frauen, mit denen er sonst zu tun hatte, waren zumeist Sekretärinnen, die insgeheim zwar für ihn schwärmten, aber niemals gewagt hätten, ihn so schamlos anstarrend mit einem derart frechen Lächeln zu provozieren. In den Sechzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts tat eine Frau das einfach nicht. Da war noch klar, wer in der Gesellschaft den Ton angab. Okay, manchmal kam ihm seine Sekretärin etwas näher, aber das gehörte wohl irgendwie zu ihrer Stellenbeschreibung. Oder hieß es Stellungsbeschreibung? Egal. Und als er erfahren hatte, dass seine Assistentin verlobt war, hatte er das ja auch sofort abgestellt und sich eines dieser neuen Diktiergeräte angeschafft, um sie nicht mehr zum Diktat bitten zu müssen. Helmut war ein Ehrenmann. Und sie sowieso eine Enttäuschung am Schreibtisch. Oder darunter – nein, das war sogar noch halbwegs in Ordnung gewesen.
Heikler waren da schon die Kundinnen, die glaubten, sein Beratungshonorar schlösse das Glattbügeln von siebzigjährigen Falten auf Körpern, die sonst durch teure Markenkleidung gut vor Blicken geschützt waren, automatisch mit ein. Mit einem dreißigjährigen, sportlichen Bügeleisen samt Schamlockenstab. Von dieser Sorte gab es einige unter seinen Geschäftspartnerinnen. Mehr oder weniger wohlhabende Witwen zumeist, die bei ihrer Heirat eben die wirklichen Traummaße eines Mannes genau gekannt hatten: 80-60-40. 80 Jahre, 60 Mille, 40 Fieber. Der perfekte Kurzzeitehemann, bis dass der Tod uns scheide. Vor allem für eine ambitionierte zukünftige Witwe, die etwas auf sich hielt.
„Bevor ich Sie jetzt noch total verunsichere, schlage ich vor, dass ich schüchtern den Blick senke und mich vorstelle. Ich bin Bettina. Und der Langeweiler von Künstler ist ein Cousin von mir, nur damit Sie nicht gleich nochmal in ein Fettnäpfchen treten müssen.“ Sie lachte auf ihre gewinnende, ehrlich wirkende Art.
„Oh ja, entschuldigen Sie bitte. Helmut Hofer. Danke für den Hinweis, in dieses Fettnäpfchen bin ich ja wohl schon mit zwei gestreckten Beinen hineingesprungen“, fasste er sich nur langsam wieder und lachte ebenfalls, allerdings mit kaum übersehbarer Verlegenheit. Er errötete sogar leicht, was Bettina aber taktvoll zu übersehen schien. Ihr gefiel es, wie er sich ausdrückte. Gepflegt wie sein Äußeres. Bettina verabscheute ungepflegte Männer. Sie erkannte sie auch, wenn sie sich ausnahmsweise wuschen und in Schale warfen. Man kann einen Mann aus der Gosse holen, sagte sie oft, aber nicht die Gosse aus einem Mann. Ein Blick auf die Hände, und du weißt Bescheid. Und falls nicht, weißt du es nach den ersten fünfzehn Worten, die er spricht.
Er taxierte sie von oben bis unten. Sie war eine dieser Frauen, die nach den üblichen Merkmalen nicht als eigentliche Schönheit wohl aber als attraktiv – im Sinne des Wortes – galten. Sie zog ihn tatsächlich an. Entgegen der herrschenden Mode trug sie ihr rotbraunes Haar offen. Und sie tat gut daran, fand er. An der Figur gab es nichts auszusetzen, mittelgroß, schlank aber nicht dürr. Ihrem Gesicht gab die leicht schiefe Nase eine Spannung, die ihn faszinierte. Die Kleidung war unauffällig aber nicht billig, stellte er fest.
„Wenn Sie dann mit der Beurteilung meines Äußeren fertig sind, würde ich mich freuen, wenn Sie mir das Ergebnis auch mitteilen, Helmut“, sprach sie ihn mit dem Vornamen an. Wieder dieses Lachen, das eher ein Lächeln war, und aus dem jede Menge Selbstsicherheit sprach, was ihm die seine auf der Stelle raubte. Samt seiner sonst durchaus offen zur Schau getragenen Überlegenheit. So konnte er als Entgegnung nur eine Entschuldigung stammeln, worauf sie wiederum laut auflachte und ihm beschied, dass sie ihm das nicht übelnähme. Sie wäre es gewohnt, Männer zu verunsichern und sie wäre in der Tat oft genug von ihrer Mutter dafür gescholten worden.
Und? Welches Ergebnis hätte seine Taxierung nun ergeben? Fände ihr Äußeres Gnade vor seinen Augen?
„Wenn Sie mir gestatten, Ihnen das Du anzubieten, würde ich dir das gerne in meiner Wohnung mitteilen“, hatte er sich wieder gefasst und war damit ganz entgegen seiner sonstigen, eher zurückhaltenden Art, aufs Ganze gegangen, vielleicht auch, um sich und ihr zu beweisen, dass man ihn nicht so schnell einschüchtern konnte.
Jackpot! Wirkungstreffer! Ohne dass sie auch nur ansatzweise die Deckung hinauf bekommen hätte. „Was für ein frecher Hund!“ war alles, was sie in diesem Moment dachte. Gefolgt von einem „Aber interessant!“
Ganz im Gegensatz zu den damals üblichen gesellschaftlichen Gepflogenheiten gingen sie diesen Abend, keine zwei Stunden nachdem sie sich kennengelernt hatten, in seiner Wohnung noch dreimal aufs Ganze, während am Plattenspieler die Stones „Satisfaction“ brüllten, bevor die Plattennadel dann in der Endrille einen zweistündigen, stillen, nur von leichtem Knistern begleiteten Dauerlauf hinlegte. An diesem Abend bewiesen sie sich gegenseitig, dass die Roaring Sixties ihren Namen zu Recht trugen.
*
Zwei Monate später heirateten sie. In Wien – und im kleinsten Rahmen, nur sie beide und zwei wildfremde Trauzeugen, die sie einfach auf der Straße aufgelesen hatten.
Sie hieß nun also Bettina Hofer, B.H. wie er in der Hochzeitsnacht lachend anmerkte, bevor er ihr in der Hochzeitssuite im Sacher selbigen öffnete. „H. H. ist auch nicht besser“, erwiderte sie, und er meinte darauf nur: „Und auf keinen Fall lustiger! Aber die Überraschung mit dem Sacher ist dir gelungen. Mal sehen, was dir heute sonst noch gelingt.“
Dann brachte er sie zum Schweigen. Und zwar mit der einzigen Methode, die seiner Meinung nach (ausgenommen der Kauf neuer Schuhe) bei einer Frau wirklich funktionierte, zumindest wenn man die damit zwangsläufig entstehenden Nebengeräusche wohlwollend überhörte. Und sie liebte es mindestens genauso wie er, auf welche Weise er das zustande brachte. Das „Was“. Das „Wie“. Und vor allem das „Wie lange“. Ja sei’s drum, auch das „Womit“!
Dann lagen sie einige Minuten atemlos da, eng aneinander gekuschelt, bis die Hitze in ihren Körpern langsam abebbte. Sie mochten diese Minuten, und sie genossen sie still. Helmut dachte daran, wie Bettina ihm einige Tage vor der Hochzeit klipp und klar gesagt hatte, dass ein Leben als Hausfrau für sie nicht in Betracht käme. Sie erfülle eben das gesellschaftliche Frauenbild nicht, ob er damit klarkomme? Eine Frage, die nicht als Frage gemeint gewesen war.
Helmut war zwar durchaus an die Normen der damaligen Zeit angepasst, aber er erkannte, dass er diese Frau, in die er sich schon auf der Vernissage mit Haut und Haaren und was-weiß-ich womit sonst noch verliebt hatte, nie würde einsperren können. Sie zu halten – dieser Ausdruck war an sich schon verkehrt, aber ein besserer fiel ihm nicht ein – war wohl nur möglich, wenn er ihr die nötigen Freiräume gestattete. „Luftketten“ nannte Bettina das. Und dass niemand ihr Freiräume „gestatten könne“. Die nähme sie sich schon selbst, klar?
Für einen Mann, der zuhause vollkommen entgegengesetzte Verhaltensweisen vorgelebt bekommen hatte und auch im Beruf kaum einmal auf Widerspruch stieß, war das ein Kulturschock wie es die Rolling Stones für ihre Elterngeneration gewesen waren. Aber Helmut lernte schnell damit umzugehen. Bettina arbeitete auch weiterhin in ihrem Beruf als Journalistin bei der Linzer Tageszeitung, wo sie es als erste Frau zur Redakteurin gebracht hatte. Nein, nicht als Kolumnenschreiberin über Linienprobleme gelangweilter Hausfrauen, sondern als stellvertretende Chefredakteurin für Tagespolitik. In den Neunzehnhundertsechzigern wurde ja noch richtig Politik gemacht. Mit Gesprächskultur, Stil, Inhalt, seriös berichtenden Medien und nur ein klein wenig Polemik und Hetze. Und vor allem ohne Facebook und Twitter.
Tags darauf fuhren sie zurück nach Wels. Der Ehering fühlte sich ungewohnt an, so fanden sie beide, aber sonst hatte sich durch die Hochzeit nicht viel geändert.
*
Wenn die Liebe groß genug ist, verträgt eine Ehe einiges an Problemen. Die es bei den beiden aber nicht gab. Ihr Zusammenleben war von Anfang auf kurzweilige Art harmonisch. Der Wunsch nach Kindern war da nur eine Frage der Zeit. Als erstes merkt ein Mann das an den Blicken seiner Frau, wenn er mit ihr spazieren geht und ihnen eine Mutter mit einem Kinderwagen begegnet. Wenn er es überhaupt merken will! Wenn nicht, sorgt sie dafür, dass er will, ohne dass er merkt, dass er darauf vergessen hat, es merken zu wollen.
Nach etwa einem halben Jahr war diese Zeit gekommen. Sie verzichteten auf Verhütung und versuchten im Gegenteil alles, damit Bettina schwanger wurde. Vergeblich. Nach etwas mehr als einem weiteren Jahr waren sie zu einem Spezialisten gegangen, der festgestellt hatte, dass es einen klaren Grund für ihre Kinderlosigkeit gab. Helmut war unfruchtbar. Fast alle seiner Spermien trieben im Ejakulat wie die Fische an der Wasseroberfläche eines Teichs nach dem Crocodile Dundee dort mit Dynamit gefischt hatte. Mausetot. Da schwänzelte nichts mehr, jedenfalls fast nichts. Bauch nach oben und treiben lassen. Seine Spermien waren keine Navy Seals, das waren Touristen am Toten Meer.
Als er seine Frau darauf ansprach, dass es klar seine Schuld sei, wurde sie das erste Mal in ihrer Ehe richtig böse. Er solle es ja nicht noch einmal wagen, in diesem Zusammenhang das Wort „Schuld“ zu verwenden (bei anderen Gelegenheiten schon, Männer sind oft schuld, eigentlich immer, sie wissen es nur nicht, bis man es ihnen sagt, worauf dann entweder gestritten wird – oder Schuhe gekauft werden). Ob ihrer beider spezifisches Problem nun bei ihm oder bei ihr läge, Schuld habe keiner von beiden, meinte Bettina. Schuld sei etwas, das eine vorsätzliche oder zumindest willkürliche Handlung bedinge, erklärte sie ihm mit ihrer Redakteursstimme, die keinen Widerspruch duldete. Und jetzt werde man eben darüber nachdenken, was man in dieser Angelegenheit unternehmen könne, ja?
Zu allererst unternahmen sie einen weiteren Ausflug ins Ehebett. Das erste Mal seit längerem ohne jeden Druck, schwanger werden zu müssen. Umso schöner war es für beide, auch wenn er sich fast ein wenig gruselte, als er nach seinem Höhepunkt daran denken musste, dass er ihr gerade Millionen von kleinen Leichen in den Leib gespritzt hatte, die nun mit dem Bauch oben in ihrer Vagina trieben. Wenn Spermien überhaupt einen Bauch haben sollten, was er bezweifelte aber genaugenommen nicht so genau wusste. Das Bild brachte er trotzdem einige Zeit lang nicht mehr aus dem Kopf.
2
Die geistliche Schwester, die sich um den kleinen Felix kümmerte, hieß Agnes. Sie wäre in einem weltlichen Beruf wohl schon in Pension gewesen, aber Nonnen gehen nicht nach dem Berufsleben in Rente, die sterben in Ausübung ihrer Berufung. Dafür erspart man ihnen dann, gewissermaßen als apostolischen Überstundenzuschlag, die Qual des Fegefeuers. Ihrem Alter entsprechend nahm es Agnes mit der Vorschrift, ihre kleinen Patienten nur mit Latexhandschuhen anzufassen, nie so genau. Wenn sie jemand gefragt hätte, würde sie wohl geantwortet haben, dass den Kleinen Hautkontakt sicher besser bekäme, was Jahrzehnte später auch als allgemein anerkannte Lehrmeinung Einzug in die Medizin halten sollte. Also wusch sie sich lieber öfter die Hände, als ständig diese unpersönlichen, innen mit Talkum gepuderten Latexhandschuhe zu verwenden. Außerdem half sie der Klinik auf diese Weise ein wenig sparen, dachte sie.
Schwester Agnes liebte den kleinen Schreihals. Sie mochte alle Kinder, aber diesen kleinen Racker liebte sie. Er war gerade einmal ein paar Tage alt, aber er brüllte schon wie ein Löwe. Und er trank wie ein Matrose bei seinem ersten Strandurlaub nach zwei Monaten auf See, nur natürlich keinen Alkohol sondern körperwarme Milch, wie das Babies eben tun. Agnes lächelte.
Alles jedoch, was man in ein Baby füllt, kommt mit Ausnahme dessen, was es zum Wachstum benötigt, zeitverzögert auch irgendwann wieder aus ihm heraus. Agnes wickelte den Kleinen gerade zum gefühlt zwanzigsten Male an diesem Tag. Sie hätte die penibel geführten Aufzeichnungen einsehen müssen, um das genau sagen zu können. Aber wozu die Mühe? Die jungen Schwestern mochten diese Aufzeichnungen sinnvoll finden oder sogar darauf angewiesen sein, aber sie wusste auch so, was Säuglinge brauchten. Sie hatte die Erfahrung, den feinen Unterschied am Schreien eines Babies zu erkennen, je nachdem, ob es hungrig war, in die Windeln gemacht hatte oder es gerade sein Bäuchlein drückte.
Die Kleinen können sich zwar nur durch ihr Schreien artikulieren, aber das ist im Allgemeinen auch völlig ausreichend, um ihren Willen durchzusetzen. Die Natur hat dem Schrei eines Babies einen alles durchdringenden Sound verliehen, dem man sich als mitfühlender Erwachsener kaum entziehen kann. Oder evolutionär formuliert: Die Säuglinge, die am durchdringendsten schreien konnten, hatten die höchsten Überlebens- und damit Fortpflanzungschancen. Survival of the loudest. Charles Darwin lässt grüßen.
Was jeder weiß, der einmal über einen längeren Zeitraum Kinder gewickelt hat, ist, dass sie noch mindestens eine andere Möglichkeit haben, um einem das Leben schwer zu machen. Und sie nutzen diese Möglichkeit mit der Präzision eines chirurgischen Instruments, als hätte man ihnen mit ihrer Zeugung ein entsprechendes Zielfernrohrgen gleich mit eingebaut.
Beim Wickeln gibt es ganz zwangsläufig einen Zeitpunkt, zu dem man die alte Windel entfernt und dem Kind eine neue unterschiebt, erfahrene Mütter nennen das den Hochrisikomoment, an dem man die schellende Haustürglocke tunlichst ignorieren, das Telefon läuten und das Öl in der Pfanne anbrennen lassen sollte. Denn irgendwie, als würde es dafür analog zum Geburtsvorbereitungskurs für Eltern auch für die Kleinen eine Schulung geben, wissen sie mit der Genauigkeit eines Schweizer Uhrwerks, dass exakt dieser Zeitpunkt der beste ist, in aller Freiheit und, unbedrängt vom Druck der Stoff- oder Wegwerfwindeln, die es 1964 jedoch noch kaum gab, dem Harndrang nachzugeben und einfach mal zu überprüfen, ob man den Hoch- und Weiturinierwettbewerb der Untereinjährigen mit etwas Körpereinsatz nicht doch noch für sich entscheiden könnte. Buben haben hier gegenüber Mädchen klarerweise einen anatomischen Vorteil, den Felix in diesem Moment auch nutzte, indem er bei Schwester Agnes exakt in die Brusttasche ihres Habits zielte – und präzise wie eine lasergesteuerte Smartbombe in hohem Bogen auch traf. Yeah Baby, Bullseye, gimme five! Wobei natürlich auch einiges danebenging und am Boden landete. Hey Baby, die Runde geht an mich! Felix lächelte zufrieden.
Schwester Agnes war alt und routiniert genug, damit sie derartige kleinere Zwischenfälle nicht mehr ärgerten sondern vielmehr amüsierten. Und so quittierte sie das mit einem „Na bravo, jetzt hast du mich aber mal wieder überlistet“, wickelte den Kleinen in aller Ruhe fertig, legte ihn in sein Bettchen zurück, gab ihm einen Kuss auf die Stirn, drehte sich um, weil sie sich umziehen gehen musste, rutschte in der kleinen Urinlache aus und brach sich den Oberschenkelhals, als sie zu Boden stürzte. Felix lächelte auch noch, als Agnes mit skurril verdrehtem Bein auf dem Boden liegend vor Schmerzen schrie.
Zwar ist es besser sich, wenn man sich schon den Hals brechen muss, das mit dem Oberschenkelhals zu machen, aber es gibt auch weniger problematische Knochen, die man sich dafür aussuchen kann. Vor allem als älterer Mensch. Dabei ist mit Sicherheit ein Krankenhaus der am besten geeignete Ort für eine Unternehmung dieser Art. So bekam die verunglückte Schwester Agnes sehr schnell professionelle Hilfe. Da der Bruch jedoch kompliziert war, musste sie noch am selben Tag unters Messer des orthopädischen Chirurgen.
Die Operation verlief gut, aber nach drei Tagen bekam Schwester Agnes ein Blutgerinnsel, das in die Lunge wanderte, dort als Embolie ihrer beruflichen und irdischen Karriere ein Ende setzte und ihre Seele auf die Reise ins Licht schickte. Gehe direkt in den Himmel, gehe nicht über Fegefeuer!
Felix erfuhr davon nichts. Jedenfalls jahrelang nicht. Amen!
*
Zuerst schafften sich Bettina und Helmut einen Hund an. Sie wussten zwar beide, dass dies ihren Kindeswunsch nicht stillen würde, aber irgendwie sind diese entzückenden Hundewelpen doch fast wie Babies. Nur früher stubenrein, was die Gefahr eines fatalen Oberschenkelhalsbruchs gewaltig reduziert, aber solche Gedankengänge waren den beiden ebenfalls noch nicht gekommen.
Das Gebell der kleinen Promenadenmischung, in der neben eindeutig feststellbaren Dackelgenen wohl auch einiges von einem Terrier steckte (man will sich gar nicht vorstellen, wie es dazu kam), klang beinahe wie ein Glöckchen, und weil es eine Hündin war und kein Rüde, nannten die beiden sie Tinker Bell, nach der kleinen Elfe aus Peter Pan, die sich ebenfalls anstatt durch Sprache nur mittels glockenartiger Geräusche verständlich machte. Zudem war das „Bell“ in ihrem Namen ein lustiges Wortspiel für einen Hund, fanden sie. Sie lachten jedes Mal herzhaft, wenn Bettina rief: „Tinker Bell, bell!“, was auch immer und prompt mit einem glockenhellen, wohlklingenden Bellen beantwortet wurde. Man könnte sagen, Tinker Bell war darauf konditioniert wie der berühmte Pawlow’sche Hund, bei dem man jedes Mal vor der Fütterung eine Glocke läutete. Nach einiger Zeit lief dann dem armen Hund bei jedem Glockenläuten der Geifer aus den Lefzen, auch wenn er gar kein Futter bekam. Tinkerbell, bell! Wau, wau! Haha!
Da Bettinas Arbeitszeiten – Helmut ging um etwa acht Uhr morgens aus dem Haus und kam um halb sechs heim, während Bettina zwischen ein Uhr nachmittags und etwa sieben Uhr abends in der Redaktion war – so lagen, dass der Hund nur sehr wenig alleine war, war die Betreuung kein Problem. Außerdem hatten sie nette Nachbarn, deren Hilfe sie aber nur in Anspruch nahmen, wenn sie sich einen gemeinsamen Abend im Theater oder im Kino gönnten, was jedoch zum Leidwesen von Bettina nicht mehr allzu häufig vorkam. Sie brauchten als jung vermähltes Ehepaar kaum Animation von außen, fand Helmut, noch reichten sie sich selbst vollkommen aus. Helmut hatte zudem schnell bemerkt, dass Bettina in ihre nächtliche Freizeitgestaltung sehr viel Fantasie einbrachte, wobei sie ihn manchmal mit Dingen überraschte, die ihn beinahe schockierten, ihm schlussendlich aber doch sehr zusagten – um es vorsichtig auszudrücken.
Trotz dieses sehr harmonischen Zusammenlebens fehlte etwas, und das spürten sie beide. 1964 war die künstliche Befruchtung noch nicht erfunden, und so blieben Ehepaaren mit unerfülltem Kinderwunsch nur zwei Alternativen: Beten oder Adoptieren. Ersteres hilft leider nur in den seltensten Fällen, auch wenn aussagekräftige Studien darüber nicht vorliegen. Männer, die beruflich viel beten, haben kein Interesse daran, allzu viele Kinder in die Welt zu setzen, jedenfalls die von der katholischen Fraktion, und wenn sie es doch tun, beten sie eher dafür, dass niemand dahinterkommt.
Sie sprachen daher über eine Adoption.
Über die psychischen Aspekte einer Adoption sei eine Menge geschrieben worden. Psychiater und Psychologen schrieben überhaupt sehr gerne und sehr viel, erklärte ihr Helmut. Manchmal frage man sich, wie man mit so wenig Fachwissen solche Unmengen schreiben kann, denn bei der Komplexität der menschlichen Psyche sei wirkliches Wissen oft gar nicht möglich, das wäre eher Ahnen oder Vermuten. So wenig, wie alle Bäume die gleiche Form haben, so wenig glichen sich nun einmal die Psychen (oder Seelen, wenn man es religiöser formulieren will) der Menschen, nicht wahr?
Irgend so ein Wissenschaftler, erklärte Helmut Bettina weiter, habe sich mächtig unbeliebt gemacht, als er die Unterscheidung zwischen harten Wissenschaften mit durch Experimenten wiederholbaren Vorhersagen und weichen Wissenschaften einfach in Wissenschaften und Pseudowissenschaften umbenannt hatte. Wobei er aber wohl gar nicht so unrecht gehabt haben dürfte, philosophierte Helmut, der nun richtig in Fahrt war, während er geflissentlich das Augenrollen seiner Angebeteten übersah, der das Abschweifen des Gesprächs vom Thema Adoption zum Thema Wissenschaft nicht behagte.
„Logisch“ schiene ihm daher der natürliche Antagonist von „psychologisch“ zu sein. Warum wohl streiten sich Wissenschaftler noch in unseren Tagen, was das Bewusstsein eigentlich ist und ob das Selbstbewusstsein Teil des Bewusstseins oder etwas ganz eigenes sei, und ob es sich nur bei vergemeinschafteten Menschen entwickeln kann oder theoretisch eventuell auch bei solchen, die nie einem anderen Menschen begegnet sind, etc. Nein, welche Auswirkungen eine Adoption habe, könne man unmöglich absehen.
Psychologie sei eben – wie ein kluger Mann einmal gesagt habe – zu fünfzig Prozent Sex und zu fünfzig Prozent Fehlinterpretation!
„Und Wissenschaft ist auch nur der aktuelle Stand des Irrtums“, meinte Bettina, der es nun langsam reichte.
Er nickte und senkte den Blick, was ihren Unmut stets im Nu verpuffen ließ.
„Unbestritten ist aber, dass eine Adoption ein wohlüberlegter Schritt sein sollte“, stellte er fest.
Sie nickte. Und was glaubst du ist das, was wir gerade tun?
Er kratzte sich am Kopf. Für sie ein untrügliches Zeichen, dass er sich geschlagen gab. Obwohl er das selbst vermutlich gar nicht bemerkte. Sie ergriff die Initiative.
„Und was machen wir nun?“
Wieder dieses Kratzen.
„Wo kann man sich eigentlich über die Formalitäten für eine Adoption informieren?“
An einem sonnigen aber eiskalten Tag im Februar 1964 stellten sie den entsprechenden Antrag.
Da sie beide über einen tadellosen Leumund verfügten und auch im idealen Adoptionsalter und wirtschaftlich gut situiert waren, ging der Antrag nach einer psychologischen Beurteilung durch einen frisch von der Universität unter kräftiger Mithilfe seines Onkels, eines Hofrats, an diesen Beamtenposten geratenen Jüngling unter Beantwortung einiger weniger Standardfragen an die beiden schon im März desselben Jahres durch. Der Knabe hing während der Befragung sowieso eher seinen schlüpfrigen Fantasien nach, die sich um diese heiße Rothaarige vor ihm drehten. Sie hätte ihm sogar sagen können, dass sie vorhatte, mit dem Kind im Kinderwagen einen Banküberfall mit Geiselnahme zu begehen und auf der Flucht einen Psychologen zu erschießen, er hätte höchstens darüber fantasiert, wie es wäre, ihre Geisel zu sein und hätte dann seinen Stempel samt seiner krakeligen Knabenunterschrift auf das Adoptionsdokument gesetzt. Wie Bettina manchmal sagte, wenn sie nach einigen Gläsern Wein auf ihre guten Manieren vergaß: „Schwanzgesteuert und bescheuert.“
*
Die jüngeren Schwestern, allesamt weltlich und keine Ordensfrauen, hielten sich an die Vorschriften der Klinik und hatten stets ihre Latexhandschuhe übergestreift, wenn sie mit den Neugeborenen arbeiteten. Schließlich musste man die kleinen Erdenbürger ja nicht gleich in den ersten Lebensmonaten mit irgendwelchen Keimen in Berührung bringen, auch wenn zur damaligen Zeit Resistenzen auf Antibiotika noch die Ausnahme waren. Zudem verfügen Neugeborene über erstaunliche Abwehrkräfte, vor allem, wenn sie gestillt werden, was bei Felix nicht der Fall war. Der machte schon als Baby Bekanntschaft mit Nahrung aus der Dose. Ob da ein Zusammenhang mit seiner späteren Entwicklung besteht, darf zwar bezweifelt werden, aber was weiß man schon? Irgendein Psychologe wird sicher einmal eine Studie dazu verfassen und feststellen, dass gestillte Babies mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit eher Leberkäsesemmeln statt Salat essen.
Der kleine Felix entwickelte sich trotzdem prächtig. Und heute würde ein adoptionswilliges Ehepaar kommen und ihn sich ansehen. Er lachte Schwester Carina aus seinem Bettchen an, als sie ihm die Windel wechselte. Mit ihrer Haut kam er nicht in Kontakt. Und sie nicht mit seinem Urin, sie kannte die Tricks der Kleinen.
Das Unglück von Schwester Agnes blieb ein trauriger Einzelfall. In der Abteilung war sie bei allen Kolleginnen – männliche Pfleger gab es hier nicht – aufgrund ihrer ruhigen, freundlichen und gewinnenden Art sehr beliebt gewesen. Niemand konnte sich erinnern, von ihr je ein lautes oder gar böses Wort gehört zu haben. Es erwische irgendwie immer die falschen, dachte sich Carina und hatte als potentiell „Richtigen“ den unbeliebten Assistenzarzt an ihrer Seite im Sinn, der es bei jeder jungen Schwester schon mindestens einmal versucht hatte. Vermutlich auch bei einigen älteren. Ziemlich viele ihrer Kolleginnen waren in den letzten Monaten seinem Charme erlegen, wiewohl kaum eine darüber sprach. Kein Wunder, der Typ sah ja auch wirklich umwerfend aus. Groß, blond, sportlich und in seinen blauen Augen loderte es, eine richtige Sahneschnitte aus der Süßigkeitenvitrine mit der Aufschrift „Männer“. Man konnte dieses Feuer in seinen Augen durchaus für Leidenschaft halten, aber sie wusste es mittlerweile besser. Der Typ war eher ein emotionaler Flächenbrand der Zerstörung. Wenn er ein Mädchen gehabt hatte, verlor er sofort das Interesse und ließ es fallen wie eine heiße Kartoffel. Irgendetwas stimmte mit dem Kerl nicht. Definitiv nicht! Scheißtyp! Man sollte ihm einen Tripper anhängen. Wenn man einen hätte. Mal sehen. Wenn sie sich einen fangen würde, dann ... was tut man nicht alles für das Vaterland und die Leidensgenossinnen?
Der Arzt ahnte nichts von Carinas Überlegungen und untersuchte den kleinen Felix.
„Es scheint alles mit ihm in Ordnung zu sein“, meinte er. „Wird einmal ein Prachtbursche, schau dir nur seinen Pimmel an! Der wird noch einige Hasen gegen den Strich bürsten.“
Er nahm den zwar noch sehr kleinen aber im Verhältnis zur Größe des Kindes doch beachtlichen Penis in seine zarten Hände und grinste Carina süffisant an.
„Arschloch“, murmelte sie kaum hörbar, aber er hatte es trotzdem mitbekommen. Bevor er etwas antworten konnte, drehte sie sich um und ging, ohne noch etwas zu sagen.
Sie wusste nicht, dass das Schicksal schon beschlossen hatte, dass sie ihm keinen Tripper anhängen würde. Niemand sollte je dieses zweifelhafte Vergnügen haben. Doktor Flächenbrand würde ohne Tripper und auch ohne irgendeine andere, sexuell übertragbare Krankheit durchs Leben kommen.
Allerdings nicht sehr weit.
*
Bettina und Helmut Hofer waren an diesem sonnigen Märztag überpünktlich in der Klinik eingetroffen. Zwar gab es in der Umgebung der Klinik in Linz genügend Parkplätze, aber es war ein wichtiger Tag in ihrem Leben, da riskiert man besser nicht, zu spät zu kommen.
Bettina hatte sich genau wie Helmut heute Urlaub genommen. Die Redaktion der Zeitung würde schon einmal ohne sie auskommen, und auch Helmuts Bank in der gleichen oberösterreichischen Kleinstadt musste das an diesem Tag wohl oder übel. Ja, Mädels aus der besseren Gesellschaft, heute müsst ihr euch an einen anderen Mann wenden, wenn ihr euch einen Korb holen wollt! Helmut hatte ihr in einem schwachen Moment einmal von diesen „Schabracken“ erzählt, und wie sie ihm nachstellten – und sich gewundert, dass Bettina es nicht so lustig fand wie er.
„Egal, wie alt diese Hyänen sind“, hatte sie damals gesagt, „Es sind Frauen. Und bei anderen Weibern ist jede Frau absolut humorlos.“
Als sie sein entsetztes Gesicht gesehen hatte, hatte sie gelacht.
„Wenn ich dich mit einer erwische, werfe ich deine Eier Tinker Bell zum Fraß vor.“, fügte sie hinzu und griff zur Bestätigung etwas fester als sonst zwischen seine Beine.
Helmut hatte kurz aufgestöhnt und dann ihr Lachen erwidert. Und trotzdem war er sich nicht sicher, wie ernst sie das gemeint hatte.
Der Portier hatte ihnen erklärt, wie sie gehen müssten, um die Neugeborenenabteilung der Kinderklinik zu finden. Es klang nicht sonderlich kompliziert, aber sie verliefen sich dennoch und fragten eine Schwester, die gerade einen Servierwagen an ihnen vorbeischob, indem wohl das immer kalte und immer gleich grässlich schmeckende Krankenhausessen auf den immer gleich aussehenden Tabletts steckte. Die sehr liebenswürdige Schwester brachte sie persönlich zur richtigen Stelle im Haus. Sie wären nicht die ersten, die sich hier verlaufen hätten, erklärte sie ihnen, und nein, keine große Sache, das Essen komme schon noch bald genug auf die Station. Kälter könne es sowieso nicht mehr werden, hahaha!
Kein Mensch versteht, nach welchen Gesichtspunkten Architekten Krankenhäuser planen. Vielleicht steckt eine Absicht dahinter, oder aber, weil Krankenhäuser meist öffentliche Bauten sind, werden bei den Planungswettbewerben nur optische und keine praktischen Gesichtspunkte beurteilt. Wogegen aber wiederum spricht, dass solche Gebäude zu allem Überfluss meist auch noch ziemlich hässlich sind. Architekten sind irgendwie die Folterknechte der Moderne, sie geißeln uns mit verwinkelten, lichtlosen Labyrinthen und nageln uns ans Betonkreuz der Postmoderne, dachte Bettina, als sie durch die kahlen Gänge liefen.
Da waren sie also nun, zwei selbstsichere, erfolgreiche Menschen Anfang dreißig, aufgeregt wie Teenager vor dem ersten Schulball. Sie ahnten, dass sich heute ihr Leben grundlegend ändern würde.
Was sie nicht wussten war, wie richtig sie mit dieser Vermutung lagen.
*
Doktor Flächenbrand hatte einen langen, anstrengenden Dienst hinter sich, als er am Abend desselben Tages aus der Klinik in die stürmische Kälte des Märzabends trat. Die Sonne hatte sich verzogen, an ihrer Stelle war eine Kaltfront angerückt. Richtiges Sauwetter. Kein Mensch braucht diesen eisigen Märzwind, dachte er, vor allem, wenn man sowieso schon hundemüde ist. Assistenzärzte gingen niemals schon nach zwölf Stunden Dienst nach Hause. Zwei oder drei aufeinanderfolgende Räder, wie sie einen Zwölfstundendienst nannten, waren keine Seltenheit, ebenso wenig wie eine Wochenarbeitszeit von sechzig bis achtzig Stunden, das Schwesternvögeln in einem leeren Untersuchungszimmer bereits mit eingerechnet. Da hatte ein Spital oder eine Klinik deutliche Vorteile, Besenkammern sind etwas für Tennisprofis, Schreibtische etwas für Bänker, Ärzte haben Betten oder zumindest Untersuchungsliegen zur Verfügung.
Dafür könnte er in einigen Jahren Oberarzt sein und sich dann neben seiner Tätigkeit in der Klinik langsam eine Praxis als Kinderarzt aufbauen. Mit einem feinen Sechsstundentag, drei-, maximal viermal die Woche, und einem ansprechenden Verdienst, der ihm einen Lebenswandel ermöglichen sollte, wie er ihm seinem Selbstverständnis nach zustand. In einigen Jahren, einen Kassenvertrag vorausgesetzt, hätte er es dann geschafft, dachte der junge Arzt weiter. Ein Seegrundstück im Salzkammergut, vielleicht am Attersee, wäre nett, mit einem kleinen Segelboot eventuell? Und eine Mitgliedschaft in einem elitären Golfclub. Noch konnte man in Österreich als Facharzt gut leben, und genau das hatte er vor.
Davor würde er aber noch einige Jahre als Assistenzarzt schuften müssen. Sei’s drum, das war auszuhalten. Es gab ja genug junge Schwestern und genug leere Untersuchungszimmer. Vor allem nachts.
Bei diesen Gedanken musste er seine Haube festhalten, der Wind war jetzt wirklich stürmisch, und gerade eben mischte sich auch noch Eisregen dazu, der schon nach ein paar Schritten wie tausend kleine Nadelstiche auf seinen Wangen brannte.
Er zog sich die Haube tief ins Gesicht, um sich davor zu schützen.
*
Der Fahrer des Autobusses der Linie vier hatte ebenfalls einen langen Arbeitstag gehabt und fuhr gerade in die Busgarage zurück. Seine Lebensplanung unterschied sich von der des Arztes in einigen wesentlichen Details.
Walter war 38 und baute mit seiner um einige Jahre jüngeren Frau, die halbtags im Krankenhaus putzte, seit Jahren an ihrer beider kleinem Einfamilienhaus. Wenn alles gut lief, würden sie nächstes Jahr einziehen, dann endlich Kinder bekommen, und das Haus vielleicht schon mit fünfundfünfzig abbezahlt haben, so hatte er sich das zumindest ausgerechnet. Jedenfalls, wenn die Zinsen nicht weiter stiegen. Walter war zwar „nur Busfahrer“, wie er immer bescheiden sagte, wenn man ihn nach seinem Beruf fragte, aber das Rechnen hatte er schon immer ziemlich gut gekonnt.
Als er den einsetzenden Eisregen bemerkte, reduzierte er sein Tempo. Es war kein Fahrplan mehr einzuhalten, und ob er ein paar Minuten früher oder später in der Remise eintrudelte, war gleichgültig. Nur nichts riskieren. Er brauchte diesen Job.
Er dachte darüber nach, welches Angebot für die Fenster sie nehmen sollten. Gar keine leichte Entscheidung, es gab einige Angebote, die zudem aufgrund der technischen Unterschiede schwer zu vergleichen waren. Vermutlich würden sie sich für diese neuartigen Kunststofffenster entscheiden, etwas für die Ewigkeit, hatte der Vertreter gesagt. Da stand quasi für einen Eisregen wie heute aufgedruckt: Ich muss draußen bleiben! Eigentlich ein guter Werbeslogan, dachte er. Vielleicht habe ich den falschen Beruf.
Man konnte zwar nicht sagen, dass er abgelenkt war, und eine Untersuchung des Unfalls hatte später die Erkenntnis zur Folge, dass er ihn nicht hätte vermeiden können und auch definitiv nicht zu schnell unterwegs gewesen war (nicht einmal für diese eisigen Verhältnisse), aber das letzte Quäntchen Aufmerksamkeit für den Verkehr und die Straße ließ er vermissen.
Und auch wenn Walter, der sein ganzes Leben lang nie jemandem etwas zuleide getan hatte, laut Befund des Gutachters keine Schuld an diesem Unfall trug: Er selbst wusste es besser.
Es würde ihn sein gesamtes Leben lang verfolgen, speziell wenn er einmal die Muße hatte, zuhause nach einem langen Arbeitstag bei einem Glühwein durch sein wetterabweisendes Kunststofffenster in eine stürmische Spätwinternacht zu blicken.
Bei solchen Gelegenheiten bat er dann stets Gott darum, einmal die Gelegenheit zu bekommen, diese Schuld zurückzahlen zu können.
*
Der Assistenzarzt, den Schwester Carina insgeheim als Doktor Flächenbrand bezeichnete, hieß mit seinem bürgerlichen Namen Doktor Siegfried Perthaner und hinterließ außer seinen trauernden Eltern keine nahen Verwandten, als er müde und in Gedanken versunken auf die Straße trat, ohne auf den nahenden Autobus zu achten, den er aufgrund des Sturmes nicht einmal kommen hörte.
Es quietschten keine Reifen, als der Busfahrer Sekundenbruchteile zu spät auf die Bremse trat, weil diese auf dem mittlerweile leicht vereisten Asphalt beim Blockieren kaum ein Geräusch verursachten. Walter wollte noch hupen, aber seine Hand verfehlte die im Lenkrad integrierte Folgetonhupe, sodass sich alles in gespenstischer Lautlosigkeit abspielte. Ganz langsam hinten ausbrechend glitt das tonnenschwere Fahrzeug auf den Arzt zu, der es aufgrund der tief ins Gesicht gezogenen Haube so lange nicht kommen sah, bis es eindeutig zu spät war. Er hatte nicht einmal mehr eine Gelegenheit, „Scheiße!“ zu sagen, ja, nicht einmal mehr dazu, diesen Fluch zu denken.
Der Aufprall tötete ihn zwar nicht sofort, sondern riss ihm zuerst den rechten Arm ab, als dieser zwischen den Bus und eine Straßenlaterne geriet, schleuderte ihn dann gegen den Laternenpfahl und brach ihm beim Aufprall einige Rippen. Der Laternenpfahl weigerte sich stur nachzugeben, zertrümmerte ihm stattdessen die Schädelbasis und behielt das halbe Gesicht zurück, das in der Folge langsam am Metallpfeiler nach unten glitt, wobei es auf eine skurrile Art so aussah, als würde es lächeln. Doktor Flächenbrand starb kurz bevor wenige Minuten später der Notarzt eintraf, was ihm ein Leben als Harvey Twoface wie in den Batmancomics, die er so gerne las, ersparte. Wer später das mittlerweile angefrorene Gesicht vom Laternenpfahl entfernte, wissen wir nicht. Siegfried war das zu diesem Zeitpunkt wohl auch gleichgültig.
Auf der Kinderabteilung war man geschockt, als man am nächsten Tag in der Kaffeküche bei Tee, Kaffee und Kuchen darüber sprach, aber es ist nicht verbürgt, dass jemand geweint haben soll. Carina jedenfalls vergoss keine Träne.
Das Seegrundstück im Salzkammergut, welches vielleicht der dann gut situierte Kinderarzt Doktor Perthaner gekauft haben würde, erwarb später ein betuchter Anwalt aus Vöcklabruck. Vielleicht hat dieser auch die Frau geheiratet, die für den Arzt bestimmt gewesen wäre. Glück brachte sie ihm keines, eine Geschichte, die man an anderer Stelle erzählen kann.
*
Es war Liebe auf den ersten Blick. Die Hofers sahen den Kleinen, er lachte sie an – finito! Alles geklärt! Hallo Sohn! Der Rest war ein Papierkrieg mit der Bürokratie, der in der damaligen Zeit aber noch überschaubar und vor allem ohne Hinzuziehen eines Anwalts zu bewältigen war.
Ein paar Tage später übergab eine geistliche Schwester den Kleinen seinen neuen Eltern. Für diese Übergabe verzichtete sie auf die Latexhandschuhe. Das hätte irgendwie eigenartig ausgesehen, fand sie.
Schwester Susanne war eine der wenigen jungen Nonnen in der Klinik. In den Sechzigern war es um den Nachwuchs bei den Bräuten Christi schlecht bestellt gewesen. Die Roaring Sixties, die freie Sexualität und der Aufschwung nach den schweren Fünfzigerjahren hatten auch hier die Zukunftsperspektiven allzu sehr in Richtung Konsumgesellschaft verschoben. Daran konnte auch ein in Aussicht gestellter „Direkt ins Paradies, gehe nicht über Fegefeuer“-Bonus für Nonnen nichts ändern.
Susanne war das alles nie wichtig gewesen. Ihre Lebensplanung sah anders aus. Sie war vom Scheitel des kurz geschnittenen Haars bis zur Sohle der klobigen Schuhe ein herzensguter Mensch. Sie pflegte mit ihrem sonnigen Gemüt alles mit Humor zu nehmen, half, wo sie konnte, und so war es irgendwie für ihre Eltern auch keine große Überraschung, als sie mit siebzehn Jahren in den Konvent der Franziskanerinnen eintrat. Der Vater murmelte etwas von „Verschwendung“ und „so ein hübsches Mädel wie du bist“, aber sein Widerstand war von Anfang an halbherzig. Was sollte man als Mann auch gegen einen Gott ausrichten, wenn man schon gegen die eigene Frau regelmäßig den Kürzeren zog?
Auf dem Heimweg von der Klinik in ihr Kloster, an dem Tag, an dem sie den Hofers ihren Felix übergeben hatte, wurde Schwester Susanne dann von zwei betrunkenen jungen Kerlen, die gerade eine ziemlich unbefriedigende und erfolglose „Aufrisstour“ durch mehrere Bars hinter sich gebracht hatten, überfallen und in der beißenden Märzkälte vergewaltigt. Ohne großes Vorspiel, ohne viele Worte. Vergewaltiger führen solche kunstvollen Dialoge nur in Hollywoodfilmen, in der Realität packen sie das Opfer einfach und traumatisieren es in wenigen Minuten für dessen ganzes restliches Leben. Das würde ihr sicher eine Menge Gutpunkte am Fegefeuervermeidungskonto bringen, aber daran dachte Susanne in diesen Momenten nicht. Auch nicht, dass Waltraud dazu wohl gesagt hätte, das unterbiete jeden Autorücksitz noch um Längen!
Einer der beiden hatte pikanterweise ein Kreuz am Oberarm eintätowiert, ein gutes, altes Häfenpeckerl, wie man in Österreich dazu sagt, was schnell zur Ausforschung der Täter führte. Susanne überlebte schwer verletzt. Aber sie überlebte.
Als sie einigermaßen genesen war, besuchte sie die beiden Attentäter im Gefängnis und sagte ihnen, dass sie ihnen verziehen hätte. Das war die erste Lüge, an die sie sich in ihrem Leben erinnern konnte. Aber zumindest eine gute, fand sie, was die Frage aufwirft, ob man für einen guten Zweck lügen dürfe?
Sie entschied sich für ein „Nein“ und ging am nächsten Tag zur Beichte.
*
Bei all diesen Vorkommnissen stellte niemand eine Verbindung zu Felix her.
Mal ehrlich: Warum auch?
3
April 1964
Felix war seit gestern in seinem neuen Zuhause. Die Hofers waren vor einer Woche in einen kleinen Ort in der Nähe von Wels gezogen. Sie hatten sich dort ein Einfamilienhaus gekauft, das die Vorbesitzer veräußern mussten, als ihre Ehe nach einigen Jahren in die Brüche gegangen war. Der Klassiker: Sie geht fremd, er kommt drauf, kann ihr aber nichts beweisen, er geht auch fremd, sie lässt sich scheiden, Gütertrennung, Haus verkaufen.
Es war perfekt für sie – nicht zu groß aber geräumig genug für eine kleine Familie. Außer der Küche und den Nassräumen war noch nichts eingerichtet, was aber den beiden durchaus gelegen kam, weil sie es nun so möblieren konnten, wie sie wollten.
Das Schönste an diesem Haus war jedoch die Lage. Und der Garten. Es war an einen flachen Hang gebaut, dessen eine Seite, günstigerweise die Nordseite, an einen Mischwald grenzte, während sie in alle anderen Richtungen freies Blickfeld hatten. Da das Grundstück ziemlich groß war, würde ihnen auch nicht so schnell jemand ein Haus vor die Nase setzen können. „Eigentum ist der beste Schutz vor Nachbarschaft“, hatte Bettinas Vater immer gesagt, und er hatte damit absolut Recht, dachte sie.
Dass der Garten aufgrund der Hanglage in Terrassen angelegt war, verlieh dem Haus irgendwie einen noblen Touch, fanden die beiden. Und die Zufahrtsstraße war zwar nicht geteert, aber dafür endete sie an ihrem Haus, weswegen sie nur von Fahrzeugen befahren wurde, die zu ihnen wollten oder die sie verließen. Der nächste Nachbar war einige hundert Meter entfernt, sodass sich niemand über Tinker Bells Gebell beschweren müsste.