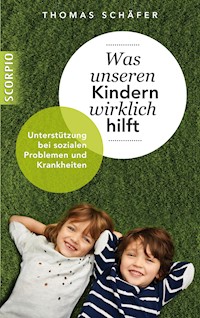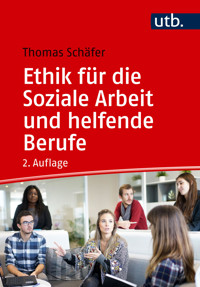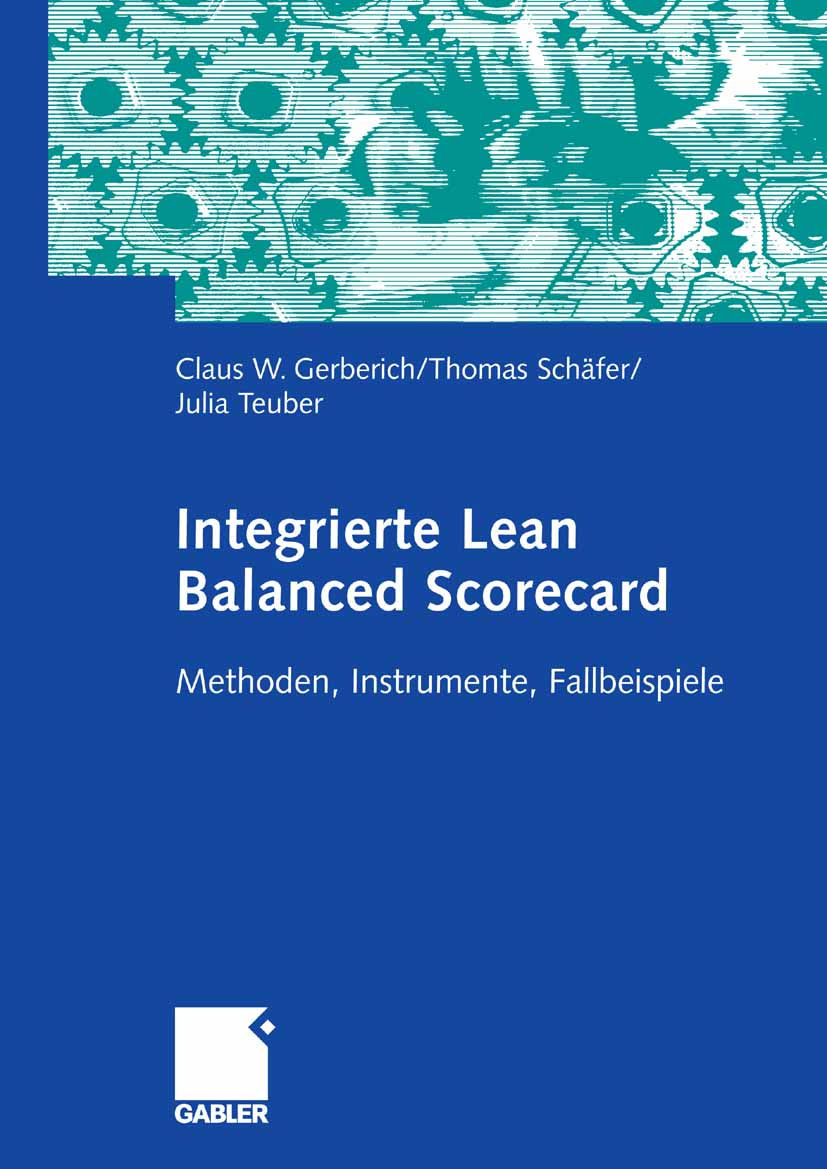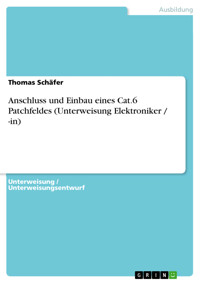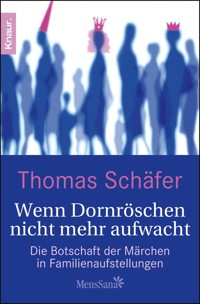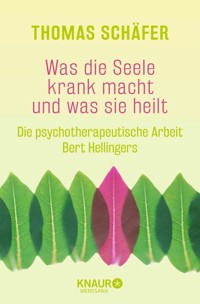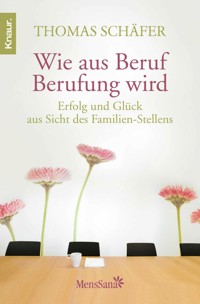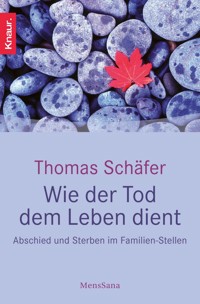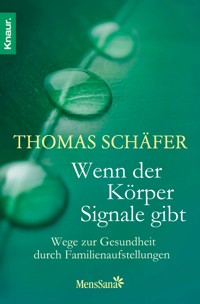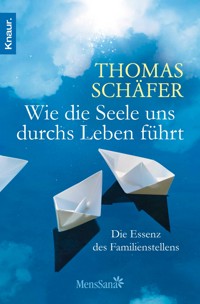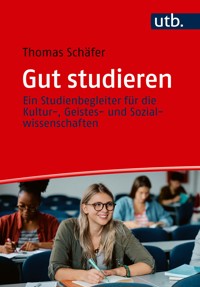
20,99 €
Mehr erfahren.
Wie gelingt das Studium? Das Buch bietet eine umfassende Einführung in „gutes“ Studieren und das Verständnis von Wissen und Wissenschaft. Es lehrt kritisches Denken und betrachtet die ethischen und sozialen Aspekte der Wissenschaft. Der Autor vereint philosophische und psychologische Werkzeuge, um Souveränität im Umgang mit diversen Studienanforderungen zu schaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Was macht ein gutes Studium aus und was kann ich dafür lernen? Das Buch bietet eine umfassende Einführung in „gutes“ Studieren und das Verständnis von Wissen und Wissenschaft. Es fördert kritisches Denken und betrachtet die ethischen und sozialen Aspekte der Wissenschaft. Der Autor vereint philosophische und psychologische Werkzeuge, um Mut zu machen und Souveränität im Umgang mit diversen Studienanforderungen zu schaffen.
Dies ist ein utb-Band aus dem Verlag Barbara Budrich. utb ist eine Kooperation von Verlagen mit einem gemeinsamen Ziel: Lehr- und Lernmedien für das erfolgreiche Studium zu veröffentlichen.
QR-Code für mehr Infos und Bewertungen zu diesem Titel
utb 6226
utb.
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Thomas Schäfer
Gut studieren
Ein Studienbegleiter für die Kultur-, Geistes- und Sozialwissenschaften
Verlag Barbara Budrich Opladen & Toronto 2024
Der Autor:
Dr. Thomas Schäfer, Akademischer Mitarbeiter und Lehrbeauftragter für Ethik, Philosophie und Propädeutik an der Alice Salomon Hochschule Berlin und der Hochschule Fulda
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier, CO2-kompensierte Produktion Printed in Germany
Alle Rechte vorbehalten.
© 2024 Verlag Barbara Budrich GmbH, Opladen & Toronto www.budrich.de
utb-Bandnr.6226
utb-ISBN978-3-8252-6226-6
utb-e-ISBN978-3-8385-6226-1 (PDF)
utb-e-ISBN978-3-8463-6226-6 (EPUB)
DOI10.36198/9783838562261
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Online-Angebote oder elektronische Ausgaben sind erhältlich unter www.utb-shop.de.
Druck: Elanders Waiblingen GmbH, Waiblingen Satz: Linda Kutzki, Berlin – www.textsalz.deUmschlaggestaltung: siegel konzeption | gestaltung
[5] Vorwort
1. Das Buch richtet sich an Lehrende und Studierende
– im Bereich der Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften, incl. entsprechender Studiengänge an Hochschulen
– für die Arbeit in Seminar und Vorlesung sowie auch für das Selbststudium (deshalb die direkte Ansprache der Studierenden im Text)
– als Studienanfänger_innen und Fortgeschrittene
– zur Anregung bei der Lehrplanung
– mit Interesse an philosophischen und psychologischen Impulsen für Studium und Lehre
2. Sie erhalten Anregungen und Einsichten zu folgenden Aspekten des Studiums
– Guter Einstieg ins Studium
– Sicherheit und Souveränität im Umgang mit diversen Studienanforderungen
– Interesse und Motivation gegenüber Wissen und wissenschaftlichem Denken
– Selbstständigkeit und Eigensinn beim Lernen und Studieren
– Klarheit und Genauigkeit im eigenen Denken
– Kritische Einstellungen gegenüber Gedanken, Theorien und Weltbildern
– Gute Haltungen und Einstellungen bei Argumentation und Diskussion
– Praktische Anleitungen für gelingende Studienarbeiten
– Umgang mit sich selbst, eigenen Problemen und schwierigen Studiensituationen
[6] Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung: Warum und wozu dieses Buch?
I Gut ins Studium hineinfinden
1 Was heißt „gut Studieren“?
2 Erfahrungen von Studierenden am Studienbeginn – Probleme, Reflexionen und Lösungsperspektiven
2.1 „Aber nun sitze ich in den Seminaren und verstehe nichts“
2.2 „Und bereits nach wenigen Minuten des Studiums begannen die ersten Selbstzweifel“
2.3 „Ich neige dazu, mir viel zu viele Gedanken um Sachen zu machen“
2.4 Positive Perspektiven und Lösungen
3 Achtsam lernen – mit Anfängergeist, Kreativität und Selbstmitgefühl
3.1 Anfängergeist
3.2 Kreativität
3.3 Selbstmitgefühl
II Wissen und Wissenschaft – erste Zugänge
4 Was bedeuten „Wissen“ und „Wissenschaft“?
4.1 Was ist „Wissen“?
4.2 Was ist „Wissenschaft“?
4.3 Formen des Wissens und der Wissenschaft
4.4 Wozu brauchen wir Wissenschaft?
5 Wissenschaftliches Arbeiten und Studieren – einige wichtige Aspekte
5.1 Richtiges Definieren
[7] 5.2 Wer sagt was? Eigene und fremde Gedanken in Texten
5.3 Begründen und Erklären
5.4 Kritische Analyse von Begriffen und Gedanken
5.5 Die Anführungsstriche „ …“ – wo gehören sie hin und warum?
5.6 Gutes Präsentieren
III Grenzen und Kritik des Wissens und der Wissenschaft
6 Wissen und Skepsis. Wichtige Regeln beim Prüfen von Behauptungen
6.1 Eine kritische Grundhaltung
6.2 Außergewöhnliche Behauptungen verlangen außergewöhnliche Beweise
6.3 Vorsicht bei „Allaussagen“
6.4 Unterscheide Allaussagen und Existenzaussagen
6.5 Die Beweispflicht liegt beim Behauptenden
6.6 Trenne zwischen Behauptung und Erklärung
6.7 Verknüpfe nicht vorschnell Interessen, Motive und Tatsachen
6.8 Verwechsele nicht „Korrelation“ und „Kausalität“
7 Kritischer Umgang mit wissenschaftlichem Wissen und Denken
7.1 Problematische Studien
7.2 Problematische Gedankengänge
7.2.1 Beispiel 1: Neurobiologie und menschliche Freiheit
7.2.2 Beispiel 2: Evolutionsbiologie und Genderfragen
7.3 Ein positives Beispiel: Reflektierte Wissenschaft
8 Was ist Kritik?
8.1 Kritik im Alltag
8.2 Kritik in der Wissenschaft
8.2.1 Kritik an menschlichen Lebensverhältnissen
8.2.2 Kritik an Denkweisen
8.2.3 Kritik am Bewusstsein von Menschen
8.2.4 Kritik von innen und von außen
8.2.5 Schritte der Kritik
9 „Diskurse“, „Mythen“, „Narrative“ und die Wissenschaft
9.1 „Diskurs“
9.2 „Mythos“
9.3 „Narrativ“
[8] IV Gute Haltungen beim Studieren
10 Mündiger Umgang mit Wissen und Wissenschaft
11 Erkenntnis und Wissen durch Achtsamkeit
11.1 Was heißt „Achtsamkeit“?
11.2 Von der achtsamen Wahrnehmung zum achtsamen Erkennen
11.3 Ein Fallbeispiel
12 Reflexion, Selbstreflexion und Wissen
12.1 Was ist Reflexion? Wie wird sie zu Erkenntnis und Wissen?
12.2 Reflexion als gedanklich-philosophische Hinterfragung
V Logisches Denken und Argumentieren
13 Logik – nicht trocken, sondern spannend, wichtig und hilfreich
13.1 Ein Logik-Rätsel
13.2 Rationale Logik und Psycho-Logik
13.3 Logik in der Wissenschaft
13.4 Logisches Argumentieren: Überzeugen und Überreden
13.4.1 Überzeugen – wie funktioniert das?
13.4.2 Überreden – mit der Macht im Bunde?
13.4.3 Das „Argument an die Person“ – kurzschlüssig und problematisch
14 Meinungen besitzen und Behauptungen aufstellen – was wir meinen und was wir nicht meinen
14.1 „Ich finde, dass…“ oder „Es ist so“ – Subjektivität oder Objektivität?
14.2 Konfusionen und ihre Auflösung
VI Menschliches und Zwischenmenschliches
15 Umgang mit Stress und Zeit
15.1 Stress verstehen
15.2 Zwei verschiedene Sichtweisen
15.3 Analysen und Ratschläge
15.3.1 Eigene Muster erkennen und verändern
15.3.2 Nicht Bewerten
15.3.3 Geduld mit sich üben, sich akzeptieren
[9] 15.4 Die Zeit gut managen
15.4.1 Fehlplanungen
15.4.2 „Prokrastination“
16 Gute Kommunikation und konstruktives Diskutieren
16.1 Widersprüche im Argumentieren und Diskutieren
16.2 Hilfreiche Regeln für gelingende Diskussionen
16.3 Gewaltfreie Kommunikation
VII Kontexte der Wissenschaft
17 Wissenschaft, Werte und Normen
17.1 Beschreibungen, Wertungen und Normen
17.2 Begründungen, Belege und Beweise
17.2.1 Begründungen für beschreibende Behauptungen
17.2.2 Begründungen für normative Behauptungen
18 Wissen, Wissenschaft und Macht
18.1 Die Macht des Wissens
18.2 Macht in der Wissenschaft
19 Wissen und Weisheit
19.1 Zusammenhänge von Wissen und Weisheit
19.2 Die Weisheit über dem Wissen und der Erkenntnis?
Literatur
[10] Einleitung: Warum und wozu dieses Buch?
Das vorliegende Buch wendet sich an Menschen im Studium, aber durchaus auch in ihrem Leben ganz allgemein. Es richtet sich an Menschen, die – in einem noch zu klärenden Sinne – „gut studieren“ und dabei auch ein gutes Leben führen wollen. An beides ist hier gleichermaßen gedacht, denn man kann wohl feststellen:
Das Studium findet immer mitten im Leben von Menschen statt und es gelingt vor allem dann gut, wenn uns das umfassendere – unser Leben – gut gelingt.
Ein wichtiger Teil des Studiums, sei es an Universitäten oder an Hochschulen, besteht in dem Anspruch, dass die Studierenden „wissenschaftliches Arbeiten“ erlernen sollen. Häufig wird darunter verstanden, dass man lernt, mit wissenschaftlichen Texten angemessen umzugehen, dass man formale Techniken, wie das korrekte Zitieren, beherrscht etc. Die Veranstaltung, in dem speziell dies gelernt werden soll, nennt sich in der Regel „Propädeutik“ oder „Wissenschaftliches Arbeiten“. Studierende erleben es häufig als „trocken“ und mehr oder weniger „langweilig“, und vielleicht haben Sie diese Erfahrung ja auch schon gemacht.
Dies muss aber nicht so sein. Es gibt Aspekte des Umgangs mit Wissenschaft, die wichtig und spannend sind und die zu studieren sich nicht nur lohnt, sondern auch mit viel Freude betrieben werden kann. Das ist jedenfalls die Behauptung und der Anspruch des vorliegenden Studienbegleiters. Auch Studierende erleben und erkennen dies immer wieder, was sich stellvertretend für viele ähnliche Feststellungen in der folgenden Passage aus einem Lerntagebuch ausdrückt:
„Mich wissenschaftlich mit einem Thema auseinanderzusetzen, lässt mich klarer denken, wenn ich viele Gedanken und Gefühle auf einmal habe. Wissenschaftliches Arbeiten hat mir geholfen, mich emotional etwas abzugrenzen und wertfreier zu arbeiten. Wissenschaft gibt mir und meiner Arbeit einen Rahmen und klarere Grenzen, wodurch ich mich innerlich freier fühle.“
(Studierende_r M. W.1)
Die Inhalte der folgenden Kapitel wurden in zahlreichen Seminaren erprobt. Die vielen positiven Feedbacks von Student_innen geben Grund zu der Hoffnung, dass auch [11] Sie als Leser_in dem Text Interesse, gute Einsichten und möglichst viel Freude abgewinnen können.
Das vorliegende Buch möchte Sie also auf das Studium vorbereiten bzw. die Studienzeit begleiten, und zwar vor allem dadurch, dass es einige für das gute Studieren wichtige Haltungen oder Tugenden zu fördern versucht, wie etwa:
– Neugier und Interesse gegenüber Wissen und wissenschaftlichem Denken
– Selbstständigkeit und Eigensinn beim Lernen und Studieren
– Sicherheit und Souveränität im Umgang mit den diversen Studienanforderungen
– Klarheit und Genauigkeit im eigenen Denken
– kritische Einstellungen gegenüber Gedanken, Theorien und Weltbildern
– eine offene, faire und menschenfreundliche Diskussionshaltung
– einen freien Umgang mit sich selbst, eigenen Problemen und der Studiensituation
Bemerkung: Eingrenzungen
Es soll gleich zu Beginn festgestellt werden, dass die einzelnen, z. T. sehr großen Themen – etwa „Wissen“ oder „Wissenschaft“ – in den folgenden Kapiteln natürlich nur in einem ersten Ansatz behandelt werden können. Denn das Buch soll einerseits ja nur einführen, hinführen und begleiten bei dem, was Studierenden im Studium begegnet, andererseits soll es einige ausgewählte wichtige Anregungen und Hilfestellungen beim Studieren geben.
[12] I Gut ins Studium hineinfinden
1 Was heißt „gut Studieren“?
Gutes Studieren besteht nicht nur (und vielleicht sogar weniger) darin, wissenschaftlich-handwerklich gut arbeiten zu können, sondern auch darin, als ganzer Mensch gut im Studium zurecht zu kommen und bestehen zu können. Wem nützt es, so könnte man fragen, wenn jemand eine handwerklich-technisch gelungene Arbeit verfasst hat, dabei aber unkreativ, geistig unselbständig und womöglich von Ängsten verfolgt war? Was braucht es also, damit die Lernprozesse im Studium bestmöglich gelingen?
Ein gutes Studium wird in diesem Buch dementsprechend als eine bestimmte Art der Persönlichkeitsbildung gesehen, als die Entwicklung mentaler Stärke, die das Studieren zu einer interessanten und fröhlichen Herausforderung macht. Deshalb ist die Hoffnung dieses Buches, dass es ihm gelingt, zu einer solchen Art „studentischer Persönlichkeit“ beizutragen; das bedeutet, dass Studierende im besten Falle und soweit möglich
– gut in sich selbst ruhen,
– geistig unabhängig sind und autonom denken,
– umsichtig und gewissenhaft mit Wissen, Gedanken und Theorien umgehen,
– zu offenem und freiem Nachdenken und Diskutieren in der Lage sind,
– gelassen, emotional ausgeglichen und stabil sind,
– die Verantwortung für sich selbst zu tragen vermögen und zu sich stehen können,
– selbstsicher und selbstbejahend sind,
– sich mit den eigenen „Stärken“ und „Schwächen“ akzeptieren können,
auf das eigene Urteil über sich und die Welt vertrauen können und sich nicht zu sehr an das der anderen binden,
sich keinen Ideologien anschließen, die nicht in Übereinstimmung mit der wohlverstandenen eigenen Persönlichkeit und den eigenen Einsichten stehen.
Damit sind die wichtigsten Eigenschaften, Qualitäten bzw. Haltungen benannt, die in den diversen Kapiteln des Textes durch konkrete Anregungen, Überlegungen, Gedankenspiele, Fragestellungen etc. gefördert werden sollen. Sie mögen Ihnen zu Quellen der Inspiration für das Studium wie auch für das Leben insgesamt werden. Dann wären das wichtigste Anliegen sowie der Sinn dieses Buches erfüllt.
[13] 2 Erfahrungen von Studierenden am Studienbeginn – Probleme, Reflexionen und Lösungsperspektiven
Dieses Kapitel richtet sich vor allem, wenn auch nicht nur, an Studienanfänger_innen. Es enthält eine Sammlung von – anonymisierten – Erfahrungsberichten Studierender am Anfang ihres Studiums, die im Rahmen von Lerntagebüchern formuliert wurden. Thematisch handelt es sich vor allem um Problemsituationen, die den Betreffenden in bestimmter Weise zu schaffen gemacht haben. Vielleicht können Sie sich darin wiedererkennen. Die Kommentare zu den jeweiligen Darstellungen sollen Ihnen einerseits die Kontexte dieser Erfahrungen näher erläutern und andererseits Lösungsperspektiven aufzeigen.
2.1 „Aber nun sitze ich in den Seminaren und verstehe nichts“
Nach den ersten Wochen hatte ich ein ziemliches Tief. Jetzt hatte ich endlich mal was gewagt und bin meinem Traum gefolgt, aber nun sitze ich in den Seminaren und verstehe nichts. Ich war deprimiert. Doch meine Kommilitonen haben mich aufgebaut, denn vielen ging es wohl so wie mir. Das hilft einem schon, wenn man weiß, dass man nicht alleine die Probleme hat. Nur, auch wenn die anderen mir von ihren Problemen erzählten, fühlte ich mich so, als ob es bei mir trotzdem schwieriger war. Meine Kommilitonen konnten in den Seminaren Beiträge leisten. Doch ich, ich traute mich nichts zu sagen oder etwas zum Seminar beizutragen. Wenn ich in den Seminaren was vortragen musste, fing ich an zu stottern und erzählte nur Mist. Also sagte ich noch weniger im Seminar, was natürlich unproduktiv war, denn je mehr man mitarbeitet, umso mehr könnte man auch lernen.
(Studierende_r L. F.)
Kommentar
Die hier geschilderte Erfahrung hat mehrere wichtige Aspekte:
1. Der Eindruck, in der Sache nicht mitzukommen
2. Der Trost, dass es anderen ähnlich geht
3. Befangenheit und Schüchternheit
4. Der Sinn von Mitarbeit in Seminaren
Zu 1.: Es ist wohl tatsächlich eine häufige Erfahrung, dass man in Veranstaltungen und insbesondere in Diskussionen „nicht mitkommt“. Hier sollten Sie das Problem nicht vorschnell bei sich selbst suchen. Denn oft sind Vorträge oder Diskussionen von Unklarheiten, Konfusionen, aber auch „Bluff“ geprägt. Leider ist die Welt der Sprache immer wieder von Unklarheiten und Ungereimtheiten durchzogen, sodass das Verstehen ganz objektiv erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht wird. Es liegt dann also [14] keineswegs nur an Ihnen, auch wenn viele – vor allem als Studienanfänger_innen – die Unzulänglichkeiten gern bei sich selbst suchen.
Zudem wollen einige Studierende, aber auch Lehrende offenbar häufiger dadurch beeindrucken, dass sie Fachbegriffe oder Fremdwörter benutzen, um sich damit hervorzutun. Schon das Wissen darum hilft Ihnen vielleicht und kann Sie hoffentlich etwas beruhigen. Zu dieser Thematik aufschlussreich ist das Buch „Uni-Angst und Uni- Bluff“ von Wolf Wagner (1992), das Sie hier mit Gewinn zu Rate ziehen könnten.
Andererseits gibt es Situationen, in denen wir etwas tatsächlich nicht verstehen, nicht mitkommen etc. Auch hier können Sie sich durch den Gedanken beruhigen, dass dies nur allzu normal und unvermeidbar ist, und dass sich dies in aller Regel mit der Zeit und dem eigenen Erkenntniszuwachs ändert. Deshalb sind vorschnelle Zweifel am Studium nicht sinnvoll, schon gar nicht Selbstzweifel, wie Sie sie in einem späteren Zitat noch finden werden. Erst, wenn sich die Situation auf Dauer nicht ändert, können Sie sich immer noch fragen, ob ihr Studium wirklich das Richtige für Sie ist. Aber bis dahin gilt wohl: Nehmen Sie die Situation zunächst so an, wie sie ist, und bewerten Sie diese und sich selbst nicht, und vor allem nicht vorschnell!
Zu 2.: Der Trost, dass es anderen ähnlich geht, ist eine zweischneidige Sache. Denn das Gefühl, mit etwas nicht allein zu sein, hilft psychologisch gesehen zwar sehr, aber in der Sache – dem Verstehenwollen – hilft es keineswegs. Denn Sie wollen doch etwas von der Welt verstehen und erkennen, und da nützt es letztlich nicht viel, dass andere dabei auch Schwierigkeiten haben.
Im Übrigen ist das darin enthaltene Sich-Vergleichen höchst problematisch und kann sogar als ein Unglücks-Prinzip bezeichnet werden, das u. a. leider von unserem Schulsystem stark gefördert wird. Zunächst scheint der Vergleich zu beruhigen. Wenn er aber ergibt, dass andere im Gegensatz zu Ihnen den Lernstoff verstehen, wäre Ihr Problem nur vergrößert.
Letztlich geht es doch aber um Ihren eigenen Lernprozess und der muss und sollte auch unabhängig von anderen gestaltet werden. Wenn Sie diesen, soweit möglich, gelassen und nicht mit negativen und destruktiven Gedanken begleiten, haben Sie sicher gute Chancen, ihn auf Ihre Weise positiv zu erleben.
Zu 3. und 4.: In Seminaren befangen und schüchtern oder eingeschüchtert zu sein, ist eine ebenso häufige wie unangenehme Erfahrung, die sich vor allem aus der unter 2. diskutierten Thematik ergibt. Dass dies für das Lernen und Arbeiten nicht hilfreich ist, ist offenkundig. Und hier ist es sinnvoll, nach eigenen Wegen zu suchen, um die Probleme zu überwinden.
Ein anderer Aspekt ist dagegen weniger offensichtlich. Daher lohnt es, sich diesen vor Augen zu führen und ihn vielleicht auch an sich selbst zu bemerken. Dann werden Sie vielleicht erkennen, dass man sich selbst durch die Zurückhaltung oder gar Blockierung bei eigenen Beiträgen in Seminaren zunehmend in eine Art Zuschauer-Position [15] bringt. Was ist dabei aber das Problem, wo wir doch sehr oft durch bloßes Zuschauen lernen, sei es bei Vorträgen, Internet-Videos etc.?
Das Problem besteht darin, dass diese „Konsumhaltung“ zu einer mangelnden Identifikation mit der Veranstaltung und damit zu mangelnder Begeisterung und Motivation führen kann. Aus der pädagogisch-didaktischen wie auch der neurobiologischen Forschung wissen wir – was auch die alltägliche Erfahrung aus Lehre und Studium zeigt –, dass es den Lernprozess mehr oder weniger hemmt und zudem weniger Freude bereitet. Darauf weist auch die oben zitierte Studentin am Ende ihres Textes hin. Es sei Ihnen deshalb hier die Empfehlung gegeben, sich in Lehrveranstaltungen – so gut es Ihnen möglich ist – zu engagieren.
Allerdings wäre es wiederum auch nicht hilfreich, wenn Sie dies mit einem unguten Druck verbinden würden, wie es in der im folgenden Abschnitt zitierten Selbstauskunft zum Ausdruck kommt.
2.2 „Und bereits nach wenigen Minuten des Studiums begannen die ersten Selbstzweifel“
Ich saß also in dem Seminar und fand das Thema zunächst sehr interessant. Was der Dozent sagte, war mir auch durchaus verständlich, bis es zu dem Punkt kam, als meine Kommilitonen anfingen sich zu beteiligen. Das Thema schlug plötzlich in eine völlig andere Richtung und ich beobachtete mich selbst, wie ich immer unsicherer wurde. Es wurde politisch und ich verstand nichts mehr.Und bereits nach wenigen Minuten des Studiums begannen die ersten Selbstzweifel. Ich wollte seit meinem 16. Lebensjahr studieren, nun hatte ich den Platz und war bereits nach der ersten halben Stunde am Zweifeln. Wieso? Fragen, wie z. B. „Bin ich hier wirklich richtig?“ und „Bin ich überhaupt in der Lage dazu, ein Studium erfolgreich abzuschließen?“ schossen mir plötzlich durch den Kopf. So dachte ich darüber nach, ob es nicht vielleicht besser wäre, das Studium zu beenden. Ich hatte Angst vor den Themen, mit denen ich in der Zukunft konfrontiert werden würde, vor denen, mit welchen ich mich einfach nicht auskannte.
(Studierende_r G. B.)
Durch viele Gespräche mit Kommilitonen, die überraschenderweise genau die gleichen Probleme haben, ging es mir oft viel besser. Man fühlte sich nicht mehr so allein und wusste, man ist mit seinen Problemen nicht die einzige.Ich denke, so etwas hilft in solchen „Selbstfindungsphasen“ sehr, da es meiner Meinung nach sehr in der Gesellschaft verankert ist, überall der/die Beste zu sein, sein Bestes zu geben und den „richtigen“ Weg zu finden. Wenn man jedoch an seinem Weg zweifelt, entstehen Ängste, nicht das „Richtige“ zu tun. Wenn man solche Ängste, die man sich gewissermaßen selbst aneignet, mit jemandem teilen kann, fühlt man sich schon nicht mehr als einziger „Versager“…
(Studierende_r Y. N.)
[16] Mir wurde bewusst, dass es genau das Falsche ist, von mir selbst während des Studiums so schlecht zu denken. Gerade weil ich etwas lernen will, sitze ich in der Hochschule, und nicht, um schon alles zu wissen. Im Gegensatz zu meinen Kommilitonen habe ich auch meine ganz persönlichen Erfahrungen gesammelt, die nicht weniger wert sind, als die der anderen.Wahrscheinlich ist es normal, dass man anfangs erst einmal unsicher ist und nicht recht weiß, wie man mit den vielen Informationen, die man bekommt, umgehen soll. Außerdem bin ich inzwischen nicht mehr an das Lernen, das lange Zuhören und Konzentrieren gewöhnt.Es ist unsinnig, sich so viel Druck aufzubürden, da die Zeit des Studiums nicht davon belastet werden sollte.
(Studierende_r G. P.)
Kommentar
Der letzte Satz könnte noch ergänzt werden durch die Feststellung: Es ist nicht nur unsinnig, sich einen derartigen Druck zu machen, weil es nichts nützt und weil es belastet, sondern es ist zudem auch falsch. Und zwar einfach deshalb, weil der Druck keine Berechtigung hat. Prüfen Sie selbst: Wo steht geschrieben und was ist der Grund dafür, dass man alles, was man tut, so und so gut können sollte? Oder dass man es womöglich „perfekt“ können sollte?
Bedenken Sie hier nun noch etwas Weiteres, das im obigen Zitat zu Beginn unter dem Stichwort „schlecht von sich denken“ angesprochen wird: Eine schlechte Bewertung der eigenen Leistungen sollte nicht dazu führen, über sich selbst als Person und als Mensch insgesamt schlecht zu denken. Der Wert meiner Arbeiten und Leistungen ist etwas anderes als der Wert meiner Person. Beides ist recht unabhängig voneinander, und was unseren Wert als Menschen betrifft, so ist zu bedenken: Wir sind alle zu dem geworden, was wir heute sind, auf der Basis von Vorbedingungen und Umständen, die jede_n Einzelne_n besonders und einzigartig gemacht haben. Aber niemand hat diese Voraussetzungen frei gewählt und niemand ist für sie, im Guten wie im Schlechten, verantwortlich. Deshalb sind wir alle durchaus berechtigt, zu uns zu stehen und uns so anzunehmen, wie wir sind. Wenngleich wir dennoch immer wieder aus für uns guten Gründen und je nach Bedarf Veränderungen bei uns anstreben können.
→ LEKTÜRE-HINWEIS | Hier können Sie mit großem Gewinn das folgende Buch vertiefend zu Rate ziehen: Michael Schmidt-Salomon: Entspannt Euch! (Schmidt-Salomon (2020))
[17] 2.3 „Ich neige dazu, mir viel zu viele Gedanken um Sachen zu machen“
Für mich ist es immer wieder erstaunlich festzustellen, welche Grenzen und Ängste man oder besser gesagt: ich mir durch meine Gedanken setze. Ich neige dazu, mir viel zu viele Gedanken um Sachen zu machen, mir Möglichkeiten vorzustellen, was alles schief gehen könnte, und verliere so manchmal den Blick für das Wesentliche. Ich kann mir den Kopf darüber zerbrechen, wie alles ablaufen könnte, es ändert aber nichts an den Situationen. Auch das hab ich für mich jetzt gelernt. Viel einfacher ist es, wenn man alles auf sich zukommen lässt und schaut, wie es läuft, denn es passieren immer wieder unerwartete Situationen, auf die man in dem entsprechenden Moment reagieren muss. Ich weiß für mich, dass ich z. B. bei Präsentationen versuche, mich so gut, wie es für mich möglich ist, vorzubereiten und es so gut wie möglich zu präsentieren. Mehr kann ich eh nicht machen. Und dieser Gedanke, dass ich mein Bestes gebe, hat mich spüren lassen, dass es einfacher wird, gelassener an alles heranzugehen. (Studierende_r C. M.)
Kommentar
Hier wird etwas angesprochen, das Sie vielleicht von sich selbst kennen und das in unserer Kultur weit verbreitet ist: Dinge vorwegzunehmen, sie sich so und so vorzustellen und damit Sorgen und Ängste zu verbinden. Wir alle wissen, dass ein derartiges In-die-Zukunft-blicken einerseits häufig nicht besonders realitätstauglich ist und dass es andererseits ungute Gefühle oder schlechte Stimmungen hervorruft. Nicht nur viele psychologische Glücks-Ratgeber betonen immer wieder die Schädlichkeit solcher Zukunftssorgen, auch in der Achtsamkeitslehre wird davor aus ähnlichen Gründen gewarnt und dazu aufgefordert, derartige „Kopfgeburten“ zu vermeiden.
Im letzten Zitat bietet uns die Studentin eine entsprechende Lösung an, die hier tatsächlich weiterhelfen kann: in Gedanken immer nur beim nächsten Schritt zu sein, die Dinge ohne zu urteilen auf sich zukommen zu lassen – und damit zu mehr Gelassenheit gegenüber den Ereignissen zu gelangen. In Verbindung mit der Feststellung: „Ich gebe mein Bestes, mehr habe ich nicht, und mehr geben zu wollen, macht keinen Sinn“, handelt es sich sicher um eine geeignete und hilfreiche Einstellung für ein entspannteres Studium.
Das Problem, sich grundlos Sorgen über die Zukunft und dabei einigen Stress zu machen, zeigt sich auch in der folgenden Äußerung:
Ich war wahnsinnig nervös bei unserer Präsentation. Das allein ist nichts Ungewöhnliches bei mir, aber ich war vor allem nervös, weil ich Angst vor der Reaktion unseres Kurses hatte, da ich selbst nicht zufrieden mit unserer Arbeit war. Dieser Aspekt der Nervosität war dann doch neu für mich. Die Nervosität mir gegenüber hielt sich in [18] Grenzen. Ich wusste nämlich, dass ich alles gut ausgearbeitet und verstanden habe. Außerdem war ich gut auf mein Thema vorbereitet und konnte es verständlich erklären. Bei meinen Gruppenmitgliedern war ich mir da allerdings nicht so sicher. Ich wusste zwar, dass auch sie sich alle Mühe gegeben haben und ihre Sache vorbereitet hatten. Aber ich wusste nicht, wie sicher sie in der Materie wirklich stecken …
(Studierende_r D. H.)
Kommentar
Hier wirkt sich vielleicht ein falsches Verständnis von „Studium“ aus. Es ist ja kein Problem, wenn man Dinge vorträgt, die nicht so ganz gelungen sind. Das Studium ist dazu da, dass man sich ausprobiert, den anderen etwas vorträgt und gemeinsam schaut, wo und wie etwas verbessert werden könnte. Es handelt sich um einen Lern-Prozess. Doch leider haben wir aus der Schule häufig die Vorstellung mitbekommen, dass ein Vortrag zeigen solle, was man kann und wie es zu bewerten ist.
Dass dadurch der Anspruch gefördert wird, seine Sachen möglichst „perfekt“ machen zu müssen, ist dann kaum verwunderlich. Dabei vergessen wir allerdings, dass wir gerade aus Fehlern viel lernen können, häufig sicher mehr, als wenn alles „glatt gegangen“ und unser Nachdenken nicht angeregt worden wäre. Denn studieren heißt, noch nicht vor dem Ernstfall zu stehen, sondern diesen so gut wie möglich vorzubereiten – eben auch durch „Fehler“ und ihre Korrektur als Lernerfahrung.
Einige Menschen, vielleicht auch Sie, denken dabei an möglichst gute Noten und begründen den inneren Druck damit. Doch Chancen im Beruf und auf bestimmte Arbeitsstellen hängen sehr häufig gar nicht von Zeugnissen und Notenspiegeln ab, sondern in unserer Welt zunehmend von anderen Kriterien, etwa von den Kompetenzen, die jemand mitbringt, oder von dem Gesamtbild, das jemand vermittelt.
2.4 Positive Perspektiven und Lösungen
Zurückkehrend zum Thema „Zukunftssorgen“ deutet sich in der folgenden Erzählung bzw. Selbstreflexion eine mögliche Lösung des Problems an:
Während des Vortrags, als ich vor der Gruppe stand, passierte etwas für mich ganz Sonderbares. Meine Nervosität hielt sich in Grenzen, selbst als ich sprach, und auch meine Stimme zitterte zum ersten Mal während eines Referats nicht. Im Nachhinein war ich so stolz auf mich und ich werde aus diesem Vortrag sehr viel für spätere Präsentationen mitnehmen. Ich fand es schlicht und ergreifend nicht mehr so schlimm wie früher, vorne zu stehen und vor 40 Leuten zu sprechen. Ich muss aber sagen, dass das auch stark mit dem Thema zu tun hatte. Ich war so interessiert an unserer Aufgabe, dass ich unsere Ergebnisse unbedingt mit meinen restlichen Kommilitonen aus dem Kurs teilen wollte …
(Studierende_r J. N.)
[19] Kommentar
Wir sehen hier, dass uns die positive Beziehung zum Thema über Ängste und Nervositäten hinweghelfen kann, dass also die Bedeutung der Sache die Bedeutung der Situation als „Prüfung“ mehr oder weniger stark verdrängen kann. Wenn Sie also etwas „unbedingt mit den Kommilitonen aus dem Kurs teilen“ möchten, dann kann die damit verbundene Begeisterung günstig sein. Sie kann dazu führen, dass das Äußerliche der Situation, die Sorgen und Ängste in den Hintergrund treten und Sie sich entsprechend davon befreien können. Versuchen Sie also, das Interesse an der Sache möglichst stark zu machen bzw. sich Themen auszusuchen, die sie wirklich interessieren. In dieser Richtung könnten Sie auch folgende Überlegungen ermutigen:
Wenn ich in diesem Studium wirklich etwas lernen möchte, lernen über das breit gefächerte Studiengebiet und lernen über mich selbst, dann muss ich bei mir anfangen und mit einem ganz anderen Gedanken an dieses Studium herangehen. Dieser Gedanke hat sich diesen Sommer in mir ganz neu definiert. ICH möchte studieren, erforschen und lernen, um im Beruf jemand zu werden, die sich selber reflektieren und an sich arbeiten kann. Um dieses Ziel zu erreichen muss ich mich und meine Arbeitsweise neu strukturieren. Ich möchte mich, von Anfang an, in jedem Modul und in jedem Kurs neu entdecken und einfinden. Das Ziel soll es nicht sein, nur für die Prüfungsleistung zu studieren, sondern für meine berufliche und persönliche Entwicklung und um mehr Wissen zu erlangen. Ich möchte in Zukunft meinen Zeitplan und Arbeitsweise neu strukturieren, im Seminar nicht nur körperlich anwesend zu sein, sondern auch mit Verstand und Herz, ist ein wichtiges Ziel, welches ich gern erreichen möchte.
(Studierende_r M. K.)
Eine mögliche Kritik am „verschulten“, primär auf Notenerwerb ausgerichteten Studieren, die sich aus dieser Haltung ergibt, wird in den folgenden Bemerkungen formuliert:
Dazu kam, dass das Studium auf den Erwerb von Leistungsscheinen ausgerichtet ist, was dazu führt, dass Seminare, in denen man leicht eine gute Note erhalten kann, völlig überfüllt sind. Die Masse der Studenten achtet überhaupt nicht mehr auf die Inhalte des Seminars. Es wird auch nur noch für das gelernt, was überhaupt mit einer Note belohnt wird. Gerade erst kürzlich konnte ich miterleben, wie eine Kommilitonin zu Beginn des zweiten Semesters in ein anderes Seminar wechselte, nur um einer 15-minütigen Präsentation zu entgehen.
(Studierende_r A. F.)
[20] 3 Achtsam lernen – mit Anfängergeist, Kreativität und Selbstmitgefühl
Nachdem Sie in den ersten beiden Kapiteln einige mögliche Ideale guten Studierens und Lernens einerseits und einige weitverbreitete Hürden im Studium andererseits kennengelernt haben, werden Sie nun einer Idee zum guten Lernen und Studieren begegnen. Sie kann als „achtsames Lernen“ bezeichnet werden. Das Thema „Achtsamkeit“ ist Ihnen vermutlich bereits begegnet, da es im Laufe der letzten Jahrzehnte zunehmende Verbreitung gefunden hat.
An dieser Stelle soll es uns allerdings vor allem bei der Frage guten Lernens und Studierens hilfreich sein (siehe dazu auch vertiefend Kapitel 11).
BEMERKUNG:LERNENBevor wir dazu kommen, was „achtsames Lernen“ eigentlich bedeutet, sollten wir uns vorweg an eines erinnern: Lernen ist nicht gleich Schule! Wir alle haben zwar viel in der Schule lernen müssen, dürfen oder können, aber die Art und Weise, wie in Schulen in der Regel gelernt wird, ist doch nicht unbedingt eine gute oder bestmögliche Form des Lernens. Ganz im Gegenteil hat die Schule viele von uns von der Freude und Fruchtbarkeit des Lernens eher abgebracht als diese zu fördern. Es gibt zwar im Bereich der Reformpädagogik schon sehr lange vielerlei Konzepte für ein freudvolles und nachhaltiges Lernen, doch diese fanden und finden leider nur sehr langsam und mühsam Eingang in die Regelschulen.
Was bedeutet also „achtsames Lernen“, das uns hier als positives Gegenbild zu den angedeuteten, eher unglücklichen oder gar abschreckenden Lernformen dienen soll? In der Kapitel-Überschrift finden sich drei Begriffe, die für diese Frage relevant sind und die im Folgenden der Reihe nach erläutert werden.
3.1 Anfängergeist
Das Wort „Anfängergeist“ könnte wie eine Anspielung auf „Studienanfänger_in“ klingen – aber das ist, wenn überhaupt, nur die halbe Wahrheit. Die Idee des „Anfängergeistes“ ist vielmehr ein fester Bestandteil der Achtsamkeitslehre. Auf eine kurze Formel gebracht, besagt sie:
Wir sollten die Dinge wie zum ersten Mal, wie Anfänger_innen, betrachten.
Diese Empfehlung besagt, dass wir mit Dingen, Menschen oder Situationen nicht so selbstverständlich, gewohnt oder unbedacht umgehen sollten, wie wir es häufig tun. [21] Wir sollten sie stattdessen wie neu und unbekannt, möglichst unvoreingenommen zu betrachten versuchen. Damit vermeiden wir zweierlei: (1.) dass wir Dinge, Menschen oder Situationen in der gewohnten, üblichen Weise und in vorgefertigten Formen wahrnehmen, und (2.) dass wir ihnen in der Vorstellung und dem Gefühl begegnen, wir würden sie eigentlich schon kennen.
Aber wozu das alles? Ist es nicht hilfreich, Dinge wiederzuerkennen, sie einzuordnen und damit richtig zu verstehen? Hilfreich ist dies sicherlich vor allem dann, wenn wir etwas schnell erfassen wollen, um dann eventuell zügig handeln zu können. Sehr viel weniger hilfreich ist es aber, wenn wir den Dingen oder Menschen näherkommen wollen, wenn wir sie – möglichst unvoreingenommen – als das wahrnehmen und erleben wollen, was sie selbst sind und nicht als das, wozu sie von unseren vorgefertigten Vorstellungen oder Vorurteilen häufig gemacht werden. Und genau hier ist der Anfängergeist nützlich. Der bekannte Zen-Meister Suzuki formuliert es so:
Der Geist des Anfängers ist leer, frei von den Gewohnheiten des „Experten“, bereit zu akzeptieren, zu zweifeln und offen für alle Möglichkeiten. Es ist die Art von Geist, die die Dinge sehen kann, wie sie sind.Im Geist des Anfängers liegen viele Möglichkeiten, in dem des Experten weniger.
(Suzuki, 2016, Vorwort)
Inwiefern ist der Anfängergeist – also eine interessierte Offenheit und Vorurteilslosigkeit – nun auch beim Lernen und Studieren ratsam? Dazu können wir etwas unmittelbar aus dem vorigen Zitat entnehmen: wir sollten die üblichen Weisen, Dinge wahrzunehmen, ebenso wie bestehendes Wissen oder Denken nicht als etwas Abgeschlossenes und Fertiges hinnehmen.
Insbesondere Studienanfänger_innen haben die spezielle Chance, das bestehende und gelehrte Wissen neu zu befragen und zu hinterfragen. Nutzen Sie diese Chance! Aber nicht nur für sich selbst, sondern auch für die anderen. Denn diese erhalten durch Ihren frischen und freien Blick auf die Dinge ebenfalls die Chance, die Welt noch einmal neu zu betrachten.