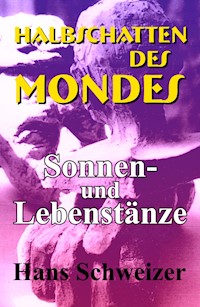
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Gut 20 Jahre später hat angefangen, was ich von mir nie gedacht hätte. Ich habe meine BIO-grafie geschrieben und damit ist ein großer Prozess in Gang gekommen, unerwartet in mancherlei Hinsicht und wunderbar. Mein Leben und mehr - viel mehr - ist also hier in meinem Buch zu finden. Ich mag Spielereien mit Worten und ich mag Zufälle. Durch einen solchen bin ich auf meine erste neutrale Leserin gestossen, eine Frau, die mich nicht schon lange kennt, sich aber dazu bereit erklärt hat, einmal in mein Manuskript zu gucken. Ich zitiere hier aus einer gleichentags an mich ergangene Mail: «Heute morgen brachte mir der Postbote ein sehr gewichtiges Paket ins Haus. Herzlichen Dank. Ich habe mich sogleich ans Lesen begeben und finde die Lektüre höchst interessant. Warum? Der Autor ist verwurzelt in einer Vergangenheit, die heute wohl nur ganz wenigen Menschen noch bekannt ist. Die Familiengeschichte mit Vor- und Nachfahren ist darum schon für sich selbst lesenswert und macht nachdenklich. (Ich staune, mit welcher Übersicht er einen so umfangreichen Stoff in den Griff kriegen konnte.) Das zweite Element des Buches sind die ganz persönlichen Erlebnisse, die dem Leser so nahe gebracht werden, dass er unmittelbar daran teilnehmen kann. Dies beides, der sachliche Bericht und das persönlich Erlebte, macht die Lektüre für mich wertvoll.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Hans Schweizer
Halbschatten des Mondes
Sonnen- und Lebenstänze
Copyright: © 2018: Hans Schweizer
Umschlag & Satz: Erik Kinting
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
ISBN 978-3-7469-2887-6 (Paperback)
ISBN 978-3-7469-2888-3 (Hardcover)
ISBN 978-3-7469-2889-0 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Mit einem Dach und seinem Schatten dreht
sich eine kleine Weile der Bestand
von bunten Pferden, alle aus dem Land,
das lange zögert, eh es untergeht.
Zwar manche sind an Wagen angespannt,
doch alle haben Mut in ihren Mienen;
ein böser roter Löwe geht mit ihnen
und dann und wann ein weisser Elefant.
Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald,
nur dass er einen Sattel trägt und drüber
ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt.
Und auf dem Löwen reitet weiss ein Junge
Und hält sich mit der kleinen heissen Hand,
dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge.
Und dann und wann ein weisser Elefant.
Und auf den Pferden kommen sie vorüber,
auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge
fast schon entwachsen; mitten in dem Schwunge
schauen sie auf, irgendwohin, herüber –
Und dann und wann ein weisser Elefant.
Und das geht hin und eilt sich, dass es endet,
es kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel.
Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet,
ein kleines kaum begonnenes Profil –.
Und manches Mal ein Lächeln, hergewendet,
ein seliges, das blendet und verschwendet
an dieses atemlose blinde Spiel …
Rainer Maria Rilke
Bild: Hans Schweizer
Inhalt
1
Ein Buch?
2
3
Die Ausgangspunkte
Mutter betet
Da kommt Mutter her …
… und da der Vater
Schule
Mit Mutter im Dorf
Appenzellerland
Kriegskinder
«Zwilling» als Empfindung
Unverständliches klärt sich (?)
Der Mond wirft seinen Schatten
«Halb- oder Kernschatten»
Sein auf Langrüti
Vater im Schulzimmer
Bei Vetter Ernst auf dem Hof
Erziehung und Wutausbrüche
«Heuferien»
Baden im See
Douglas
Vaters Lektionen
«Christliche Seefahrt» – oder was?
Nur Jesus geht auf dem Wasser
Das «Spritzenhäuschen»
Susi Hug
Hochzeit
Zwei Prägungen auf jeder Münze
Hinter dem Fussballtor
Schülergeburtstag 1954 …
«Klavier» (Einschub A )
… mit Frauenpower
«Klavier» (Einschub B)
4
Vaters Sein auf Langrüti
Kirchenchor und Konzerte
Praktikantinnen und Praktikanten
Bibelstunde
«Autofahren» – er?
5
Der «Sandhof» – Marti und Hedi
Friedi R., Jakob Z. der Jüngere und Marteli
Früher Verlust von Pate und Bruder
Herrin auf dem Sandhof
Abhängigkeit
Kreis der Lehrersfrauen
Zwei Fotos
Bibelverständnis – «Heilige Pfeife»
Die «Pfeifenzeremonie»
6
Berufsberatung in Horgen
Vaters Beistand
Oberrealschule in Zürich
Erneut auf der Suche
Das Lehrerseminar Küsnacht
Das «Evangelische» in Unterstrass
Als «Flab Soldat»
Konrad Zeller (Chueri)
Das Kantonale Oberseminar
Vikariat in Wetzikon (anstelle eines Praktikums)
Vikariat in Richterswil (anstelle eines Praktikums)
7
Reizvolle Bekanntschaft
Als Junglehrer
Im «Gottfried-Keller-Dorf»
Befreit vom Wartemuster
Auf «Moosegg»
8
Mit einer Frau auf Langrüti
Friedi
Annelies
Am «Poly-Ball»
Hochzeit im Appenzeller Land
Brauerei der Familie Keller
9
Hochzeitsreise – «Beba»
«Ich glaube, Sie warten Kind»
Das Kollektivbillett
Kaspar – Gelpkes – im Wallis
Das Saastal, Ludwig Gelpke und Almut, seine Frau.
Florian
Alltagstrott
Das Mädchen
Die Sippe der Zollinger
Rettung des Hofs
Von Saulus zu Paulus.
Grossvater spürte sein Ende nahen
Der Kranzwagen
Die «Schweizer» und die «Ficks»
Aus Vaters Buch
Frieda (Schweizer-) Fick (1880–1963 )
Die Auswanderer
Hermann Heinrich Schweizer-Fick (1870–1947)
Grossmutter Frieda Schweizer-Fick (1880–1963)
Zu einer anderen Linie des «Ur-Schweizer» aus Stadel
Zur Ahnenreihe
Erste Ehejahre – Familienleben
Ungleiche Bedürfnisse
Alltag
Krank machend?
Mein Malraum
Im«Einklang» sein
Noch einmal eine Beratung – «Mona»
Geheimniskrämerei
Entsprechungen?
Schattenteppiche im Halbschatten?
Mutters Antwort
10
Ruth
Hin zur eigenen Idylle
Champoly
11
Vaters Tod (aus meiner Sicht)
Tagesbefehl zum letzten Lebenstag
Mutters Trauer
Mutters Ableben
Sonnenfinsternis 1999
12
Schule und Behinderungen
Hanns Josef Ortheil
This
Mein Orientierungssinn
Skifahren als «schönste Nebensächlichkeit»
Trainingslager für Leiter von Schullagern
Die Segel setzen
Therapiesitzung am «IAC»
13
Einige Erfahrungen mit Schreiben
Worte als Ausdrucksmittel
«Wolkenkratzer»
«Meteore im Hochhaus»
«Schreiben, und wie komme ich zu einem Ende?»
Auch Bilder können erzählen
Ruedi W.
14
Die «Baumzeremonie»
Nachschlag
1
Focus
Ein Buch?
«Antworten» waren beim Erwachen mein erster Gedanke.
«Nein, bitte! Sicher werde ich kein Buch schreiben! Fehlte noch!»
«Unsere Stadt ist gebaut», soll meine einstige Mitschülerin am Evangelischen Lehrerseminar gesagt haben, als sie zur sozialistischen Stadträtin von Zürich geworden, das Baudepartement inne- hatte. Allerdings bin ich ziemlich sicher, dass sie das niemals so undifferenziert gesagt haben kann. «FakeNews» hat es in der Politik schon damals gegeben, nur den Ausdruck dafür nicht.
Analog dazu hätte ich jetzt gerade behaupten wollen, dass die Bücher längst alle geschrieben sind! Aber zugegeben, diese Behauptung ist nicht von mir und kann wahrscheinlich gut widerlegt werden, und in unsern Städten und Dörfern wird drauflosgebaut, als sollten künftige Generationen nie wieder die Chance bekommen, etwas Vernünftiges für ihre Mitmenschen zu tun.
Ein Buch? Nein.
Wie war das doch bei Wilhelm Busch? «Jedes legt noch schnell ein Ei und dann kommt der Tod herbei.»
Und jetzt? «Jeder» hinterlässt vor seinem Abgang ein bescheidenes Denkmal. Ist doch so – oder? Vielleicht macht einer einen Pilgerweg, wie ich. Und häufig schreibt er dann erst das Buch. Mit selbstgefälligem Leistungsausweis jedenfalls – um einer irgendwann anstehenden Abdankungsrede zu angemessenem Schwung zu verhelfen? – Memoiren also? – So ehrgeizig bin ich doch nie gewesen. – Oder doch?
Meine Kollegen am Seminar fanden damals, ich sollte schreiben. Aber die hatten doch keine Ahnung! Es ging für mich nicht um prestigereiche Zusatzentwürfe für mein Leben. Ich hoffte einzig und allein, die Zeit an diesem evangelischen Schulbetrieb unbeschadet zu überstehen; den Kopf so lange über Wasser halten zu können, bis alles vorbei war.
Einer meiner Lehrer äusserte sich einmal so: «Schweizer, entweder sind Sie ein Idiot oder ein Genie!» Manchmal hege ich den Verdacht, seine Aussage sei mir zu einer Art Tarnkappe geworden, unter welcher ich glaubte, mich verstecken und schützen zu können. Antworten also zuerst?
Da hat wohl eine innere Instanz nicht so gut geschlafen wie ich. Wie ein Myzel den Waldboden hatten offenbar Fragen meinen Schlaf durchwühlt.
Aber was zum Teufel will mich dazu bringen, mein Innerstes auf Papier und zwischen Kartondeckel zu bannen?
Gehts um mein Sein, um meine ureigene Wahrheit, ums Altwerden? Was habe ich mit meinem Potenzial, mit meinen Talenten gemacht?
Geht es um die Klangfarbe des Selbstmitleids, um meine persönliche Gerechtigkeit? Oder um die Struktur und Einordnung in meiner Ahnenkette? Warum liegen meine Söhne, meine Enkel und ihre «Geschichten» mir stets im Sinn?
Ich nehme mir vor, darauf einige Antworten zu finden. Kürzlich hat jemand mein Tun «Schreibprojekt» genannt. Unter Kapitel 12 soll es nochmals zum Thema werden.
2
Substanz
3
In Form gebracht bei Eva Ehrismann
Die Ausgangspunkte
Sie liegen gut drei Viertel eines Jahrhunderts zurück und gehen zu den Anfängen deiner jungen Familie, Vater, und zu meinem Ursprung. Es war während des Zweiten Weltkriegs.
Da ist er nämlich unversehens zur Welt gekommen, der von euch erwartete «Hansueli». Später wurde auch von den «Hansuelenen» gesprochen. Niemand hat ja damals gemerkt oder geahnt, dass es zwei sein würden, die in diesen düsteren Tagen durch einen im örtlichen Spital erstmals praktizierten Kaiserschnitt das Licht der Welt erblicken durften: Ich nämlich, den du, Vater, dann als Hans (Hans Hermann) pflichtbewusst auf der Gemeinde gemeldet hast, genauso wie auch deinen Erstgeborenen, den Ueli (Ulrich Jakob). Als Mutter mit Nierenkomplikationen im Spital lag, konnte sie die Ärzte bei halbgeschlossener Türe belauschen und bekam auf diese Weise mit, dass ihr Kind jetzt – etwa sechs Wochen zu früh – geholt werden müsse und dass man sie, die bestürzt lauschende Mutter, nur mit diesem am Ort bisher noch nie praktizierten Eingriff am Leben erhalten könne.
Mutter mit Hans und Ueli
Währenddessen hast du, Vater, im Schützengraben gestanden. Und als dort die Meldung von eurem Zwillingsglück eintraf, wurde dir erlaubt, diesen Graben und den Ort, den man niemandem preisgeben durfte, mit dem Militärvelo zu verlassen, um die nächste Bahnstation zu erreichen. Von dort brachte dich der Zug zum Spital am See, und du konntest deine Buben sehen und deine junge Frau. Es sei das einzige Mal gewesen, dass du dir in der Folge beinahe militärischen Ungehorsam geleistet hättest: am darauffolgenden Tag nämlich, als der Urlaub vorbei war und du schon wieder vereinnahmt werden solltest.
Einer der Zwillinge mit dem stolzen Vater
So also mein Ausgangspunkt, unser Ursprung, die Anfänge deiner eigenen Familie, die du zwar immer wieder verlassen musstest, weil das von dir so verlangt wurde. «Rufst du mein Vaterland!» Das war ja schliesslich unsere Landeshymne!
Später hast du diese mit uns Schülern – wie alle vaterländischen Lieder – mit viel Feuer gesungen, als Ueli und ich von der vierten bis zur sechsten Klasse deine Schule besuchten auf «Langrüti» einer der «Aussenwachten» der stolzen Seegemeinde. Ich mochte deine Singstunden und deinen Heimatkundeunterricht.
Hans links – Ueli rechts
Vater mit Hans – Mutter mit Ueli
Schweizer Geschichte konnte man als Viertklässler schon bei den Sechstklässlern mithören. In der Dreiklassenschule, die du über Jahrzehnte geführt hast, war das möglich, denn oft waren alle drei Klassen gleichzeitig anwesend. Auch Schulweihnachten mit Christbaum, Musik und Liedern, mit Geschenkpaketen und Theater oder gar mit einem Krippenspiel, das wir aufführen durften: Das war dein Ding! Das gab es bei uns auf Langrüti und alles war ganz einmalig, machte sie aus, die kleine, idyllische Welt im Schulhäuschen. Die Erinnerungen reichen aber viel weiter zurück.
Sommer wars und hinten im Garten wurde ein schön geformtes Badewännchen aufgestellt aus galvanisiertem Blech. Ueli und ich planschten im sonnenwarmen Wasser zwischen den Johannisbeersträuchern. Zwei oder drei von Vaters Schülerinnen entdeckten uns dort, kletterten über den Hag zu den nackten Buben, lachten und streuten duftende Kräutlein ins Wännchen. Nein, niemand hat die Mädchen gescholten. Aber mit Baden im Freien war es für uns vorbei. Ein für alle Mal! Schade, sehr schade. Es gab in Gottes Namen Dinge, die in einem Schulhaus nach Meinung der Eltern nicht gingen. Da achteten sie strikte darauf.
Da war auch ein halberwachsenes Mädchen, das Mutter mit ihren Zwillingen gegen ein kleines Entgelt zur Hand gehen sollte: die «Idibischbild». Diesen Namen hatten wir von Mutter übernommen, denn sie pflegte beim Verlassen des Hauses «Idi» jeweils zu fragen, ob sie über alles Notwendige «im Bild» sei. «Idi» war eine Bauerntochter und ziemlich tüchtig. Sie konnte anpacken und lachte viel. Wir mochten sie sehr und wenn Ueli und ich nebeneinander auf unserer Kommode sitzend angezogen werden sollten, konnte sie durchaus einmal am einen oder dem andern «Schnäbelchen» etwas zupfen – sichtlich belustigt über die relative Winzigkeit, die sie zwischen unsern Beinen vorfand. Den «Bitzen» (das Bisschen) nannte sie es. Wir mochten das harmlose Spielchen. Aber Mutter stellte das Mädchen ungewöhnlich schroff in den Senkel. Es nützte nichts, dass wir sofort erklärten, das sei doch lustig gewesen und tue überhaupt nicht weh.
Wir erlebten unsere Kindheit also im kleinen Schulhaus auf «Langrüti». Das war ein schöner und sonnendurchfluteter Ort. Draussen befand sich der kiesbedeckte Pausenplatz für Vaters Schüler. Da gab es die flache Auffanggrube als Teil der Hoch- und Weitsprunganlage. Die enthielt eine beträchtliche Schicht «Rollgerste», womit die ganz kleinen Kieselsteinchen gemeint waren. In dieser Grube standen, etwas entfernter, zwei verstellbare Reckstangen und luden mich unablässig dazu ein, mir Kunststücklein anzueignen, die ich den grossen Schülern abgeschaut hatte. Waren diese aber wieder an ihrer Arbeit bei Vater im Schulzimmer, gehörte der Platz mir. Ich setzte mich an den Rand der Grube und stopfte eine geballte Ladung Rollgerste in meine Turnhose. Es gab nichts Behaglicheres, denn die Steinchen waren in der obersten Schicht an der warmen Sonne schön trocken geworden und jetzt voll herrlicher Sonnenenergie. Aufstehen, auslaufen lassen und wieder füllen – das war vielleicht was!
Da waren auch zwei Barren und ganz in der Ecke die hohen Kletterstangen, die als Wahrzeichen bei jedem Schulhaus zu stehen hatten und der militärischen Ertüchtigung der Jugend galten. Unermüdlich habe ich auch da geübt und konnte etwas zeigen. Ich weiss nicht, ob Mutter oder ich stolzer waren bei Vorführungen vor ihren Freundinnen. Eines hat mir aber mit Sicherheit den grössten Spass gebracht: Auf allen vieren konnte ich behände wie ein Äffchen die schräg stehenden Kletterstangen hochklettern, und zuoberst, da, wo Mutter nie hingekommen wäre, drehte ich mich um, den Kopf nach unten, genoss Mutters entsetztes Aufbegehren, hängte mich in den Kniekehlen so an die schräg abfallenden Stangen, dass ich auch die Hände loslassen und dazu johlen konnte. Erst wenn es mir gefiel, rutschte ich langsam, freihändig und immer noch kopfüber zu Boden.
Ueli und ich sassen später, von der vierten bis zur sechsten Klasse, mit unseren Mitschülern unten im einzigen Schulzimmer. Vater amtete als Schulmeister und oben, in der Lehrerwohnung, pflegte die Mutter unseren Haushalt. Man konnte es im Schulzimmer hören, wenn sie dort mit dem Staubwischer über die Klaviertasten fuhr. Gespielt hat sie selten, und wenn doch, dann fast nur auf den schwarzen Tasten. Ich habe keine Ahnung, wie sie sich das so beigebracht hat. Aber auf Schulreisen oder in Ferienlagern konnte sie mit dieser Technik jedes gängige Lied begleiten, das sie angestimmt hatte.
Grosseltern Zollinger mit Ueli, Christoph W., Hans
Grosseltern Schweizer
Schulweihnacht
Schulhäuser Langrüti
Die Schulhausfenster boten Aussicht auf die Berge und auf den See. Ein schöner Ort. Aus der Lehrerwohnung tretend, konnte ich mich oben auf das Treppengeländer setzen und dann in zwei Etappen rutschen, mit Zwischenhalt auf dem «Bödeli», und schon stand ich vor dem Schulzimmer. Eigentlich war dies mein Schulweg. In der Regel hat Vater am untern Ende der Treppe seine Schüler empfangen, wo sie mit roten Backen oder nassen Lodenpelerinen zum Schulzimmer drängten. Und er hat mich – egal, wie kurz die Zeit noch dauerte bis Unterrichtsbeginn – auf meinen Weg geschickt: Mit dem «Thek» am Rücken, falls er genau aufgepasst hat, sonst ohne, hatte ich zur hundert Meter entfernten Telefonstange hinunterzurennen, musste diese umrunden und aufwärts ging es wieder zurück. Ueli war in der Regel schon auf dem Rückweg, wenn ich hinunterstürmte.
«Oben in der Wohnung bin ich euer Vater», hat es geheissen, «und unten der Lehrer.» Heute denke ich, dass ich mit diesem Spagat Mühe hatte. Ich habe Vater jetzt viel eher als Lehrer empfunden. Mit den «Gspänli» in der Schule hatten wir es eigentlich gut, ganz zu ihnen gehörten die «wohlbehüteten Lehrersdubeli» aber nicht. Diesen Ausdruck hat Luc für uns beide später einmal geprägt. Wenn es um massiven Klatsch ging, wenn Streiche ausgeheckt oder «Kriege» angezettelt wurden – «Reformierte gegen Katholiken» etwa –, dann gehörten wir nicht dazu oder höchstens nach strengsten Verhaltensregeln, die strikte einzuhalten waren, wie wir versprechen mussten. Natürlich wollten wir dabei sein. Das hätten wir auch dann gewollt, wenn geheimes Aufklärungswissen ausgetauscht wurde. «Ihr sagt ja doch alles dem Vater», hiess es dann jeweils und es trug dazu bei, dass wir in grosser Naivität und Arglosigkeit aufwachsen «durften» oder mussten. Denn genau das brachte uns Schwierigkeiten. Es entstanden feine Risse in der kleinen, heilen Welt, und der Nebel der Verunsicherung drang durch, trübte die Wahrnehmung.
Die Umgebung aber, besonders der Bauernhof der Nachbarn, brachte trotz elterlichen Bewahrungstendenzen mit sich, dass wir ausser Haus zu neuen, erweiternden Erfahrungen kamen. Der Hof war ein Dorado. Da war Vetter Ernst. Wir sprachen uns nämlich gegenseitig so an: Vetter Ernst, Vetter Ulrich, Vetter Hans, kurz: einfach Vetter. «Ernstli» war ein Jahr jünger. Wir waren oft auf dem Hof und ziemlich unzertrennlich. Ernstli hatte jüngere Schwestern. Judith, aus der Reihe der Geschwister, war jünger als Ernstli und setzte sich mit allen Mitteln dafür ein, bei unserem Tun dabei sein zu können, auch wenn uns das gar nicht passte. So blieb nichts anderes übrig, als uns mit Hilfe einer Leiter auf das Dach des «Zigerligestells» abzusetzen und die benutzte Leiter dann schnell heraufzuziehen. Einmal gelang es Judith nämlich, die Leiter noch vorher umzuwerfen und uns oben sitzen zu lassen.
Während des Kriegs war im nahen Moor Torf gestochen worden und daraus wurden «Zigerli» geformt. Einmal luftgetrocknet in diesem hohen Gestell, konnten diese während der Kriegszeiten im Winter verheizt werden. Jetzt war nur noch die stattliche Anzahl Querstecken im Gestell. Damit konnten wir immer wieder andere, höher oder tiefer liegende luftige Stübchen mit Tischen und Bänken einrichten und nannten diese «Wirtschaften». Keine heutige Einrichtung für Kinderspielplätze ist ebenbürtig.
Ernstli hatte einen Grossvater, und dieser verfügte hinter der Malzgrube über eine Werkstatt, die «Butik». Wir waren schlank genug, um sie durch die breitesten Ritzen der Bretterwand zu erreichen, sogar dann, wenn die Türe verschlossen war. Da gab es einen Stapel mit morschen Brettern, einen Schraubstock und andere Gerätschaften, die unser Interesse geweckt hatten, und da war auch die Werkbank, mit Werkzeug und Nägeln und mit gelblicher Karrensalbe in einer rostenden Büchse. Dieser Dinge bedienten wir uns vorzugsweise, wenn Grossvater Bollier nicht zugegen, sondern am Mittagsschläfchen war. Oder auch dann, wenn er zu hören war. Er schimpfte und fluchte oft mit hoher Stimme auf dem ganzen Hof herum. Auch so konnten wir uns rechtzeitig in Sicherheit bringen. Eigentlich war ich sicher, dass, wer so flucht, in die Hölle kommen wird. Anderseits wusste ich, dass dieser Grossvater einmal Mitglied des Gemeinderats gewesen war, und dass er es war, der Ernstli immer so schöne Geschenke machte wie das Dreiradvelo und später ein «regelrechtes», auf Knabenverhältnisse verkleinertes Herrenvelo. Solch begehrenswerte Erwerbungen hatte dieser Grossvater für seinen Enkel getätigt. Auch unseren Wünschen hätten ähnliche Präsente sehr entsprochen. Aber es war Vater wichtig, dass seine Zwillinge sich niemals wichtiger oder gar vornehmer fühlen sollten als seine Schüler. Nein, überheblich sollten die nie werden.
Da schleppten wir drei «Vettern» dann eines Tages die morschen Bretter aus Grossvaters Butik ins Freie und legten damit vor dem Hühnerhof einen Boden aus. Darüber wollten wir mit den Nägeln eine Hütte bauen, um darin übernachten zu können. Ernstli war häufig der Anführer und behauptete, er wisse schon, wie das geht. Wir waren Feuer und Flamme. Und als Judith plötzlich dastand und auch mittun wollte, wurde vorgeschlagen, sie zu messen, um herauszufinden, ob sie in der Hütte auch noch Platz finden könnte. Sie ging auf den Handel ein, und einer nach dem andern nahmen wir Mass, indem wir mit beiden Händen von unten her je an der Aussenseite ihrer Beine nach oben fuhren, bis zur breitesten Stelle an ihren Hüften. Die Distanz genau zwischen den Handflächen haltend, zogen wir die Arme wieder unter ihrem Rock hervor und übertrugen dieses Mass auf den Bretterboden. Ich war wohl der Letzte in der Reihe, denn als ich erschreckt hochfuhr, startete Judith gerade ihre Flucht. Ernstli und Ueli waren schon nicht mehr zu sehen. Ich aber hörte eine starke, warme Männerstimme: «Hoppla, geht es dir noch!», und «Ei, ei, ei! Da fängt einer aber früh an!», ergänzte die Bäuerin, als beide aus dem Kuhstall ans Licht traten. So ertappt, hätte ich im Erdboden versinken mögen und wusste mit einem Schlag, wie unmöglich es war, das Unterfangen mit «Massnehmen» begründen zu wollen. Eine Erklärung blieb mir erspart, und so unglaublich schuldbewusst ich mich auch fühlte, so spürte ich schwach, dass meine «Todsünde» in diesem Umfeld auch ein verhohlenes Schmunzeln verursacht haben musste. Nicht einmal die Eltern wurden unterrichtet.
Anders als damals bei Bolliers wurde es, als wir Vettern in der weiteren Nachbarschaft, wo auch Kinder und Mädchen wohnten, auf Abenteuer aus waren. Dabei sind wir, etwas versteckter, hinter einer kaum benutzten Scheune in den Genuss gekommen, erregt zu bestaunen, wie der «Liebgott» die Mädchen gebaut hat. Es war ein heisser, bleischwerer Sommertag und ich weiss noch, dass ich mich früh von der Gruppe gelöst hatte, den Heimweg antrat und mich ungewohnt schlapp fühlte. Zuhause bat Mutter mich, mit ihr auf die «Winde» zu kommen, den Estrich. Hier, direkt unter dem Dach, war es halbdunkel und noch schwüler. Am Boden lagen Hunderte – nein, Abertausende von halbtoten Fliegen. Ich mochte Fliegen, schaute ihnen gerne zu, wie sie ihre Vorderbeine aneinanderrieben, sich quasi die Hände wuschen. Aber das hier war ganz abscheulich, Ekel erregend, kam mir krank vor. Und genau dieses Empfinden verknüpfte sich in mir sofort mit meinem sehr schlechten Gewissen. War es etwa die Folge meines «Sündigens», was ich hier zu sehen bekam – trug ich also Schuld daran? Wir mussten die Fliegenplage auf Kehrichtschaufeln wischen, tote und halblebendige, flugunfähige Tiere zusammen, und ein wirklich grosser Eimer füllte sich.
Obwohl wir dort, hinter der Scheune, versteckt am «Dökterlen» gewesen sind, hat uns offenbar jemand zugeschaut, und den Lehrersleuten wurde zugetragen, was für Früchtchen sie hatten. Wir sollten also bestraft werden. Ich erwartete eine zünftige Tracht Prügel, eine mit dem grossen Teppichklopfer, die meiner Seele Absolution hätte verschaffen können. Das hätte ich sogar als Wohltat empfinden können. Aber wir mussten «halbhöch ufestah», uns also auf den dunklen, gerade unter dem Estrich liegenden Treppenabsatz stellen, mit dem Blick gegen die Wand. Besinnen sollten wir uns dort, und wenn mir recht ist, auch ganz, ganz fest schämen. Eine Weile hatte ich damit irgendwie begonnen, als mich «Mueti» aufforderte, wieder zu ihr hinunterzusteigen. Ich folgte zögernd und Ueli schämte sich weiter. In der Küche erklärte mir Mueti dann, dass die Frau, die unsere Spiele zwar beobachtet hatte, ihren Namen aber durchaus nicht preisgeben wollte, sehr wohl bezeugen könne, dass ich, Hans, den Ort unserer «Schande» früher verlassen hatte als die andern.
Mutter schien mir eigentümlich verändert. Mir wurde warm und frische Luft strömte durchs Fenster. Ich verstand die Welt nicht mehr, spürte einfach nur den Wandel und empfand tiefe Nähe zu meinem Mueti und auch, dass dies gegenseitig war. Ich versprach dann «teuer und heilig» (so wurden solche Geständnisse von ihr vorformuliert) «es» nie, nie wieder zu tun.
Nach einer Weile hat Vater auch den Ueli heruntergebracht. Wir assen einfach zu Nacht. Aber etwas ging vor in mir. Ich hatte wohl einen «Teilsieg» errungen im Wetteifern mit dem Bruder um die Liebe und Gunst der Mutter! Ich wusste noch genau, wie ich mich einst verzweifelt bemüht hatte, eine entsprechend wirkungsvolle Liebesbezeugung an Mutter zu ersinnen, wie Ueli es gelungen war mit seiner schönen Erklärung: «Mueti, weisst du, ich habe dich so fest lieb, wie der Himmel hoch ist.» Diese Äusserung wurde von Mutter sofort behändigt und überall herumerzählt. Er konnte sich sonnen im Licht der allgemeinen Rührung und vielleicht noch mehr tat dies Mutter für sich. Schnell ist mir klar geworden, dass das nicht zu überbieten war, auch mit der «Tiefe des Meeres» nicht, obwohl ich es versucht hatte.
Nun aber, nach dem problematischen Sieg, den ich durch früheres Verlassen des Ortes unserer Sünde gegen Ueli errungen hatte, und erst recht nach meinem feierlichen Gelöbnis, «es» nie wieder zu tun, erwuchs in mir die erregende Ahnung, dass ich für Mueti wohl etwas Aussergewöhnliches, etwas ganz Besonderes sein musste. Meine spätere, von niemandem je so formulierte Vermutung dazu: Mich, den nie erwarteten Zweitgeborenen, empfand Mutter wohl als «persönliches Geschenk» des lieben Gottes, empfangen für all die Seufzer und Stossgebete, die sie an diesen gewendet hatte, in dunkel-geheimnisvollen Augenblicken ihres Lebens, die – nie angesprochen – ihre Magie stets hatten behalten können. Wir waren also eins, Mutter und ich. Das wollte ich bleiben und ich wurde hellhörig für all ihre Erwartungen und Wünsche. Ich erriet sie, machte sie zu meinen eigenen und war bereit, ihren Plänen zu entsprechen.
Mutter betet
Sie erledigte ihr Gebet zuweilen an einem unserer Betten. Da konnte geschehen, dass ich in ihr Beten kurzerhand mit einbezogen wurde, unergründlich und geheimnisvoll. Mutter konnte sich an meinem Bettchen schräg über mich legen und ihr Kopf lastete schwer auf meinen Wangenknochen. Ganz nahe war sie und etwas schien sie zu bewegen. Da gabs wenig zu verstehen, aber faszinierend war das alleweil, da sie sich meist vorher ein Taschen- oder Kopftuch über ihr Haupt drapiert hatte. Sie sprach dann mit ihm, den eine Frau nur mit Kopfbedeckung anrufen sollte, mit dem «Liebgott» eben, der alles zu heilen wusste, aber auch alles sehen und bestrafen konnte. Mueti war eins mit dem «Liebgott» und ich war dabei: erfahrene Dreieinigkeit? «Dreifaltigkeit», was war das eigentlich? Ich blieb und war «einfältig». Den «Heiligen Geist» verspotten – das habe ich früh gehört – war die Sünde, die nie Vergebung finden würde. Mutter betete. Sprachfetzen waren zumal herauszuhören, wie «tüürechoschbaare, … heilige Vergoscht, … eren Bluet» und wieder ganz unverständliches Gemurmel. (Das teure, kostbare, heilig vergossene Blut des Herrn Jesu war wohl gemeint.)
Mutter liebte lehrreiche Erbauungsreden, aber das waren magische Zauberformeln! Und ich ahnte, dass Mueti wohl gegen Ängste und Sorgen focht mit dem lieben Gott. Es «tschuderte» mich und Ohr und Wange dampften, wenn Mutter sich nach Langem wieder aufrichtete, und ich wollte, dass sie mir ihr dunkelblaues «Jäcklein» überliess zum Einschlafen – das mit den farbig gestickten Blumen.
Nein, von «Freud» hatte ich noch jahrzehntelang keine Ahnung, aber vage zunächst – und dann doch klar als Erinnerung – taucht fetzenweise aus hellgrau vernebelter Kinderzeit auf, was folgt:
Ich liege wach und ein Gedanke lässt mich immer erregter werden. Mutter tritt an mein Bett und fragt, was denn los sei. «Wenn ich einmal gross bin und ein richtiger Mann, dann will ich dich heiraten», versprach ich und war durchaus in einem Gemütszustand, der zu einem Heiratsantrag passte.
«Aber das geht doch gar nicht, mein Lieber», traf mich wie eine kalte Dusche. «Du weisst doch, dass ich schon mit Hermann verheiratet bin.» Daran hatte ich gar nicht gedacht.«Aber», begann ich zu stammeln, «aber ich dachte ja nur, Vati ist doch älter als du, vielleicht wenn er einmal gestorben ist, oder?»
«Nein, denk doch, es ist ganz lieb von dir, aber das geht wirklich nicht, ich bin dann sicher eine alte Frau und du wirst eine jüngere gerne haben, eine in deinem Alter. Ich will doch hoffen, dass auch Vati ganz alt wird.»
Ich konnte nichts mehr entgegnen, schon gar nicht, als sie mir eröffnete, dass Ueli ihr vor Tagen einen ähnlichen Antrag gemacht hatte. Meine Logik war aber nicht imstande, die Sache so eng und endgültig zu verstehen. Auf jeden Fall wollte ich Mutter die Treue halten, auch wenn das tausend Jahre ginge, und Ueli würde da nicht mithalten können. Beharrlich wollte und stur konnte ich alleweil sein. Da war ich mir sicher. Ich glaube, mich sogar wieder daran zu erinnern, wie ich nachts im Bettchen für mich überprüfte ob nicht etwa schon stattgefunden hatte, was sie mir prophezeit hatte. Nein! Es stimmte nicht. Mein Anliegen war noch überhaupt nicht vergessen! Und ein Monat war, gemäss meiner immer wieder gestellten Frage, schon lange vorbei. Ich konnte sehr gut warten.
Jetzt – erst beim Schreiben – wird mir bewusst, dass ich sehr viel später, am Seminar, eher aussichtslos zwar, aber dennoch heftig in die schöne Charlotte mit dem dichten Haar verliebt, erneut dem beschriebenen Muster verfallen war. Es hat mich über Jahre besetzt gehalten und meine natürliche Entwicklung wohl in vielerlei Hinsicht beeinflusst und verzögert. Geduldiges Warten war für mich noch lange eine tatenlos zu erbringende Leistung, die einmal belohnt werden würde – oder könnte, dies eigentlich sollte und schliesslich müsste. Warten ist zur Glaubensfrage geworden. Ich werde auf das Thema zurückkommen.
Vater trug einen Hut, wenn er, vom Berge kommend, unten im Dorf mit mir allein unterwegs war. Im Aktivdienst war er jetzt nur noch selten. Bei seinen Kollegen oder jeder sonst bekannten Grösse, der wir begegneten, lüftete er seinen Fladenhut. Ehrerbietig wurde zurückgegrüsst, und auch sein Söhnchen erhielt Beachtung. Es kam etwa vor, dass einer der Herren mich am Kinn fasste und so meinen Blick nach oben auf sein Antlitz richtete. Dann hörte ich die obligat scheinende Frage: «So, was willst du einmal werden?» Nichts war mir ferner als diese Frage. Ich war doch mit meinem Vater unterwegs und genoss es einfach, mit ihm zusammen aufzutreten. Ich brauchte also nichts anderes zu werden. Der Herr aber insistierte. Einmal antwortete ich: «Ein Zahnbürsteli!», was mit eher laschem Gelächter quittiert wurde. Darum holte ich bei der nächsten derartigen Begegnung aus und gestand, «General» werden zu wollen, der General Guisan natürlich.
Eines Abends kam Vater auf mich zu und sprach, extra – also mit Fleiss, womit er stets absichtlich meinte – sollte ich seine leeren Blumentöpfe aus Ton wirklich nicht zerschlagen. Die Worte hörten sich an, als hätte ich mir einen kleinen, dummen Scherz erlaubt. Was dachte der! Nie würde ich doch so etwas tun! Aber er hat es mir zugetraut und mir nicht einmal eine Strafe angedroht. Man kann sich vielleicht denken, was einer von meiner Strickart darauf sagte: zunächst nichts …! Aber sobald ich mich unbeaufsichtigt fühlte, kam meine beleidigte Reaktion: Keiner der noch intakten Töpfe blieb es! Keiner! Und Kommentar dazu von Vater? Gabs auch keinen! – Ja, war das denn richtig und gerecht?
Mein Gerechtigkeitsfimmel war phänomenal.
Da kommt Mutter her …
Sandhof
So menschlich waren die Kamele 1848
Da noch stattlich: Grossmutter
Hinten: Rösli, Marly, Hedi, Hanni, Hermann W., Marti, Fredel, Gottlieb W, Gottfied, Hermann Sz, Walter und Friedi St.





























