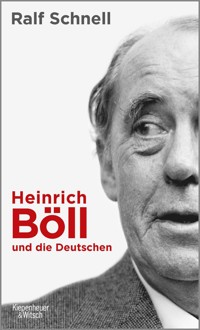
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine scharfsinnige Studie zum 100. Geburtstag eines der bedeutendsten Schriftsteller Deutschlands. Heinrich Böll (1917-1985), geboren in Köln, im Zweiten Weltkrieg einfacher Soldat, nach 1945 Repräsentant der »Trümmerliteratur«, Autor bedeutender Romane, kritischer Intellektueller mit hoher öffentlicher Wirksamkeit und Literaturnobelpreisträger des Jahres 1972. Wie hielt es der Schriftsteller Böll mit den Deutschen, und wie hielten es die Deutschen mit ihm?Ralf Schnell, ausgewiesener Kenner der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, ist Mitherausgeber der Kölner Ausgabe der Werke Heinrich Bölls. Er widmet sich in seinem Buch dem Verhältnis Bölls zu Deutschland und den Deutschen und zeigt in lebendiger, anschaulicher Form, auf welche Weise die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts Bölls Leben geprägt haben – und welche Resonanz die künstlerischen Antworten Bölls bei seinen Lesern fanden.Ausgehend von Bölls Herkunft und Jugend – die kinderreiche Kölner Kleinbürgerfamilie katholischen Glaubens, die Kriegsteilnahme und Gefangenschaft – folgt Schnell den zentralen Aspekten von Bölls Biografie und Werk. Er beleuchtet die literarischen Anfänge des jungen Familienvaters in der Nachkriegszeit, die Auseinandersetzung mit Kriegsschuld und Holocaust, den politischen Konservatismus der Adenauer-Ära, die Formierung des Literaturbetriebs durch die Gruppe 47 und Bölls Verhältnis zur DDR und zur RAF.Unentbehrlich für alle, die Heinrich Bölls Werk kennen oder neu entdecken wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ralf Schnell
Heinrich Böll und die Deutschen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Ralf Schnell
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Ralf Schnell
Ralf Schnell, geboren 1943 in Oldenburg ist emeritierter Professor für Neuere deutsche Literaturgeschichte und Medienwissenschaft. Er studierte an der Universität Köln und an der Freien Universität Berlin. Als Hochschullehrer wirkte er an der Universität Hannover (1972–1987), an der Keio-Universität Tokio (1988–1997) und an der Universität Siegen (1997–2006), die er von 2006 bis 2009 als Rektor leitete. Seit 2010 lebt er in Berlin. Zu seinen wichtigsten Publikationen zählen »Deutsche Literatur von der Reformation bis zur Gegenwart« (2011), »Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945« (2003), »Medienästhetik« (2000), »Germanistik. Was sie kann, was sie will« (2000) und »Dichtung in finsteren Zeiten« (1998).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Heinrich Böll (1917-1985), geboren in Köln, im Zweiten Weltkrieg einfacher Soldat, nach 1945 Repräsentant der „Trümmerliteratur“, Autor bedeutender Romane, kritischer Intellektueller mit hoher öffentlicher Wirksamkeit und Literaturnobelpreisträger des Jahres 1972. Wie hielt es der Schriftsteller Böll mit den Deutschen, und wie hielten es die Deutschen mit ihm?
Ralf Schnell, ausgewiesener Kenner der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, ist Mitherausgeber der Kölner Ausgabe der Werke Heinrich Bölls. Er widmet sich in seinem Buch dem Verhältnis Bölls zu Deutschland und den Deutschen und zeigt in lebendiger, anschaulicher Form, auf welche Weise die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts Bölls Leben geprägt haben – und welche Resonanz die künstlerischen Antworten Bölls bei seinen Lesern fanden.
Ausgehend von Bölls Herkunft und Jugend – kinderreiche Kölner Kleinbürgerfamilie katholischen Glaubens, Kriegsteilnahme und Gefangenschaft – folgt Schnell den zentralen Aspekten von Bölls Biografie und Werk. Er beleuchtet die literarischen Anfänge des jungen Familienvaters in der Nachkriegszeit, die Auseinandersetzung mit Kriegsschuld und Holocaust, den politischen Konservatismus der Ära-Adenauer, die Formierung des Literaturbetriebs durch die Gruppe 47 und Bölls Verhältnis zur DDR und zur RAF.
Unentbehrlich für alle, die Heinrich Bölls Werk kennen oder neu entdecken wollen.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: ullstein bild – B. Friedrich
ISBN978-3-462-31746-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort
1 Ich bin ein Deutscher
2 … das Herz eines Künstlers
3 Das Brot der frühen Jahre
4 ›Körper‹ versus ›Körperschaft‹
5 Die Stadt der alten Gesichter
6 Auferstehung des Gewissens
7 Zur Verteidigung der Waschküchen
8 Keine so schlechte Quelle
9 Soviel Liebe auf einmal
10 … unteilbar wie die Freiheit selbst
11 Gesamtdeutsches Jägerlatein
12 Die Sprache als Hort der Freiheit
13 Ich lebe in dieser Zeit und schreibe für diese Zeit
14 Literaturhinweise
Dank
Für Fiete und Lotte
Vorwort
Nein: Heinrich Böll war nicht der ›gute Mensch von Köln‹ und auch nicht das ›Gewissen der Nation‹. Er war kein praeceptor Germaniae wie Walter Jens und ebenso wenig Moralist im Stile eines Günter Grass. Er hat sich, im Unterschied zu Martin Walser, zu keinem Zeitpunkt dazu verstanden, für die Zeitung einer kommunistischen Partei Kommentare zu schreiben, und er war, obwohl gläubiger Katholik, durchaus kein ›katholischer Schriftsteller‹. Alle diese Bezeichnungen – oder sagen wir richtiger: Klischees – finden sich allenthalben und immer wieder, wenn von Heinrich Böll die Rede ist. Doch keines von ihnen wird ihm gerecht.
Gewiss: Heinrich Böll hat sich eingemischt. Doch er tat dies stets auf eigenes Risiko, auf eigene Verantwortung und im eigenen Namen. Er ließ sich zu keinem Zeitpunkt als Repräsentant vereinnahmen. Und eben deshalb kam der einst bekannteste deutsche Autor als »offizieller deutscher Dichter« auch nicht in Betracht, wie Theodor W. Adorno treffend bemerkte. Böll war, wie er selbst gelegentlich eingeräumt hat, ein »Einzelkämpfer« – ein Begriff, der eine Haltung bezeichnet, keine Position.
Nach der »Haltung« Bölls wird in diesem Buch gefragt, und zwar am Beispiel seines Verhältnisses zu Deutschland und den Deutschen – ein Thema, das die Abgründe eines ganzen Jahrhunderts und den Ertrag eines einzigartigen literarischen Werks umfasst. Es schließt die Verwerfungen ein, die mit den großen historischen und politischen, gesellschaftlichen und kulturellen, geistigen und künstlerischen Entwicklungslinien zwischen 1917 und 1985 einhergehen. Und es rührt an die Problematik einer freien Schriftstellerexistenz, wie wir sie seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts kennen. Es bietet eine Fülle von Provokationen und Irritationen, dieses Thema, und es führt ins Zentrum der Frage, wie die Deutschen ihrerseits umgehen mit ihren großen Autoren und deren Werk, mit Sprache und Literatur, mit dem Verhältnis von ›Poesie‹ und ›Engagement‹.
Heinrich Böll hat in unserem kurzen, allzu kurzen kulturellen Gedächtnis als öffentlicher Intellektueller überlebt. Doch man kann die Reden und Essays, die seine literarische Arbeit bis an sein Lebensende begleitet und ergänzt haben, im Ernst nicht trennen von den frühen Erzählungen oder den Romanen der 1960er- und 1970er-Jahre. Seine öffentliche Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen und Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland erhielt ihre intellektuellen Impulse, ihre gedankliche Schärfe, ihre sprachliche Kraft von seinen literarischen, seinen künstlerischen Wahrnehmungsmöglichkeiten. Der Gesellschaftskritiker ist, wie dieses Buch anhand exemplarischer Stationen seines Weges zu zeigen versucht, ohne den Sprachkünstler nicht zu denken.
Die ausführlichste und eindringlichste seiner autobiografischen Auskünfte hat Heinrich Böll mit der mütterlichsten Frage aller besorgten Mütter überschrieben: »Was soll aus dem Jungen bloß werden?« Bei Heinrich Heine, dem ersten ›freien‹ Autor der deutschen Literaturgeschichte, findet sich als Antwort auf diese Frage ein selbstironischer Hinweis, der sich zwanglos auf Heinrich Böll übertragen lässt: »Er hat es, wie die Leute sagen, auf dieser schönen Erde zu nichts gebracht. Es ist nichts aus ihm geworden, nichts als ein Dichter.«
1Ich bin ein Deutscher
Fremdsein, Heimat, Sprache
Am 16. Dezember 1974 hielt Heinrich Böll einen Vortrag an einem in vielfacher Hinsicht – religiös, historisch, politisch, militärisch – brisanten Knoten- und Kreuzungspunkt der Weltkulturen: in Jerusalem. Den Anlass seines Vortrags bot die Eröffnung der 39. Tagung des Internationalen P.E.N.-Clubs (›Poets, Essayists, Novelists‹). Sie stand unter keinem guten Stern. Die ursprünglich bereits für Dezember 1973 vorgesehene Veranstaltung war wegen der militärischen und politischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten verschoben worden. Die arabischen und sozialistischen P.E.N.-Zentren hatten ihre Teilnahme aus politischen Gründen abgesagt. Nur 30 Delegationen – darunter als größte die aus der Bundesrepublik Deutschland mit 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmern – waren angereist. Den Berichten über die Tagung ist zu entnehmen, dass die Diskussionen über das vom israelischen P.E.N.-Zentrum vorgeschlagene Rahmenthema »Cultural Heritage and Creativeness in the Literature of our Times« im Wesentlichen spannungsfrei, ohne Streit, aber auch ohne Höhepunkte verliefen.
Die Ausnahme bildete die Rede Heinrich Bölls (KA 19, 54–61). Mit guten Gründen hatten die in Jerusalem versammelten Mitglieder des internationalen Autorenverbandes von diesem deutschen Kollegen einen Vortrag erbeten. Der Literaturnobelpreisträger des Jahres 1972 stand auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Er hatte sich seit Mitte der 1950er-Jahre weit über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinaus einen Namen als streitbarer öffentlicher Intellektueller gemacht. 1970 hatte man ihn zum Präsidenten des deutschen P.E.N.-Zentrums (bis 1972), nur ein Jahr später zum Präsidenten des Internationalen P.E.N. gewählt, ein Amt, das Böll im Mai 1974 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Doch nicht allein solcher Funktionen wegen schien er für eine programmatische Rede prädestiniert. Sondern man erhoffte sich von ihm einen wegweisenden Beitrag vor allem deswegen, weil sich Böll immer aufs Neue für verfolgte und unterdrückte Schriftsteller, zumal in den Staaten des Warschauer Pakts, eingesetzt hatte. Wegen dieses Engagements war er in Ost und West immer wieder gewürdigt, aber auch angefeindet worden. Der Ruf und das Renommee dieses Autors sollten auch dem Schriftstellerverband Resonanz und Gehör verschaffen.
Böll enttäuschte die in ihn gesetzten Erwartungen nicht. Bereits mit dem ersten Satz seiner Rede thematisierte er den – aus seiner Sicht – zentralen historischen Konflikt des 20. Jahrhunderts: Er nannte es »das Jahrhundert der Vertriebenen und der Gefangenen«. Unmissverständlich bezog er in diese Zuschreibung die Geschichte des »jüdischen Volks« ein, ausdrücklich hob er die Sprachtradition und die literarische Kultur des Judentums hervor. Ebenso unmissverständlich wies Böll jedoch auf die »grausame Voraussetzung« jeder Vertreibung hin und explizit auch auf die Realität des israelisch-arabischen Konflikts: darauf, »daß der, der die Vertreibung und die Angst vor ihr kennt, in den grausamen Zwang gerät, andere zu vertreiben, auf der Suche nach einer neuen Heimat andere in jenen Zustand versetzt, dem er gerade entgangen ist«.
Implizit war damit auch das Verhältnis von Ursache und Wirkung im Nahostkonflikt angesprochen, präziser: die Teilung Palästinas und die Gründung des Staates Israel 1948, der Palästinakrieg 1948/49 und seine Folgen, zu denen im Jahr 1974 auch der Sechstagekrieg von 1967 und der Jom-Kippur-Krieg von 1973 zählten, ebenso die Unterdrückung der Palästinenser durch den Staat Israel und der ursächliche Anteil Israels an den militärischen Interventionsversuchen der arabischen Staaten. Böll traf damit den Puls der Zeit und den Nerv der Tagung. »Die arabische Frage, Existenzproblem Israels«, so konnte man wenig später in einem Bericht Hilde Spiels von der P.E.N.-Tagung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) lesen, »wurde bereits am ersten Abend an den Kongreß herangetragen«. Es sei Böll gewesen, »der den verhängnisvollen Umstand betonte, daß ›Völkerwanderung immer auch Völkervertreibung‹ gewesen ist« (KA 19, 410). Eine These, die in der israelischen Presse seinerzeit nicht eben zustimmend aufgenommen wurde.
Doch Böll hielt in Jerusalem nicht nur eine politisch-programmatische, sondern zugleich eine sehr persönliche Rede. Der nachträglich gewählte Titel gab diesem persönlichen Anteil Ausdruck: Ich bin ein Deutscher – das war, zumal in Israel, zweifellos ein bekenntnishafter Satz. Merkwürdigerweise aber findet sich dieser Satz im Vortragstext selbst an keiner Stelle. Zurückhaltender gesagt: Er findet sich lediglich in einer eigenwilligen Umschreibung: »It was not very pleasant to be a German – and it still not is.« (›Es war nicht sehr angenehm, ein Deutscher zu sein – und das ist es immer noch nicht.‹) Merkwürdig, in der Tat: Der zu diesem Zeitpunkt bekannteste Autor deutscher Literatur nach 1945 hält 1974 in Jerusalem vor Schriftstellern aus aller Welt eine Rede in deutscher Sprache mit dem Titel »Ich bin ein Deutscher«. Den einzigen Satz aber, der ihn als Deutschen identifiziert, sagt er auf Englisch, noch dazu in einer Umschreibung, die eher ein Ausweichen als ein Bekenntnis andeutet.
Der Gedanke liegt nahe, Böll habe sich an dieser Stelle seiner Jerusalemer Rede eines Stilmittels aus dem Repertoire des epischen Theaters bedient. Mit Bertolt Brecht könnte man von einem ›Verfremdungseffekt‹ sprechen. Denn es handelt sich um den Versuch, etwas Vertrautes – in diesem Fall: »Ich bin ein Deutscher« – in einem ganz wörtlichen Sinn ›fremd‹ erscheinen zu lassen, es buchstäblich zu ›verfremden‹, und so den eigentlich gemeinten Sinn kenntlich zu machen. Doch es geht Böll um etwas anderes als um einen bloßen Effekt und um mehr als nur um eine ›Verfremdung‹ im Brecht’schen Sinn. Ausdrücklich bezieht sich Böll in seinem Vortrag auf eine »geistesgeschichtliche Tradition, die dieses Fremdsein metaphysisch interpretiert«, eine Formulierung, die den religiösen und philosophischen Diskurs einer transzendentalen Obdachlosigkeit des Menschen ebenso einschließt wie den Marx’schen Begriff der ›Entfremdung‹ mit seinen gesellschaftlichen Implikationen. Böll war sich, jenseits aller philosophischen und soziologischen Traditionen, auch der unstillbaren Sehnsucht des Menschen nach Transzendenz bewusst, der Dimension des Glaubens also. Er hat diese »Tatsache« 1983 gesprächsweise mit den Worten umschrieben, »daß wir hier auf der Erde nicht zu Hause sind, nicht ganz zu Hause sind. Daß wir also noch woanders hingehören und von woanders herkommen« (KA 26, 311). In diesem Bewusstsein teilt sich eine Irritation mit, deren Substanz das Attribut ›fremd‹ auf angemessene Weise wiedergibt. Es geht Böll um das »metaphysisch« begründete Problem des Fremdseins in der Welt: um Fremdheit im Verhältnis zur deutschen Geschichte und zur deutschen Politik, zu Herkunft und Heimat, sogar zum eigenen Werk. Böll gibt mit seiner Rede dieser Irritation in Gestalt suggestiver Fragen Ausdruck: »[S]ind wir nicht alle fremd auf dieser Erde? Fremd im eigenen Land, in der eigenen Familie, und gibt es da nicht Augenblicke, wo einem die eigene Hand so fremd wird wie die eigene Wohnung?«
›Fremdsein‹ ist für Böll, wie diese Fragen zeigen, kein psychologischer Terminus. ›Fremdsein‹, so wie Böll es versteht, ist eine existenzielle Kategorie. Sie spricht von seinem Weltverhältnis. Sein Verständnis von ›Fremdsein‹ schließt die Beziehung zu den nächsten Menschen ebenso ein wie die zum eigenen Land. Es umgreift die eigene Person wie die vertrauteste Umgebung. Der Literaturnobelpreisträger zieht, um dieses Thema durchzuspielen, alle Register seines Könnens. Er schildert die Stationen, an denen sich das Fremdsein in der Welt für ihn konkretisiert hat. Er nimmt dafür die bekannten Themen seines Frühwerks wieder auf: Krieg und Tod, Trümmer und Elend, Flucht und Vertreibung. Er spricht über die Unterdrückung der und über die Unterdrückung durch Sprache, über den Anteil der Deutschen an der Geschichte der Zerstörungen im 20. Jahrhundert und über die des Deutschen an den historischen Katastrophen. Er zeigt sich als historischer Analytiker wie als politischer Kommentator. Und er nutzt seine poetischen Mittel, um von jenen Splittern und Fragmenten zu erzählen, die das ›Fremdsein‹ zur Grunderfahrung gemacht haben. »Was noch zu meiner Erinnerung gehört: der Staub und die Stille. Der Puder der Zerstörung drang durch alle Ritzen, setzte sich in Windeln, Bücher, Manuskripte, aufs Brot und in die Suppe, er war vermählt mit der Luft, sie waren ein Herz und eine Seele«, so Böll im Rückblick auf die unmittelbare Nachkriegszeit in Köln. »Das andere war […] die Stille. Sie war so unermeßlich wie der Staub, und nur die Tatsache, daß sie nicht total war, machte sie glaubwürdig und erträglich. Irgendwo bröckelten in diesen unermeßlichen stillen Nächten lose Steine ab oder stürzte ein Giebel ein; die Zerstörung vollzog sich nach dem Gesetz umgekehrter Statik, mit der Dynamik im Kern getroffener Strukturen, und manchmal auch konnte einer am hellen Tag beobachten, wie ein Giebel sich langsam, fast feierlich senkte, Mörtelfugen sich lösten, weiteten wie ein Netz – und es prasselten Steine. Die Zerstörung einer großen Stadt ist kein abgeschlossener Vorgang wie eine Operation, sie schreitet fort wie Paralyse, es bröckelt allenthalben, bricht dann zusammen.«
Man darf diese Beobachtungen aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, Bölls buchstäblich atemberaubende Eindrücke inmitten der zertrümmerten Stadt, die geradezu körperliche Empfindung einer alles umschließenden, alles durchsetzenden Stille, die sich in das Getöse unaufhaltsamer Zerstörung und Vernichtung verwandelt – man darf diese Erinnerungsfetzen und Wahrnehmungsfragmente als Versuche zur Beschreibung einer Katastrophe verstehen, die nicht nur die Statik der städtischen Architektur, nicht allein die Struktur der Häuser und der Wohnungen betraf. Betroffen war vielmehr, bis in die feinsten Fasern seiner Existenz, der einzelne Mensch, der den Untergang seiner Welt, seiner Geschichte, seiner Kultur, seiner Traditionen, seiner Identität erfährt. Doch Bölls Rede will alles andere sein als eine Klage über die Verluste, die mit den Stadien konkreter Fremdheitserfahrung einhergehen. Ihr Autor will sie vielmehr als einen »Hymnus« verstanden wissen: »ein Hymnus auf eine neue Heimat, die aus dem Staub des kulturellen Erbes bestand«. Um aus der existenziellen Erfahrung des Fremdseins in der Welt und angesichts einer Wüste aus Trümmern im Jahr 1945 zu einem neuen Selbstverständnis zu finden, bedurfte es des Einsturzes alles Vertrauten und aller Gewissheiten: »Der freiwillige, weder durch Sprengung noch sonstige akute Gewalt bewirkte Einsturz einer hohen Giebelmauer«, so Böll in seiner Jerusalemer Rede, »ist ein unvergeßlicher Anblick; in irgendeiner, nicht voraussehbaren, schon gar nicht berechenbaren Sekunde gibt dieses schöne, geordnete, in Zuversicht und Lust zusammengefügte Gebilde nach; es zählt, fast unhörbar tickend, knisternd, vom Datum seiner Entstehung auf Null zurück […] und gibt sich auf. Das war unsere neue Heimat, und wir nahmen sie an.«
Das Band zu einem Deutschland, das der zurückkehrende Soldat ›Heimat‹ hätte nennen können, war durch den Krieg zerrissen worden. Zur Erfahrung des Fremdseins tritt in diesem historischen Augenblick eine neue Erfahrungsdimension hinzu: die der Freiheit. Der Anblick einstürzender Altbauten vermittelt den Eindruck einer einzigartigen Rückabwicklung von Geschichte. Es handelt sich um das Ende der Vorstellung, Geschichte als einen Prozess verstehen zu können, in dem sich das Vertrauen in gesellschaftlichen Fortschritt und die Freude an der Weltgestaltung noch in der Architektur bürgerlicher Lebenswirklichkeit vergegenständlichen ließen. Diese Welt ist unwiderruflich eingestürzt. Ihr Einsturz repräsentiert den Verlust aller Gewissheiten und das Ende einer Epoche: Zurück auf »Null«.
Böll war sich durchaus darüber im Klaren, dass es 1945 einen »Nullpunkt« in einem politisch oder ökonomisch, sozial oder kulturell geprägten Verständnis nicht gegeben hat. Spätestens mit der Wiederaufrüstung in den 1950er-Jahren war auch für ihn sichtbar geworden, »daß eigentlich die Kreise, die die größte Schuld am Heraufkommen der Nazis hatten, also Industrielle und Großbürgertum, auch der Adel, unbeschädigt den Krieg überstanden hatten, und ob sie Nazis waren oder nicht, das spielte plötzlich gar keine Rolle« (KA 25, 297). Seine Beschreibung des Einsturzes einer Giebelmauer nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs unterstellt denn auch keinen historischen ›Nullpunkt‹. Doch sie vermittelt einen authentischen Eindruck von der Prägnanz des schöpferischen Neubeginns: der Erfahrung eines Nichts, das sich als Freiheit bestimmen und als ›neue Heimat‹ verstehen lässt.
Nun war ›Heimat‹ in Deutschland immer schon ein schwieriger und strittiger Terminus, mit hermeneutischen Variablen und charakteristischen Untiefen, semantisch vieldeutig schillernd und politisch vielfältig beansprucht, wenn nicht missbraucht. Seine philosophisch prägnanteste Bestimmung fand er in der berühmten Schlusswendung von Ernst Blochs Hauptwerk Das Prinzip Hoffnung, nach welcher »der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch« als »Wurzel der Geschichte« gesehen wird: »Hat er sich erfaßt und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand zu Hause war: Heimat.« Von dieser Vision ist Bölls durch den Krieg geprägter Wahrnehmungshorizont denkbar weit entfernt. Sehr viel näher dürfte ihm die Einsicht eines Jean Améry gewesen sein, der sich, gezeichnet durch Exil und Gestapo-Folter, in seinem Essay »Wieviel Heimat braucht der Mensch?« 1967 zu der erfahrungsgesättigten Formulierung verstand: »Die Heimat ist das Kindheits- und Jugendland. Wer sie verloren hat, bleibt ein Verlorener, und habe er es auch gelernt, in der Fremde […] mit einiger Furchtlosigkeit den Fuß auf den Boden zu setzen.«
Dies war eine Selbstwahrnehmung, in der sich auch Böll hätte erkennen können. Doch sein Weg war ein anderer. Ein Deutscher zu sein, hieß für ihn im Jahr 1945, die persönliche Biografie wie die Geschichte des eigenen Landes neu zu sehen, neu zu verstehen und neu zu bestimmen. Die persönliche Erfahrung eines existenziellen Nichts im Jahr 1945 war für ihn eine Freiheitserfahrung, die alte Verbindlichkeiten und Verpflichtungen, Traditionen und Ideologien außer Kraft setzte – vorausgesetzt, »wir nahmen sie an«. Eine einzigartige Möglichkeit, diese Erfahrung anzunehmen, sah Böll für sich in der Sprache. Sie erwies sich für den Kriegsheimkehrer, der Schriftsteller werden wollte, als das Medium einer Selbstbegegnung, die ihm eine neue Sicht auf Deutschland und die Deutschen eröffnete. Und sie blieb für ihn zeit seines Lebens ein entscheidendes Kriterium zur Beantwortung der Frage, inwieweit Tradition und Geschichte aufeinander verwiesen sind: »[I]ch glaube, daß jeder, der in einer Sprache schreibt, eine Vorstellung haben müßte, wo diese Sprache eine geschichtliche oder politische Heimat hat« (KA 24, 45). Man darf Bölls programmatische und persönliche Jerusalemer Rede in diesem Sinn als die rückblickende Beschreibung eines Epochenbruchs verstehen, der ihm neue Horizonte erschlossen hat. Ausdrücklich zitiert er den russischen Dichter Joseph Brodskij, der zwei Jahre zuvor aus der Sowjetunion ausgewiesen worden war. Der spätere Literaturnobelpreisträger (1987) hatte mit allem Nachdruck gegen seine Ausbürgerung protestiert. »Sprache ist etwas viel Älteres und Unvermeidlicheres, älter als der Staat«, so schrieb er in einem Brief an den damaligen Staats- und Parteichef der KPdSU, Leonid Breschnew. Ein Credo, das Böll mit dem sowjetischen Dissidenten vorbehaltlos teilte. 1976 widmete er ihm seine Rezension Sprache ist älter als jeder Staat, ein programmatischer Titel, auch in eigener Sache.
Zwar bezeichnete sich Böll wiederholt ganz unprätentiös als »Staatsbürger und Bürger der Bundesrepublik Deutschland«. Zwar hat er in einem Gespräch mit dem russischen Germanisten Lew Kopelew betont: »Ich definiere mich ganz eindeutig, ohne jede Einschränkung, als Deutscher« (KA 25, 528f.). Zwar entwickelte er – »als einer, der dort und dort wohnt, der Steuern zahlt, der Kinder hat, die zur Schule müssen« (KA 25, 294) – ein durchaus pragmatisches Verhältnis zum deutschen Staat, mit allen hieraus sich ergebenden Verpflichtungen des bürgerlichen Alltags. Doch seine Identität als Autor, als Künstler wie als Intellektueller, ging über solchen staatsbürgerlichen Pragmatismus weit hinaus. »Ich glaube, daß jemand mit der Sprache, in der er schreibt, mehr bekennt als Nationalitäts-Zugehörigkeit«, so Böll 1978: »Es gibt überhaupt keine höhere Form des Bekenntnisses zu einem Volk, als in seiner Sprache zu schreiben« (KA 25, 293).
2… das Herz eines Künstlers
Herkunft, Familie und Krieg
Verschiedentlich hat sich Heinrich Böll in autobiografischen Skizzen zu seiner Herkunft und seiner Familie, zu Kindheit und Jugend, zu seinen Prägungen und seiner Entwicklung als Schriftsteller geäußert. Zu solchen Skizzen zählen Selbstvorstellung eines jungen Autors (1953), Biographische Notiz (1956), Über mich selbst (1959), Raderberg, Raderthal (1965), Was soll aus dem Jungen bloß werden? Oder: Irgendwas mit Büchern (1981), Hoffentlich kein Heldenlied (1981) und Brief an meine Söhne oder vier Fahrräder (1985). Es sind Erinnerungen, Beobachtungen und Auskünfte in einem teils nüchtern-sachlichen, teils kritisch-sarkastischen, teils humorvoll-ironischen Ton. Bisweilen vernimmt man aus ihnen den ungebrochenen Zorn auf die Zeit in »Angst und Schrecken« unter dem Hitler-Regime (KA 21, 403), bisweilen spricht sich in Form von Anekdoten, Arabesken und Andeutungen die Liebe zum skurrilen oder auch intimen Detail aus.
Allerdings darf man nicht jeden geschilderten Vorgang als factum brutum verstehen und nicht jede der Informationen für bare Münze nehmen. Wie bei allen autobiografischen Erinnerungsdokumenten bleibt auch in den entsprechenden Skizzen Heinrich Bölls die Subjektivität des Verfassers in seinen Wahrnehmungen präsent, zur Erheiterung wie zur Irreführung des Lesers. Ein Beispiel: »Meine väterlichen Vorfahren kamen vor Jahrhunderten von den Britischen Inseln, Katholiken, die der Staatsreligion Heinrichs VIII. die Emigration vorzogen«, heißt es in Über mich selbst: »Sie waren Schiffszimmerleute, zogen von Holland herauf rheinaufwärts, lebten immer lieber in Städten als auf dem Land, wurden, so weit von der See entfernt, Tischler.« (KA 12, 31f.) Das klingt nach einer langen familiären Tradition und passt vorzüglich zum großväterlichen und väterlichen Beruf des Schreiners und Holzschnitzers. Doch ist die Familiengeschichte der Bölls, so wie sie hier geschildert wird, in keiner gesicherten Quelle nachzuweisen. Fest steht lediglich, dass ein seit 1720 bestehendes Haus in Xanten (Niederrhein) als Stammhaus der Familie Böll gelten kann. Hier wurde Heinrich Böll, Sohn eines Tagelöhners und Großvater des Schriftstellers, 1829 geboren, ein Schreinermeister, der 1850 nach Essen zog. Sein Sohn Viktor, Heinrich Bölls Vater, gleichfalls Schreinermeister, zog 1896 nach Köln um. Mehr lässt sich, historisch gesichert, kaum nachweisen. Ebenso wenig lässt sich die anschließend geschilderte »erste Erinnerung« des Kindes aus dem Jahr 1919 beglaubigen, die sich auf »Hindenburgs heimkehrende Armee« (KA 12, 32) beziehen soll. Zwar mögen Teile der Armee des Generalfeldmarschalls seinerzeit »grau, ordentlich, trostlos« in Sichtweite des Hauses an der Teutoburger Straße vorbeigezogen sein, in dem Heinrich Böll am 21. Dezember 1917 geboren wurde. Doch die dem Kind unterstellte Erinnerungsfähigkeit vermag kaum zu überzeugen – der kleine Heinrich dürfte zu diesem Zeitpunkt nicht einmal eineinhalb Jahre alt gewesen sein.
Authentizität bedeutet nicht Faktentreue. Auch wenn sich Böll bei manchen seiner Angaben geirrt haben mag, auch wenn einige seiner Erinnerungen sich vermutlich aus Erzählungen der Familienmitglieder zusammensetzen, auch wenn diese oder jene Einzelheit eher seiner Lust am Fabulieren als der harten Realität entsprungen sein sollte – die Hintergründe und das Atmosphärische, die Empfindungen und Stimmungen, die einzelnen Facetten und ihre Farbigkeit müssen als poetische Transformationen ernst genommen werden, als literarische Aneignung von Realitätsmaterialien, als Umwandlung von Elementen und Partikeln der Wirklichkeit in Literatur.
Auch hierfür ein Beispiel. Bölls frühe Kindheit wird in seinen Skizzen durch die Wahrnehmung zweier heterogener gesellschaftlicher »Lager« bestimmt, von den Gegensätzen zwischen »dem bürgerlichen und dem sozialistischen (das waren damals noch wirkliche Gegensätze!), oder von den ›Roten‹ und den ›besseren Leuten‹«, so Böll 1965 in seinem Essay Raderberg, Raderthal (KA 14, 381–390): »Mich zog’s immer in die Siedlung, die wie unsere neu erbaut war, in der Arbeiter, Partei- und Gewerkschaftssekretäre wohnten; dort gab es die meisten Kinder und die besten Spielgenossen, immer genug Kinder, um Fußball, Räuber und Gendarm, später Schlagball zu spielen. Meine Eltern störte es nicht, daß ich die meiste Zeit bei den ›Roten‹ verbrachte.« Das Köln der gehobenen Stände, der Professoren und Prokuristen, der Architekten und Bankdirektoren, war ganz offensichtlich weniger attraktiv. Auf der Straße, bei den »roten« Kindern, lernte der junge Böll, was er nach eigenem Bekunden im bürgerlichen Teil der Stadt nicht kennengelernt hätte: Abenteuer des Alltags, Sport- und Geschicklichkeitsspiele, Wettkämpfe und Mutproben. Diese Variationen einer klassischen Unterschicht-Sozialisation bilden die gesellschaftlichen Wahrnehmungen des Kindes aus, das mit ihnen groß wird. Es entspringt seiner familiären Herkunft und seiner lebensgeschichtlichen Prägung, dass Böll solche Tugenden bei Angehörigen der sozialen Unterschicht, des Proletariats und des Kleinbürgertums entdeckt. Aus ihnen entsteht, durchaus glaubwürdig, das Fundament, aus dem später die Parteilichkeit des Schriftstellers und seine kritische Sicht auf die politische und soziale Wirklichkeit der Bundesrepublik Deutschland erwachsen.
Was für die autobiografischen Skizzen gilt, lässt sich in vergleichbarer Weise auch für die frühesten literarischen Arbeiten sagen. Im Duktus der Kalendergeschichten Johann Peter Hebels etwa setzt die Erzählung Jugend ein (KA 1, 68–90), die Böll 1937, mit knapp 19 Jahren, verfasst hat: »In der dunklen Webergasse der alten Stadt Köln, im Hofe des alten baufälligen Hauses, betrieb der alte Meister Bolanders sein Handwerk als Schreiner.« Eine Stadt, eine Wohnung und ein Mensch werden hier durch das wiederholte Attribut »alt« so miteinander verknüpft, dass aus dem Zusammenspiel mit den Stimmungswerten der Straße (»dunkel«) und des Hauses (»baufällig«) eine Atmosphäre des Verfalls entsteht, die sich am Ende in einer blutigen, expressionistisch inspirierten Tragödie entlädt. Auf den ersten Blick handelt es sich um eine Schulgeschichte, wie wir sie aus anderen Werken des frühen 20. Jahrhunderts kennen, von Hermann Hesse (Unterm Rad, 1906) über Robert Musil (Die Verwirrungen des Zöglings Törleß, 1906) bis zu Ödön von Horváth (Jugend ohne Gott, 1937). Was Bölls frühe Erzählung jedoch abgrenzt von vergleichbaren Werken, das ist – neben der Hervorhebung religiöser und musikalischer Motive – der inhaltliche Akzent auf der städtischen Szenerie. Die »Erkenntnis, daß die Stadt eine Insel der Armut war«, prägt auch Bölls Figuren, den erst 17-jährigen Paul und seine Freunde, sie brennt sich ihnen ein und bringt sie schließlich zum Verstummen. So entwirft sich der junge Autor eine, seine städtische Welt.
Orientierung, weltanschaulich wie religiös, bot dem Heranwachsenden – in weit höherem Maß als etwa der Besuch des altsprachlichen Gymnasiums – der engere Kreis der Familie. Sein Vater Viktor hatte gemeinsam mit einem Berufskollegen ein Atelier für kirchliche Schnitzwerke gegründet, mit Werkstätten und Arbeitsplätzen, an denen erfolgreich Altäre, Beichtstühle, Orgelgehäuse und Kirchenbänke hergestellt wurden, bis sich mit der Weltwirtschaftskrise 1929 empfindliche Rückschläge bemerkbar machten, mit Auftragsrückgängen, Kreditschwierigkeiten und finanziellen Einbußen. Böll wuchs, als jüngstes von sechs Kindern aus der zweiten Ehe seines Vaters, in einer zwar katholisch bestimmten, doch vergleichsweise liberalen Umgebung auf, die für ihn dauerhaft prägend geblieben ist. Er hat seiner familiären Bindung und damit auch seinem Dank an die Familie in indirekter Form verschiedentlich Ausdruck gegeben, in Texten, die sich als eine Art Vermächtnis an die nachwachsenden Generationen verstehen lassen. So ist der 1985 verfasste Brief an meine Söhne oder vier Fahrräder





























