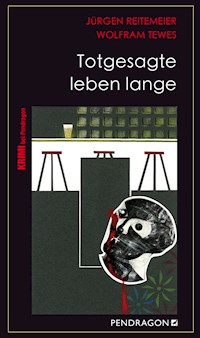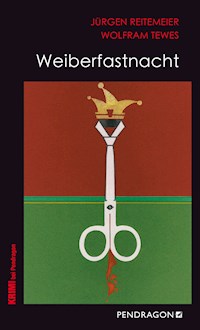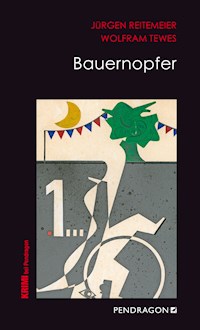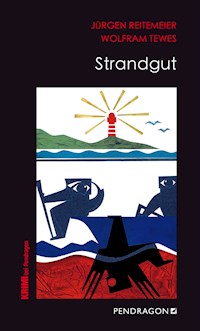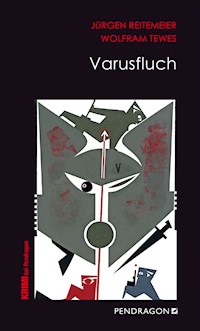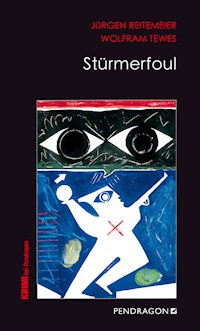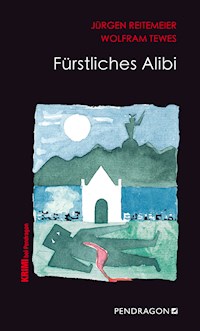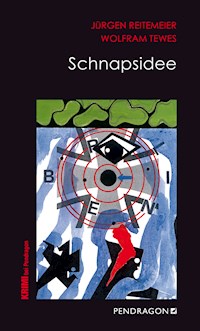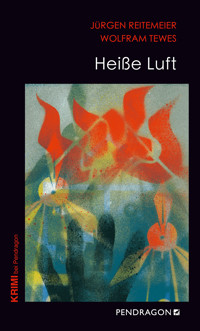
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jupp Schulte ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein Dorf in Aufruhr: Am Abend der Bundestagswahl brennt ein Haus nieder. Ex-Kommissar Jupp Schulte genießt seinen wohlverdienten Ruhestand, doch das Feuer forderte das Leben eines guten Freundes. Zunächst spricht vieles für einen Unfall, aber Schulte hat von Anfang an Zweifel. Zeitgleich sollen im Dorf mehrere Windräder errichtet werden – ausgerechnet auf dem Grundstück des verstorbenen Klaus Krukemeier. Es geht um viel Geld und plötzlich herrscht Goldgräberstimmung im Dorf. Derweil streiten sich Witwe und Schwiegermutter um das Erbe und dann taucht auch noch eine geheimnisvolle Besucherin aus Amerika auf. Obwohl Schulte versucht, sich aus den Mordermittlungen herauszuhalten, stolpert er ständig über neue Widersprüche. Am Ende steckt hinter all dem wohl mehr als nur heiße Luft …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JÜRGEN REITEMEIER WOLFRAM TEWES
Heiße Luft
PENDRAGON
Das ist doch …, werden Sie vielleicht beim Lesen denken. Aber wir müssen Sie enttäuschen – alle Personen der Handlung sind völlig frei erfunden. Ähnlichkeiten mögen reizvoll sein, sind aber rein zufällig und keinesfalls beabsichtigt.
Juni 2014
Mit aller Kraft drückte er den Kofferdeckel nach unten. Der große Reisekoffer war bereits so vollgestopft, dass sich der Deckel wölbte. Alles drin? Hektisch blickte er sich um. Auf keinen Fall durfte er wichtige Unterlagen in der Wohnung lassen. Aber Gründlichkeit und Eile sind keine guten Partner, und eilig hatte er es. Verdammt eilig sogar. Wieder und wieder öffnete der stämmige Mann mit dem dunkelblonden Vollbart und dem Tattoo, das einen stilisierten Wirbelsturm auf dem linken Unterarm zeigte, einen der Koffer, suchte etwas Bestimmtes und atmete erst durch, wenn er es gefunden hatte. Kein einziges Kleidungsstück war darin. Aber zwei Notebooks, eine externe Festplatte, jede Menge Aktenordner und unzählige lose Blätter – ein komplettes Büro.
Wieder warf er einen schnellen, zunehmend panischer werdenden Blick auf die Wanduhr. Eine Armbanduhr besaß er nicht, das hätte nicht dem selbst gewählten Image des schlampigen Genies mit der Mission Weltrettung entsprochen. Er musste weg – auch auf die Gefahr hin, irgendwas übersehen zu haben. Sein Tesla stand bereits vor dem Haus, den Akku hatte er über Nacht geladen. Also los! Er zerrte den schweren Koffer vom nun leeren Schreibtisch und wollte den ersten Schritt zur Tür machen – im selben Augenblick krachte es wie bei einem Gewitter, die Zimmertür flog auf, knallte gegen die Wand, vier schwarz gekleidete, vermummte Gestalten drangen in den Raum, Maschinen
pistolen im Anschlag. In der nächsten Sekunde spürte er, wie kräftige Arme ihn zu Boden rissen, auf den Bauch drehten und seine Hände hinter dem Rücken mit Kabelbindern fixierten. Alles war so schnell gegangen, dass er seine Lage noch gar nicht erfasst hatte, als ein Mann in Zivil ebenfalls in den Raum kam, sich vor ihn stellte, eine Weile auf ihn herunterblickte und sagte: „Schau an, die Ratte will das sinkende Schiff verlassen. Zum Glück haben wir einen guten Tipp bekommen. Dann wollen wir doch mal sehen, was Sie in Ihrem Koffer haben.“
1
Es hatte gedauert. Doch jetzt stand das neue Haus.
„Ich wollte nie bauen, jedenfalls nicht für den Eigenbedarf “, gestand Bodo Bruschetta seinem Freund Schulte. Die beiden Männer werkelten in der neuen Küche, sie bereiteten das Abendessen vor.
„Du kannst dir nicht vorstellen, welchen Stress es immer wieder mit den Handwerkern gab. Wenn ich es mir recht überlege, das Beste während der ganzen Bauphase waren deren Ausreden, warum sie doch nicht gekommen sind oder wieso ein Fehler im Endeffekt keiner war, jedenfalls keiner, den sie zu verantworten hatten.“
Jetzt, am Ende des Bauprojektes, strahlte Bruschetta vor guter Laune. Während der Bauphase hatte Schulte allerdings öfter beobachten können, dass sein Freund sein Temperament nicht zügeln konnte.
Vor mehr als einem Jahr hatte ein Profikiller im Auftrag seiner Brüder eine Bombe in Bruschettas Haus deponiert. Doch Profi hin oder her, der Mann hatte einen tödlichen Fehler begangen. Er hatte die Bombe an den Hausstromkreis angeschlossen. Dabei übersah er, dass die Beleuchtung im Flur über einen Bewegungsmelder gesteuert wurde. Diese Tatsache führte letztendlich dazu, dass der Killer unwissentlich den Sensor selbst aktivierte und sich so in die Luft jagte. Bei dieser Aktion musste nicht nur der Bombenleger sein Leben lassen. Auch das Haus wurde bei der Explosion so in Mitleidenschaft gezogen, dass es bis auf die Grundmauern abgerissen werden musste, um es dann neu aufzubauen. Bruschetta hatte italienische Wurzeln, das wusste Schulte, doch wo genau die in Italien lagen, das war ihm nicht bekannt.
„Sag mal Bodo, aus welchem Teil Italiens kommen deine Vorfahren eigentlich?“, fragte er ihn daher.
Bruschetta bekam einen wehmütigen Gesichtsausdruck. „Meine Familie kommt aus dem kleinen Ort Torrita di Siena, er liegt in der Nähe von Montepulciano in der Toskana. Es ist sehr schön da, und ich versuche mindestens einmal im Jahr dort ein paar Tage zu verbringen. Heute Abend gibt es im Übrigen eine Fenchelsalami aus Torrita di Siena, von einem Schlachter namens Belli. Die Wurst ist großartig.“
Während Bodo Bruschetta von der Heimat seiner Vorfahren schwärmte, holte er einen Nudelteig aus dem Kühlschrank. „Die Nudeln, die wir jetzt machen werden, heißen Pici und sind ebenfalls eine Spezialität der Region.“
Das Abendessen war wunderbar gewesen und nun saßen Bruschetta, seine Freundin, die Staatsanwältin Zoé Stahl, sowie Schulten-Jupp und Adelheid Vahlhausen vor einem weichen Grappa, den sie in kleinen Schlucken genossen.
Schulte streichelte sich seinen Bauch. „Ich bin so was von genudelt. Das war einfach zu gut.“ Er sah grinsend in die Runde. „Ja, ich weiß, die Hälfte hätte es auch getan, aber weniger zu essen wäre eine zu große Überwindung gewesen.“
Adelheid Vahlhausen lächelte. „Du musst dich nicht entschuldigen, ich glaube, es geht uns allen so. Bei dem köstlichen Essen konnte sich, glaube ich, keiner zurückhalten.“
„Und der Rotwein“, führte Zoé Stahl die Lobeshymne fort. „Der ist ja so was von lecker.“ Sie besah sich das Etikett. „Vino Rosso Nobile di Montepulciano“, las sie, „und der Winzer heißt Crociani.“
„Den habe ich mitgebracht, als ich im Herbst in der Toskana war. Ebenso wie die Salami, den Käse und den Schinken. Wenn ich dort bin, ist der Wein von der Cantina meine Hausmarke.“
„Hach, Italien“, seufzte Adelheid Vahlhausen. „Manchmal, wenn es hier in Lippe so trist und grau ist, denke ich, man sollte einige Monate des Jahres in einer solchen Gegend verbringen.“
Bodo nickte. „Ich habe den Großteil meiner Liegenschaften in Berlin verkauft. Irgendwann war ich nur noch müde von dieser Stadt. Besonders von den Kreisen, in denen ich immer wieder gezwungen war, mich zu bewegen. Na, jedenfalls habe ich ein bisschen Geld flüssig. Also warum nicht ein kleines Anwesen in Italien?“
„Könnte ich mir auch vorstellen“, sinnierte Schulte zur Verwunderung aller.
„Du bekommst doch schon Heimweh, wenn du mal nach Warburg musst“, stellte Adelheid amüsiert fest.
„Quatsch, ich war sogar schon mal in Italien. Das muss so um 1978 gewesen sein. Da bin ich mit ein paar Kumpeln nach Korsika gefahren. Und stellt euch vor, auf dem Weg dorthin war ich in einer Osteria essen.“
„Und wie sieht es mit der Finanzierung eines solchen Projektes bei dir aus?“, stellte Adelheid die nächste Frage. Sie wusste zwar, dass Schulte bescheiden lebte, aber ob sein Erspartes für ein Haus in der Toskana ausreichen würde, da hatte sie so ihre Zweifel.
Schulte schenkte sich ein weiteres Glas Rotwein ein. „Tja, was soll ich sagen, Handwerk hat goldenen Boden.“
„Na, aber du bist Polizist und kein Handwerker“, stellte Zoé Stahl trocken fest.
„Ich war Polizist“, sagte er und hob den Zeigefinger. „Aber mein Vater war Handwerker. Tischler und Sargverkäufer. Und sein Kumpel Luhi war Maurermeister.“
„Okay?“, kam es neugierig von Zoé Stahl. „Und was willst du uns damit sagen?“
„Nun ja“, kam es bedächtig von Schulte. „Dieser Maurermeister, der hat nicht nur Häuser für die Hälfte der Bewohner des Altkreises Warburg gebaut, sondern auch eine Menge für sich. Und mein Vater, der hat die Tischler- und Zimmermannsarbeiten für Luhi erledigt.“
Schulte machte eine bedeutungsschwere Pause. „Na nun erzähl schon“, drängte ihn Zoé Stahl.
Jupp grinste schelmisch. „Und wie das so war bei uns in Warburg, da wusch eine Hand die andere. Mein Vater hat sich nämlich nicht in Geld auszahlen lassen, da hätte ja gleich das Finanzamt die Hand aufgehalten, sondern in Häusern.“
Er schwieg wieder einige Sekunden und blickte in drei Gesichter, die drei Fragezeichen mimisch darstellten.
„In Häusern?“, echote Zoé Stahl.
„Genau“, Schulte spielte wieder auf Zeit. „Ihr müsst euch das so vorstellen. Vier Häuser für Luhi und ein Haus für meinen Vater.“
„Und wie viel Häuser hat Luhi?“, wollte Adelheid wissen.
„Hatte Luhi, muss es heißen“, erklärte Schulte. „Denn der lebt natürlich nicht mehr, genauso wie mein Vater tot ist.“
„Schulte“, drängte Zoé Stahl und knuffte ihm in die Seite. „Nun komm in die Pötte!“
„Also, wie viele Häuser Luhi hatte, weiß ich nicht so genau. Da müsste ich mal einen seiner Söhne fragen.“
„Schulte!“, Zoé Stahl warf mit einem Bierdeckel nach ihm.
„Na, jedenfalls hatte mein Vater am Ende sechs Häuser und das, in dem meine Mutter wohnte. Und die war eine sparsame, bescheidene Frau.“
Adelheid staunte nicht schlecht. „Du hast sieben Häuser?“, fragte sie immer noch ungläubig.
„Eigentlich fünf “, entgegnete Schulte, als sei es das Normalste der Welt. „Aber zwei habe ich in Absprache mit Ina meiner Tochter Lena geschenkt und zweihunderttausend Euro hat sie auch noch bekommen.“
„Was?“, kam es wie im Chor von allen dreien. „Du hast noch eine Tochter?“
2
So langsam, aber sicher fand Schulte Gefallen daran, nicht mehr jeden Tag zum Dienst zu müssen. Heute Morgen hatte ihn Zoé Stahl angerufen und ihn zu einer Pizza bei Fiorini in Heidenoldendorf eingeladen. Ohne zu zögern, hatte er zugesagt.
In der ersten Zeit im Ruhestand hatte sich Schulte schwer damit getan, keine Aufgaben oder Termine zu haben. Den Tag einfach auf sich zukommen zu lassen, das hatte für ihn den gleichen Stellenwert wie faulenzen. Doch mittlerweile hatte er kein Problem mehr damit. Er war frei, genau das zu tun, worauf er Lust hatte. Was für ein Luxus!
Schulte kam ins Träumen. Vielleicht konnte er demnächst einfach mal, so ganz spontan, nach Italien fahren, nach Torrita di Siena. „Schatz“, würde er zu Adelheid sagen. „Was hältst du davon, wenn wir uns morgen mal zu einer kleinen Reise in die Toskana aufmachen?“
Schulte fühlte sich unbeschwert – es war ein großartiges Gefühl. Adelheid hingegen hatte nicht dieselben Freiräume. Sie müsste erst ihre Arbeitszeiten im Hofladen von Fritzmeier ändern oder einen solchen Ausflug Wochen im Voraus planen. Aber er, Schulte, konnte in den Tag hineinleben. Er, der einst so gestresste Polizist, hatte Zeit. Viel Zeit, und er war fest entschlossen, die Möglichkeiten, die sich daraus ergaben, zu nutzen.
Gutgelaunt betrat er die Pizzeria. Manuel, der Chef, begrüßte ihn herzlich. „Endlich kommst du mal wieder vorbei, Jupp. Ich habe schon überlegt, ob dir meine Pizza nicht mehr schmeckt. Oder hast du als Pensionato zu viel zu tun?“
Schulte lachte. Er freute sich über die freundschaftliche Begrüßung.
„Schau, die Professoressa ist schon da. Sie wartet auf dich. Was möchtest du? Wie immer, Mare e Monti?“
Schulte lachte. „Du hast es erfasst. Wie immer, Mare e Monti.“
Schulte schlenderte zu Zoé Stahl und umarmte sie zur Begrüßung.
„Eigentlich wollte ich schon während der Einweihungsparty bei Bodo über eine Angelegenheit mit dir reden“, kam sie schnell zur Sache. „Doch dann hast du uns damit verblüfft, dass du erstens eine Erbschaft gemacht und zweitens eine weitere Tochter hast.“
„Ja, meine Lena“, entgegnete Schulte versonnen. „Sie hat auch zeitweise hier in Detmold gewohnt. Es schien damals immer so, als sei sie die zurückhaltende der beiden Mädchen. Aber sie hat uns bewiesen, dass es nicht so ist. Lena ist Lehrerin. Zurzeit gerade an einer deutschen Schule in Neuseeland. Zuvor hat sie drei Jahre in Japan gearbeitet. Ich sage dir, die Frau ist in der Welt herumgekommen, von wegen zurückhaltend und schüchtern.“ Schulte schmunzelte. „Vielleicht sollte ich sie mal besuchen? Ich habe sie schon seit, ich glaube sieben Jahren nicht mehr gesehen.“
Zoé Stahl lachte. „Jupp, du wirst mir doch auf deine alten Tage nicht noch zum Weltenbummler?“
„Warum nicht? Zeit hätte ich jedenfalls. Außerdem lebe ich nicht auf großem Fuß. Es wäre sicher bezahlbar. Mittlerweile könnte ich es mir sogar gut vorstellen, noch ein bisschen von der Welt zu sehen“, lächelte er.
Zoé Stahl machte einen verwunderten Gesichtsausdruck. Dann schüttelte sie ungläubig mit dem Kopf. „Was für eine Verwandlung passiert denn mit dir gerade? Noch vor einigen Monaten warst du nur in Notsituationen bereit, die lippische Landesgrenze zu überschreiten und jetzt denkst du über ein Häuschen in der Toskana und über eine Reise nach Neuseeland nach. Ich fasse es nicht.“
Schulte sah mit nachdenklichem Blick in den Gastraum. „Weißt du, Zoé, ich genieße es mittlerweile, morgens aufzuwachen, um mir dann zu überlegen, wie ich den Tag verbringe. Ich lebe fast nicht mehr nach den Terminen, die mir irgendein Kalender diktiert. Nein, es gibt sogar Tage, da habe ich den ganzen Tag Zeit. So wie heute. Du lädst mich spontan zu einer Pizza ein und ich brauche nicht eine Minute zu überlegen, ob ich dafür über Freiraum verfüge. Als ich den Polizeijob an den Nagel gehängt habe, da hatte ich an vielen Abenden das Gefühl, ich habe den Tag verbummelt, und das ging einher mit einem schlechten Gewissen und mieser Laune. Diese Zeiten sind vorbei. Weißt du, ich muss nicht nach Neuseeland fahren. Aber die Möglichkeit zu haben, das hat was.“
„Mit anderen Worten“, kam es nachdenklich von Zoé, „du wirst alles dafür tun, dir diese jetzt gewonnene Freiheit, diese neue Lebensqualität zu erhalten. Zukünftig wirst du dir demnach so wenig Verpflichtungen ans Bein binden, wie es eben geht. Die Möglichkeit, von heute auf morgen alles stehen und liegen zu lassen, und dich ins Flugzeug oder ins Auto zu setzen und ab geht die Post, das ist für dich das neue Lebensmodell.“
„Nein, so kann man das auch nicht sagen“, entgegnete Schulte bedächtig. „Von einem neuen Lebensmodell möchte ich gar nicht sprechen. Ich würde eher sagen, dass meine bisherige Lebensweise um einige Facetten reicher geworden ist. Ich habe jetzt einfach andere und vielleicht auch mehr Möglichkeiten.“
Das Nachdenken über Schultes Leben wurde unterbrochen, denn Mimi, die Wirtin, brachte das Essen. Sie ließen es sich schmecken. Dabei hing jeder seinen Gedanken nach. Nach einigen Minuten ergriff die immer nachdenklicher gewordene Zoé Stahl wieder das Wort.
„Weißt du, Jupp, ich habe dich nicht einfach so zum Essen eingeladen. Ich wollte dich um etwas bitten. Aber jetzt, nachdem du mir einen kleinen Einblick in deine momentane Lebenswelt gegeben hast, bin ich mir nicht mehr sicher, ob du überhaupt der richtige Ansprechpartner für mein Anliegen bist.“
Sie aßen weiter schweigend ihre Pizza. Doch Zoé Stahl glaubte, eine gewisse Unruhe bei Schulte zu bemerken. Hatte sie ihn getriggert? Die Minuten schleppten sich dahin. Wie würde Schulte reagieren? Mehr und mehr baute sich eine Spannung am Tisch auf. Selbst Mimi, die Wirtin, schien es zu bemerken. Besorgt fragte sie: „Alles gut bei euch?“
Beide nickten, schwiegen und aßen bedächtig weiter.
Dann plötzlich legte Schulte sein Besteck neben seinen Teller. „Na, rück schon damit raus“, forderte er Zoé Stahl auf. „Was willst du von mir?“
„Na ja“, druckste die herum. „Es ist so, neulich habe ich einen Kollegen, einen Polizisten und Hundeführer, im Krankenhaus besucht. Er hat Krebs. Karl, so heißt er, wird zwar nicht unmittelbar an der Krankheit sterben, doch sie fordert dennoch ihren Tribut. Als Polizist wird er nicht mehr arbeiten können. Und um seinen Polizeihund, den er noch hat, der aber auch, aufgrund seines Alters aus dem Dienst genommen wird, um den kann er sich in den nächsten zwei Jahren, so lange wird seine Rekonvaleszenz dauern, nicht kümmern. Nachdem ich ihn besucht hatte, wusste ich ehrlich gesagt nicht, unter was der Mann mehr leidet. Unter der Tatsache, dass er todkrank ist, oder darunter, dass sein Hund nicht vernünftig untergebracht ist. Na, jedenfalls habe ich dem Mann versprochen, mich um seinen Hund zu kümmern. Und da habe ich an dich gedacht. Dein Hund ist auch nicht mehr der Jüngste. Na, jedenfalls kam es mir in den Sinn, dass ein weiterer Hund bei dir auch noch einen Platz finden könnte. Aber jetzt, wo ich von deinen Weltenbummlerambitionen gehört habe …“
Schulte schwieg und dachte einen Moment nach. „Okay“, meinte er dann bedächtig, „Ich muss mit Fritzmeier und Linus sprechen. Wenn die grünes Licht geben, dann nehme ich den Hund.“
Zoé Stahl schien erleichtert. „Und was ist mit Adelheid, muss die nicht auch einverstanden sein?“, fragte sie vorsichtig.
„Wieso?“, fragte Schulte mit einem verschmitzten Grinsen. „Wenn ich weltenbummle, mache ich das doch mit ihr zusammen. Adelheid hat dann gar nicht die Möglichkeit, sich um den Hund zu kümmern.“
3
Einige Jahre zuvor.
Schulte saß auf seiner alten Bank vor seinem Haus und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Er hatte jetzt Feierabend. Gott sei Dank! Früher hatte er sich keine Gedanken darüber gemacht, wann sein Dienst endete. Ob er zehn Stunden arbeiten musste oder in heißen Phasen auch zwölf. Egal! Doch diese Zeiten waren vorbei. Er hatte nur noch wenige Monate bis zu seiner Pension, und das war auch gut so. Mittlerweile war er froh, wenn die acht Stunden Dienst hinter ihm lagen.
„Opa“, wurde er von seinem pubertierenden Enkel aus seinen Gedanken gerissen. Schulte erschrak zutiefst. Mann, war er weit weg gewesen. Und mit Linus hatte er gar nicht gerechnet. Seitdem die Hormone unter die Schädeldecke des Jungen knallten, sah er seinen Enkel höchst selten.
Neulich hatte Schulte Linus gefragt, ob er mit ihm in die Stadt gehen möchte, zu Rudolphs Bratwurstbude, Currywurst essen.
Der Junge hatte lange überlegt. „Gut“, hatte er gesagt. „Ich komme mit. Aber gehe bitte drei Schritte hinter mir und sprich mich bloß nicht an.“
Schulte war beleidigt gewesen. Aber Linus hatte ihm seine Welt erklärt.
„Das ist nicht gegen dich, Opa“, hatte er gemeint. „Du bist schon ganz in Ordnung. Aber das wissen die Leute aus meiner Klasse nicht. Und wenn mich irgendjemand von denen sieht, dann meinen die, ich sei ein Baby, weil ich noch mit meinem Opa losgehe.“
Das hatte Schulte verstanden und so waren die beiden Männer doch noch zu ihrer Currywurst gekommen.
„Opa, sag mal, träumst du?“, Linus zupfte ihm am Jackenärmel.
„Schuldige Linus, ich war in Gedanken“, versuchte sich Schulte wieder ins Hier und Jetzt zu befördern. „Ich habe wirklich ein bisschen geträumt. Aber jetzt bin ich aufmerksam.“
„Opa, ich brauche deine Hilfe.“
„Was kann ich für dich tun, Linus?“, fragte Schulte und freute sich, dass sein Enkel an ihn dachte, wenn er Hilfe brauchte.
„Na ja, für das Fach Politik muss jeder aus unserer Klasse ein Referat schreiben und halten. Ich habe das Thema: Möglichkeiten und Grenzen von Windkraft.“
„Eine anspruchsvolle Aufgabe“, stellte Schulte fest.
„Kann sein, aber da muss ich durch“, gab sich Linus cool. „Du hast ja vielleicht schon in der Zeitung gelesen, dass der Fürst Windkraftanlagen auf dem Teuto bauen will.“
Schulte war ahnungslos. „Nee“, brummelte er etwas beschämt. „Habe ich nichts von gehört.“
Linus verdrehte die Augen. „Mann, da ist ja Anton Fritzmeier besser informiert als du. Na ja, auf jeden Fall gibt es dazu heute Abend eine Podiumsdiskussion in Berlebeck, mit dem Bürgermeister, dem Fürsten und Westfalenwind. Das ist der zukünftige Betreiber. Ich dachte mir, die höre ich mir an. Dann habe ich schon mal jede Menge Argumente für mein Referat.“
Schulte nickte anerkennend. „Nicht schlecht, die Idee. Die hätte von mir sein können. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was ich für dich tun kann.“
„Ach, Mama ist nicht zu Hause. Und da wollte ich dich fragen, ob du mit mir dahinfährst.“
Schulte grinste. „Und was ist, wenn mich deine Kumpel mit mir sehen?“
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand von denen freiwillig eine solche Veranstaltung antut“, meinte Linus schelmisch. „Ich glaube, da besteht keine Gefahr!“
4
Adelheid Vahlhausen ordnete das frisch gelieferte Gemüse auf dem Regal des kleinen Hofladens neu an. Die vor einem Jahr pensionierte Polizistin hatte es gern übersichtlich. Seit zwei Jahren wohnte sie auf dem Hof des alten Bauern Anton Fritzmeier, in einer Wohnung im sogenannten Herrenhaus, wie Fritzmeier das große Wohngebäude des Hofes nannte. Adelheid Vahlhausen wohnte im 1. Stock, während der alte Bauer, der nicht mehr so gut Treppen steigen konnte, unten lebte. Es gab zwei kleinere Nebengebäude. In einem davon wohnte Jupp, Adelheids ehemaliger Kollege und Lebenspartner. Im Gebäude direkt daneben lebte seine Tochter Ina mit ihrem achtzehnjährigen Sohn Linus. Seit ihrer Pensionierung half Adelheid Vahlhausen im Hofladen Fritzmeiers mit. Allerdings war helfen eine starke Untertreibung, denn sie leistete die Hauptarbeit. Fritzmeiers Leistung beschränkte sich immer mehr darauf, mit den Kunden über Gott und die Welt zu plaudern. Es gab allerdings Kunden, denen Fritzmeier lieber aus dem Weg ging, wie Adelheid Vahlhausen wusste. Eine dieser Kundinnen war Klara Henkemeier, die ehemalige Dorfschullehrerin. Fast genauso alt wie Fritzmeier kam sie nahezu jeden Tag und schüttete den neuesten Dorftratsch über all die aus, die zufällig gerade im Laden waren. Fritzmeier flüchtete, sobald er sah, dass diese Frau den Hof betrat, und überließ sie Adelheid Vahlhausen. Doch manchmal war Klara Henkemeier schneller als er und ihm blieb nichts anderes übrig, als sich das leere Geplapper dieser alten Frau anzuhören. Heute war er wieder einmal nicht rechtzeitig verschwunden, und Adelheid Vahlhausen freute sich jetzt schon darauf, wie der alte Bauer sich wohl aus der Affäre ziehen würde.
„Herrliches Wetter, nicht wahr?“, grüßte die hochgewachsene, dünne Frau, als sie in den Hofladen kam. „Ist schon fast wie im Frühling. Du kennst das ja, Anton: Wenn Engel spazieren gehen, dann lacht der Himmel. Sieht man an mir.“
„Hm“, brummte Fritzmeier. „So’n Engel hab ich mir immer chanz anders vorgestellt. Bisse hierher cheflogen oder chelaufen? Wo hasse denn deine Flügel chelassen?“
Die Frau war keineswegs beleidigt, sondern griff seine Worte gewohnt bierernst auf: „Schön wärs ja, wenn ich Flügel hätte. Das Laufen fällt mir immer schwerer. Meine Hüfte – die zwickt immer schlimmer. Und meine Knie wollen auch nicht mehr so. Hab ich dir schon erzählt, dass ich mir vorgestern den großen Zeh …“
„Ja, hasse schon“, unterbrach Fritzmeier sie barsch. Klara Henkemeiers Krankengeschichten waren legendär und drückten Anton Fritzmeiers Blutdruck stets in ungesunde Höhen. Die alte Lehrerin achtete nicht weiter auf ihn, sondern wandte sich an Adelheid Vahlhausen: „So ist das nun mal, junge Frau. Das Alter – da kann man nichts machen.“
Anton Fritzmeier, der schon auf dem Weg zur Tür war, drehte sich noch einmal um und sagte in einem Ton, als wolle er sie trösten: „Mach dir nix draus, Klärchen. Auch ’n altes Huhn chibt noch ’ne chute Suppe.“ Zufrieden grinsend verließ er daraufhin den Hofladen.
Sekundenlang schien es Klara Henkemeier die Sprache verschlagen zu haben. Dann schüttelte sie ihre weiße Dauerwelle und sagte resigniert: „Besonders höflich war er noch nie. Ich kannte ihn noch als jungen Mann. Schon da war er ein grantiger Eigenbrötler. Er hat sich kaum verändert. Wie kommen Sie denn mit ihm klar?“
Adelheid Vahlhausen, die keine Lust hatte, mit dieser berüchtigten Tratsche über ihr Binnenverhältnis zu Fritzmeier zu sprechen, zuckte nur mit den Achseln und fragte zurück: „Was kann ich Ihnen denn heute Schönes anbieten? Wir haben ganz frische Kohlrabi reinbekommen. Oder sehen Sie mal hier, da …“
Sie kam nicht dazu, den Satz zu vollenden, denn in diesem Moment bimmelte das kleine Glöckchen an der Hofladentür und eine Frau von Mitte siebzig, die Adelheid Vahlhausen noch nie gesehen hatte, betrat, einen Einkaufskorb am Arm, den Laden.
„Hallo, Sabine“, wurde die Eintretende von Klara Henkemeier begrüßt. „Auch mal hier? Dich hab ich lange nicht gesehen. Wie gehts denn?“
„Muss ja“, kam die typisch ostwestfälische Variante einer Antwort auf diese Frage. Die Frau, von der Adelheid Vahlhausen nicht wusste, dass es sich um Sabine Krukemeier handelte, stellte ihren Einkaufskorb auf den Fußboden und pustete erst mal tief durch.
„Das Wetter ist ja schön“, sagte sie dann mit erstaunlich tiefer Stimme, „aber meinem Asthma tut das gar nicht gut.“
„Asthma hast du?“ Jede Erwähnung einer Krankheit fand bei Klara Henkemeier sofort aufnahmebereite Rezeptoren. „Das wusste ich ja noch gar nicht.“
„Das wundert mich allerdings“, gab Sabine Krukemeier zur Antwort. „Dass du mal irgendetwas über irgendjemanden nicht weißt, ist eine echte Überraschung. Muss ich mir Sorgen um dich machen?“
Adelheid Vahlhausen spürte, dass hier die Chemie nicht stimmte, und beschloss, den aufkommenden Disput abzuwürgen.
„Womit kann ich Ihnen denn eine Freude machen?“, fragte sie so unschuldig wie möglich. Aber zu ihrer Verblüffung ging weder die eine noch die andere Besucherin darauf ein.
„Um mich muss sich niemand Sorgen machen“, stellte Klara Henkemeier fest, zog die Augenbrauen wütend zusammen, machte den Rücken gerade und wirkte damit noch größer, als sie sowieso schon war. „Ich bin, allen Wehwehchen zum Trotz, noch immer ziemlich fit. Vor allem im Kopf, was man nicht von jedem in meinem Alter sagen kann. Auch nicht von Leuten, die deutlich jünger sind.“ Sie unterstrich diese Worte mit einer Kopfbewegung, die klar machte, dass sie damit Sabine Krukemeier meinte.
„Wenn du mich damit meinst“, antwortete Krukemeier, „dann lass dir gesagt sein, dass ich gerade mal sechs Jahre jünger bin als du. Das macht in unserem Alter kaum noch was aus. Ich habe jedenfalls schon die Briefwahl erledigt. Und ich habe das Richtige gewählt, was man von dir bestimmt nicht sagen kann. Hast du überhaupt vor, zu wählen? Oder geht so eine Bundestagswahl einfach an dir vorbei, weil dir deine vielen Krankheiten wichtiger sind?“
Adelheid Vahlhausen, die gar nicht wissen wollte, welche politische Partei von den beiden alten Damen bevorzugt wurde, zog sich hinter die schützende Ladenkasse zurück.
„Ich will dir mal was sagen“, rief Klara Henkemeier mit ihrer hohen, dünnen Stimme, hörbar erbost. „Ich wähle nicht per Briefwahl. So etwas Wichtiges mache ich immer noch persönlich. Was meinst du übrigens, warum ich hier bin? Ich kaufe ein paar Sachen ein für die Wahlparty der Landfrauen am Sonntag. Ja, du hast richtig gehört. Wir treffen uns anlässlich der Bundestagswahl am Sonntag in der der ehemaligen Gaststätte Zum Wilden Jäger. Die Gaststätte gehörte Hermine Kaltenbecher, wie du dich hoffentlich erinnerst, und Hermine, eine gute Freundin von mir, öffnet aus diesem Anlass die Gaststätte mal wieder. Natürlich ohne Bierausschank oder so etwas. Wir bringen alle was mit, Getränke und Essen. Ja, wir Landfrauen sind eben aktiv und lassen uns nicht so hängen wie andere. Du warst doch auch immer bei den Landfrauen. Hast du keine Einladung bekommen?“
„Wieso bist du eigentlich bei den Landfrauen?“, fragte Sabine Krukemeier bissig, anstelle einer Antwort, „du warst doch keine Bäuerin, wie ich. Du hast dir doch nie die Hände schmutzig gemacht.“
Der Versuch Klara Henkemeiers, den Rücken noch ein bisschen gerader durchzudrücken, scheiterte. Aber ihre Miene wurde noch drohender. „Aber als Lehrerin war ich eine der wichtigsten Personen im Dorf. Wer hat denn euren Blagen Lesen und Schreiben beigebracht? Wer hat ihnen gesagt, wie man sich einigermaßen anständig benimmt? Euch Bauern waren die Kühe und Schweine immer wichtiger als eure Kinder. Daher bin ich so was wie eine Landfrau ehrenhalber. Ein Status, den ich mir mehr als verdient habe.“
Sabine Krukemeier lachte nur trocken. „Wenn du meinst. Aber kommen werde ich trotzdem nicht zu eurer Wahlparty. Denn ich weiß genau, dass meine liebe Schwiegertochter, dieses Miststück, dort das große Wort führen wird. Ich könnte es nicht ertragen, mir das anzuhören. Sie ist mein Untergang und der meines dummen Sohnes. Wie kann man sich nur an einen solchen Drachen binden? Nee, macht eure Party mal lieber allein!“
5
Nachdenklich verließ Anton Fritzmeier die Wohnung Schultes, bei dem er sich wieder einmal selbst zum Abendessen eingeladen hatte. Für den alten Mann war Kochen bestenfalls ein notwendiges Übel, das man möglichst schnell, kostengünstig und unkompliziert erledigen musste. An diesem Abend war es Adelheid Vahlhausen gewesen, die in Schultes Küche gezaubert hatte. Fritzmeier hatte die gemütliche Runde beim Essen und das Bier danach genossen und hätte zufrieden den Abend beschließen können. Aber Schulte hatte ihm noch einmal ausführlich von dem verheerenden Anschlag auf das Haus seines Freundes Bodo Bruschetta berichtet. Das hatte Fritzmeier beunruhigt. Was, dachte er, wenn mein Haus mal abbrennt? Es ist schließlich ein altes Gebäude. Wie alt eigentlich? Etwas peinlich berührt hatte er feststellen müssen, das gar nicht zu wissen. In welcher Generation stand er selbst jetzt? Warum hatte er sich eigentlich nie um die Geschichte dieses Hofes, der doch immerhin seine Lebensgrundlage war, gekümmert? In seiner aktiven Zeit als Landwirt hatte es immer mehr als genug Arbeit gegeben, sodass für eine Beschäftigung mit der Geschichte des Hofes Fritzmeier nie Zeit und Muße gewesen war. Und dann hatte er es schlichtweg vergessen.
Leise vor sich hin murmelnd stieg er die Treppe zu seiner Haustür hoch. Früher hatte er die sieben Stufen immer im Laufschritt genommen. Heute konzentrierte er sich auf jede einzelne, und wenn er auf der kleinen Empore vor der Haustür angekommen war, musste er eine Weile durchpusten. Er hatte sich daran gewöhnt und verschwendete keinen Gedanken mehr an seine nachlassende körperliche Leistungsfähigkeit. Für sein Alter war er immer noch ziemlich gut in Schuss, fand er, und damit lag er wohl auch richtig.
In seinem Wohnzimmer angekommen, schaltete er reflexhaft den Fernseher an. Aber nach ein paar Sekunden knipste er den Apparat wieder aus. Zu sehr nahmen ihn die Gedanken von eben gefangen. Wie ferngelenkt ging er zu dem mächtigen, uralten Eichenschrank, der sein weitläufiges Wohnzimmer dominierte, und zog eine der unteren Schubladen auf. Die Staubschicht, die er damit aufwirbelte, hätte jede Hausfrau als persönliche Niederlage empfunden. Fritzmeier ignorierte sie einfach. Er nahm ein hölzernes, mit goldenen Nieten beschlagenes Kästchen heraus, pustete den Staub vom Deckel und trug es zum Wohnzimmertisch.
Minutenlang saß er vor dem alten Stück, unentschlossen, ob er es wirklich öffnen sollte. Er zögerte immer wieder, als habe er nicht seine Familiengeschichte, sondern die Büchse der Pandora vor sich auf dem Tisch. Das Holz des Kästchens war durch die Zeit nahezu schwarz geworden, die Goldbeschichtung des Vorhängeschlosses glänzte nicht mehr, sondern war ebenfalls dunkel angelaufen. Fritzmeier ging noch einmal zurück zum Schrank und fischte einen Schlüssel aus der noch geöffneten Schublade. Ganz vorsichtig, als könnte ihm das Kästchen jeden Moment um die Ohren fliegen, steckte er den Schlüssel in das Vorhängeschloss, drehte ihn um und öffnete den Deckel. Sofort schlug ihm ein muffiger Geruch entgegen, eine Mischung aus altem Leder und ebenso altem Papier. Er nahm eine in Leder gebundene Mappe, die ganz oben lag, heraus und schlug sie auf. Als er die erste Seite der wie ein Buch gebundenen Mappe vor sich hatte, stöhnte er enttäuscht. Er konnte die mit Tinte geschriebene Handschrift nicht entziffern. Es war nicht das Sütterlin, das er noch aus seiner Volksschulzeit kannte, sondern die ältere Kurrentschrift. Aber jetzt war seine Neugier geweckt und er gab nicht eher auf, bis er die ersten Buchstaben identifiziert hatte. Als er das geschafft hatte, ergab sich der Rest beinahe wie von selbst. Auf der ersten Seite las er nun: Familiengeschichte des Hofes der Familie Fritzmeyer
Die andere Schreibweise seines Familiennamens tat er als nebensächlich ab und las weiter: Aufgeschrieben von Heinrich Wilhelm Fritzmeyer im Jahre des Herrn 1902. Den Ahnen zur Ehre, den Nachfahren zur Erinnerung.
Der Name war dem alten Bauern nicht sofort geläufig, aber dann wurde ihm klar, dass es sich um seinen Opa handeln musste, den er immer nur Opa Heini genannt hatte. Wann es zur Änderung der Schreibweise gekommen war und warum, interessierte ihn weniger, denn als er das Vorsatzblatt umschlug, fiel ihm ein ursprünglich schwarz-weißes, aber nun sepiafarbenes, verwittertes Foto mit gezacktem Rand entgegen. Das Foto zeigte eine vielköpfige Familie, deren Mitglieder alle mit bitterernster Miene in die Kamera schauten, bemüht, sich einen möglichst würdevollen Ausdruck zu geben. In einem der Kinder, die Jungen alle im Matrosenanzug, die Mädchen mit einer großen Schleife vor der Brust, glaubte Fritzmeier, seinen Vater Hans-Werner zu erkennen, war sich aber nicht sicher. Auf der Rückseite des Fotos stand etwas mit Bleistift geschrieben, das Fritzmeier nicht entziffern konnte. Er legte das Foto zur Seite und begann mit dem Text. Von nun an hing sein Blick wie festgetackert an den mit großer Sorgfalt geschriebenen Zeilen, deren Tinte zu verblassen begann, deren Inhalt den alten Mann aber unter Strom setzte.
6
Ich werde alt, kam es Schulte in den Sinn. Er dachte über seine Hunde nach. Der Erste, der bei ihm eingezogen war, hieß Monster. Irgendwann hatte die geschundene Hundeseele in seinem Garten gelegen, halb tot war er gewesen. Schulte hatte nicht lange gefackelt. Er hatte seinen Kumpel Detlev Dirkes, seines Zeichens Tierarzt, angerufen. Der hatte das Tier, das niemanden näher als zwei Meter an sich heranließ, erst mithilfe eines Köders betäubt und dann zusammengeflickt. Als das riesige Tier wieder zu sich kam, hatte Schulte es gefüttert. Es hatte nicht lange gedauert, da wusste der Hund, dass Schulte sein Brötchengeber war. Und zu einer solchen Person war man freundlich.
Nachdem Herr und Hund miteinander zurechtkamen, wäre es Schulte niemals in den Sinn gekommen, das Tier wieder abzugeben.
Seit dieser Zeit hatte Schulte Hunde. Ihm war das bisher nicht bewusst, doch seitdem Monster bei ihm eingezogen war, galt der Grundsatz: Ein Leben ohne Hund war vielleicht möglich, aber keinesfalls erstrebenswert.
Und wenn der Sensenmann dann an die Tür klopfte und seinen vierbeinigen Kumpel mitnahm, trauerte Schulte immer eine gewisse Zeit. Aber es kam der Tag, an dem die nächste Fellnase bei ihm einzog.
Diese Selbstverständlichkeit hatte nun Risse bekommen. Sicher, alle Hunde, die Schulte auf den Hof geholt hatte, waren in gewisser Weise auch die von Fritzmeier. Denn wenn Schulte seinem Polizistendasein nachging, musste sich jemand um die Tiere kümmern, und das war nun mal Fritzmeier. Auch für den alten Bauern hatte sich das Verhältnis zu Hunden verändert.
Schon bevor Schulte zu ihm auf den Hof gezogen war, gab es auf dem Anwesen Hunde. Immer ein bis zwei Terrier, die sich um die Ratten zu kümmern hatten, und meist noch eine Schäferhund-Promenadenmischung, ein Kettenhund, der dafür verantwortlich war, dass sich auf dem Hof niemand herumtrieb, der dort nichts zu suchen hatte. Fritzmeier verschwendete damals keine Zeit damit, die Hunde zu erziehen. Der große Hund war die meiste Zeit des Tages an einer Kette und nachts schlief er bei den Kühen im Stall. Was die Terrier machten, interessierte Fritzmeier nicht. Die kamen allein klar. Wenn die gefangenen Ratten sie nicht hinreichend satt machten, bedienten sie sich am Schweinefutter. Das änderte sich, als Schulte seinen ersten Hund Monster in Fritzmeiers Obhut gab. Das riesige Tier folgte Fritzmeier nach kurzer Zeit auf Schritt und Tritt. Irgendwann begann der alte Bauer, mit dem Hund zu reden. Es dauerte noch ein paar Wochen, dann durfte er in die Küche und zu guter Letzt hatte der alte Bauer dem Hund auch noch einen Korb neben seinen Lieblingssessel gestellt, sodass der mittlerweile treue Gefährte auch einen gemütlichen Platz hatte, wenn Fritzmeier seine Zeitung las.
Vor dem Einzug des neuen Hundes hatte Schulte seinen Enkel Linus und den alten Bauern zu sich eingeladen und den beiden von der Absicht erzählt, dass er einem ausgedienten Polizeihund einen Alterssitz geben wollte.
„Es kann ja sein“, sagte Schulte, „dass mir mal was passiert. Schließlich bin ich nicht mehr der Jüngste. Darum müsst ihr mir versprechen, dass ihr euch um den Hund kümmert, wenn ich es nicht mehr schaffe.“
Für Linus war das kein Problem. „Klar“, meinte er. „Da kannst du dich drauf verlassen.“
Fritzmeier hingegen hatte Schulte angesehen, als hätte der ihm mitgeteilt, dass die zukünftige Bundesregierung die Absicht hätte, sämtliche Agrarsubventionen zu streichen.
„Sach mal, cheht et dich nich chut?“, hatte er sich aufgeregt. „Hasse Fieber?“
Fritzmeier gab ihm mit dem Wedeln der Hand vor seiner Stirn zu verstehen, dass Schulte nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Das sprach er auch laut aus und dann noch einiges mehr. Seine Schimpftirade schloss er mit den Worten: „Erstens mal hasse mich noch nie chefracht, wenne dich eine neue Töle ancheschafft has. Und zweitens bin ich ja wohl der, der zuerst ins Chrass beißt.“
Dieses Ereignis hatte heute Mittag stattgefunden. Jetzt war es gleich siebzehn Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Zoé Stahl angekündigt, um den neuen Hund zu bringen.
Linus, Schulte und Adelheid Vahlhausen saßen in der Küche und warteten gespannt. Selbst Lümmel schien zu merken, dass etwas im Busche war. Aufgeregt schleppte der alte Labradormischling Schultes Pantoffel durch die Gegend.
Kurze Zeit später war es so weit. Die Staatsanwältin stoppte vor dem Haus, öffnete den Kofferraum und heraus sprang ein großer Malinois. Er hatte rehbraunes Fell. Teile des Kopfes und die Schnauze waren schwarz, dem Alter geschuldet jedoch mit kleinen grauen Stellen.
Der bisherige Besitzer hatte dem Hund sicherheitshalber einen Maulkorb aufgesetzt.
Linus hielt dem Hund seine Hand hin, damit der Kontakt aufnehmen konnte. Doch der ignorierte den jungen Mann. Das Tier sah sich nach Arbeit um, die es zu erledigen hatte. Dem alten Lümmel, der sich ihm vorsichtig, aber schwanzwedelnd näherte, zeigte der Malinois ebenfalls die kalte Schulter. So nach dem Motto: Stör mich nicht, ich habe zu tun.
In dem Moment kam Fritzmeier um die Ecke. „Na, wo is denn der neue Köter?“, brummelte er. Dann ging er auf den Hund zu. Der zeigte jetzt anders als bei Linus Aufmerksamkeit. Schulte war sich nicht sicher, ob das ein gutes Zeichen war.
„Wie heißt der Schluffen denn?“, war Fritzmeiers nächste Frage.
„Danger“, sprach Zoé Stahl das Wort in feinstem Englisch aus. „Wat ist dat denn für ein Name?“, maulte Fritzmeier, „da brichse dich ja die Zunge, wenne den sagen solls. Nee, nee, der is ein Rentner und so heißt der ab jez auch.“
Alle starrten den alten Bauern an. Und Schulte dachte, der wird auch immer wunderlicher. Aber Fritzmeier ließ sich nicht beirren. Er ging auf den Hund zu und streichelte ihn. Dann fasste er an den Maulkorb.
„Wat is dat denn für ein Dingen? Dat is doch Tierquälerei“, brummte er und nahm ihm das Teil von der Schnauze. Anschließend öffnete er den Karabinerhaken der Leine und legte sie auf den Boden. Danach zeigte er auf Schulte. „Damit du dat chleich weiß, da is der Chef. Und die Leberwurstbrote, die chibt et bei mich. So, Rentner, und jez komm mit, ich zeige dich den Hof.“
Der alte Bauer humpelte Richtung Hofladen und der Hund lief bei Fuß neben Fritzmeier her.
7
Fritzmeier warf die Lippische Landeszeitung auf den Küchentisch. Gerade hatte er den Artikel „Kreis Lippe sagt nein zu Gauseköten-Rotoren. Großer Erfolg oder schlechtes Signal“,1 gelesen.
„Da soll sich noch einer zurechtfinden“, murrte der alte Bauer und kratzte sich am Kopf. Noch bevor er sich weitere Gedanken zu diesem Thema machen konnte, klopfte es an seiner Küchentür.
„Jau!“, rief Fritzmeier und quälte sich aus seinem alten Sessel. Linus betrat die Küche und grinste schief.
„Da kommt ja unser Öko“, wurde der junge Mann, auf die des Bauern so eigene Art und Weise begrüßt.
„Wat treibt dich denn zu so einen alten Mann inne Küche? Du wills sicher nur mal wieder eine Flasche Detmolder schnorren.“
„Nee, lass mal, Anton. Es ist eher ein Kontrollbesuch. Ich habe dich schon ein paar Tage nicht mehr gesehen und wollte einfach mal schauen, ob du überhaupt noch lebst.“
Der alte Bauer drückte sich eine Hand in den Rücken und versuchte seine alten Knochen in Stellung zu bringen.
„Ich werde immer steifer“, brummelte er. „Aber kaputt krichse mich nich“, stöhnte Fritzmeier. „Bis ich ause Welt chehe, dat dauert noch ne Weile. Aber chut, dasse komms. Ich habe chrade die Zeitung gelesen. Et chet mal wieder um diese Windmühlen aufe Gauseköte. Ich steige da bald nich mehr durch. Setz dich mal da an den Küchentisch. Ich hole Bier und dann muss ich mit dich darüber reden.“
„Bleib sitzen, Anton, ich gehe schon“, bot sich Linus an und war schon auf dem Weg zur Speisekammer. Über die Schulter rief er: „Ich bringe gleich eine Flasche Bier mehr mit. Mein Opa kommt auch noch.“
„Der hat wohl auch nix mehr zu trinken“, grummelte Fritzmeier.
Kaum standen die Flaschen auf dem Tisch, da erschien auch Schulte in der Küche.
Der grinste, als er die Kaltgetränke sah.
„Das muss ich ja sagen Anton, du weißt, wie man Gäste behandelt.“
Der Bauer winkte ab.
„Setz dich hin, ich muss watt mit Linus besprechen.“
„Worum geht es denn eigentlich?“
Den Jungen hatte die Neugier gepackt.
„Ja, wat soll ich sagen?“ Fritzmeier schob sich seine Brille wieder auf die Nase. „Ihr beiden seid ja damals in Berlebeck bei diese Diskussion gewesen, als ett um die Windmühlen auf den Teutoburger Wald ching. Als ihr mir damals davon erzählt habt, hab ich mich auch ein bisschen schlau chemacht. Jedenfalls hab ich et versucht. Seitdem hab ich viel über diese Windräder inne Landeszeitung chelesen. Und jetzt stand ja auch noch watt da drüber in diese Illustrierte, wie heißt se doch chleich? Ach ja, Heimatland Lippe.“
Fritzmeier wedelte mit der Hauspostille des Heimatbundes. „Jetzt will nämlich auch der Landesverband, chenau wie der Fürst, Windkraftanlagen in den Wald bauen. Chans Horn-Bad Meinberg is deswegen schon auf Krawall gebürstet.“
„Mensch Anton, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du dich mit dem Thema so intensiv auseinandersetzt“, staunte Linus.
„Ja meinse denn, ich will dumm sterben“, entgegnete der alte Bauer trocken. „Na, jedenfalls sacht diese Leiterin von unserem Heimatbund, wat iss die da noch chleich?“ Fritzmeier rückte seine Brille zurecht und schlug das Heft Heimatland Lippe auf.
„Jau, da steht et, die is Leiterin der Fachstelle Umweltschutz und Landespflege im Heimatbund. Ja jedenfalls sacht die, dat es in Nordrhein-Westfalen einen so chenannten Regionalplan chibt und der lässt bereits heute keine Windenergieanlagen auf den Höhenzügen des Teuto und der Egge zu. Weiter sacht die Frau, dat die bereits ausgewiesenen Gebiete und die Flächenquote fast ausreichen, um die Flächenquote des Landes im Regierungsbezirk Detmold zu erreichen. Diese Flächen befinden sich im Offenland. Wald und Schutzzonen können und müssen nicht in Anspruch genommen werden.2
Die sacht also, wat soll da chanze Theater? Wir haben bei uns inne Chegend schon chenuch von diesen Windkraftdingern.“
Schulte und Linus kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. „Mensch Anton“, brachte Schulte bewundernd hervor. „Du bist ja besser informiert als die meisten, die ich kenne.“
„Wat heißt hier besser informiert, wenn et drauf ankommt, dann kann ich immer noch ein Loch in den Schnee pissen, dat chlaub mir Jupp. Und vor allen Dingen will ich mich, wenn ett um diesen neumodischen Kram cheht, nich verarschen lassen. Weil, unser Landesverbandsvorsitzender, der sacht wat chanz anderet. Der meint, nämlich datt ett chanz wichtig wäre, unabhängig von den fossilen Rohstoffen zu werden, und dabei würde Windkraft eine chanz wichtige Rolle einnehmen. Das größte Risiko für den Naturschutz und die Artenvielfalt wäre nämlich die Klimaerwärmung. Um hier chegenzusteuern, so sacht der, hätte datt Land NRW mindestens 1,8 Prozent der Landesfläche vorchesehen und hätte dazu ausdrücklich auch die Öffnung von Waldbereichen also da, wo früher mal Nadelwald stand, als Flächenkulisse für den Ausbau der Windenergie ermöglicht.“
Fritzmeier schlug die Broschüre des Heimatbundes zu und raufte sich die Haare.
„Ja wat denn nun? Sollen die Windmühlen nun in den Wald chestellt werden oder nich?“
Linus grinste. „Bevor ich meine belanglose Meinung zu der Windkraftproblematik sage, brauche ich noch eine Flasche Bier.“
„Ja dann mal los, Junge, du weiß, wo der Kasten steht“, griente Fritzmeier, „oder willse, dat ich dich bediene?“
„Schon gut, Anton, wenn es was für umsonst gibt, dann gehe ich auch selbst“, schmunzelte Linus. Er schnappte sich die leeren Flaschen und stiefelte los.
„Der Junge weiß wat sich chehört“, lobte ihn Fritzmeier gegenüber Schulte. Doch bevor der etwas dazu sagen konnte, verteilte Linus schon die neuen Flaschen.
„Wie gesagt, was ich hier zum Besten gebe, ist die unbedeutende Meinung eines Achtzehnjährigen. Ich erhebe also nicht den Anspruch, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben.“
„Is ja chut Junge“, winkte Fritzmeier ab und trank einen Schluck Bier. „Hier bei mir inne Küche wird nich jedet Wort aufe Goldwaage gelecht.“
Linus nickte. „Also gut, ich will mal bei der Fachbereichsleiterin des Heimatbundes anfangen. Natürlich hat sie recht, wenn sie sagt, dass die in Ostwestfalen ausgewiesenen Gebiete und Flächenquote fast schon ausreicht. Seht euch doch nur die Masse an Windrädern auf der Paderborner Hochebene an. Allein mit den dort betriebenen Windparks ist die Quote für OWL annähernd erreicht, sodass wir in Lippe und anderen Regionen erst mal keine großartigen Anstrengungen mehr unternehmen müssen, damit die vom Land vorgegebene Quote in unserer Region insgesamt erfüllt wird. Und jetzt kommen wir zu unserem Landesverbandsvorsteher. Der hat ein großes Problem. Mit den Finanzen des Landesverbandes war es in den letzten Jahren, eigentlich schon seit der Bäderkrise in den Neunzigern, nicht mehr zum Besten bestellt. Ein kleiner Geldbringer war aber immer noch der Lippische Wald. Doch dann kam vor einigen Jahren die große Trockenheit und damit ging das Waldsterben einher. In Lippe sind große Teile der Fichtenwälder dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Damit spitzte sich die Finanzsituation des Landesverbandes zu.“
Linus griff zur Flasche und nahm bedächtig einen Schluck Bier.
„Der Fürst war klug und dachte sich vermutlich, verpachte ich doch die Flächen, auf denen vor einigen Jahren Fichtenwälder standen, an ein Windkraftunternehmen. Dieses kann meine Anlagen betreiben, während ich in Ruhe den Wald aufforste. Als das Vorhaben, Windmühlen auf dem Teutoburger Wald zu errichten, Gestalt annahm, dachte sich auch der Landesverband, was der Fürst kann, können wir auch. Allerdings handelte es sich bei dem geplanten Standort der Windräder, die auf den Flächen des Fürsten errichtet werden sollten, um eine einzigartige Landschaftskulisse. Deshalb löste das Vorhaben bei vielen Lippern Widerspruch aus. Als der Landesverband schließlich ebenfalls Windräder im Wald errichten wollte, gab es in Ostwestfalen bereits ausreichend Anlagen, um die geforderte Quote zu erfüllen. Daher war es nicht mehr notwendig, auf Flächen im Wald zurückzugreifen.“
„Linus, du meins also, in Sachen Windrad im Wald wäre der Pickert erst mal chechessen?“, brummelte Fritzmeier. „Ich meine, mit diesen Windmühlen ist doch in Moment eine Menge Cheld zu verdienen.“
Linus grinste schief. „Da hast du sicher recht. Daher glaube ich nicht, dass der Fürst und der Landesverband so ohne Weiteres klein beigeben werden. Aber erst mal hat der Kreis Lippe nein zu Windkraft im Wald gesagt.“
Fritzmeier brummelte sich etwas in seinen Bart. Dann sah er zu Schulte. „Sach mal, Jupp, du sachs ja chanix, wat is denn deine Meinung dazu?“
„Schwer zu sagen, bei den hochkarätigen Experten in dieser Küche sehe ich meine Rolle eher darin, Bier zu holen. Wenn ich anfangen würde, mit euch zu diskutieren, würde ich mich wahrscheinlich wegen meiner Unkenntnis der Lächerlichkeit preisgeben.“
8
„Geht doch!“, rief Jupp Schulte gut gelaunt aus.