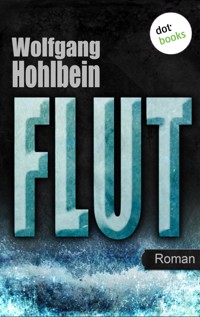1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Hohlbein Classics
- Sprache: Deutsch
Jetzt zum ersten Mal als E-Book verfügbar: Die Reihe "Hohlbein Classics" versammelt die frühen Werke von Wolfgang Hohlbein, die seinerzeit im Romanheft erschienen sind.
Die Story: Man kennt diese Zauberwaffe aus der Sage um König Artus und seine Ritter der Tafelrunde. Die Rede ist von dem Schwert Excalibur. Ein Mythos, sicher, doch jede Legende birgt auch ein Körnchen Wahrheit. Und die Wahrheit ist in diesem Fall schrecklich. Denn das Schwert existiert wirklich. Und wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, erwacht es zu fürchterlichem Leben und wird in der Hand des Falschen zu einer Mordwaffe, die der Satan persönlich zu führen scheint!
"Das Schwert des Bösen" erschien erstmals am 04.01.1982 unter dem Pseudonym Henry Wolf in der Reihe "Gespenster-Krimi".
Der Autor: Wolfgang Hohlbein ist der erfolgreichste deutschsprachige Fantasy-Autor mit einer Gesamtauflage von über 40 Millionen Büchern weltweit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Hohlbein Classics
Jetzt zum ersten Mal als E-Book verfügbar: Die Reihe »Hohlbein Classics« versammelt die frühen Werke von Wolfgang Hohlbein, die seinerzeit im Romanheft erschienen sind.
Über diese Folge
Das Schwert des Bösen
Ein Gespenster-Krimi
Man kennt diese Zauberwaffe aus der Sage um König Artus und seine Ritter der Tafelrunde. Die Rede ist von dem Schwert Excalibur. Ein Mythos, sicher, doch jede Legende birgt auch ein Körnchen Wahrheit. Und die Wahrheit ist in diesem Fall schrecklich. Denn das Schwert existiert wirklich. Und wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, erwacht es zu fürchterlichem Leben und wird in der Hand des Falschen zu einer Mordwaffe, die der Satan persönlich zu führen scheint!
»Das Schwert des Bösen« erschien erstmals am 04.01.1982 unter dem Pseudonym Henry Wolf in der Reihe »Gespenster-Krimi«.
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein ist der erfolgreichste deutschsprachige Fantasy-Autor mit einer Gesamtauflage von über 40 Millionen Büchern weltweit.
WOLFGANG
HOHLBEIN
Das Schwert des Bösen
Ein Gespenster-Krimi Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Aktualisierte Neuausgabe der im Bastei Lübbe Verlag erschienenen Romanhefte aus der Reihe Gespenster-Krimi
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Esther Madaler
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von © shutterstock/Natykach Nataliia; shutterstock/Dmitry Natashin
E-Book-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-1414-4
Das Schwert des Bösen
Ein Gespenster-Krimi von Henry Wolf
Freunde nannten ihn Lance.
Aber es gab nicht viele Menschen, die sich dieses Privilegs rühmen konnten. Die wenigen, die es besessen hatten, waren tot, hinterrücks ermordet, gefallen in irgendeiner sinnlosen, blutigen Schlacht, hingemetzelt auf dem Feld der Ehre, das so wenigen wirklichen Ruhm und so vielen den Tod gebracht hatte.
Für die anderen war er Sir Lancelot.
Lancelot du Lac. In einer kurzen, bitteren Vision sah er das vor sich aufsteigen, was die Menschen vielleicht eines Tages beim Klang dieses Namens empfinden mochten. Heldenmut. Unerschütterlichkeit. Treue und Ritterlichkeit, Ergebenheit und Mut.
Aber all das stimmte nicht. Er war nichts von alledem. Er hatte es nie sein wollen. Man hatte ihm diese Rolle aufgezwungen. Das Schicksal hatte ihn zum Helden bestimmt, und er hatte sich nicht wehren können. Er hätte es tun sollen – das begriff er mittlerweile.
Aber jetzt war es zu spät.
Er schloss die Augen, legte den Kopf in den Nacken und genoss für Augenblicke die letzten wärmenden Strahlen der Sonne. Kalter Wind war aufgekommen, fuhr raschelnd durch das Gras zu seinen Füßen und arbeitete sich geduldig durch seine Kleidung. Irgendwie hatte dieser Wind eine fast symbolische Bedeutung für Lance. Für dieses Land, vielleicht für die ganze Welt. Es war Abend, aber es schien nicht nur der Abend eines Tages zu sein, sondern der Sonnenuntergang einer Epoche, die kurze, luftige Dämmerung, der Jahrhunderte der Finsternis folgen sollten.
Lancelot du Lac ... Er wusste, dass er eines Tages ein Held sein würde. Was würden all diese nachfolgenden Generationen wohl sagen, dachte er, wenn sie ihn jetzt sehen könnten? Einen gebrochenen, verbitterten Mann, der mit gebeugten Schultern auf den letzten Ausläufern der Kreidefelsen stand und weinte.
Weinte. Gegen seinen Willen musste er lachen. Helden weinen nicht. Das war einer der Grundsätze, die sie ihm immer und immer wieder eingehämmert hatten. So lange, bis er schließlich selbst daran geglaubt hatte.
Und was hatte er davon gehabt? Alles, wofür er je gekämpft und gelebt hatte, war zerstört. Die beiden Frauen, die er in seinem Leben geliebt hatte, waren fort: Die eine tot, die andere unerreichbar, schlimmer noch als tot. Das Wissen, dass sie lebte, dass sie da war und doch unerreichbar für ihn, dass alles, was er ihr je geben konnte, ein paar flüchtige, zärtliche Blicke waren, war quälender als alles.
Er öffnete die Augen und trat dicht an den Felsabbruch heran. Das Meer rollte zweihundert Fuß unter ihm donnernd gegen die schwarzen Klippen. Es wäre leicht. So leicht. Ein Schritt, ein kurzer Sturz, vielleicht ein stechender Schmerz, und alles hätte ein Ende.
Aber auch das war ein Ausweg, der ihm verwehrt war.
Er hob das Schwert, fing die letzten Strahlen der untergehenden Sonne auf dem blitzenden Metall ein und studierte die verschlungenen Gravuren auf der fast meterlangen Klinge. Es schimmerte immer noch makellos und rein in seinen Händen. Nicht der winzigste Fleck war auf dem gehärteten Stahl zurückgeblieben.
Modreds Blut hatte keine Spuren hinterlassen.
Er dachte wieder daran, was Merlin gesagt hatte, als Artus es vor so vielen Sommern aus seinem steinernen Grab gezogen hatte:
»In den richtigen Händen vollbringt es Wunder. Aber in den falschen wird es zum Fluch.«
Waren ihre Hände so falsch gewesen? Hatte ihr großes Ziel nicht dem Willen der Götter entsprochen? Er spürte das sanfte, beruhigende Pulsieren der Waffe in seinen Händen: der Pulsschlag der ungeheuren magischen Kräfte, die in dem schlanken Stück Stuhl eingeschlossen waren.
»In den falschen wird es zum Fluch ...«, murmelt er halblaut.
Er hatte gemordet. Er hatte Excalibur dazu missbraucht, einen Menschen zu ermorden. Ein Kampf war es nur in den Augen der anderen gewesen. Auch mit einer normalen Waffe hätte Modred kaum eine Chance gegen ihn gehabt, aber Excalibur hatte es zu einer Hinrichtung werden lassen. Er hatte es nicht einmal zu führen brauchen. Die magische Waffe schien den Mörder ihres Herrn erkannt zu haben, war in seinen Händen zu einem lebendigen, flirrenden Schatten geworden, der sich so schnell bewegte, dass seine Augen nur noch einen verschwommenen Umriss sahen.
Die Macht, die in dieser Waffe schlummerte, war ihm nur zu deutlich bewusst geworden. Mit Excalibur war er unbesiegbar. Und einen kleinen Moment lang hatte er sich vorgestellt, dass es vielleicht möglich war, Artus großen Traum doch noch zu verwirklichen. Fast wäre er der Versuchung erlegen.
Aber die Tafelrunde war zerbrochen: ihre Ritter tot oder in alle Winde zerstreut. Jetzt gab es nur noch ihn. Lancelot.
Mit einer entschlossenen Bewegung holte er aus und schleuderte Excalibur von sich. Das Schwert beschrieb einen weiten, glitzernden Bogen, drehte sich wie unter einer inneren Kraft schneller und immer schneller, bis es einem flammenden Feuerrad zu gleichen schien.
Dann tauchte es in den Wellen unter.
Er blieb noch lange so stehen, starrte die Stelle an, an der Excalibur verschwunden war, und dachte nach. Er fühlte sich wie von einer schweren, drückenden Last befreit. Er hatte Artus auf dem Totenbett versprechen müssen, die Waffe im Meer zu versenken. Es war sein letztes Versprechen gewesen, die letzte Verbindung zur Tafelrunde und zu ihrem legendären König. Jetzt war er frei.
Er straffte die Schultern, drehte sich um und pfiff seinem Pferd. Britannien war groß. Es würde lange dauern, ehe das Reich ganz in Barbarei und Chaos versank.
Bis dahin gab es genug Arbeit für einen Helden ...
***
Noch lange, nachdem der Ritter seinen Platz auf dem Gipfel des Kreidefelsens verlassen hatte, glomm ein geheimnisvolles Feuer durch die Brandung. Die Menschen, die in dieser Gegend lebten, fürchteten es. Sie mieden die Stelle, und auch, als das Licht verloschen war, erzählten sie mit gesenkter Stimme und hinter vorgehaltener Hand davon.
Irgendwann geriet es in Vergessenheit. Lange, endlos lange wusste niemand, wo Excalibur zu suchen war. Fast sechzig Generationen lang.
Mehr als eintausendfünfhundert Jahre vergingen ...
***
Das dumpfe Brummen des Außenbordmotors ging im Brüllen der Brandung beinahe unter. Die See war relativ ruhig an diesem Tag, aber in der kleinen Bucht fing sich die Strömung wie in einem Flaschenhals. Selbst an Tagen wie heute, wenn die Nordsee wie eine flache, spiegelnde Ebene vor der Küste lag, brachen sich die Wellen mit ungestümer Gewalt an den Klippen.
Lancelot hatte Mühe, das Boot gegen die Gewalt der Strömung auf Kurs zu halten. Vom Ufer bis zur Schaluppe seines Vaters waren es keine neunhundert Fuß, aber Lance brauchte regelmäßig mehr als eine viertel Stunde, um die geringe Distanz zu überbrücken. Hinzu kam, dass die Bucht mit Riffen gespickt war wie der Rachen eines Haifisches mit Zähnen. Selbst dort, wo das Wasser einigermaßen ruhig zu sein schien, musste er mit voller Konzentration fahren, um nicht auf eine der gefährlichen, manchmal nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche verborgenen Klippen aufzulaufen. Wenn das Boot hier draußen leckschlug oder kenterte, war das so gut wie ein Todesurteil. Selbst ein ausgezeichneter Schwimmer hätte sich gegen die reißenden Unterströmungen nur wenige Augenblicke halten können.
Eine plötzliche Windböe erfasste das winzige Boot, drängte es vom Kurs ab und brachte es in gefährliche Nähe eines Riffs, das schwarz glänzend und drohend aus der schaumigen Wasseroberfläche emporragte. Lance fluchte unterdrückt, riss mit aller Kraft am Ruder und drehte den Motor erbarmungslos auf. Das Boot machte einen Satz, krängte zur anderen Seite hinüber und kam schließlich frei.
Trotz der Kälte war Lance schweißgebadet, als er das Motorboot neben die algenverkrustete Bordwand der Schaluppe lenkte und nach dem Tau griff, das ihm einer der Matrosen zuwarf. Er kletterte an Bord, nickte dem Mann dankbar zu und überließ es ihm und seinen Kollegen, das Beiboot an Deck zu hieven und zu vertäuen. Selbst hier oben auf Deck wehte ein eisiger, durchdringender Wind. Lance schauderte, als er daran dachte, dass er die gleiche Fahrt am selben Abend noch einmal unternehmen musste. Selbst am Tage war es schon ein Abenteuer, über die Bucht zu fahren. Nach Dunkelwerden konnte es zu einem Spiel auf Leben und Tod werden. Aber er hatte keine Wahl – sein Vater mochte großzügig sein, aber bei seiner Arbeit duldete er keinen Widerspruch.
Lance warf einen flüchtigen Blick ins Ruderhaus und ging dann unter Deck. Sein Vater war in seiner Kabine und arbeitete. Er sah kaum auf, als Lance den kleinen, mit Bücherregalen und Papieren vollgestopften Raum betrat.
»Na«, brummte er. »Wie war die Fahrt?«
Lancelot grinste humorlos und ließ sich auf einen der niedrigen, bequemen Stühle fallen, die im Halbkreis um den überdimensionalen Schreibtisch aufgereiht waren. »Stürmisch«, sagte er nach einer Weile.
Professor Jacob Biggs sah kurz von seinen Papieren auf. Er war Mitte sechzig, aber die Jahre schienen spurlos an ihm vorübergegangen zu sein. Wären die winzigen, im schwachen Licht der Kabine kaum sichtbaren Fältchen um seine Augen und das graue Haar nicht gewesen, hätte man ihn für vierzig halten können. Und er sah ganz und gar nicht so aus, wie man sich im allgemeinen einen würdigen Professor für Archäologie und Geschichte vorstellen mochte – im Gegenteil, Biggs machte einen sportlichen, durchtrainierten Eindruck, und in seinen Augen glomm ein jugendliches Feuer.
»Hast du das Geld?«, fragte er.
Lancelot griff wortlos in sein Jackett und förderte einen dickleibigen Briefumschlag zutage. »Alles da. Vierhundertfünfzig Pfund. Alles, was noch auf dem Konto war. Du musst nach London telegrafieren und Nachschub ordern.« Er grinste flüchtig.
Biggs steckte den Briefumschlag in die Hosentasche, ohne auf die Bemerkung seines Sohnes einzugehen. Er beugte sich wieder über seine Karte, fügte mit präzisen Bewegungen ein paar Punkte und Striche zu dem scheinbar sinnlosen Durcheinander aus Linien, Kreuzen und geheimnisvollen Zeichen und sah schließlich triumphierend auf. »Ich glaube, wir sind jetzt fast am Ziel«, sagte er.
Lancelot beugte sich gelangweilt über den Tisch. Die polierte Ebenholzplatte brach unter dem Gewicht der Bücher und Papiere beinahe zusammen, aber für Lance bedeuteten all diese Zeichen nicht mehr als die Hieroglyphen in einer ägyptischen Pyramide. Aber er wusste, dass er wenigstens Interesse heucheln musste, wenn er seinen Vater nicht kränken wollte.
»Hier.« Biggs deutete mit der Spitze seines Federhalters auf einen der wenigen Flecke der Karte, die noch nicht mit Zeichen und Linien übersät waren. »Sharkland steigt heute Nachmittag hier ab. Wenn wir etwas Glück haben, hat er Erfolg.« Er wartete, dass sein Sohn etwas sagte, und stand schließlich enttäuscht auf. »Du solltest dich umziehen«, sagte er. »Du bist nass bis auf die Haut.« Er griff in die Hosentasche und gab Lance das Paket mit dem Geld zurück. »Tu mir einen Gefallen und zahl’ anschließend die Leute aus. Sie warten schon seit gestern auf ihren Lohn.«
Lance ergriff das dargebotene Paket, machte aber keine Anstalten, es einzustecken oder aufzustehen. Auf seinem Gesicht erschien ein verlegener Ausdruck.
»Ist noch etwas?«, fragte Biggs.
»Nun ...« druckste Lance herum. »Ich ...«
»Red nicht um den heißen Brei herum. Du weißt, dass ich so etwas nicht leiden kann, Was ist los mit dir?«
»Ich ... brauche Geld«, platzte Lance schließlich heraus. »Ich würde dich nicht darum bitten, aber ... ich brauche es ziemlich dringend. «
Biggs sagte eine ganze Weile lang gar nichts. Schließlich drehte er sich um, schlurfte zu seinem Stuhl zurück und setzte sich mit betont umständlichen Bewegungen.
»Du brauchst Geld«, wiederholt er schließlich.
Lance nickte hastig. Seine Finger spielten nervös mit dem Umschlag. »Ich … ich würde dich bestimmt nicht ausgerechnet jetzt fragen, aber ... es ist dringend.«
»Dringend? Soso.« Biggs nickte, verschränkte die Hände vor dem Bauch und sah seinen Sohn scharf an. »Wozu, wenn ich fragen darf. Und wie viel?«
»Ich ...« Lance atmete scharf ein, schloss die Augen und sagte fast eine Minute lang nichts. »Tausend Pfund«, stieß er schließlich hervor. »Bis morgen Abend.« Seine Stimme zitterte. Von dem Image des jugendhaften Playboys, das er in der Öffentlichkeit zur Schau zu tragen pflegte, war nichts mehr geblieben. »Tausend Pfund?!« Biggs beugte sich vor und stützte die Arme auf dem Schreibtisch auf. »Das ist verdammt viel Geld, mein Junge.«
»Sag nicht mein Junge!«, zischte Lance. »Ich bin neunundzwanzig, und ich kann es nicht leiden, wenn du mich ...«
»Halt den Mund, Lancelot«, fuhr ihm sein Vater ins Wort. Er hob nicht einmal die Stimme dabei, aber der Klang seiner Worte ließ Lance augenblicklich verstummen. »Ich weiß recht gut, wie alt du bist. Aber ich weiß auch, dass du noch keinen Tag wirklich gearbeitet hast, seit du das College mit Hängen und Würgen hinter dich gebracht hast. Und ich weiß auch, dass ich dir seit Jahren ein Studium finanziere, von dem ich längst nicht mehr annehme, dass du es jemals mit Erfolg beendest. Und ich weiß auch, dass ich dir ein Taschengeld zahle, von dem mancher schwer arbeitende Mann eine Familie ernähren könnte. Da wird es doch wohl erlaubt sein, zu fragen, wozu du so viel Geld benötigst.«
»Ich – ich habe Schulden«, sagte Lance. Er hob den Kopf, konnte dem Blick seines Vaters aber nicht standhalten und sah betreten zu Boden.
»Das dachte ich mir«, nickte Biggs. »Wofür?«
»Bitte, Vater. Ich brauche das Geld, und ...«
»Wofür?«, fragte Biggs scharf.
»Ich ... ich habe gespielt.«
»Gespielt?« Biggs sprang auf, kam mit raschen Schritten um den Tisch herum und baute sich drohend vor seinem Sohn auf. »Glücksspiele? Poker und so etwas?«
»Black Jack und Gin Rommee.« Lance sah auf. In seine Augen trat ein trotziges Flackern. »Die gleichen Spiele, die du auch mit deinen Freunden spielst. Du hast sie mir beigebracht.«
»Nur, dass ich nicht um Geld spiele, Lance«, antwortete Biggs ruhig. »Schon gar nicht um solche Beträge.«
»Es ist aber nun einmal passiert«, gab Lance aufgebracht zurück. »Ich würde dich nicht um Hilfe bitten, wenn ...«
»Du brauchst mich nicht zu bitten«, sagte Biggs ruhig. »Ich werde dir keinen Penny geben. Du hast dich in die Klemme hineingebracht, nun sieh zu, wie du wieder herauskommst. Du bist alt genug dazu.«
»Vater, bitte!« Lance stand ebenfalls auf und sah seinen Vater flehend an. Seine Stimme klang beinahe verzweifelt, als er weitersprach. »Du verstehst das nicht. Die Leute, denen ich das Geld schulde, lassen nicht mit sich spaßen. Sie ... sie haben mir gedroht, wenn ...«
»Dann geh zur Polizei«, antwortete Biggs hart. Er drehte sich abrupt um, setzte sich erneut und beugte sich wieder über seine Arbeit.
»Vater, sie werden mir etwas antun, wenn du mir nicht hilfst.« Lance schrie jetzt fast, aber sein Vater schien die Worte gar nicht zu hören.
»Vater!«
Biggs sah endlich von seinen Papieren auf. Sein Gesicht wirkte unbeteiligt, aber Lance sah, dass er den Federhalter so fest umklammerte, dass die Knöchel weiß hervortraten.
»Setz dich, Lancelot«, sagte er schließlich sanft.
Lance gehorchte.
»Ich ... ich kann dir das Geld nicht geben, Junge«, begann Biggs nach einer Weile. »Selbst wenn ich wollte.«
»Aber ich ...«
Biggs schüttelte unmerklich den Kopf. »Ich habe es nicht«, sagte er. »Die vierhundertfünfzig Pfund, die du da in den Händen hältst, sind der Rest. Alles, was ich hatte.«
»Aber ...« Lance starrte seinen Vater entgeistert an. »Das – das ist doch unmöglich ...«, keuchte er.
»Es ist so«, sagte Biggs leise. »Ich habe das Geld nicht. Ich hätte es dir längst sagen sollen, ich weiß, aber jetzt, so kurz vor dem Ziel. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Ich weiß, dass wir in den nächsten Tagen fündig werden. Und ...«
»Aber du kannst doch unmöglich unser ganzes Geld in dieses wahnsinnige Unternehmen gesteckt haben!«, brüllte Lance plötzlich.
»Es war mein Geld, Lance«, sagte Biggs betont. »Nicht unser Geld. Und dieses Unternehmen ist ganz und gar nicht wahnsinnig. Ich dachte, dass du das begriffen hast.«
Lance sprang auf. »Soll das heißen, dass wir ruiniert sind?«, brüllte er. »Das Geld, die Wertpapiere, der Familienschmuck ...«
»Es ist nichts mehr da«, gab Biggs ruhig zurück. »Selbst wenn ich wollte, könnte ich dir nicht helfen.« Er lehnte sich zurück, sah seinen Sohn nachdenklich an und lächelte dann. »Ich stehe kurz vor dem Ziel, Lance«, sagte er leise. »Wir haben die Bucht Zentimeter für Zentimeter abgesucht. Es gibt nur noch diese eine Stelle, an der es liegen kann.«
Lance starrte seinen Vater entgeistert an. Dann, nach einer scheinbaren Ewigkeit, drehte er sich wortlos um und verließ mit hängenden Schultern die Kajüte.
***
Rouwland schnippte seine Zigarette zu Boden und drehte sich ärgerlich um. »Er kommt nicht«, brummte er. Ein wütender Zug lag um seine Mundwinkel, und seine Augen tränten vom langen angestrengten Starren in den Sonnenuntergang. Er ging zum Wagen zurück, riss die Tür auf und knallte sie unnötig heftig hinter sich zu. »Das Bürschchen denkt, dass es uns verladen kann.«
Cowley, der neben ihm auf dem Beifahrersitz saß und gelangweilt auf einem Grashalm herumkaute, lächelte dünn. »Vielleicht ist ihm etwas dazwischengekommen. «
»Dazwischengekommen. Pah!«, machte Rouwland. Er beugte sich vor, drehte den Zündschlüssel um und trat aufs Gas. Der Motor des Rovers erwachte brüllend zum Leben.
»Ist ja immerhin möglich, dass der Alte nicht mit dem Geld rausgerückt ist«, sagte Cowley.
Rouwland grinste humorlos. »Ich gebe ihm noch eine Chance«, sagte er leise. »Wenn er sich bis morgen früh nicht bei uns meldet, nehmen wir uns den Kleinen mal vor.« Er wendete den Rover, fuhr ein Stück den Feldweg entlang und stoppte. Von hier oben aus konnten sie die kleine, dreieckige Bucht gut überblicken. Die Schaluppe hockte wie eine schwarze, lang gestreckte Spinne im Zentrum eines Gewirres von Kabeln, Ketten und Drahtseilen, das sie gegen die wütende Strömung auf ihrer Position hielt. Trotzdem schaukelte das Boot so stark, dass die beiden Männer die Bewegung hier oben noch ausmachen konnten.
»Möchte wissen, was der Alte da unten zu finden hofft«, murmelte Rouwland.
»Vielleicht einen versunkenen Schatz«, spöttelte Cowley.
Rouwland verzog ärgerlich das Gesicht. Die rote, aufgeworfene Narbe über seiner linken Wange ließ es zu einer Furcht einflößenden Grimasse werden. »Red keinen Scheiß, Cow. Der Alte ist Professor in Harvard, oder?«
Cowley nickte.
»Wahrscheinlich buddelt er auf dem Meeresgrund nach alten Tonscherben oder so etwas.«
Cowley schauderte. »Ich möchte da jedenfalls nicht runter«, murmelt er nachdenklich. »Der Alte muss den Leuten Unsummen bezahlen, die da tauchen.«
Rouwland nickte nachdenklich. »Wahrscheinlich.« Er zündete sich eine neue Zigarette an und blies eine blaue Rauchwolke gegen die Windschutzscheibe. »Ich denke, es ist am besten, wenn wir gleich nach London zurückfahren.«
»Ohne das Geld?«
Rouwland grinste. »Thompson wird nicht sehr erfreut darüber sein, wie?«