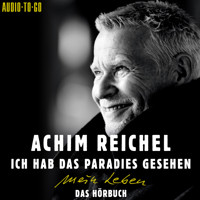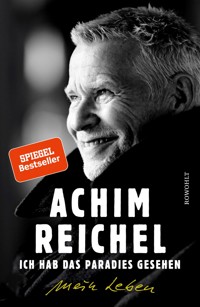
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Achim Reichel, seit fast 60 Jahren auf der Bühne zuhause, blickt zurück auf sein Leben. 2019 feierte er zu seiner größten Verwunderung seinen 75. Geburtstag – und es ist viel passiert, was sich zu erzählen lohnt: In den Sechzigern feiert er als Frontmann der Rattles Erfolge, wird in den Siebzigern Vorreiter des Krautrocks, veröffentlicht ein Album mit Shantys und Seefahrersongs, vertont Balladen von Goethe und Fontane, arbeitet mit Jörg Fauser und veröffentlicht seine großen Hits "Aloha Heja He" und "Kuddel Daddel Du". Und jetzt? Auf einem Containerschiff reiste Reichel nach Namibia und nutzte diese Auszeit, um sein Leben aufzuschreiben – von den Anfängen auf St. Pauli über die wilden Jahre on the road bis heute. Bunt, nachdenklich und faszinierend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Achim Reichel
Ich hab das Paradies gesehen
Mein Leben
Über dieses Buch
Achim Reichel, seit fast 60 Jahren auf der Bühne zuhause, blickt zurück auf sein Leben. 2019 feierte er zu seiner größten Verwunderung seinen 75. Geburtstag – und es ist viel passiert, was sich zu erzählen lohnt: In den Sechzigern feiert er als Frontmann der Rattles Erfolge, wird in den Siebzigern Vorreiter des Krautrocks, veröffentlicht ein Album mit Shantys und Seefahrersongs, vertont Balladen von Goethe und Fontane, arbeitet mit Jörg Fauser und veröffentlicht seine großen Hits «Aloha Heja He» und «Kuddel Daddel Du». Und jetzt? Auf einem Containerschiff reiste Reichel nach Namibia und nutzte diese Auszeit, um sein Leben aufzuschreiben – von den Anfängen auf St. Pauli über die wilden Jahre on the road bis heute. Bunt, nachdenklich und faszinierend.
Impressum
Achim Reichel dankt den folgenden Fotografen herzlich für die Fotos im Tafelteil:
Jim Rakete
Günter Zint
Hinrich Franck und Matti Klatt
Michael Gimbut
Eva Kroht
Arthur Carstens
Jens Ehlers
Arne Weserberg
Ingo Nordhofen
Max Scheler
Archiv Herbert Hauke Rockmuseum
Arno Weichold
Rudolf Ahlert
«Brösel» Rötger Feldmann
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Alle abgedruckten Songtexte von Achim Reichel und Jörg Fauser
mit freundlicher Genehmigung von Gorilla Musik-Verlag GmbH
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Hinrich Franck, Matti Klatt
ISBN 978-3-644-00657-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Widmung
Gewidmet meiner Frau Heidi und unserer wahren Liebe,
den Kindern Marlies, Alena & Illya,
meinen Eltern Ella und Heinrich Reichel und
meiner Schwester Jutta
Die Frachterreise
----------------------------------------------
Wenn der Wind in die Segel der Erinnerung weht
Und der alte Seebär noch einmal auf die Reise geht
er schließt dann die Augen und hört alsbald
Gesang der von fern übers Wasser hallt
Reise Reise
Reise Reise
die Leinen los
Reise Reise
Wenn der Wind in die Segel der Erinnerung weht
und er bei steifer Brise wieder an der Reling steht
Da wird’s ihm in den Knien vom Seegang federleicht
Nur Wellen, Wind und Wolken, soweit das Auge reicht
Reise Reise …
Und wie der Wind in die Segel der Erinnerung weht
Ihm ein Geschmack von Salz über die Lippen geht
Da öffnet er die Augen, ganz ungewollt
Es war das Salz von Tränen, die ihm über die Wangen gerollt
Reise Reise …
Seit fünf Jahren schrieb ich nun schon an meiner Autobiographie und hatte das Gefühl, nicht mal die Hälfte davon geschafft zu haben. Immer wieder musste Zeit für Dinge aufgewendet werden, die meine Schreibbemühungen in die Pause schickten. Ich war der irrigen Auffassung, ein Buch könnte, wenn auch langsam, aber doch peu à peu nebenher entstehen. So konnte nur einer denken, der noch nie eins geschrieben hatte.
Mal mussten neue Songs für ein neues Album geschrieben werden, das ich «Raureif» nennen wollte; als ich damit fertig war, wollte entschieden werden, in welchem Studio mit welchen Musikern aufgenommen werden sollte. Als die Aufnahmen im Kasten waren, begannen die Veröffentlichungsvorbereitungen, das bedeutete Fototermine, Treffen mit Grafikern, die das Cover, das Booklet, das Konzertposter, die Anzeigen et cetera gestalten sollten. Dann musste ein neuer Pressetext her; es musste geklärt werden, wer dafür in Frage kam, ihn zu schreiben, und als derjenige gefunden war, zog auch das wieder Gesprächstermine nach sich. Als das Album veröffentlicht wurde, stand die obligatorische Interviewreise an, die mich kreuz und quer durchs Land führte. Kaum war das erledigt, sollte eine Tournee vorbereitet werden, also ging es weiter: Gespräche mit der Konzertagentur, Zusammenstellung des Tourneeprogramms, Gespräche mit den Musikern, den begleitenden Technikern, und dann begannen die Konzertproben. Als es endlich so weit war, der Boden vorbereitet, ging es auf Tournee, zehn Konzerte im Frühjahr, zehn Konzerte im Herbst.
Für alles, was hier entschieden und organisiert werden musste, war ich selbst zuständig. Dabei wollte die Fitness, sowohl die körperliche als auch die an meinem Instrument, die Handhabung der sich rasch verändernden Studiotechnik, die geschäftlichen als auch sozialen Kontakte und, was eigentlich zuerst genannt werden sollte, das Familienleben beständig gepflegt werden. All das versetzte mich bisweilen in die Rolle eines Zehnkämpfers der besonderen Art.
Dass ich mit meiner Philosophie des Rundum-Selbstmanagements irgendwann an meine Grenzen gelangen würde, war zu erwarten, denn die Naturgesetze machen vor niemandem halt. Früher hatte mir all das überhaupt nichts ausgemacht und mir das schöne Gefühl gegeben, als One-Man-Kompanie autark alle Fäden in eigener Hand zu halten; aber nun war ich an einem Punkt angelangt, an dem ich mir eingestehen musste, dass dieses Konzept auf den Prüfstand gehörte. Immer wieder von einem Thema ins nächste zu springen und bei alldem nebenher auch noch eine Autobiographie zu schreiben, wollte mir nicht so recht gelingen.
Wie sagte mir im Oktober 2012 der Schriftsteller Frank Schätzing während unseres gemeinsamen Engagements für die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, bei dem er aus seinem Bestseller «Der Schwarm» las und ich einige meiner maritimen Lieder beisteuerte: «Zum Schreiben bedarf es Einsamkeit.» Der tiefere Sinn dieses Satzes wurde mir erst bei meiner Reise mit dem Frachtschiff so richtig klar.
Das Eintauchen und ungestörte Verharren in jener Welt, die man sich zum Thema gemacht hat, kann nur gelingen, wenn man dranbleibt und seiner Konzentration nicht ständig selbst den Teppich unter den Füßen wegzieht.
Mit meiner Musik seit mehr als einem halben Jahrhundert unterwegs zu sein und dabei immer wieder vor mein Publikum zu treten, ihm etwas geben zu können und im Gegenzug etwas zurückzubekommen, das mir das schöne Gefühl beschert, ein sinnvolles Dasein zu führen, war mir eine große Lust und Freude. Es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und, ich gebe zu, auch mit einem gewissen Stolz.
Während es im Alltag immer virtueller zugeht, lief bei jeder Tournee alles in Echtzeit ab, vom gemeinsamen Frühstück bis zur Abfahrt in die nächste Stadt, vom Bühnenaufbau bis zum Soundcheck, bis dann zur Krönung eines jeden Tages die Bühnenlichter angingen und ein vorfreudig applaudierendes Publikum uns zu den Instrumenten greifen ließ.
Nachdem es vollbracht war, ging es kaputt, aber glücklich zurück ins Hotel – und an die Hotelbar für den wohlverdienten Absacker. So in etwa sah sie aus, die sich täglich wiederholende Tourneeroutine.
Aber trotz alldem: was für ein selten schönes Gefühl, sich am Ende eines langen Tages entspannt in die Kissen fallen zu lassen und noch beim Hinabgleiten in die Träume den verklingenden Applaus der letzten Zugabe in den Ohren zu haben.
7. August 2018, Hamburger Hafen, Süd-West Terminal am Kamerunkai; der Containerfrachter Blue Master 2 wartete auf seinen einzigen Passagier. Wobei klargestellt sein will: Gewartet hätte er mit Sicherheit nicht, denn in den Beförderungsbedingungen kam klar zum Ausdruck, dass die Fracht vorrangig war und der Passagier darauf eingestellt sein sollte, dass ihn kein Empfangskomitee erwarten würde. Der Umstand, dass der Abfahrtstermin vom ursprünglich angekündigten 8. August kurzfristig auf den 7. vorverlegt worden war, gab mir einen ersten Vorgeschmack.
Der Koffer war schnell gepackt, und ich war pünktlich zur Stelle; meine Frau Heidi und Tochter Alena fuhren mich bis an die Gangway. Es war zwar kein Komitee, aber doch der Schiffssteward Oleg, der uns willkommen hieß und uns zunächst alle drei in die Offiziersmesse führte. Dort war um 11 Uhr 30 Dinnertime, und er servierte Schnitzel für alle. Anschließend führte er uns auf Deck 4, wo ich für die nächsten drei Wochen zu Hause sein würde. In der Hotelsprache würde man es als Juniorsuite einordnen: ein Schlafraum, Badezimmer mit Dusche und Klo und ein Wohnzimmer mit Fernseher, DVD- und CD-Player, Minibar, einer Sitzgruppe mit Tisch, den ich zu meinem Schreibtisch erklärte, alles recht gemütlich. Wie bei Containerfrachtern so üblich, befanden sich die Aufbauten auf dem Hinterschiff, was bedeutete, dass ich aus meinem Kabinenfenster einen erhabenen Ausblick über das ganze Vorderschiff hatte. Ich verabschiedete mich von meinen Lieben, und dann war es auch bald so weit: Reise Reise, wir legten ab, und bei strahlendem Sonnenschein ging es die Elbe runter.
Vorbei an der Elbphilharmonie, wo ich ein knappes Jahr zuvor ein triumphales Konzert mit meinem 70er-Jahre-Avantgardeprojekt A.R. & Machines hatte erleben dürfen, vorbei an den St. Pauli Landungsbrücken, wo ich meine Kellnerlehre absolviert hatte, weil ich als Schiffssteward zur See fahren wollte, vorbei an meinem Elternhaus oberhalb der Hafenstraße, vorbei an der St. Pauli-Kirche, in der ich konfirmiert worden war, vorbei an der Fischauktionshalle, wo ich im August 2003 an zwei Tagen mein 40-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert hatte, vorbei am Strand von Övelgönne, wohin wir als Schuljungen mit dem Fahrrad zum Schwimmen gefahren waren, vorbei am Falkensteiner Ufer, wo der pubertierende Achim mit seinen Kumpels das erste Mal wild kampiert hatte.
Das geht ja gut los, dachte ich, stand auf dem Oberdeck, und mich beschlichen große Gefühle. Als wir auf Höhe Cuxhaven anlangten, wo ich im Schullandheim Stickenbüttel während einer Klassenreise das erste Mal Bekanntschaft mit Heimweh gemacht hatte, waren davon nur Lichter im Dunkel zu sehen, und ich legte mich kurz darauf in meine Koje.
Doch mit dem Einschlafen war es nicht so einfach; der Maschinenraum, welcher sich ebenfalls im Hinterschiff befand, machte sich selbst im vierten Oberdeck noch mit einem dumpfen Grollen und vibrierenden Wänden bemerkbar. Dieses Geräusch sollte nun für drei Wochen mein ständiger Begleiter werden.
Am nächsten Morgen beim Frühstück von 7 Uhr 30 bis 8 Uhr 30 stellte ich fest, dass Seeleute ein Völkchen für sich sind: Einer nach dem anderen erschienen die Offiziere in der Messe und gaben, wenn überhaupt, nur einen kurzen, grunzenden Laut von sich. Auch untereinander wurde eher geschwiegen. Die gesamte Schiffscrew stammte aus Polen; war das deren Mentalität oder deren Gemütszustand? Auch daran hatte ich mich wohl zu gewöhnen.
Außer zu den Essenszeiten ließ ich mich kaum blicken, hockte in meiner Kammer und schwelgte in Erinnerungen, bearbeitete die Tasten und freute mich über die günstigen Preise im Bordshop. Hier war alles zollfrei, egal ob Wodka, Whiskey, Bier oder die Stange Zigaretten, alles spottbillig, und die Kombination aus allem brachte meine Schreiberei so richtig in Fahrt.
Der Kapitän lud dazu ein, bei Interesse jederzeit auf die Kommandobrücke kommen zu dürfen, und immer wenn mir nach einer Pause zumute war, schaute ich mir an, was es auf einem Frachtschiff alles zu entdecken gab. Wo früher einmal der Rudergänger an einem imposanten Steuerrad stand, fand ich ein Lenkrädchen vor, das gut und gerne auch aus einem Kleinwagen hätte stammen können. Was beim Automobil noch Zukunftsmusik, war in der Handelsschifffahrt längst Realität geworden: Den Kurs besorgte der satellitengesteuerte Autopilot, insofern gab es außer einigen Computermonitoren nicht viel zu sehen.
Was mich aber mächtig beeindruckte, war der Maschinenraum. Der befand sich im Heck des Schiffes und erstreckte sich über vier Decks unterhalb der Wasserlinie. Dort herrschte ein ohrenbetäubender Krach; zum Schutz trugen hier alle Lärmschutzkopfhörer, und bevor die Führung begann, bekam ich einen Satz Ohrstöpsel ausgehändigt, die ich mir in den Gehörgang pfropfte, was leider zur Folge hatte, dass ich von den Erklärungen des Obermaschinisten kein Wort verstand – obwohl ihm anzusehen war, dass er schrie.
Bis wieder ein Hafen angelaufen wird, ist dieses Schiff oft wochenlang unterwegs, und dabei laufen die Maschinen Tag und Nacht ohne Unterbrechung. Während ich mit der Kamera wild um mich schoss, zeigte sich der Maschinist völlig unbeeindruckt. Welch ein Arbeitsplatz, dachte ich, dagegen ist ein Pressluftbohrer oder die heftigste Heavy-Metal-Dröhnung nur harmloses Gesäusel.
Noch aber waren wir nicht mal in Antwerpen, wo der ganze Reiseplan aus dem Ruder laufen sollte. Irgendwo im Hafen war ein Feuer ausgebrochen; ich bekam die Anweisung, alle Fenster geschlossen zu halten, da es sich um einen Chemiebrand handele, dessen Rauch, einmal auf die Schleimhäute gelangt, heftigen Hustenreiz nach sich ziehen würde. Neugierig geworden, schlich ich mich trotzdem raus aufs Deck und sah eine Rauchsäule, die so weit entfernt war, dass ich glaubte, es würde uns nicht weiter betreffen. War dann aber doch so; wir liefen nicht wie geplant aus und mussten warten, wie sich die Dinge entwickelten.
Am Ende hingen wir anstelle von ursprünglich geplanten zwei Tagen eine ganze Woche im Hafen von Antwerpen fest, und mir ging langsam der Vorrat an Schnaps, Bier und Zigaretten aus.
Bei meinem Versuch, nachzubessern, eröffnete mir Oleg, dass der zollfreie Bordshop erst dann geöffnet werden dürfe, wenn das Schiff den Hafen wieder verlassen habe. Ich vertrieb mir die Zeit damit, dass ich an Land ging und mit dem Taxi in die Stadt fuhr, um mir Antwerpen anzusehen – ohne rechte Vorstellung davon, was mich erwarten würde. Es wurde weitaus interessanter als vermutet; ich war beeindruckt von der prunkvoll großbürgerlichen Architektur der Altstadt, die alle Kriege weitgehend unbeschädigt überstanden hatte, dazu gehörte auch die Liebfrauenkathedrale mit Gemälden von Peter Paul Rubens, und selbst der Hauptbahnhof war einer der schönsten, die ich bislang gesehen hatte. Ich wurde mit der Nase auf eine klaffende Bildungslücke gestoßen; dass Antwerpen nach Rotterdam der zweitgrößte Hafen Europas war, gehörte auch dazu.
Am nächsten Morgen beim Frühstück war ich dann weniger beeindruckt. Ich hatte mich gerade damit abgefunden, dass ich mich täglich zwischen Rührei, Spiegelei oder gekochtem Ei entscheiden konnte, und siehe da, heute war alles anders, denn vor mir auf dem Teller lagen zwei Wiener Würstchen. Ich schaute Oleg fragend an: «Würstchen zum Frühstück, wie merkwürdig ist das denn?» Er antwortete nur, dass das auf diesem Schiff überhaupt nicht merkwürdig sei. Also zweimal wöchentlich Würstchen, mal dünne lange, mal kurze dicke. Obwohl Robert, der Koch, auch mit positiven Überraschungen aufwarten konnte – ich entwickelte mich zwangsläufig zu einem Kenner der polnischen Küche, besonders ein Gericht, das sich Bigos nannte, schmeckte mir richtig gut. Meine Gewohnheit, vegetarisch zu essen, konnte ich mir komplett abschminken. Der Rückfall ins Fleischliche blieb nicht der einzige, und daran war nicht nur allein der Bordshop schuld. Ab und zu ein Bierchen, ein Weinchen oder ein Wodka als Rachenputzer erwies sich als geistige Nahrung, und ich registrierte mit Erleichterung, dass mein zur Nervosität neigender Magen problemlos mitspielte.
Irgendwann war auch Antwerpen überwunden, und bald darauf ging es durch den Ärmelkanal, links Frankreich und rechts die weißen Klippen von Dover. An einem dieser Tage kam Oleg während des Essens an meinen Tisch, beugte sich verschwörerisch zu mir herunter und flüsterte mir ins Ohr: «Your Ikognito ist kaputt», hielt mir sein Handy vor die Augen und zeigte sich sichtlich beeindruckt von dem Video, das er auf YouTube entdeckt hatte, besonders davon, wie das Publikum während meines Geburtstagskonzerts 1994 in der Großen Freiheit bei «Aloha Heja He» den Gesang übernahm, während ich selbst auf der Bühne stand und nur noch zuschaute. Die Kunde verbreitete sich schnell unter der Besatzung, was zur Folge hatte, dass der eine oder andere sich mir beim Betreten der Messe zuwandte und anstelle von «dzień dobry» nun «Good morning» murmelte.
Am Freitag, es war der elfte Tag unserer Fahrt, klopfte es an meiner Kabinentür, und ein bisher wortlos Gebliebener machte mich darauf aufmerksam, dass sich am Boden meines Kleiderschranks eine Schwimmweste, ein Schutzhelm und ein Sack mit einem Thermoanzug befanden. Er plagte sich sehr damit, sich im Englischen verständlich zu machen, aber Sinn und Zweck seines Erscheinens blieben mir verborgen. Mir selbst waren diese Dinge schon aufgefallen, und ich glaubte, er wolle mir nur die Sicherheitsausrüstung erläutern – wie bei einer Flugreise die Notausgänge, die Funktion der Sauerstoffmasken und die Sicherheitsgurte erklärt werden.
Kurz nachdem er gegangen war und ich mich wieder dem Schreiben zugewandt hatte, schrillte plötzlich ein hochfrequenter Alarmton in einer Lautstärke, die mir augenblicklich durch Mark und Bein fuhr. Reflexartig sprang ich aus meinem Sitz und hielt mir mit beiden Händen die Ohren zu. Was sollte denn der Quatsch? Kurz darauf klopfte Oleg an meine Tür, um mich zu einer Seenotrettungsübung abzuholen. Die ganze Schiffsmannschaft versammelte sich auf dem Oberdeck neben einem Gefährt, das als «free falling life boat» bezeichnet wurde. Das Boot war eine hermetisch abgeschlossene Kabine mit einer Heckluke, hatte Platz für 25 Personen und hing in einer Vorrichtung zehn Meter oberhalb des Wasserspiegels. Das konnte doch nicht wahr sein! Wir wurden tatsächlich zum Einsteigen aufgefordert, und anschließend erklärte ein Offizier die Bordausrüstung: Notverpflegung, Signalpistolen, Medikamente und ich weiß nicht was noch alles. Nach der Übung durften sich alle wieder zurück auf ihre Stationen begeben. Kaum war ich wieder zurück in meiner Kammer, heulte dieser schrille Ton ein weiteres Mal auf – diesmal zur Entwarnung. Ich griff zu meinem Smartphone und wollte das Erlebte gleich mal nach Hause whatsappen, aber nix war, wir befanden uns außer Reichweite aller Netzverbindungen.
Das Wetter blieb uns die ganze Zeit gnädig, sogar als wir entlang der Biskaya zum vorletzten Stopp Richtung Portugal fuhren.
Leixoes, 19. August, ein reiner Containerhafen mit gewaltigen Kränen, die diese riesigen Blechkisten aufs Schiff hoben. Bisher war vorwiegend der Frachtraum beladen worden, jetzt wurden die Containertürme darüber gestapelt, bis ich aus meinem Fenster in vierten Oberdeck nur noch Blechwände vor Augen hatte. Es war Sonntag; bevor wir die Endstrecke nach Walvis Bay/Namibia antraten, wollte ich mir Porto ansehen, das ganz in der Nähe war, die letzte Station in Europa. Ich ging von Bord und irrte durch nicht enden wollende Blocks von gestapelten Containern, als wäre ich in einer Stadt, in der die Häuser keine Fenster hatten. Das Thermometer zeigte 33 Grad, und ich hatte das Gefühl, in einem Irrgarten unterwegs zu sein. Irgendwann hatte ich den Ausgang gefunden und fragte einen Mann, der seinen Hund ausführte, wo hier ein Taxi zu finden wäre. Er erklärte mir mit weit ausholenden Armbewegungen auf Portugiesisch den Weg, ich glaubte kapiert zu haben und marschierte weiter in die angezeigte Richtung. Angekommen am Taxistand – kein Wagen da. Ich wartete. Bald darauf kam eine Frau vorbei, die auf meine Frage nach einem Taxi nur meinte, dass ich am heutigen Sonntag wohl lange warten könne.
Heute war wohl nicht mein Tag. Nach einer halben Stunde in gleißender Sonne entschied ich mich zum Rückzug. Völlig unzufrieden war ich nicht, hatte ich doch immerhin einen ausgiebigen Spaziergang auf festen Boden unternehmen können, wie er auf dem Schiff nicht möglich gewesen wäre. Dort gab es vom vierten Oberdeck nur die Wege hinab und herauf, 120 Treppenstufen, Fahrstuhl war nicht, 200 Meter entlang der Leeseite des Schiffes bis zum Bug und auf der Luvseite wieder 200 Meter zurück, mit Blick aufs Meer bis zum Horizont.
Außer dem Rauschen des vom Bug durchpflügten Wassers hörte ich entlang der schmalen Seitengänge Geräusche, die mir unheimlich erschienen. Wie ich mir sagen ließ, waren es die Blechwände der Container, die sich durch die Bewegung des Schiffes ständig verformten. Es klang, als befände sich darin jemand mit einem Vorschlaghammer, und manchmal entstand ein Rhythmus, als würde ein Schlagzeuger seinen ganzen Frust in ein gewaltiges Solo entladen. Auf meinem Weg vorbei an den Containern konnte ich nicht anders, als den Kopf einzuziehen und meine Schritte zu beschleunigen, um schnell daran vorbeizukommen. Von einem gemütlichen Deckspaziergang konnte nicht die Rede sein, und insofern war mir in meiner Kammer dann doch wohler zumute.
Auf meinem Laptop hatte ich zwölf Folgen einer amerikanischen Jazzdokumentation von Ken Burns dabei, die mir mein IT-Spezi Guido überspielt hatte; davon führte ich mir zum Ausklang eines jeden Tages eine Folge von knapp einer Stunde zu Gemüte.
In jüngeren Jahren empfand ich Jazzmusik als nerviges Gedudel; das tiefere Anliegen dieser Musik war mir lange verborgen geblieben und auch, dass es eine lange Entwicklungsgeschichte gab, die mit vielen ganz unterschiedlichen Stilrichtungen aufwarten konnte. Dass ein Mann wie Charlie Parker beileibe nicht der einzige mit wahrem Genie Gesegnete war, der sich mit seinen Improvisationen die Seele aus dem Leib spielen konnte und dabei Dinge vollbrachte, die 250 Jahre vor ihm Johann Sebastian Bach noch mit Bedacht zu Papier hatte bringen müssen, um sie hörbar zu machen.
Ich war verwundert, wie bewegt und angerührt ich von dieser wirklich exzellenten Musikdokumentation war. Musik, gleich welcher Richtung, kann ein Zuhause sein, und ich war glücklich, meines, wenn auch mit bescheidenerer Ausstattung, gefunden zu haben.
Nachdem die Blue Master 2 den Hafen von Leixoes wieder verlassen hatte, passierten wir in der folgenden Nacht Gibraltar, den engsten Punkt zwischen Europa und Afrika, und 48 Stunden später die Kanarischen Inseln; am Horizont war Teneriffa zu erkennen. Hier bot sich für lange Zeit die letzte Möglichkeit, per Smartphone ein Lebenszeichen nach Hause zu schicken.
Bevor wir wieder Land sehen würden, würden wir eine Strecke von Luftlinie 6658 Kilometern bewältigen müssen; da wir aber nicht durch die Luft unterwegs waren, sondern übers Wasser, musste zunächst der Bauch der Afrikanischen Westküste umfahren werden. Die Route führte entlang von Marokko, Westsahara, Mauretanien, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone und Liberia. All diese Länder befanden sich weit hinter dem Horizont, ohne dass jemals etwas anderes zu sehen war als Wasser, darüber der Himmel und in der Magengrube das komische Gefühl, dass es unter uns verdammt tief war; eine dunkle Parallelwelt, bevölkert von Fischen, Seeungeheuern und Schiffswracks.
Dieser Zustand sollte für ganze zwei Wochen anhalten. Mitten auf dem Atlantik gab es einen Punkt, von dem aus der Weg nach Brasilien kürzer gewesen wäre als der nach Namibia.
Am Samstag, dem 25. August fand auf dem vierten Oberdeck ab 18 Uhr ein großes Barbecue statt, an dem die gesamte Schiffscrew teilnahm und zu dem auch ich eingeladen war. Oleg erzählte mir, dass dieses Fest auf jeder Hinfahrt, die den Frachter noch ums Kap der Guten Hoffnung bis nach Durban in Südafrika führen sollte, und ein weiteres Mal auf dem Weg zurück nach Hamburg stattfand, und er gab mir mit schelmischem Grinsen zu verstehen, ich solle mich auf einiges gefasst machen.
Als ich das Oberdeck betrat, fand ich eine lange, festlich eingedeckte Tafel vor, darauf Batterien von eisgekühlten Bierflaschen, von denen die Tropfen perlten. Robert, der Koch, machte sich an einem großen Holzkohlengrill zu schaffen. Daneben ein Tisch mit Bergen von Steaks, Schnitzeln, Koteletts und verschiedenen Sorten von Grillwürsten.
Der Kapitän saß am Kopfende der langen Tafel, und mir wurde der Platz neben ihm zugewiesen. Kurz darauf servierte man mir einen Teller mit der ersten Fleischportion, ich nahm mir ein Bier dazu und ließ es mir schmecken.
Der Kapitän war in Plauderlaune und schien etwas für Musik übrig zu haben; er erzählte davon, dass es in Polen große Festivals gäbe, bei denen internationale Rockstars meines Alters auftraten und das Publikum von weit her angereist käme. Er selbst habe dort die Spencer Davis Group gehört und geriet regelrecht ins Schwärmen. Schau mal an, so’n polnischer Kapitän besucht Rockfestivals.
Aber damit nicht genug: Kurz darauf kam er auf das Thema Marihuana zu sprechen, und mit einer Handbewegung, als führte er sich zwischen Daumen und Zeigefinger einen dünnen Spliff zum Munde, lobte er das fortschrittliche Denken von Tschechen und Holländern, die dieses Genussmittel längst legalisiert hatten. Ich druckste ein wenig herum, konnte aber schlecht sagen, dass ich mir gern etwas davon mitgenommen hätte und es nur deshalb unterlassen hatte, weil in den Reiseinstruktionen nachzulesen war, dass der Zoll in den Häfen auch mal private Gepäckstücke filzte.
Derweil stieg rundherum der Gesprächspegel; Kandidaten, die mir bisher nur mit versteinerten Mienen begegnet waren, zeigten nun ein gelöstes Lächeln und scherzten. Der Sonnenuntergang tauchte alles in ein atmosphärisches Licht, und die zweite Phase des Festes begann. Plötzlich standen Wodka- und Whiskeyflaschen auf dem Tisch, und es dauerte gar nicht lange, da wurde ich von links und rechts angesprochen, wann ich denn nun diesen Song singe, der da auf YouTube zu sehen war, mit Aloha und so? Zur Ermunterung schenkte man mir randvoll Wodka ein und prostete mir zu, mit Gläsern, so groß wie Zahnputzbecher.
Hochprozentiges ist nicht so mein Ding, und wenn, dann eher nach deutscher Manier aus 2-cl-Schnapsgläschen, hier aber war ich unter polnischen Seeleuten, da herrschten andere Maßstäbe. Es kündigte sich ein regelrechtes Saufgelage an, und mir dämmerte, was Oleg gemeint hatte. Hinterher ist man immer schlauer – ich hätte vorher eine Dose Ölsardinen verdrücken sollen. So aber lief es darauf hinaus, dass ich ziemlich schnell Schlagseite bekam und dachte: Bring es hinter dich, solange du noch einigermaßen klare Gedanken fassen kannst.
Ich holte aus meiner Kammer die Baby Taylor, meine Reisegitarre, die auf allen meinen Reisen dabei ist, setzte mich zurück an den Tisch und legte los. Ich dachte, ich biete zunächst etwas an, was Standard ist, und entschied mich für «Twist and Shout». Nach halber Länge behielt ich dieselbe Akkordfolge bei und begann, den Text von «La Bamba» darüber zu singen. Ich bekam Applaus. Man schien nun echt bemüht um mich zu sein; kaum hatte ich einen Schluck aus meinem Zahnputzbecher genommen, schenkte man mir sofort nach. Pass auf dich auf, hörte ich Heidis Stimme im Geiste mahnen.
Als Nächstes schien mir der eine oder andere Sea-Shanty das Richtige zu sein, und so legte ich mit «Drunken Sailor» nach, gefolgt von «Rolling Home». Ich hatte mir vorgenommen, es bei einer Kostprobe zu belassen, aber vor mir stand schon wieder ein randvolles Glas, also ging ich direkt dazu über, «Aloha Heja He» anzustimmen.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie dieser Song sogar bei Leuten ankommt, die kein Wort vom Text verstehen. Sobald es zum Refrain kommt, kapieren sie immer, wo es langgeht. Die kantigen Kerle gerieten in Wallung, wenn auch zunächst noch etwas zaghaft, aber als ich gen Ende des Songs drei Refrains mit von Mal zu Mal ansteigender Stimmlage wiederholte, waren die meisten richtig in Stimmung, während sich bei einigen anderen die slawische Seele meldete, um mich mit melancholisch-glasigem Blick zu taxieren.
Nun hatte ich mein Gastgeschenk abgegeben; ich erhob mich von meinem Sitz, um mich mit einer scherzhaften Verbeugung für den Applaus zu bedanken, da schwankte plötzlich der Boden unter meinen Füßen, und es warf mich nach kurzem Taumel zurück in den Sitz. Hoppla! Ich hielt mich mit den Händen an der Tischkante fest, um nicht vom Hocker zu kippen. Zu allem Überfluss trat genau in dem Moment ein Schrank von Maat mit bis oben hin tätowierten Armen an mich heran und fragte, ob ich auch was von AC/DC singen könnte.
Ich warf das Handtuch; würde ich hier wankend über die Reling plumpsen, wäre ich von Gott und der Welt verlassen, denn rundherum war mittlerweile rabenschwarze Nacht. Aber auch der traumhafte Anblick des kristallklaren Sternenhimmels konnte nichts daran ändern: Ich wollte nur noch am Kissen horchen.
Der folgende Tag gehörte dem Kater, die Messe blieb geschlossen, das Frühstück fiel aus, der Einzige, der ohne Probleme seinen Dienst tat, war der Autopilot. Erst zum Mittag wurde wieder feste Nahrung zu sich genommen, und die alte Wortkargheit war zurückgekehrt. Das beim Betreten der Messe hingenuschelte «dzień dobry» klang eher nach einem Frosch im Hals.
Mir war nicht nach Schreiben zumute, sondern eher nach Faulenzen in der Sonne. Die einzige Möglichkeit dafür bot das Oberdeck, auf dem gestern das Barbecue stattgefunden hatte. Dort fand ich alles wieder tipptopp aufgeräumt vor; offensichtlich gab es doch Crewmitglieder, die Maß halten konnten. Ich schob, bekleidet mit kurzer Hose und Sonnenbrille, eine Sonnenliege in einen windgeschützten Winkel und ließ mich darauf nieder. Mag es für’s Auge friedlich ausgesehen haben, für’s Ohr sah das ganz anders aus. Obwohl sich Maschinenraum und Schiffsschraube fünf Decks tiefer unter der Wasserlinie befanden, machten sie einen ziemlichen Radau, was meiner Vorstellung von Entspannung nicht entgegenkam. Ein Kopfhörer mit Musik würde das Problem sicher lösen, also ging ich zurück in meine Kammer, cremte mich noch schnell mit Sonnenschutzfaktor 30 ein und kehrte zurück auf die Liege. In der nächsten halben Stunde drehte ich die Musik Stück für Stück lauter, bis der Maschinenlärm nur noch Hintergrundgeräusch war, aber mir wollte trotzdem nicht behaglich werden, denn mit meinem noch nicht überwundenen Schädelbrummen ging mir nun die Lautstärke der Musik auf den Wecker, und bei leiseren Passagen schob sich das Motorengeräusch wieder in den Vordergrund. Also verzog ich mich doch wieder in meine Kammer, um zu lesen.
Ich hatte das neue Buch von Wolfram Fleischhauer mit den Titel «Das Meer» dabei; es ging um industrielles Fischen unter Umgehung internationaler Gesetzeslagen und um eine Gruppe von radikalen Umweltaktivisten, die dagegen aufbegehrten. Obwohl es sich bei der Story um Fiktion handelte, hatte sie viele Bezüge zur Realität. Ich war sehr angetan von der Aufbereitung des Themas und verbummelte den Tag mit dieser höchst aufschlussreichen und dabei nicht minder spannenden Lektüre.
Nach dem Abendessen zog ich mir eine weitere Folge von Ken Burns’ Jazzdokumentation rein; ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass sie mich derartig in den Bann ziehen würde. Danach hatte ich mit Hilfe von Thelonious Monks «Round Midnight» auch die richtige Bettschwere erlangt.
Am nächsten Morgen unter der Dusche blickte ich erstaunt auf mein linkes Schienbein; ich war am Tag zuvor offenbar nur sehr nachlässig mit der Sonnenschutzcreme umgegangen. Hoch bis zum Knie entdeckte ich Verbrennungen, die, wie ich später feststellen sollte, selbst zwei Wochen später noch zu sehen waren. Sonne und Meer, eine gefährliche Mischung.
Durch den außerplanmäßig längeren Aufenthalt in Antwerpen verschob sich unsere Ankunft in Walvis Bay/Namibia um eine volle Woche. Ich hatte nun dafür zu sorgen, den Shuttledienst, der mich vom Hafen nach Swakopmund bringen sollte, die Beach Lodge, in der ich noch eine Woche verbringen wollte, und auch meinen Rückflug von Windhoek nach Frankfurt mit Anschluss nach Hamburg neu zu terminieren. Die einzige Möglichkeit bot der Bordcomputer, welcher nur periodisch einem Satelliten zugeschaltet war. Nach längerem Hin und Her gelang es mir, mit Hilfe der auf Afrika spezialisierten Agentur Toucan Reisen in Hamburg unter Verschmerzung unvermeidlicher Umbuchungsgebühren alles neu zu regeln. Nun denn, was wäre ein Abenteuer ohne Überraschungen?
Als ich von Bord ging, hatte ich viele Hände zu schütteln. Ich steckte Oleg noch ein Paar Scheine zu, und dann erwartete mich bereits ein freundlicher Officer, der mich innerhalb des Hafens mit dem Auto zum Immigrationsbüro fuhr. Dort angekommen, saß am Schalter hinter einer Glasscheibe eine schwarze Frau in Uniform. Ich glaubte, bestens vorbereitet zu sein. Peter, die gute Seele meines Büros, hatte mir extra für diesen Anlass eine Mappe mit allen Dokumenten zusammengestellt, die laut der Agentur Langsamreisen, bei der ich die Schiffsreise gebucht hatte, Bedingung waren, um ins Land gelassen zu werden: ein Gesundheitszeugnis meines Hausarztes, ein Unbedenklichkeitszertifikat des Tropeninstituts bezüglich Gelbfieberschutzimpfung, ein Nachweis meiner Krankenversicherung, dass ich auch im Ausland versichert war, der Ausdruck meines Rückflugtickets als Nachweis, dass ich das Land auch wieder verlassen würde, ein gültiger Auslandsführerschein, ein gültiger Reisepass und, was später hinzukam, eine Liste aller ins Land eingeführten Geräte wie: Gitarre, Laptop, Back-up-Festplatte, Fotoapparat, Smartphone, Ladegeräte bis hin zur elektrischen Zahnbürste, unterzeichnet und gestempelt vom Kapitän des Schiffes, mit dem ich angereist war. Ich war fast ein wenig enttäuscht, dass außer dem Reisepass nichts von alledem nachgefragt wurde. Was war es für eine Action, um diesen ganzen bürokratischen Kram auf die Reihe zu kriegen, und nun wollte niemand auch nur einen Blick darauf werfen.
Kurz darauf saß ich in einem klimatisierten Kleinbus Richtung Swakopmund, mein schwarzer Fahrer stellte sich als Matthias vor, und neugierig, wo ich hier gelandet war, ließ ich meinen Blick schweifen. Links des Wegs erstreckte sich der Atlantische Ozean, und zur Rechten sah ich, so weit das Auge reichte, nichts als Wüstensand. Matthias erzählte von sich schnell fortbewegenden Wanderdünen und Sandstürmen, die zu bestimmten Jahreszeiten so heftig übers Land gehen, dass es den Bewohnern dieses Landstrichs passieren konnte, sich freischaufeln zu müssen, um zur Haustür hinauszugelangen. Es ist doch überall ein Haar in der Suppe, dachte ich; dafür musste hier niemals Schnee geräumt werden.
Für mich sollte das kein Thema sein; denn ich war gekommen, um in Abgeschiedenheit in mich hineinhorchen zu können und mit meinem Buch voranzukommen.
Eine Kindheit auf St. Pauli
----------------------------------------------
Mein Daddy war ’n Sailorboy
Und meine Mama stand am Kai, ahoi.
Die war’n echtes Liebespaar,
Warum ich auch ’n echtes Wunschkind war!
mit ’m St. Pauli Blues.
Die Schule war ’ne Sauerei
Wir ham se abgerissen – heut steht da ’ne Brauerei
Die erste Liebe hast du mir gegeben
Und die letzte …
ist der St. Pauli Blues.
Du liegst mir im Blut
Und das tut so gut.
Drück mich an dein Herz.
Ich vergess mein’ Schmerz.
und den St. Pauli Blues.
Hier wird in den Straßen noch gelacht und gesungen.
Hier wird aber auch um jeden Freier gerungen.
Feine Pinkel wie Bauernpack,
Keine Angst – hier kommt ihr alle in den Sack!
zum St. Pauli Blues.
Wir sind doch alle deine Kinder,
Ob Chinese, Italiener oder Inder.
Und wenn dann alles mal zusammenfällt,
Was soll’s! Hier bin ich doch gleich am Tor zur Welt.
mit’m St. Pauli Blues.
Hey, wenn du nachts nicht schlafen kannst,
Wer hilft dir dann?
Und wenn nix mehr läuft?
Einer läuft immer!
Der St. Pauli Blues.
Früh am Morgen weckte mich der Klang des Nebelhorns, und als ich zum Fenster herausschaute, sah ich auf der Elbe nur die milchigen Positionsleuchten des sich in Zeitlupe bewegenden Schiffsverkehrs. Was am Morgen noch nach einem trüben Tag aussah, sollte sich am Mittag zum Besseren wenden. Der Frühnebel hatte sich verzogen, und die Märzsonne lud dazu ein, draußen zu spielen.
Wir waren dabei, mit weißer Kreide das Kopfsteinpflaster in unserer Straße Stein für Stein mit Kreisen und Kreuzen zu bemalen. Von einer Fahrbahnseite zur anderen und wieder zurück, still versunken in unsere Arbeit, als könnte uns nichts etwas anhaben. Über allem lag eine Ruhe, als wäre das Auto noch nicht erfunden worden. Nur vom Hafen schallte das vertraute Grundgeräusch von den Werften und Schiffen zu uns herüber.
Bis wir nach Hause gerufen würden, wollten wir die Straße auf Häuserbreite verziert haben, und so rutschte jeder auf seinem Hosenboden über die blanken Pflastersteine und hinterließ seine Spur. Bis zum Abend ging uns die Kreide nicht aus, und als wir unser vollendetes Werk endlich voller Stolz bestaunen konnten, hatte sich die Sonne bereits gen Horizont geneigt, und unsere weißen Kreuze und Kreise auf dem Straßenpflaster leuchteten in einem rötlichen Schimmer.
Es hatte sich ergeben, dass Vaters Schiff in Bremerhaven lag und er für einige seltene Tage nach Hause kommen sollte. Ich hatte das Gefühl, ihn kaum zu kennen, was mich ein wenig scheu sein ließ – ich erinnerte mich kaum daran, dass er je zu Hause war. Aber er war freundlich und brachte Geschenke mit, Holzschnitzereien aus Afrika, das indische Taj Mahal als Miniatur aus Speckstein und Tiefseemuscheln von den Philippinen, die so groß waren wie ein Menschenkopf; hielt man sie ans Ohr, klang es, als würde darin der Ozean rauschen. Vater ging mit uns in ein vornehmes Fischrestaurant mit weißen Tischtüchern und Stoffservietten. Mutter hatte ein schmuckes Kleid an, Vater ein Sakko mit Kavalierstuch in der Brusttasche, und ich musste die Hose mit den angenähten Hosenträgern anziehen, die ich so ungern trug, auch weil sie an den Beinen so unangenehm kratzte. Als der Kellner die Speisekarte brachte, erklärte mir Vater als Mann vom Welt, was sich hinter den geheimnisvollen Beschreibungen verbarg – zum Beispiel, dass «Müllerin Art» eine Zubereitungsweise beschreibt. In diesem Fall wird der Fisch durch gesalzene Milch gezogen, anschließend in Mehl gewendet und dann mit Butter in der Pfanne von beiden Seiten goldgelb gebraten. Oder dass Schillerlocken geräucherte Bauchlappen von einem Haifisch sind und nur so genannt werden, weil sich einst irgendjemand an des berühmten Dichters Locken erinnert fühlte. Die Speisekarte hatte mehrere Seiten, und ich wusste nicht so recht, wofür ich mich entscheiden sollte, also fragte ich, ob auch etwas dabei wäre, bei dem ich ohne langes Grätenpulen auskommen würde. Vater riet mir zu Seezunge «Müllerin Art». Als der Kellner das Essen brachte und mich ansprach – «Wünschen der junge Herr, dass ich seinen Fisch filetiere?» –, verstand ich nur Bahnhof, und als Vater sah, dass ich um die Antwort verlegen war, gab er dem Ober mit einem kurzen Nicken seine Zustimmung. Mit geschickter Hand sein Servierbesteck führend, begann der Ober den Fisch vor unseren Augen in seine Bestandteile zu zerlegen. Nachdem das Fleisch von den Gräten befreit war, legte er mir zwei der vier Filetstückchen auf den Teller und stellte das Serviertablett auf ein abseits stehendes Rechaud, in dem zwei Teelichte brannten. «Erst mal aufessen, dann ist ja noch was da», sagte Mutter. Wir griffen zum Besteck und ließen es uns schmecken.
Irgendwann fragte Vater mich, wie es denn in der Schule so liefe. «Im Zeichnen bin ich der Beste, im Betragen hab ich eine 2 und im Rechnen hab ich Nachhilfeunterricht, ich gebe mir alle Mühe, ehrlich!»
Er schaute sich meine Hände an und sah, dass ich an den Fingernägeln kaute, ohne etwas dazu zu sagen. Was mag er gedacht haben? Wenn er wüsste, dass ich vor einem Jahr noch gelegentlich Träume hatte, die mir feuchte Rätsel aufgaben; wie konnte es sein, dass ich auf einem nassen Bettlaken aufwachte, obwohl ich mich genau daran erinnern konnte, an einen Baum gepinkelt zu haben? Wie konnte es sein, dass ich die Welt aus der Vogelperspektive sah, obwohl ich doch in meinem Bett lag? Träume konnten einen richtig zum Narren halten, wie der, in dem ich auf einem Trümmergrundstück einen Schuhkarton voll mit Geldscheinen fand. Ich nahm ihn mit nach Haus, versteckte ihn unter meinem Bett, gewiss, dass sich der Schuhkarton an einem sicheren Ort befände, und legte mich schlafen. Als ich am nächsten Morgen die Augen aufschlug, schaute ich reflexartig unters Bett, um mich davon zu überzeugen, dass der Schuhkarton sich noch am rechten Platz befände …
Dieser Art Reflexe gehörten bald der Vergangenheit an, und auch die Fingernägelkauerei sollte bald überwunden sein, und so vermied ich es, das Gespräch darauf zu bringen.
In der folgenden Nacht schlief ich unruhig; in mir rumorte es vom späten Essen, und mein Kopf träumte wirres Zeug, als ich von fremdartigen Geräuschen geweckt wurde. Das, was ich hörte, drang aus dem direkt hinter meiner Kammertür liegenden Elternschlafzimmer. Ich traute mich nicht, die Nachttischlampe einzuschalten, erkannte aber die Stimme meiner Mutter, die angsterfüllt versprach, auch ganz artig zu sein, wenn man ihr nur nicht wieder wehtue. Mein Herz klopfte heftiger, und ich fürchtete mich, als sich die Stimmung hinter der Tür plötzlich ins Gegenteil zu wenden schien. Nun hörte ich leises Lachen, als würde Mutter sich amüsiert dagegen wehren, durchgekitzelt zu werden, während Vater die ganze Zeit brummte und ächzte wie unser Kohlenhändler, wenn er seine zentnerschweren Säcke ins obere Stockwerk wuchtete. Ich wusste nicht mehr, was ich denken sollte – dieses Hörspiel ließ mich einigermaßen verwirrt zurück und gab mir Rätsel auf, bis ich wieder eingeschlafen war.
Einige Tage später, es war der 1. April, und es hatte Zeugnisse für das zweite Schuljahr gegeben, sollten meine Eltern feststellen, dass ich nicht nur im Rechnen unter dem Durchschnitt lag, sondern auch im Lesen. Da half auch die 2 in Leibeserziehung nicht viel. Ich blickte in ernste Gesichter und versprach mich zu bessern, dann setzte Vater seine Unterschrift an die dafür vorgesehene Stelle auf dem Zeugnis. Viel lieber als mein Zeugnis zeigte ich Vater und Mutter meine Schiffsbilder, die alle an unserem Wohnzimmerfenster zum Hafen entstanden waren. Ein Motiv zeigte einen Frachter bei sturmschwerer See; gesehen hatte ich das Schiff, als es bei ruhigem Wetter elbabwärts auslief. «Und die stürmischen Wellen und Wolken hab ich mir dazu ausgedacht!» «Tja, von wem er das wohl hat?», fragte Mutter. Dann war da eine kleine Serie mit «großen Pötten», wie sie gerade von Bugsierschleppern durch den Hafen geschleust wurden, und noch eines, das mochte ich besonders, das den Großsegler «Seute Deern» zeigte, mit seiner Länge von 75 Metern der weltgrößte Frachtsegler, der noch komplett aus Holz gebaut war. Von meinem Platz am Fenster aus gut zu sehen, lag diese imposante alte Bark, fest vertäut als Hotel- und Restaurantschiff, am Liegeplatz der alten Fähre 7. Ihre drei Masten überragten die hoch am Uferhang stehenden Wohnhäuser, und von ihrer hölzernen Galionsfigur ging ein merkwürdiger Zauber aus. Ich stellte mir vor, wie dieser alte Segler am roten Felsen von Helgoland vorbeifuhr. «Der Junge hat Phantasie», meinte der Vater und nickte anerkennend. Ich glaube, das war auch Mutters Meinung, als sie sagte: «Besser, als wenn se Dummheiten machen.»
Damit meinte sie unsere Eskapaden durch die Trümmergelände der Umgebung, in der wir auf der Jagd nach Dingen waren, für die der Schrotthändler gegenüber einen guten Preis zahlte. Kupfer und Messing brachten am meisten. Unsere waghalsigen Kraxeleien in baufälligen Ruinenlandschaften mögen nicht immer ganz ungefährlich gewesen sein, aber einen besseren Abenteuerspielplatz als diesseits und jenseits der Elbe konnte es nicht geben. Drüben im Freihafen die eingestürzten Lagerschuppen, aus denen bereits kleine Bäume und Sträucher wucherten und wo entlang entlegener Hafenbecken Masten und Aufbauten auf Grund liegender Schiffen aus dem Wasser ragten. Auf den Kaianlagen erinnerten bizarre Stahlgerippe verbrannter Güterwaggons daran, dass es hier vor gar nicht langer Zeit mächtig gekracht haben musste.
Damals waren Hamburgs große Werftanlagen und seine revolutionären U-Boot-Bunker Teil der deutschen Rüstungsmaschine und darum bis zuletzt strategisches Angriffsziel der englischen Bombengeschwader.
Wenn ich heute daran denke, dass zwei Monate vor Kriegsende 450 Royal-Airforce-Bomber eine letzte 3000 Tonnen schwere Bombenlast auf das Hamburger Hafengebiet niederregnen ließen und Baby Achim mit einem aus Reet geflochtenen Wäschekorb in den Bunker getragen wurde, dann bin ich froh, keine Erinnerung daran zu haben. Den Wäschekorb gab es noch immer, als ich erste neugierige Fragen zu stellen begann. Als ich irgendwann wissen wollte, warum das Reetgeflecht ringsum an den Rändern so brandverkohlt war, wurde mir bei Mutters Antwort ganz mulmig: «Als die Luftschutzsirenen Alarm gaben und wir auf dem Weg in den Bunker waren, fielen schon die ersten Phosphorbomben. Wir trugen dich, zum Schutz von einer Wolldecke umhüllt, so schnell uns die Beine trugen im Slalom durch die am Boden züngelnden Flammen in den Bunker. Erst nachdem wir ihn erreicht hatten, bemerkten wir, dass der Reetkorb am Kokeln war. Der Schreck war groß, da hätte nicht viel gefehlt, aber Baby Achim schlief wie ’n Murmeltier und bekam von alldem nichts mit.»
Es überlebte nicht nur der Wäschekorb, auch die alte Wolldecke blieb uns lange erhalten; sie war bedruckt mit dem Schriftzug «Deutsche Schifffahrts Gesellschaft», Schifffahrt mit drei f. Das hatten wir in der Schule anders gelernt, da hieß es, Schiffahrtsgesellschaft würde mit zwei f geschrieben, einige Jahrzehnte später schrieb man es dann wieder so, wie es schon einmal war, mit fff in der Mitte.
Während ich zu Hause nur eine fensterlose Schlafkammer mein Eigen nennen konnte, fand ich draußen einen Spielplatz, wie er besser nicht sein konnte. Ansonsten war mein Lieblingsplatz an der Fensterbank unserer guten Stube. Dort lagen immer ein Flaggenlexikon und ein Weltatlas in Reichweite.
Bei den auslaufenden Schiffen konnte ich erkennen, wohin die Reise ging, weil sich am Mast neben der eigenen Nationalflagge eine zweite für das Gastland und eine dritte für das Bestimmungsland befand. Ich griff dann zum Atlas und reiste manchem Schiff mit dem Finger auf der Weltkarte voraus. Wenn ich meinen Tagträumen nachhing und mir vorstellte, dass mein Vater gerade den Indischen Ozean überquerte, während Großvater grad in der Karibik unterwegs war und die letzte Postkarte von Mutters Bruder Oskar aus Amerika kam, dann wuchs in mir der Wunsch, es ihnen eines Tages gleichzutun.
Am 21. April 1952 kam ich vom Spielen heim, dachte an nichts Böses und fand meine Mutter tränenüberströmt in der Küche vor. «Jetzt musst du ganz tapfer sein», wimmerte sie in ihr Taschentuch. «Das Herz deines Vater hat aufgehört zu schlagen, du wirst ihn nun nie wieder sehn.»
Ich sah sie entgeistert an; in einem so aufgelösten Zustand hatte ich meine Mutter noch nie erlebt, und weil ich nicht wusste, was zu tun war, versuchte ich, sie zu trösten. «Wir sind doch auch so immer gut klargekommen, Papi war doch nie da!» Das war meine kindliche Sichtweise.
Die folgenden Tage vergingen in beklemmender Stimmung. Auf mein bohrendes Nachfragen, wie es denn angehen könne, dass Vaters Herz einfach aufgehört hatte zu schlagen, obwohl er doch erst 46 Jahre alt war, sollte ich erfahren, dass die Ursache ein vorausgegangener Herzinfarkt war und dass Vaters «sterbliche Überreste» in einem Krematorium verbrannt werden sollten. Mutter meinte: «Lieber ein Häufchen Asche als von den Würmern gefressen werden.»
Für mich war die eine Möglichkeit so grausam wie die andere und nach der Vorstellung eines Achtjährigen kein erstrebenswertes Lebensziel. Es stand nun eine Begräbnisfeier an; für mich das erste Mal. Die Trauergemeinde traf sich in einer kleinen Kapelle auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Nachdem alle Platz genommen hatten, erklang dunkle, schwere Orgelmusik, Mutter, meine Schwester Jutta und ich saßen in der Mitte der ersten Reihe, und als ich mich umschaute, sah ich viele bekannte Gesichter aus der Nachbarschaft. Nachdem die Orgel verklungen war, begann ein Pfarrer, die Trauerrede zu halten. Neben ihm, umgeben von Kränzen und Blumen, stand eine Urne mit der Asche meines Vaters. Während der Pfarrer die Stationen des kurzen, aber ereignisreichen Lebensweges von Wilhelm Heinrich Reichel Revue passieren ließ, hallte im Raum das Schniefen und Schluchzen der Trauergemeinde wider. Langsam merkte ich, wie sich mir ein Kloß im Hals bildete, aber noch stemmte ich mich tapfer dagegen. Mit dem Schmerz, den man fühlte, wenn man auf die Nase gefallen war, hatte ich schon oft Bekanntschaft gemacht, aber weinen, weil einem traurig zumute ist? Ich glaubte, das sei eher was für Mädchen. Als aber der Kloß im Hals und der Druck auf die Tränendrüsen nicht weichen wollten, gab ich meinen Widerstand auf, und die Tränen rannen mir die Wangen hinunter, während Mutter meine Hand drückte. Als im Anschluss die Urne zum Grab überführt wurde, hatte ich meine Fassung wiedererlangt, und unser kleiner Trauerzug setzte sich in Bewegung, allen voraus der Pfarrer, der die Urne feierlich vor sich hertrug.
Ich war, wie viele andere in der Nachkriegszeit auch, ein vaterlos heranwachsendes Kind. Ob sich dieser Umstand positiv oder negativ auf meinen Charakter ausgewirkt hat, mag gern ein Rätsel bleiben. Was zählt, ist, dass aus «Vaters Sohn» etwas geworden ist. Und ich denke, er hatte seinen Anteil daran, indem er mir ein geistiges Erbe hinterließ, das mich dazu bewegte, in vielen meiner Lieder seinen Spuren zu folgen. Davon auszugehen, dass Vaters Gene mir gar meine künstlerische Ader bescherten, mag im Bereich des Spekulativen liegen, trotzdem fand ich es nicht uninteressant, auf alten Urkunden seiner familiären Linie Artisten, Tänzerinnen und sogar eine Sängerin zu finden. Wenn auch die Ahnenforschung nicht in jedem Fall mit einer Erklärung aufwarten kann, so betrachte ich es doch als großes Geschenk, dass mir der Sinn für die Musik in die Wiege gelegt wurde.
Mutter war 1952 44 Jahre alt und hatte zwei Ehemänner verloren. Der erste liegt auf einem Soldatenfriedhof bei Kirkenes in Norwegen und der zweite auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg. Was sollte nun werden, wird sie sich gefragt haben.
Wenn sie Rat suchte, besprach sie sich oft mit ihrer Freundin Martha, einer Nachbarin. Es hieß, Martha könne die Zukunft aus den Karten lesen – für mich geheimnisvolle Geschichten, in denen ich selbst mitspielte: «Es wartet ein Brief auf dich, darin wird dir eine Einladung oder auch Angebot ins Haus getragen … darüber wirst du dich freuen, und ich sehe da auch Männer, die sich für dich interessieren. Und wenn eines unbegründet scheint, dann ist es die Sorge um deinen achtjährigen Sohn, wie es aussieht, scheint der ein Glückskind zu sein.»
Was Martha aus den Karten las, gab meiner Mutter offenbar frischen Mut. Sie wird es nicht immer ganz einfach mit mir gehabt haben, doch obwohl sie zweifache Witwe war, schien sie nicht bereit, fortan nur noch Schwarz zu tragen.
Stattdessen ging sie einmal in der Woche mit einigen Freundinnen zum Seniorentanzball bei «Munzer und Völker» am Schulterblatt, und dort lernte sie Emil kennen.
Auf den ersten Blick sah Emil aus wie der Prototyp all jener, die bei Schichtwechsel die Hafenbarkassen am Vorsetzen enterten: dunkle Joppe mit Schiffermütze und ein federnder Gang, fast so wie Hans Albers in «Große Freiheit Nr. 7» – auch Emil war ein Hamburger Original. Er sprach mit sanfter Stimme einen Slang aus Hamburger Platt mit hochdeutschen Bestandteilen und hatte etwas Gutmütiges; ich hörte ihm gern zu, wenn er über Taubenzucht und Hühnerhaltung sprach. Immer wenn ich auf das Thema Seefahrt kommen wollte, um ihn zu animieren, doch zu erzählen, wie es denn so war in ferner Kontinente Häfen, als er noch als Seemann in der großen, weiten Welt unterwegs war, schüttelte Emil nur grinsend den Kopf und meinte: «Für so was bist du noch viel zu lütt, mien Jung.» Er versuchte dann, mich mit kleinen Kunststückchen abzulenken, zeigte mir seine leeren Hände, griff mit einer Hand in seine Hosentasche, machte sich darin zu schaffen und zog sie im nächsten Augenblick, Simsalabim, mit einem Blättchen voller Tabak wieder hervor. Er führte es mit einer schwungvollen Bewegung einmal am Mund vorbei, um den Klebefalz zu befeuchten, riss ein Streichholz an und blies mir nach dem ersten Zug den Rauch ins Gesicht. Was war ich beeindruckt! Wie kam man denn auf so was?
«Früher auf See», meinte Emil und klopfte dabei auf seine Hosentasche, «da war es draußen an Deck die einzige Möglichkeit, zu drehen, ohne dass Tabak und Papier schon vor dem Anzünden nass wurden.»
Fürs Rauchen interessierte ich mich noch nicht, aber ich erzählte Emil, dass unter uns Jungen ein Spiel verbreitet sei, bei dem die Vorderseiten von Zigarettenschachteln als Spielkarten dienten. Dabei hatte jeder Spieler einen beliebig großen Kartenstapel mit den Bildern nach unten vor sich liegen. Einer eröffnete und deckte die oberste Karte seines Stapels auf, die anderen folgten Zug um Zug, bis zwei gleiche Bildmotive aufeinander trafen. Gewinner war, wer die zweite Karte zur Dublette legte, er kassierte den Abwurfstoß und eröffnete die nächste Runde. «Gutes Spiel», sagte Emil, der aufmerksam zugehört hatte. «Dann hält das Taschengeld auch länger.» Ich erzählte ihm auch von unseren anderen Spielen, zum Beispiel «Ditschen», gespielt mit Zehn-Pfennig-Münzen. Die Spieler standen drei Meter vor einer Wand und versuchten ihre Münzen so geschickt zu werfen, dass sie möglichst dicht an der Wand zum Liegen kamen. Sieger war, wer am nächsten dran war; ihm gehörte der Pott, also die in der Spielrunde geworfenen Geldstücke. Der Sohn vom Grünhöker Ölckers in der Antonistraße gehörte zu den Besten beim Ditschen und ließ sich eine Variante einfallen, bei welcher der Gewinner nicht nur den Pott bekam, sondern auch noch die Freude, dem Verlierer zum Vergnügen aller einen eigens dafür mitgebrachten «Hansematz Negerkuss» ohne Gegenwehr auf die Nase drücken zu dürfen. Einige von uns wollten nicht gegen ihn antreten, weil sie das Risiko, sich zum Deppen zu machen, nicht eingehen wollten. Leider kam es viel zu selten vor, dass es ihn selbst traf, aber wenn es einmal der Fall war, war er fair genug, sich auch eine Clownsnase aus klebrigem Eiweißschaum mit Schokoglasur auf die Nase kleben zu lassen.
«Pass auf dein Taschengeld auf», meinte Emil, «wenn dir das erste Mal die 50 Pfennig für die Jugendvorstellung im Stern-Kino fehlen, wirst du hoffentlich drüber nachdenken, ob es das wert war.»
Ich hatte nichts gegen Emil, mir schien sogar, als hätte er was für mich übrig, und es dauerte nicht lange, da entschied sich Mutter, ihn zum Untermieter zu nehmen. Emil wollte gleich am folgenden Sonntag mit mir auf den Fischmarkt gehen, wo ich mir ein weißes Karnickeljunges aussuchen sollte. Er baute für mein kleines Langohr fachgerecht aus Maschendraht und Lattenhölzern sogar einen, wie ich fand, etwas groß geratenen Stall und stellte ihn auf unseren Balkon. Das kleine Ding hatte darin viel Auslauf, und wenn ich aus der Schule kam, griff ich mir eine Möhre und erfreute mich daran, wenn mein Kuscheltier daran herummümmelte. Mit Emil kam neues Leben in unseren Alltag, und mein Karnickel auf dem Balkon sollte Gesellschaft bekommen; er baute ihm gegenüber einen Hühnerstall, und auf dem Dachboden hielt er einen Taubenschlag. Fasziniert sah ich ihm zu, wie er seinen Tauben kleine markierte Aluminiumringe an den Beinen befestigte, und fragte ihn, wie es zu erklären sei, dass die Vögel, einmal ausgeflogen, trotzdem immer wieder zurückkehrten. «Darauf muss man sie trainieren, feste Futterzeiten, feste Flugzeiten, sich viel mit ihnen beschäftigen», und weil Emil sich auskannte, erklärte er weiter, «mit Jungtieren geht das am besten, die werden handzahm und erkennen deine Stimme, wenn du sie zu den Futterzeiten rufst.»
Irgendwann sollte ich die andere Seite dieser Art von Haustierhaltung kennenlernen. Zum Wochenende stand Hühnersuppe auf dem Speiseplan, und weil die nicht aus der Tüte kam, ging Emil mit mir auf den Balkon: «Wir sorgen jetzt dafür, dass in der Hühnersuppe auch eins drin ist.»
Er nahm eine Schüssel und ein Messer zur Hand, hockte sich vor den Hühnerkäfig und begann mit einem monotonen plattdeutschen Singsang. Verblüfft sah ich, wie die Viecher sich augenblicklich ganz ruhig verhielten; er öffnete langsam die Käfigtür und streckte behutsam einen Arm hinein. Voller Zutrauen ließ sich ein Vogel greifen, bekam mit geschickter Hand die Flügel glatt gestrichen und fand sich im nächsten Moment eingeklemmt zwischen Emils Oberschenkeln wieder, sodass es ausschaute, als würde ihm der Hühnerkopf zum Hosenstall herausragen. Emil, immer noch singend, in der rechten Hand das Messer und in der anderen das Huhn am Hals, setzte nun die Klinge an, ohne seinen leisen Singsang zu unterbrechen, und im nächsten Moment pulste ein Strahl Blut zielgenau in die bereitgestellte Schüssel. Ich war kaum fähig mich zu rühren, starrte wie gebannt auf das Huhn ohne Kopf und wie Zucken und Blutstrahl langsam verebbten. Erleichtert dachte ich, es wäre überstanden. Doch sobald Emil das Huhn aus seiner Umklammerung entließ, flatterte es plötzlich noch einmal, wirr wie ein gezündeter Silvesterfrosch, zwischen unseren Beinen umher, bevor es, nach einem letzten kopflosen Sprungversuch, zur Seite kippte. Den abgetrennten Kopf wollte Emil mir schenken, aber ich wollte ihn nicht haben. «Mook di man nich inne Büx», meinte er grinsend, «dorför giff dat ok ne scheune Hoinersupp.»
Ich markierte den Tapferen, obwohl ich über das, was sich da vor meinen Augen abgespielt hatte, ziemlich verschreckt war. Emil erklärte mir, dass es auch mit Achtung vor dem Tier zu tun hätte, ihm einen möglichst unaufgeregten und schnellen Tod zu bereiten. «Meine Methode kennst du ja nun, aber wir sind noch nicht ganz fertig mit unserer Arbeit.»
Auf dem Gasherd stand ein großer Kochtopf mit heißem Wasser, und das Huhn wanderte ohne Kopf im vollen Federkleid für ein paar Minuten hinein; so ließen sich die Federn leichter rupfen, erklärte Emil. Er legte los, und es dauerte nicht lang, da war unser Balkon von weißen Federn übersät. Als das Huhn nackig war, trug Emil es zum Gasherd, drehte und wendete es mit geschickten Händen über der Gasflamme, bis alle Überreste des Federkleides knisternd entfernt waren. Der Geruch des versengten Hühnerflaums hing noch in der Luft, als Emil kurz verschwand, um gleich darauf mit seinem Rasiermesser zurückzukehren. Er musterte mich ernst und gab mir zu verstehen, dass jetzt das Herausnehmen der Innereien folgen würde. Seine Lehrvorführung in Sachen Hausschlachtung war beeindruckend, Emil war voll in seinem Element. Er führte sein Rasiermesser, als wäre es das Skalpell eines Chirurgen; jeder Schnitt, jeder Handgriff geschah ohne Hast und Eile. Nachdem der Vogel ausgenommen war und Emil seine Hand ein letztes Mal aus dem Brustkorb hervorzog, legte er nach eingehender Überprüfung mit zufriedenem Blick die unbeschädigte Galle zur Seite. «Wenn die kaputtgeht», mahnte Emil und zeigte dabei auf ein grünlich schimmerndes Etwas, «dann war alles umsonst, denn läuft die Galle aus, wird das Fleisch ungenießbar bitter.»
Ich staunte, wie nüchtern und sachlich er mit diesen Dingen umgehen konnte. Für mich stand fest: Um ein lebendes Huhn fit für den Suppentopf machen zu können, musste ich noch viel lernen.
Erst nachdem man mir mit viel Geduld erklärt hatte, dass die Suppenhühner vom Geflügelhändler viel teurer waren als unsere, die wir als Küken auf’m Fischmarkt vom Bauern für ein paar Groschen gekauft hatten, verstand ich, dass sich so ein Stall auf dem Balkon lohnte. So kam es, dass von Zeit zu Zeit unser Balkongefieder auf dem Speiseplan landete, und es war immer lecker.
Mein kleines Karnickel war derweil zu einem stattlichen Rammler herangewachsen und trommelte ab und an mit dem Hinterlauf lautstark auf den Käfigboden. Als Emil das hörte, bemerkte er nur trocken: «Nu isser reif», und ich dachte: «Aha, so clever kann ein Karnickel werden, es macht auf sich aufmerksam, weil es Futter will, schlaues Ding!» Wie konnte ich ahnen, was Emil wirklich damit gemeint hatte?