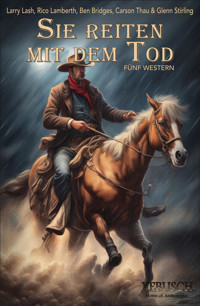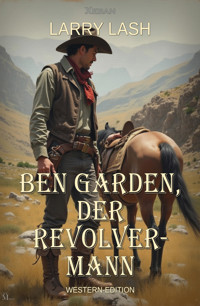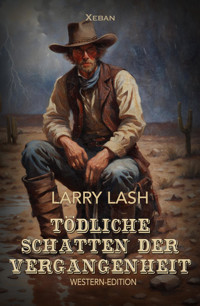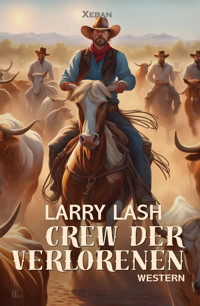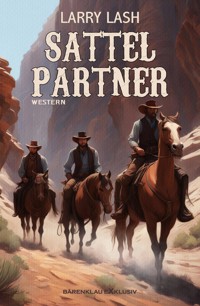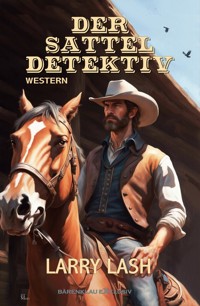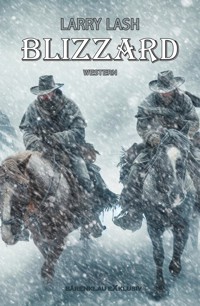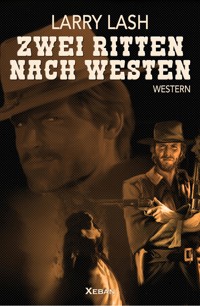3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es wütet ein unerbittlicher Krieg zwischen den Nord- und Südstaaten, bei dem jeder auf seine Art ums nackte Überleben kämpft.
Eine Schwadron reitet mit einem äußerst gefährlichen Sonderauftrag und ungewissem Ausgang nach Westen. Ihr Weg führt durch Wüsten und Einöden, durch Comanchen- und Apachengebiet, ständig verfolgt von Yankeetruppen. Das sind jedoch nicht die einzigen Gefahren, die das Gelingen ihres Trails quer durchs Land bedrohen …
Was viele von ihnen vermuten, jedoch keiner so recht wahrhaben möchte – sie reiten in das größte Abenteuer ihres Lebens, dessen Härte und Erbarmungslosigkeit keine Grenzen kennt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Larry Lash
Ihr Kampf auf
Leben und Tod
Westernroman
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Author/Edition Bärenklau
Cover: © Oskar Walder mit einem Motiv von Edward Martin, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Ihr Kampf auf Leben und Tod
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Der Autor Larry Lash
Eine kleine Auswahl der Western-Romane des Autors Larry Lash
Das Buch
Es wütet ein unerbittlicher Krieg zwischen den Nord- und Südstaaten, bei dem jeder auf seine Art ums nackte Überleben kämpft.
Eine Schwadron reitet mit einem äußerst gefährlichen Sonderauftrag und ungewissem Ausgang nach Westen. Ihr Weg führt durch Wüsten und Einöden, durch Comanchen- und Apachengebiet, ständig verfolgt von Yankeetruppen. Das sind jedoch nicht die einzigen Gefahren, die das Gelingen ihres Trails quer durchs Land bedrohen …
Was viele von ihnen vermuten, jedoch keiner so recht wahrhaben möchte – sie reiten in das größte Abenteuer ihres Lebens, dessen Härte und Erbarmungslosigkeit keine Grenzen kennt …
***
Ihr Kampf auf Leben und Tod
1. Kapitel
Die Pferde stampften schleppend, als hätten sie nicht mehr viel Kraft, durch den Staub, vierzig Pferde mit schweißverkrusteten Fellen.
Ihre Reiter trugen Zeichen des Krieges, Narben und Wundverbände. Alle waren zum Umfallen müde, wie es nur Soldaten sein können, die seit Wochen keinen richtigen Schlaf mehr bekommen hatten. Vornüber geneigt und zusammengesunken hockten sie in den Sätteln. Manche schwankten, und es hatte den Anschein, als müssten sie beim Stolpern ihrer Pferde aus den Sätteln fallen.
Die Männer trugen die Uniform der Südstaatler. Doch bei keinem war sie mehr so, wie sie nach den Bekleidungsvorschriften hätte sein müssen. Einige von ihnen hatten die fehlenden Uniformstücke durch Zivilkleider ersetzt.
Wer diese vierzig Reiter sah, konnte erkennen, dass er eine harte Kampfabteilung vor sich hatte, die aus der Schlacht kam. Zwei Geschütze wurden in der Truppe mitgeführt. Sie rumpelten über den steinigen Weg.
Eine Trompete schmetterte ein Signal. »Alles absitzen, die Geschütze am Wegrand in Stellung bringen und die Sergeanten zu mir!«, tönte der laute Ruf von Captain Bell.
Emmet Stadlee sagte heiser zu seinem Nebenmann:
»Endlich, der Alte hat ein Einsehen! Noch einige Meilen mehr, und ich wäre im Sattel eingeschlafen. Die Augen fielen mir immer wieder zu.«
»Das hättest du verhindern können, wenn du dir Streichhölzer zwischen die Lider geklemmt hättest«, grinste Sergeant Red Hunter ihn an. »Ich glaube nicht, dass es eine lange Rast gibt, Emmet, der Alte kann sie sich nicht leisten. Der Feind ist dicht hinter uns, und wir haben keine Verbindung zur Truppe. Wir wissen nicht einmal, wo unsere Armee ist. Vor zwei Tagen sind wir abgesprengt worden, und seitdem schlagen wir uns durch. Es sieht nicht gut aus, für unseren Haufen.«
Das brauchte Emmet Stadlee niemand zu sagen. Alle Reiter wussten das. Die vierzig Mann fühlten sich wie in einer Falle, die jeden Augenblick zuschnappen konnte. Das Schlimmste aber war, dass man sich nicht in Feindesland bewegte, sondern auf dem Boden der Südstaaten, von dem der Gegner mehr und mehr Besitz ergriff. Die Baumwollfelder reiften im Gluthauch der Sonne, doch man sah keine Sklaven, die dabei waren, die Ernte einzubringen. Das ganze Land schien verlassen zu sein, doch dieser Eindruck täuschte.
Captain Tab Bell ließ sich nicht bluffen. Er wartete, bis seine beiden Sergeanten Red Hunter und Billy Blagan bei ihm waren. Mit ihnen kam Leutnant Orne Kay.
»Gents«, eröffnete Captain Bell das Gespräch, »es sieht böse aus! Vor einer Woche hätte sich wohl keiner von uns träumen lassen, dass wir sozusagen im Niemandsland reiten würden, so traurig das jetzt auch klingt. Leutnant, reiten Sie mit Hunter und Stadlee zur Plantage. Ich muss wissen, ob sie von Unionstruppen besetzt wurde. Nehmt euch vor herumstreifenden Schwarzen in Acht! Den ehemaligen Sklaven ist nicht zu trauen. Man sagt, dass sie von der Unionsarmee befreit wurden und dass sie sich Waffen besorgten. Es ist also Vorsicht geboten!«
»Sir, Sie wollen die Plantage als Nachtquartier benutzen?«, fragte Leutnant Orne Kay.
»Vielleicht, es wird sich noch finden«, antwortete Captain Bell. Er sah zu seinen Männern hin, die die Geschütze an den Wegrand gefahren hatten und abgesessen waren. Müde ließen sie sich ins Gras fallen.
»Leutnant Kay, Sie kennen diese Gegend und wissen, wo die Plantage liegt. Es stimmt doch, dass Sie aus dieser Ecke stammen?« Orne Kay nickte. Auf seinem schmalen Gesicht lag der Staub. Er schien sich in die Haut eingefressen zu haben. Leutnant Kay unterschied sich durch grünblaue Augen, rotes Haar und einen kleinen Schnurrbart von den anderen Männern. Er nickte, sagte aber kein Wort.
»Ich hätte es gern genauer gewusst, Kay«, knurrte Captain Bell, »oder schämen Sie sich, dass Sie hier zu Hause sind?«
»Warum sollte ich, Sir? Die Unionstruppen werden noch tiefer in die Südstaaten vordringen, man wird sie nicht aufhalten können. Neun Millionen Menschen leben in den Südstaaten. Von ihnen sind sechs Millionen schwarze Sklaven, die praktisch ausfallen. Der Norden hat nicht nur zweiundzwanzig Millionen Menschen, er hat auch die Flotte und die Industrie. Alle Schlüsselpositionen sind in den Händen der Nordstaaten. Wer von uns also auf dem Standpunkt steht, dass der Krieg für uns erfolgreich verlaufen kann, der macht sich selbst etwas vor, Captain.«
»Sie sprechen wie ein Yankee, Leutnant«, erwiderte Captain Bell. »Mit einer solchen Ansicht schaden Sie uns, mehr noch, Sie untergraben die Moral der Mannschaft. Ich kann so etwas nicht dulden, Leutnant, Sie werden bestraft!«
»All right, Sir!«
»Es wird geschehen, sobald wieder ordentliche Verhältnisse herrschen. Jetzt führen Sie meinen Befehl aus!«
Orne Kay schlug die Hacken zusammen und winkte Emmet Stadlee und Red Hunter zu sich.
Die drei Männer schwangen sich in die Sättel ihrer Pferde. Voller Neid sahen sie zu den anderen hin, die sich jetzt ausruhen durften.
*
Wenig später ritt die Drei-Mann-Gruppe durch die Baumwollfelder.
»Wie im Frieden«, sagte Leutnant Orne Kay und atmete sichtlich auf. Seine Augen schweiften in die Runde.
»Aber es ist Krieg, Sir«, sagte Emmet Stadlee. »Schauen Sie doch genauer hin! Die Baumwollfelder müssten abgeerntet werden. Niemand stört sich daran. Wertvolle Rohstoffe gehen verloren. Durch die Maisfelder dort sind unsere Gegner gestampft. Durch dieses Land zogen Karawanen von Flüchtlingen. Machen Sie sich keine falsche Illusion, Leutnant, es ist Krieg!«
»Er trinkt zu viel«, flüsterte Red Hunter dem neben ihm reitenden Emmet Stadlee zu. »Er ist wieder betrunken. Eine Schande ist das! Ich habe gesehen, wie er eine leere Flasche wegwarf. Ich vermute, dass er sich betäuben und nicht sehen will, dass die Yankees im Lande sind. Captain Bell sollte ihm so etwas nicht zum Vorwurf machen, es verärgert den Leutnant nur noch mehr. Ich habe das Gefühl, als habe Bell es besonders auf Kay abgesehen, als bestünde eine regelrechte Feindschaft zwischen den beiden. Es muss selbst dem Dümmsten aufgefallen sein, dass Bell den Leutnant schikaniert, wo er nur kann.«
Leutnant Orne Kay kümmerte sich nicht um die Unterhaltung. Er war tatsächlich wieder betrunken, das war an seiner schlaffen Haltung und der Rötung seiner Augen festzustellen. Die Augen hatten einen träumerischen Ausdruck. Aber nur wer Leutnant Kay nicht kannte, hätte sich täuschen lassen. Nie ritt ein Mann wacher als er, nie konnte sich ein Mann von einem zum anderen Augenblick rascher wandeln.
Hunter und Stadlee hielten ihre Pferde etwas zurück, sodass sie sich lauter unterhalten konnten.
»Es ist auffallend, dass der Captain uns nicht nach Süden, sondern immer weiter nach Westen führt. Im Westen aber ist keine Front, dort ist Indianer-Territorium.«
»Was willst du damit sagen?«
»Nun, ich habe das Gefühl, dass wir nicht zufällig abgesplittert sind, dass sich unsere Schwadron auf einen bestimmten Auftrag hin absetzen musste, dass es aber so aussehen soll, als wäre es nicht beabsichtigt. Seit Tagen reiten wir immer nur nach Westen. Es scheint sich niemand dagegen aufzulehnen.«
»Doch, ich!«, meldete sich Leutnant Orne Kay. Er hatte das Tempo verringert und alles gehört. »Es sieht tatsächlich so aus, als wollte uns Captain Bell aus den Kampfgebieten herausbringen. Seit zwei Tagen ist kein Kanonendonner mehr zu hören, sind keine Flüchtlingstrecks mehr zu sehen. Die Front scheint irgendwo zu sein, nur nicht in der Richtung, in die wir reiten. Ausgerechnet Captain Bell kann die Wahrheit über uns und die Nordstaaten nicht hören. Er tut so, als wäre in diesem Krieg alles für uns offen. By Gosh, was ist das für ein Optimist!«
»Der Krieg ist noch nicht entschieden«, erwiderte Stadlee rau. »Sie tun, als hätten uns die Yankees bereits Handfesseln angelegt. Dieser Krieg wird für den Süden gewonnen! Wenn Sie es besser wissen, hätten Sie sich doch gleich auf die andere Seite schlagen sollen. Das hätte Ihnen dann bestimmt viel Bitteres erspart.«
»Stadlee, ich bin kein Rebell!«, unterbrach ihn Kay. »Ich mag die Yankees nicht, aber das ist nicht ausschlaggebend und wird auch nichts an meiner Voraussage ändern. Der Krieg wird nicht von uns gewonnen, Männer!«
Kay lachte seltsam rau. Seine beiden Begleiter, Sergeant Hunter und Kavallerist Stadlee, sahen sich einen Augenblick verdutzt an, dann betrachteten sie ihren Leutnant scharf. Sie vermuteten, dass die ungeheuren Strapazen und der Alkohol, den der Leutnant getrunken hatte, Anlass zu seiner Äußerung waren.
Leutnant Kay schien keinen Wert darauf zu legen, die alten Parolen vom Endsieg an den Mann zu bringen. Er sprach offen seine Befürchtungen aus. Das hatte ihm die Ablehnung und den Hass Captain Bells und einiger Leute der Schwadron eingebracht. Alle glaubten fest an den Sieg des Südens. Alle waren Patrioten, Freiwillige, die in diesen männermordenden Krieg gezogen waren, um ihrer Sache zum Sieg zu verhelfen und dem Norden eine scharfe, aber heilsame Lehre zu erteilen. Keiner von ihnen ahnte, dass die große Zeit der Plantagenbesitzer und Sklavenhalter bald vorbei sein würde. Das hektische Treiben der Nordstaaten und die Jagd nach dem Dollar waren nicht mehr aufzuhalten.
Leutnant Orne Kay war nicht naiv genug, um die Stärke des Nordens zu übersehen. Für ihn war der Strom aus dem Norden unaufhaltsam. Die alte Tradition des Südens würde hinweggefegt werden. Der bisherige Verlauf des Krieges zeigte, dass der Süden bereits wankte. An all das musste Orne Kay denken, aber auch daran, dass er durch die Heimat ritt und dass keine zwei Reitstunden von hier entfernt, im Osten, das Haus lag, in dem er geboren wurde. In dieser Gegend hatte er seine Kindheit und seine Jugend verbracht. Das alles glaubte er überwunden und weit hinter sich zu haben. Doch jetzt, beim Anblick der blühenden Baumwollfelder, trieb es ihm die Müdigkeit aus dem Körper. Die Sehnsucht war da und wurde so mächtig, dass er das Verlangen heimzureiten kaum noch unterdrücken konnte.
Jahre waren vergangen, seit Orne Kay seine Eltern und die Heimat verlassen hatte. Was mochte sich inzwischen ereignet haben? In der letzten Zeit hatte es keine Postverbindung mehr gegeben. Monate vergingen, ohne dass man eine Nachricht bekam. Die Unionstruppen drangen ins Land, und damit waren die Verbindungen nach Hause abgerissen. Nur zwei Stunden Ritt, dann konnte Orne Kay die Heimat mit eigenen Augen sehen, mit ihren Häusern und Stallungen, mit den Corrals und der Reitbahn. Auf den gepflegten Park waren die Eltern besonders stolz.
Niemand entfernt sich von der Truppe, hörte Orne Kay Captain Bells Stimme in seinem Innern. Was, zum Teufel, Leutnant, glauben Sie noch vorzufinden? Ihr Elternhaus wird eine Ruine sein, zerstört von unseren Feinden. Ihre Eltern wurden Flüchtlinge, als die Front heranrückte. Ersparen Sie sich das also, Leutnant, und tun Sie nur, was ich Ihnen befohlen habe. Bringen Sie heraus, ob die Plantage besetzt ist, alles andere darf Sie nicht interessieren. Sie scheinen immer wieder zu vergessen, dass Sie Soldat sind, Leutnant. Sie benehmen sich wie ein schäbiger Zivilist!
Diese Worte waren es, die Orne Kay dazu zwangen, seinen Wunsch zu unterdrücken. Vielleicht erfuhr man auf der Plantage etwas.
Leutnant Kay trieb sein Pferd schneller an.
Seine beiden Begleiter schienen damit nicht einverstanden zu sein, das zeigten ihre Blicke. Aber sie mussten ihrem Leutnant folgen, ob sie wollten oder nicht.
Orne Kay ritt vom Weg ab und nahm Kurs auf die Hügel, hinter denen die Plantage liegen musste. Er zog es vor, den gut zu übersehenden Weg zu verlassen und in dem mit Buschwerk durchsetzten Gelände Deckung zu suchen. Die Baumwollfelder blieben zurück. Büsche und Dornengestrüpp erschwerten das Vorwärtskommen.
Leutnant Kays Pferd wieherte plötzlich und stieg jäh auf die Hinterhand, dann setzte es über ein Hindernis hinweg. Es gelang Kay, das Tier zu zügeln. Im gleichen Augenblick erkannten auch seine beiden Begleiter, was das Pferd des Leutnants unruhig gemacht hatte.
Ein toter Schwarzer lag vor ihnen. Er war halbnackt. Auf seinem Oberkörper waren die Striemen von Peitschenschlägen zu sehen.
Kay kletterte aus dem Sattel und beugte sich über den Toten.
»Das ist Tom«, sagte er überrascht, »mein Diener Tom!«
Wie kam Tom hierher, zwei Reitstunden von dem Ort entfernt, an dem. er eigentlich sein müsste? Er war von zwei Kugeln niedergestreckt worden. Kay schätzte, dass er etwa zwei oder vielleicht drei Stunden tot sein mochte. Was hatte er hier gesucht? Die fest zusammengepressten Lippen würden es nicht verraten. In dem großflächigen Gesicht des Schwarzen stand das Grauen.
»Mein Vater kaufte ihn mir zu meinem zehnten Geburtstag. Tom wurde mein Diener, aber auch mein Spielkamerad. Ich kann ihn hier nicht liegenlassen.«
»Leutnant, ich rühre keinen Sklaven an!«, murrte Sergeant Red Hunter.
»Denken Sie auch so, Stadlee?«, wandte Kay sich an seinen anderen Begleiter.
»Nein«, entfuhr es Emmet Stadlee. »Ich habe nie etwas von der Sklaverei gehalten. Die Schwarzen sind Menschen wie wir. Wenn das bestimmte Männer eingesehen hätten, gäbe es jetzt keinen Bruderkrieg.«
Stadlees dunkelbraune Augen richteten sich fest auf seinen Leutnant. Kay blickte in das sympathische Gesicht des ehemaligen texanischen Cowboys, das von Wind und Sonne braun gegerbt war.
»Reiten wir erst einmal weiter, Leutnant. Ich denke, die Plantage ist nicht mehr fern. Wenn wir zurückkommen, bringen wir Tom unter die Erde.«
»Wir sind nicht mehr weit vom Plantagenhaus entfernt. Das Haus von Jem Davidson liegt dort hinter dem Hügel.«
»Wer ist Jem Davidson, Leutnant?«
»Er war einst der mächtigste Mann in dieser Gegend«, erklärte Kay und schwang sich wieder in den Sattel. »Jetzt dürfte das kaum mehr der Fall sein. – Schauen Sie nur, dort an der Hügelflanke standen die Hütten der schwarzen Sklaven. Sie wurden niedergebrannt. Alles ist dem Erdboden gleichgemacht worden. Früher war das fast eine Stadt.«
Die Erde war schwarz. Nur einige verkohlte Balken erinnerten noch daran, dass hier einmal die niedrigen Hütten der Sklaven gestanden hatten. Die Schwarzen waren wie Tiere gehalten worden. Jem Davidson war dafür bekannt, dass er seinen Leibeigenen die Hölle bereitete. Seine Aufseher hatten manchen Schwarzen zu Tode geprügelt.
Die Hütten der Aufseher und der Zwinger der Bluthunde waren ebenfalls verschwunden. Von den besonders abgerichteten Tieren, die man auf entflohene Sklaven ansetzte, war nichts mehr zu sehen.
Das Haupthaus der Plantage, die dem unbeugsamen Jem Davidson gehörte, stand noch. War der Alte noch am Leben?
Beim Näherreiten sahen die drei Männer, wie jemand aus dem Haus lief und in der Deckung der Stallungen verschwand. Das zwang sie anzuhalten und außer Schussbereich zu bleiben. Plötzlich wurden drei weitere Personen sichtbar. Es waren drei Männer, denen der Anblick der Südstaatenreiter nicht geheuer zu sein schien. Sie kamen zögernd aus dem Haus und warteten, bis die drei Reiter in Rufnähe waren.
»Kommen Sie nur, Gents«, sagte einer der Männer. »Wenn Sie tatsächlich der Südarmee angehören, dann sind Sie uns willkommen.«
»Davidson?«
Einer der Männer, sehr groß, hager und grauhaarig, zuckte zusammen. Er hatte wohl nicht erwartet, dass ein Südstaatenreiter ihn mit seinem Namen anrufen würde.
Der Alte schien ziemlich überrascht zu sein, aber er erkannte den Mann nicht, der ihn angesprochen hatte.
»Woher kennen Sie den Namen dieses Mannes?«, wollte einer der anderen wissen.
»Wenn Davidson nicht so kurzsichtig wäre, könnte er Ihnen das selbst beantworten. – Hören Sie, Davidson, wer erschoss meinen Diener Tom auf Ihrem Plantagengebiet?«
Ein wildes Lachen kam über Jem Davidsons Lippen. Jäh brach es ab, dann trat er einige Schritte vor und sagte heiser:
»Orne Kay! Sie sind Orne Kay! Großer Gott, die glorreiche Südarmee ist wieder da! Sie wird die Yankees jetzt aus dem Lande jagen. Die Yankees werden dafür büßen, dass sie meine Sklaven befreiten, meine Sklavensiedlung niederbrannten und mich jagten und hetzten. Ich lief nicht davon, ich blieb in der Nähe. Jetzt werde ich meinen Triumph auskosten. Wo steht die Südarmee?«
»Das kann Ihnen Captain Tab Bell beantworten«, sagte Orne Kay, der mit seinen beiden Begleitern näher herangeritten war und jetzt auf dem Plantagenhof anhielt. »Sie haben mir meine Frage nicht beantwortet, Davidson. Wer erschoss meinen Diener Tom?« Die Männer sahen sich an, keiner von ihnen antwortete. Ihre misstrauische Haltung hatte sich auch jetzt nicht geändert, als sie die Reiter klar als Soldaten der Südstaatenarmee erkannten. Durch die bösen Erfahrungen, die sie gemacht hatten, schien ihr Misstrauen zu groß zu sein. Es war bekannt, dass es zwischen den Fronten Räuberbanden gab, die abwechselnd die Uniformen der Südstaaten und der Nordstaaten trugen. Wie die Aasgeier fielen diese Banden in Gebiete ein, deren Bewohner man niedergezwungen hatte.
»Davidson, wir glaubten, Ihr Haus verlassen vorzufinden.«
»Das glaubte ich auch«, erwiderte der alte Mann, »aber ich täuschte mich. Im Haus sind noch mehr Leute. Es sind Menschen, die sich beim Herannahen der Yankees irgendwo versteckten. Sie kamen dann hervor, als die Front weiterrückte. Jetzt wissen die meisten von ihnen weder ein noch aus. Hören Sie, Leutnant Kay, Ihr Captain muss sich um diese Leute kümmern!«
»Ich weiß nicht, ob er das tun wird, Davidson. – Emmet Stadlee, reiten Sie zur Abteilung zurück. Captain Bell kann mit der Schwadron hierherkommen.«
»All right, Sir«, erwiderte Stadlee und ritt an.
»Ihr Captain wird sich der Leute annehmen müssen, Leutnant!«, beharrte Davidson. »Es sind einige wichtige Persönlichkeiten unter ihnen, die keinesfalls im Niemandsland bleiben können. Außerdem sind vier Frauen dabei.«
»Auch Kinder?«
»Nein, keine Kinder. Das erleichtert die Sache etwas. Die Frauen und Männer sind alle gute Südstaatler.«
»Erzählen Sie das dem Captain, Davidson. Ich möchte jetzt die anderen sehen.« Orne Kay ließ sich vom Pferd gleiten. »Sergeant«, wandte er sich an Red Hunter, »Sie bleiben im Sattel!«
»In Ordnung, Leutnant.«
Kay warf Hunter die Zügel seines Pferdes zu, und der Sergeant fing sie geschickt auf.
»Mir ist hier so manches nicht ganz geheuer, Sergeant«, wandte Orne Kay sich leise an seinen Untergebenen. »Lassen Sie vor allen Dingen Davidson nicht aus den Augen. Die Tatsache, dass er sich hier aufhält, gefällt mir ganz und gar nicht. Hätten die Yankees ihn bekommen, lebte er nicht mehr. Er ist aber noch recht munter und tritt ziemlich großspurig auf. Er tut so, als wüsste er nichts über Toms Tod. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er die Schüsse nicht hörte, durch die Tom starb. Er scheint die Kerle hier zu beeinflussen. Ich werde jetzt herauszubringen versuchen, wer noch mit von der Partie ist, wer sich auf dieser berüchtigten Plantage ein Stelldichein gab. Halten Sie die Augen offen, Sergeant.«
»Ich werde achtgeben, Leutnant«, versprach Hunter.
Zusammen mit Davidson betrat Orne Kay das Haus. Von der alten Pracht war nichts geblieben. Die Seidentapeten hingen in Fetzen von den Wänden, alles war verschmutzt und besudelt. Die alten Möbel waren verschwunden, die prächtigen Bilder und die dicken Teppiche fehlten.
Im Hintergrund des Raumes hockten vier Frauen auf einen Haufen Tannenreisig. Zwei von ihnen waren Weiße, Mädchen von etwa zwanzig Jahren. Beide waren ausnehmend schön. Sie kümmerten sich um ein Mädchen, ein Mischling, das weinend am Boden lag und deren Körper von Weinkrämpfen geschüttelt wurde. Neben dem Mädchen, das nicht älter als siebzehn Jahre sein mochte, hockte eine große Schwarze. Sie hielt den Kopf des anderen Mädchens in ihrem Schoß und streichelte über deren krauses Haar. Sie sah stur geradeaus, als blicke sie durch die Wände hindurch, als wäre ihr alles gleichgültig, was um sie herum geschah.
»Wer sind die Frauen?«, wandte Kay sich an Jem Davidson.
Der Alte antwortete nicht. Er blieb stehen und wartete auf seine Begleiter. Es zeigte sich, dass insgesamt fünf Männer seine Gefolgschaft bildeten. Zwei hatten mit ihm zusammen die Ankunft der Soldaten erwartet, drei weitere waren vorher in die Deckung der Stallungen geeilt. Zwei von ihnen erkannte Kay wieder. Es waren Sklavenaufseher von Davidson. Weit und breit gab es keine übleren Burschen als Sid Cochar und Max Dam. Im Augenblick verhielten die beiden sich ruhig. Kay konnte das Lauernde in ihren Augen allerdings nicht übersehen.
Cochar war es, der heiser von Kay verlangte:
»Tun Sie bald etwas für uns, Leutnant! Nur mit Mühe sind wir den Yankees entkommen! Das schwarze Pack war mächtig hinter uns her. Wir sind durch eine Hölle gegangen.