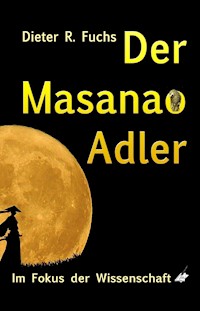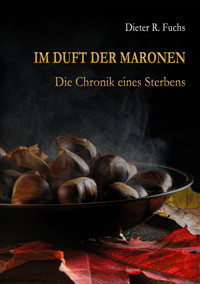
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Autor inszeniert in diesem Roman das Kopfkino eines greisen Mannes an den letzten Tagen vor dessen Tod im Hospiz. Nicht als Tragödie, sondern wie ein dokumentarisches Schauspiel voller bewegender Rückblicke und großer Gefühle. Es ergibt sich schlaglichthaft ein authentisches Gesamtbild dieses Menschen, das von der absoluten Endphase des Lebens aus rückwärts wie ein Mosaik aus prägenden Erlebnissen zusammengefügt wird. Die Leser*innen begleiten ein würdevolles Abschiednehmen, wie man es sich im Sterbebett wünschen möchte. Eine Mut machende Geschichte, die tief hinein in ein Thema führt, das in unserer Gesellschaft oft als Tabu behandelt wird. Zu Beginn wird die Krankengeschichte des sterbenden Protagonisten skizziert und man erlebt in der Onkologie dessen Einsicht in den nahenden Tod mit. Mit der Einweisung in eine geriatrische Klinik und anschließend in ein Hospiz nimmt die Haupthandlung ihren Lauf. Die LeserInnen erleben über den Zeitraum von wenigen Wochen die körperlichen, neuronalen und psychischen Veränderungen mit, bis zu seinen Empfindungen beim Schwinden der mentalen Fähigkeiten. Am Ende steht sein realistisch dargestellter Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dieter R. Fuchs
Im Duft der Maronen
Die Chronik eines Sterbens
© 2025 Dieter R. Fuchs
Coverdesign von: Martin UrbanekSatz & Layout von: Martin Urbanek
ISBN Softcover: 978-3-384-74011-3ISBN E-Book: 978-3-384-74012-0
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Dieter R. Fuchs, Fritz-Meyer-Weg 15A, D-81925 München, Germany .
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Kapitelverzeichnis
Prolog
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Zeit der Träume
Das Nest der Elstern
Gedankenflitter
Der wahre Reichtum
In Gewissheit des Sterbens
Wenn der Tod anklopft
Abgedriftet
Bilanzen
Letzte bewusste Entscheidungen
Der Junge im Felsennest
Im Nebel der Victoria-Fälle
Letzter Umzug
Endstation
Tod am Mara-Fluss
Gipfelglück
Absturz
Salto Mortale
Berggewitter
Letzte Einsichten
Ein alter Herzensbaum
Eine große Liebe
Licht am Ende des Tunnels
Letztes Aufbäumen
Finale
Epilog
Zum Autor dieses Buches
Prolog
Wann, wenn nicht vorher?
Das Sterben gehört zum Leben. Dennoch weichen die meisten Menschen Überlegungen zu den Gedanken und Gefühlen aus, die uns kurz vor dem Tod bewegen könnten. Obwohl mentale Vorbereitung selten schadet und ein Blick in unsere finale Zukunft auch unser jetziges Bewusstsein zu schärfen vermag.
Das „was wäre wenn“ begleitet uns fast täglich bei unserer Lebensgestaltung. Bewertungen zum “was wäre gewesen wenn“ prägen unsere Rückbesinnungen um frühere Entscheidungen zu hinterfragen und vielleicht aus Fehlern zu lernen. Gedankenspiele zum „wie könnte es sein“ am absoluten Endpunkt des Lebens jedoch meiden wir.
Weil wir hoffen dass dieser Moment weit in der Zukunft liegt und wissen dass wir hierauf wenig Einfluss haben? Oder aus Angst vor der finalen Dämmerung unseres Verstandes und der unausweichlichen Agonie bei unseren letzten Atemzügen?
Ziehen wir religiöse Hoffnungsszenarien eines „Lebens nach dem Tod“ vor, weil uns dies tröstlicher erscheint als das definitive Ende unserer Existenz als beseelter Mensch?
Wäre es nicht spannend, die letzten Gedanken und Empfindungen eines Sterbenden einmal mit zu verfolgen? Vielleicht würde uns der Tod dann weniger schrecklich erscheinen und wir könnten ihm entspannter entgegen gehen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Universitätsklinikum und zuhause, Rehabilitationsphase
Die letzten Etappen im Dasein sollten wohl nicht von Einsamkeit geprägt sein. Aber wer weiß schon, was man wirklich als angenehm oder belastend empfindet wenn es zu Ende geht!
Der hochbetagte Mann im Zentrum unserer Geschichte vollzog diesen Lebensabschnitt ohne ihm vertraute Begleitung, abgesehen von Ärzten und Krankenpflegern mit ihrer professionellen emotionalen Distanz. Er war allein mit seinen letzten Gedanken, wie so viele in dieser Situation. Die Menschen, die er geliebt hatte und die früheren Weggefährten waren alle bereits vor ihm gegangen oder wussten nichts von seiner Situation, weil man sich aus den Augen verloren hatte. Die Einsamkeit war ihm vertraut.
Der Greis hatte die viermonatige Chemotherapie und anschließende Operation an der Bauchspeicheldrüse gut überstanden. Schon wenige Tage nach dem vierstündigen Eingriff verspürte er wieder Lust am Leben. In den Wochen zuvor war ihm dies schwergefallen. Die Ärzte hatten sich lange nicht entscheiden können, ob sie in Anbetracht seines hohen Alters die Entfernung des Pankreas-Tumors wagen sollten. Die physischen Belastungen sowie das Risiko post-operativer neuronaler Defizite nach einer längeren Vollnarkose waren signifikant.
Aber der Tumor hatte sich durch die Chemo tatsächlich verkleinert, so dass man sich schließlich doch für den Eingriff entschloss. Dies lag auch an der für sein Alter guten körperlichen Gesamtverfassung. Herz und Kreislauf waren gesund, die Blutwerte befriedigend. Allerdings hatte der Patient unmissverständlich die Empfehlung der Ärzte in den Wind geschlagen, sich nach der Operation auf eine weitere sechsmonatige Chemotherapie einzulassen. Eine solche qualvolle Tortur wollte er nicht noch einmal durchleben müssen, dazu war er nicht bereit.
Es schien die richtige Entscheidung zu sein, denn auch ohne eine solche Nachbehandlung erholte sich der alte Mann nach der Operation erstaunlich schnell. Schon drei Wochen später konnte er mit guter Prognose in die stationäre Reha-Abteilung wechseln. Der vorher beängstigende Gewichtsverlust stoppte und auch seine psychische Verfassung verbesserte sich.
Seine Kämpfernatur hielt den inneren Widerstand gegen die lebensgefährliche Erkrankung aufrecht. Er hatte gute Gründe für seine Hoffnung, noch etwas Zeit vor sich zu haben. Schon oft war er dem Tod von der Schippe gesprungen, er war geübt im Überleben. Der Glaube an sein Glück und die Erfolge seiner Resilienz in jüngeren Jahren unterstützten mental die organische Rehabilitation.
Optimistisch stimmte ihn auch sein Appetit, der wieder da war. Oft empfand er sogar wirklichen Hunger und freute sich schon lange vorher auf die jeweiligen Mahlzeiten, egal was serviert wurde. Er nahm zu, spürte seine Kräfte zurückkommen und arbeitete engagiert zusammen mit den Physio- und Ergotherapeutinnen daran, auch seine Beweglichkeit und die kognitiven Fähigkeiten zu verbessern.
Die neuronale Belastung während der Operation hatte allerdings Spuren hinterlassen. Während er vor dem Eingriff als geistig rüstig für sein Alter galt, war anschließend seine Konzentrationsfähigkeit deutlich verschlechtert. Er litt unter Wortfindungsstörungen und wirkte manchmal verwirrt. Aber die Reha-Maßnahmen schlugen gut an und als er vier Wochen später nach Hause zurückkehren konnte, waren die Aussichten von Optimismus geprägt. Ambulante Therapien würden die weitere Genesung fördern. Auch seine Ärztin ging davon aus, dass er mit Unterstützung einer Haushaltshelferin, die zweimal pro Woche kam und eines mobilen Pflegedienstes zurechtkommen würde. Wenn er nicht außer Haus aß ließ er sich mittags und abends über verschiedene Lieferdienste das Essen in die Wohnung bringen, meistens vietnamesisch, indisch oder italienisch. Er hatte solche Gerichte im Krankenhaus vermisst und genoss die Abwechslung.
Dies ging auch einige Wochen gut, dann änderte sich die Situation drastisch. Er hatte keinen Appetit mehr, aß eher lustlos und trank nur noch wenn man ihn dazu drängte, nicht aufgrund eines echten Bedürfnisses. Er verlor wieder rasch an Gewicht und spürte seltsame Veränderungen in seinem Körper. Sein Elan und die Fähigkeit zu selbständigen Aktivitäten bauten ab und er verließ die Wohnung kaum noch. Immer mehr Zeit verbrachte er im Bett, ließ die Handhabungen durch die inzwischen täglich zu ihm kommenden Pflegepersonen stoisch über sich ergehen und gab nur noch wortkarge Antworten auf deren Fragen. Auch die Gespräche mit seiner Haushaltshilfe beschränkten sich zunehmend auf kurze Anweisungen. Der Umgang mit ihm wurde unangenehmer, denn mit der eigenen Wahrnehmung der Verschlechterung seines Zustands begann sein Geist gegen das Kommende zu rebellieren. Er wollte nicht wahrhaben, dass alle Anstrengungen vergebens gewesen waren, begann auch an seiner Ablehnung hinsichtlich einer zweiten Chemotherapie zu zweifeln. Aber nur kurz, denn die Erinnerung an seinen Zustand während dieser Behandlung war ihm noch sehr präsent und so hielt er hieran fest.
Er hatte sich bereits vor Monaten, direkt nach der Diagnose seiner Erkrankung gut informiert, auch über das was kommen würde falls die Heilung durch die Operation nicht gelang. Der Ablauf bei solch einer tödlichen Erkrankung war genau beschrieben und in medizinisch definierte Phasen unterteilt. Er kannte die ersten Anzeichen und späteren Symptome der Terminalphase bis hin zur Finalphase und wusste was ihn erwartete. Da war kein Platz für Illusionen über das Unausweichliche.
Dass dennoch Verzweiflung und Wut aufloderten, konnte er nicht verhindern. Aber diese Emotionen waren nur von kurzer Dauer. Mit abnehmender Willenskraft wich das Aufbäumen einer zunehmenden Seelenruhe. Es war an der Zeit, dem Leben oder besser dem Ableben seinen natürlichen Lauf zu lassen. Er blickte gelassen dem entgegen, was das Schicksal für ihn noch vorgesehen hatte.
Seine Psyche zog sich immer mehr in eine Traumwelt zurück um Abstand von den durchlittenen Strapazen und drohenden Konsequenzen seiner Erkrankung zu gewinnen.
Zeit der Träume
Zuhause, Ende der Rehabilitationsphase
Sein ganzes Leben über hatte der Mann sich nie an den Inhalt seiner Träume erinnern können, weder nachts, wenn er manchmal erwachte, noch am nächsten Morgen. Dieser geheimnisvolle Teil seines Verstandes war ihm immer verborgen geblieben. Doch mit dem Schwinden seiner Widerstandskraft schoben jetzt einige noch quicklebendige Triebfedern seines Unterbewusstseins ungewohnte Traumbilder über diese innerste Grenze hinweg. Es waren insbesondere zwei oft wiederkehrende Träume, an die er sich nach dem Aufwachen präzise erinnerte:
In einem hiervon glitt er wie auf Flügeln und federleicht über eine bunt schillernde Fantasiewelt hinweg. Aus dieser höheren Warte herab blickte er auf etwas Flüchtiges weit unter sich und erkannte dort schemenhaft Orte und Szenen seiner eigenen Vergangenheit, die wie im Zeitraffer vorbeizogen. Bei dieser Traumreise schlugen in seinem Kopf die Gedanken freudige Kapriolen. In den Nervenschaltungen des Gehirns und im ganzen Körper herrschte jenes positive Zusammenspiel von neuronalen Impulsen und Botenstoffen, das man mit dem Begriff „Glücksgefühle“ bezeichnen konnte. Es war als würden ihm in diesem Zustand noch einmal die größten Schätze seines Gedächtnisses präsentiert, vielleicht ein letztes Mal bevor sie für immer verschwanden.
Der andere Traum, der sich in jenen Tagen oft wiederholte, war ganz anders, statischer. Dieser weckte in ihm das Gefühl von etwas Sperrigem um ihn herum. Etwas allerdings auch Beschützendes, nach außen Wehrhaftes, das ihn quasi abschirmte von seiner Umwelt. Er war eingezwängt in ein starres Gitter durch dessen weitmaschiges Gefüge ein gewaltiges Himmelsspektakel zu sehen war. Mal rasten weiße Wolken über ihn hinweg, mal türmten sich dunkle Gewitterberge auf, rasch wechselnd mit Sonnenschein oder tief blauem Nachthimmel. Derart weggesperrt zu sein von etwas Großem ringsum presste ihm fast physisch spürbar das Herz zusammen.
Der Greis empfand das Wechselspiel zwischen Dahindämmern, Wachphasen und diesen beiden ständig wiederkehrenden Träumen als etwas gleichzeitig Befreiendes wie auch Beunruhigendes. Er versuchte sich zu konzentrieren und die vermutlich aus verschwommenen Erinnerungen zusammengefügten Empfindungen zu deuten, aber es gelang ihm nicht. Es war, als würde ihm immer wieder eine geheime Botschaft zugesandt, die er nicht verstand, für die er aber dennoch Dankbarkeit empfand. Ohne zu wissen, warum.
Manchmal, wenn die beiden Traumvarianten dicht aufeinander folgten und er sich ihrer besonders bewusst war, kam ein Hauch von Erkenntnis in ihm auf. Es waren keine Gegensätze, die ihm vorgegaukelt wurden, sondern eng zusammengehörende Teile eines für ihn wohl wichtigen Ganzen. So als spannten sie nicht nur den gesamten Freiraum ab, in welchem sich sein Leben entfaltet hatte, sondern auch das solide und ihm Halt gebende Gerüst für diese Lebenssphäre. Eröffnete ihm seine Seele durch diese Träume gerade einen Blick auf das, was ihn im Kern ausmachte und sein bisheriges Leben geformt hatte?
Was Träume sind, das glaubte er früher recht gut zu verstehen, zumindest was da im Gehirn abläuft. Neuronen im oberen Hirnstamm erzeugen zufällige Erregungsmuster die sich zu einem Traumauslöser fügen. In Verbindung mit dem tiefen REM-Schlaf bemühen sich dann in der äußersten Schicht des Großhirns die Vernetzungen der Nervenzellen darum diese Muster sinnvoll zu interpretieren. Das Ergebnis ist ein Traum.
Schon in jungen Jahren war er auch an psychischen Aspekten von Träumen interessiert. Was der Hauptzweck dieser Vorgänge war, darüber waren sich die Experten nicht einig. Manche gingen davon aus dass der Verstand im Schlaf auf fantasievolle Weise verschiedene Handlungsoptionen durchspielt und so seine Problemlösungskompetenz trainiert. Andere waren der Meinung, dass es vor allem um das Trennen von wichtigen und weniger wichtigen Informationen geht. Ein selektiver Transfer vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis findet statt und der Verstand sortiert einen Teil des ihn im Wachzustand Beschäftigenden ins vorhandene System bereits abgespeicherter Erinnerungen ein. Vielleicht sind Träume also fiktive Geschichten als Hilfskonstruktionen hierbei. Auch Gedächtniskünstler bedienen sich oft einer Methode, bei der neue Bilder in eine strukturierte Geschichte eingebettet werden. Einigkeit herrschte eigentlich nur darüber, dass Träumen für die geistige Gesundheit des Menschen enorm wichtig sei.
Solche Theorien waren ihm nun nicht mehr klar, nur einzelne Fragmente hierzu tauchten kurz auf. Er war an einem Punkt seines Lebens angekommen, an dem das intellektuelle Verstehen komplexer Zusammenhänge keine hohe Priorität mehr hatte. Sein Bewusstsein befand sich auf einem anderen Niveau. Wobei er nicht hätte sagen können, ob dieses höher oder tiefer als sein früherer vernunftbasierter Zustand lag.
In dieser Zeit verschlief er oft den halben Tag im Bett. Nur noch selten weckte etwas außerhalb des üblichen Tagesablaufs sein Interesse. An einem Tag jedoch riss ihn ein lautes seltsames Geräusch aus seiner Lethargie.
Er lag seitlich zum Fenster hingewandt und öffnete die Augen als ein hartes rhythmisches Klopfen an die Scheibe des Schlafzimmerfensters seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Da er keine Brille aufhatte, sah er nur verschwommen einen Vogel auf dem Sims außen sitzen und mit dem Schnabel verspielt gegen die Glasscheibe picken. Dennoch wusste er sofort, dass es eine Elster war. Die Größe des schönen Tiers, die langen Schwanzfedern, die auffällige schwarz-weiße Tracht und das im Sonnenlicht metallisch-blau schimmernde schwarze Gefieder waren ihm vertraut. Fasziniert beobachte er, wie diese Elster anscheinend ihr Spiegelbild in der Scheibe ansah und sich damit auseinandersetzte.
Das Verhalten des Vogels rief plötzlich eine sehr klare Erinnerung an früher Gelesenes auf. Der Mann wusste wieder, dass Elstern zu den intelligentesten Lebewesen überhaupt zählen. Wie Primaten und Delphine verfügen sie über die Fähigkeit der Selbstwahrnehmung als Individuum. Sie sehen also beim sogenannten „Spiegeltest“ nicht irgendeinen ihnen ähnlichen Artgenossen vor sich, sondern tatsächlich sich selbst. Verhaltensforscher konnten dies durch entsprechende Studien unzweifelhaft nachweisen.
Grund für diese Intelligenzleistung ist die Beschaffenheit des Gehirns der Rabenvögel. Ihr vorderer Hirnmantelbereich, welcher für die kognitiven Fähigkeiten zuständig ist, hatte in Relation zum Körpergewicht ungefähr die gleiche Masse wie der funktional entsprechende präfrontale Cortex von Menschenaffen und Menschen.
Das verhilft diesen Vögeln auch zu anderen ungewöhnlichen Leistungen. Sie sind in der Lage zu begreifen, dass ein Objekt oder eine Person weiterhin existiert, wenn es oder sie sich außerhalb des Blickfeldes befindet. In der Neurowissenschaft nennt man dies Objektpermanenz. Auch Grundfertigkeiten zum Rechnen und zu konkreten Mengenvorstellungen basieren auf diesen Gehirnstrukturen und befähigen Elstern dazu, Futter weitverstreut in Depots zu horten und sich dieser Reserven in Notzeiten noch bewusst zu sein.
Der Greis fühlte in diesem Moment der überraschend deutlichen Erinnerungen wie sein Geist aus dem Halbschlaf weiter erwachte. Langsam, um den Vogel nicht zu vertreiben, griff er nach seiner Brille auf dem Nachttisch. Sehr bewusst sog er den nun klaren Anblick der weiter mit ihrem Spiegelbild beschäftigten Elster in sich auf, erfreute sich hieran, aber auch am Aufblitzen seines früheren Wissens.
Er ließ den Blick am Vogel vorbei über die Bäume der Parkanlage im Hintergrund schweifen, jenem von seiner Frau und ihm viele Jahre lang geliebten Paradies direkt hinter ihrer Wohnanlage. Seit Wochen hatte er diese vertraute Szenerie nicht mehr bewusst wahrgenommen. In einer der höchsten Baumkronen, wohl einer alten Robinie, sah er unscharf eine kugelige Kontur, vielleicht eine große Mistel. Im nächsten Moment spürte er eine Gänsehaut über seinen Körper wandern und mit einer hohen emotionalen Intensität ging sein Blick zurück zum gefiederten Besucher auf dem Sims und dann wieder hinaus in den Park.
Das dort oben im Baum war keine Mistel, das war ein Elsternnest! Mit dieser Erkenntnis riss es ihn regelrecht zurück in eine Zeit, als er noch rundum glücklich war. Ein Wachtraum ließ längst verschüttete Erinnerungen zurückkommen.
Das Nest der Elstern
München, 2025
Viele Jahre nachdem seine Frau und er am Ende ihres Berufslebens nach Deutschland zurückgekehrt waren wurde ihnen in einem Frühjahr ein besonderes Schauspiel geboten. Zwei Elstern bauten sich ein Nest im Wipfel einer Robinie, direkt gegenüber von ihrer Wohnung in der vierten Etage. Jener Wohnung, in welcher der Greis noch immer lebte und sich nun pflegen ließ.
Es kam den beiden naturverliebten Rentnern damals fast so vor als hätten die Vögel den Brutplatz bewusst so gewählt, um ihnen einen perfekten Logenplatz zu reservieren. Vielleicht hatte es sie aber auch nur aufgrund guter Rahmenbedingungen dorthin gezogen. Wie sie selbst, sagten sich die beiden Menschen mit einem Schmunzeln und in Dankbarkeit, dass sie hier vor etlichen Jahren ihre Traumwohnung gefunden hatten.
Schon morgens vom Bett aus konnten sie im Liegen das Geschehen im Park verfolgen. Auch die großen Glasfronten im Wohn-Ess-Zimmer ließen den Blick auf die Szenerie zu, so dass sie in den kommenden Wochen das Leben rund um das Nest gut verfolgen konnten. Ein Fernglas lag hierfür immer bereit.
Das Elsternpaar war ihnen schon im Winter aufgefallen da die beiden Vögel viel Zeit in ihrem Sichtbereich verbrachten. Sie markierten ihr Revier im Zentrum des kleinen Parks indem sie oft und deutlich sichtbar auf besonders exponierten Ästen verharrten. Hierbei saßen sie aufrecht, mit hängendem Schwanz, plusterten die weißen Gefiederbereiche auf und demonstrierten so ihren Anspruch. Regelmäßige Besuche auf den Fensterbänken und Balkonen vermittelten in dieser Zeit den Eindruck, als würden die Elstern ihre Umgebung genau auf vielleicht versteckte Gefahren überprüfen.
Sie beobachteten, dass einer der beiden Vögel im Geäst eines hohen Baumes immer wieder durch Flügelzittern, Schwanzwippen und Schackern seinen Partner auf etwas aufmerksam machte. Später begriffen die Menschen, dass dies der Hinweis auf eine gute Stelle zum Nestbau war.
Im März bemerkten der Mann und seine Frau genau an jenem Baum die ersten Arbeiten. Die Vögel hatten sich in etwa zwanzig Metern Höhe eine starke Verästelung im oberen Bereich der Robinienkrone als Fundament gewählt. In diese sichere Basis klemmten sie kräftige lange Zweige und arbeiteten etwa zwei Wochen daran, diesen Unterbau sturmsicher an den Ästen zu fixieren.