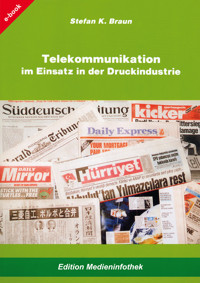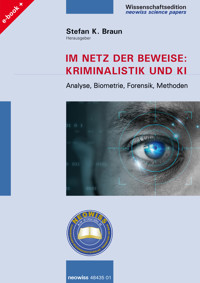
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MCDP International UG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In der kriminaltechnischen Praxis beginnt die Forensik mit der Spurensuche am Tatort. Forensische Medien bilden dadurch mediale Tatorte. Die moderne Forensik umfasst das systematische Identifizieren, Ausschließen, Analysieren oder Rekonstruieren krimineller Handlungen. Die vorliegende Ausgabe beleuchtet den Stand der Forschung sowie angewandte Methoden in Kriminalistik und Forensik aus wissenschaftlicher und praktischer Perspektive. Biometrische Verfahren wie Daktyloskopie (Fingerabdrucktechnik), Gesichtserkennung und Sprachanalyse gelten auch im polizeilichen Kontext als vielversprechende Ansätze zur Personenauthentifizierung. Professionell erstellte Deepfakes sind mittlerweile visuell kaum oder gar nicht mehr von echten Inhalten zu unterscheiden. Die Resozialisierung von Sexualstraftätern und der Einfluss digitaler Medien auf junge Menschen zählen zu den zentralen Herausforderungen der Kriminalistik, die durch die Digitalisierung weiter verschärft werden. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine Schlüsselrolle. Schätzungen zufolge existieren heute mehr als 20.000 KI-Modelle. Trotz ihrer Flexibilität und Leistungsfähigkeit erfordern Foundation-Modelle immense Rechenressourcen für Training und Betrieb und werfen zugleich ethische und gesellschaftliche Fragen auf. Forensische Methoden und Werkzeuge unterliegen schnellen und tiefgreifenden Veränderungen. Täter, Ermittler, Forensiker, Sachverständige und Justiz sind gleichermaßen von den schnellen Entwicklungen betroffen und nutzen zunehmend KI-basierte Instrumente. Mit der fortschreitenden Justizdigitalisierung wächst allerdings auch das Risiko von Identitätsverschleierung. Der Herausgeberband bietet Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Analyseansätze und Untersuchungsmethoden, die auch bei der Überführung von Tätern zum Einsatz kommen. Neben der Printausgabe erscheinen ein E-Book in verschiedenen digitalen Formaten und ein zusätzliches digitales Angebot in Form eines Repositoriums.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
neowiss Wissenschaftsedition
neowiss science papers
E-Book-Ausgabe PLUS DIGITAL REPOSITORY
IM NETZ DER BEWEISE: KRIMINALISTIK UND KI
Analyse, Biometrie, Forensik, Methoden
Herausgegeben von
Dr. Stefan K. Braun
Mit einem Geleitwort von Philipp Kurz (IPA)
Zweisprachige Ausgabe in Deutsch / Englisch
Bilingual issue in German / English
Autoren dieses Bandes:
Tobias Barthelt
Torsten Huschbeck
Stefan K. Braun
Kim Stefanie Kreins
Alexander Burggraf
Maximilian Maas
Julian Busch
Laetitia Sasha Orzeske
Markus Höhner
Lorena Sternowski
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Bibliographic Information published by Die Deutsche Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the internet at https://portal.dnb.de
MCDP International UG (haftungsbeschränkt)
Niedenau 4, 60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach §44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Alle Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr, eine Haftung der Autoren oder des Verlages ist ausgeschlossen.
Erstveröffentlichung 2025
Herausgeben von Dr. Stefan K. Braun
Copyright MCDP International UG, Frankfurt am Main, © 2025
[email protected], [email protected], www.neowiss.de
Fotografie Titel: Rawpixel.com / Shutterstock.com (Retinale Biometrie-Technologie, System zur biometrischen Erkennung von Personen.)
Umschlaggestaltung, Innenlayout und Gesamtkonzeption: Herbé
Satz: Braun Typografie, Frankfurt am Main
Lektorat: Dr. Stefan K. Braun
Schriften Druckausgabe / E-Book PDF: Frutiger LT Std 45 Light / LT Pro 55 Roman, Times New Roman
Hergestellt in Deutschland / Europa.
Bestellnummer E-Book EPUB: NSP48435 01, ISBN 978-3-945484-35-7
Ebenfalls erhältlich:
Bestellnummer Print: NSP48433 01, ISBN 978-3-945484-33-3
Bestellnummer E-Book PDF: NSP48434 01, ISBN 978-3-945484-34-0
neowiss – Europäischer Wissenschaftsverlag | Frankfurt am Main
Kriminalistik (lateinisch crimen Beschuldigung, Vergehen) ist die Lehre von den Mitteln und Methoden zur Bekämpfung einzelner Straftaten und des Verbrechertums (der Kriminalität) durch präventive und strafverfolgende Maßnahmen. Eingeschlossen sind alle erforderlichen, am Einzelfall orientierten, rechtlich zulässigen, allgemeinen und besonderen Methoden, Taktiken und Techniken. Zielsetzung der Kriminalistik ist das Ermitteln und forensische Beweisen von Straftaten, die Abwehr von Verbrechensgefahren und das Verhindern von Straftaten. Die Kriminalistik grenzt sich als selbstständige Disziplin von der Kriminologie ab. Unter Kriminologie versteht man die Lehre von den Ursachen (Kriminalätiologie) und Erscheinungsformen (Kriminalphänomenologie) der Kriminalität.
Geleitwort
Die fortschreitende Digitalisierung verändert die Welt und auch die Art und Weise, wie Verbrechen erkannt und bekämpft werden. Künstliche Intelligenz (KI) spielt dabei eine zentrale Rolle in der modernen Kriminalistik, indem sie neue Perspektiven für schnellere Ermittlungsprozesse, präzisere Analysen und eine effizientere Aufklärung bietet. Der Einsatz von KI hat das Potenzial, die Kriminalitätsbekämpfung zu revolutionieren und die Arbeitsweise von Ermittlungsbehörden nachhaltig zu verändern.
Weltweit wird KI bereits in unterschiedlichen Formen in der polizeilichen Arbeit eingesetzt. In Großbritannien nutzt die Polizei von London KI-Algorithmen zur Echtzeit-Analyse von Überwachungsaufnahmen, um verdächtige Aktivitäten automatisch zu erkennen. Dies ermöglicht schnellere Reaktionen und eine frühzeitige Identifikation potenzieller Täter. In den USA verwenden Städte wie Chicago und New York KI-basierte Systeme, um Verbrechen vorherzusagen, indem historische Daten und soziale Medien analysiert werden. So können Einsatzkräfte gezielt in Gebieten mit hohem Straftatrisiko eingesetzt werden. In Estland wird KI erfolgreich zur Bekämpfung von Cyberkriminalität eingesetzt. Die estnische Polizei nutzt fortschrittliche Algorithmen, um digitale Spuren zu analysieren und Muster in großen Datenmengen zu erkennen. Besonders bei der Aufklärung von Online-Betrug und Identitätsdiebstahl hat sich diese Technologie als äußerst effektiv erwiesen, indem sie verdächtige Aktivitäten in Echtzeit identifiziert und Täter schnell überführt.
Auch in Deutschland nimmt der Einsatz von KI in der polizeilichen Arbeit zu. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen setzt KI-basierte Systeme ein, um große Datenmengen aus verschiedenen Quellen zu durchsuchen und Muster zu erkennen. So werden potenzielle Täter schneller identifiziert und kriminelle Netzwerke effizienter enttarnt. Diese Technologien tragen nicht nur zur schnelleren Aufklärung bei, sondern auch zur Verbrechensprävention, was das Potenzial hat, die Kriminalitätsbekämpfung auf ein neues Niveau zu heben.
Trotz der vielversprechenden Möglichkeiten müssen auch die Herausforderungen berücksichtigt werden. Der Einsatz von KI wirft zentrale Fragen hinsichtlich des Datenschutzes und der Wahrung der Grundrechte auf. In einer zunehmend vernetzten Welt, in der große Datenmengen gesammelt und verarbeitet werden, ist es wichtig, den rechtlichen Rahmen stets zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Privatsphäre der Bürger gewahrt bleibt und die Polizeien rechtssicher arbeiten können.
Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung ist die KI-Verordnung der Europäischen Union, die am 1. August 2024 in Kraft trat. Diese Verordnung soll die Entwicklung und den Einsatz von KI in der EU sicher und vertrauenswürdig gestalten. Besonders relevant für die Polizei ist die Klassifizierung von KI-Systemen in Risikokategorien. Diese Kategorisierung ermöglicht es, potenziell gefährliche Anwendungen zu identifizieren, die einer strengeren Überwachung unterliegen. Für die polizeiliche Arbeit bedeutet dies, dass Systeme für Überwachung oder Verbrechensvorhersage sorgfältig geprüft und kontrolliert werden müssen, um ethische und datenschutzrechtliche Standards zu wahren. Hier ist jedoch gerade die Politik gefordert, den Polizeien die erforderlichen technischen, finanziellen und vor allem auch rechtlichen Grundlagen zur Verfügung zu stellen, um KI-Systeme effektiv und rechtssicher einsetzen zu können.
Die Chancen, die KI für die Kriminalistik bietet, sind enorm. Sie kann die Kriminalitätsbekämpfung und -prävention revolutionieren und den Ermittlungsprozess effizienter gestalten. Doch der verantwortungsvolle Umgang mit dieser Technologie erfordert eine ausgewogene Balance zwischen Innovation, Ethik und Recht. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Einsatz von KI den Fortschritt vorantreibt und gleichzeitig den Schutz der Bürgerrechte wahrt.
Es bleibt zu hoffen, dass die Nutzung von KI in der Kriminalistik in den kommenden Jahren weiter ausgebaut wird, dabei jedoch stets die ethischen und datenschutzrechtlichen Fragestellungen berücksichtigt werden. Nur dann kann gewährleistet werden, dass die Technologie zu einer sicheren, gerechten und freien Gesellschaft beiträgt.
Philipp Kurz
Präsident der International Police Association (IPA) Deutsche Sektion e. V.
Vorwort des Herausgebers
In der kriminaltechnischen Praxis beginnt die Forensik mit der Spurensuche am Tatort. Forensische Medien bilden dadurch mediale Tatorte. Die moderne Forensik umfasst das systematische Identifizieren, Ausschließen, Analysieren oder Rekonstruieren krimineller Handlungen. Die vorliegende Ausgabe beleuchtet den Stand der Forschung sowie angewandte Methoden in Kriminalistik und Forensik aus wissenschaftlicher und praktischer Perspektive.
Der Titel Im Netz der Beweise spielt auf die moderne Kriminaltechnik an, die oft auf eine Vielzahl von Quellen und Indizien zugreift, die miteinander verknüpft werden, um ein vollständiges Bild eines Verbrechens zu ergeben. Das „Netz“ symbolisiert dabei die Verbindungen und Überschneidungen von verschiedenen Beweismitteln – sei es digitale Spuren, DNA, Zeugenaussagen oder technische Daten –, die gemeinsam dazu beitragen, den Täter zu überführen. Der metaphorisch gemeinte Begriff „Netz“ steht für die Komplexität der Ermittlungen und die präzise Vernetzung von Beweisen, die in der modernen Kriminalistik von entscheidender Bedeutung sind. Fallermittlungen werden durch ein systematisches Zusammenspiel verschiedener Beweismittel und Techniken vorangetrieben, die wie ein Netz miteinander verflochten sind, um den Täter letztlich zu entlarven.
Der Herausgeberband bietet einen Überblick über relevante Theorie- und Methodenspektren ihres Forschungsfeldes und gibt Antworten auf wegweisende Themen. Biometrische Verfahren wie die der Daktyloskopie (Fingerabdrucktechnik), Face Identification (FI) (Erkennen konkreter Personen in Bildern oder Videosignalen) und Speaker Verification (phonetische Sprachanalyse) gelten auch im polizeilichen Kontext als vielversprechende Ansätze zur Personenauthentifizierung, da körperliche Merkmale im Gegensatz zu Wissensund Besitzelementen nicht nur mittelbar personenbezogen, sondern unmittelbar personengebunden und für jedes Individuum unterschiedlich sind. Mit Hilfe von empirischen Untersuchungen werden Erkenntnisse über medizinische, biologische, psychologische oder ökologische Zusammenhänge gewonnen. Der heutige Bedarf an zuverlässigen Personenidentifikationen und Personenüberwachungen steigt mit wachsender Weltbevölkerung stetig an. Über 1 Milliarde Überwachungskameras sind derzeit weltweit nur für den Zweck von öffentlichen Überwachungen installiert. Die Massenüberwachung ist längst Teil unseres Alltages und anfällig für Missbrauch. Neue 2D- und 3D-Entwicklungen in der Gesichtserkennung zeigen, wie Identitäten ermittelt und Ähnlichkeiten bei Gesichtsmerkmalen festgestellt werden. 3D-Verfahren bieten inzwischen eine erhöhte Erkennungsgenauigkeit und Posen-Unabhängigkeit.
Deepfake bei manipulierten bzw. künstlich hergestellten Bildern und Videos gewinnt immer mehr an Bedeutung. Professionell erstellte Deepfakes sind mittlerweile visuell kaum oder gar nicht mehr von echten Inhalten zu unterscheiden. Die Beweiskraft von in Verfahren eingebrachte audiovisuelle Beweismittel nimmt dadurch ab. Mit der fortschreitenden Justizdigitalisierung wächst allerdings auch das Risiko von Identitätsverschleierung.
Schätzungen zufolge existieren heute mehr als 20.000 KI-Modelle. Mehr als 150 Foundation-Modelle (Modelle mit sehr umfangreichen Datensätzen) wurden seit 2023 eingeführt (z. B. GPT-4o von OpenAI oder Gemini 1.5 Pro und PaLM 2 von Google). Trotz ihrer Flexibilität und Leistungsfähigkeit erfordern Foundation-Modelle immense Rechenressourcen für Training und Betrieb und werfen zugleich ethische und gesellschaftliche Fragen auf.
Spätestens seit dem Launch von ChatGPT im Jahre 2022 stellen sich durch die Massentauglichkeit und Zugänglichkeit der KI neue Fragen und Herausforderungen für die gesamte Forschungsgemeinschaft. Die Autoren beschäftigten sich mit Fragestellungen, wie sich Lehre und Forschung verändern werden und welche neuen Herausforderungen Intelligente Tutorensysteme und Sprachmodelle sowie neue Analysefähigkeiten von KI-Systemen mit sich bringen. Ebenfalls werden Fragestellungen erörtert, wie KI und Big Data in Entscheidungsfindungsprozessen bei Führungskräften und im Top Management unterstützend beitragen können.
Die Resozialisierung von Sexualstraftätern und der Einfluss digitaler Medien auf junge Menschen zählen zu den zentralen Herausforderungen der Kriminalistik, die durch die Digitalisierung weiter verschärft werden. Der Vergleich der Resozialisierungsansätze in Deutschland und den USA zeigt, wie komplex die Wiedereingliederung von Sexualstraftätern ist. Gleichzeitig verdeutlicht die digitale Sozialisation das Entstehen neuer Kriminalitätsformen wie Cybermobbing und Hate Speech. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine Schlüsselrolle, sowohl bei der Überwachung entlassener Straftäter als auch bei der Prävention und Erkennung digitaler Gewalt in sozialen Netzwerken.
Seit den brillanten Aufklärungserfolgen des Ermittlerduos Sherlock Holmes und Dr. Watson am Ende des 19. Jahrhunderts hat sich nicht nur die Ermittlungsarbeit vollständig verändert. Wie würde Holmes die neuen Technologien zur Fallanalyse heute einsetzen? Forensische Methoden und Werkzeuge unterliegen schnellen und tiefgreifenden Veränderungen. Täter, Ermittler, Forensiker, Sachverständige und Justiz sind gleichermaßen von den schnellen Entwicklungen betroffen und nutzen zunehmend KI-basierte Instrumente.
Der Leser erhält in dieser Ausgabe Einblick in aktuelle Entwicklungen, Analyseansätze und Untersuchungsmethoden, die auch bei der Überführung von Tätern Anwendung finden. Eine vollständige Darstellung aller forensischen Methoden in einem einzelnen Band ist nicht möglich. Ziel dieses Bandes der neowiss science papers ist es vielmehr, durch ausgewählte und verbindende Themen nützliche Methoden, Ansätze und Entwicklungen vorzustellen, um Forschenden den Einstieg in das wissenschaftliche Arbeiten zu erleichtern.
Ich danke den Autoren für ihre Beiträge, die dieses Buch in vorliegender Form ermöglicht haben. Ebenfalls danke ich Dr. Michael Beithe (eurias), Dr. Pavla Beithe (eurias) und Dr. Torsten Huschbeck (HSPV Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen) für ihre Unterstützung bei diesem Herausgeberband. Herrn Philipp Kurz, Präsident der International Police Association (IPA) Deutsche Sektion e. V. danke ich besonders für sein Geleitwort.
Alle Beiträge haben einen Review- und Lektoratsprozess durchlaufen. Last but not least danke ich den Gutachtern für ihr Engagement.
Ergänzend zur Printausgabe erscheinen ein E-Book in verschiedenen digitalen Formaten und ein zusätzliches digitales Angebot in Form eines Repositoriums. Über einen QR-Code und Link lassen sich Informationen, digitale Mediendateien und Aktualisierungen zu einzelnen Artikeln abrufen. Artikel mit Netz-Updates sind entsprechend im Buch gekennzeichnet.
Frankfurt am Main, im Januar 2025
Dr. Stefan K. Braun
Inhaltsübersicht
Geleitwort
Vorwort des Herausgebers
Inhaltsübersicht
Inhaltsverzeichnis
Review Board
Cold Cases - Die Mörder unter uns
Laetitia Orzeske
Biometrische Gesichtserkennung
Stefan K. Braun
Daktyloskopie 2.0
Lorena Sternowski
Sprecherverifikation in der Kriminalistik
Stefan K. Braun
Resozialisierung von Sexualstraftätern
Kim Stefanie Kreins
Polizieren im digitalen Zeitalter
Julian Busch, Markus Höhner, Torsten Huschbeck
Artificial intelligence and how it is changing research and teaching in economics
Tobias Barthelt, Maximilian Maas
Von Daten zu Entscheidungen – Wie Künstliche Intelligenz Führungskräfte unterstützt
Alexander Burggraf
Sachverzeichnis
Die Autoren
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorwort des Herausgebers
Inhaltsübersicht
Inhaltsverzeichnis
Review Board
Cold Cases – Die Mörder unter uns
Laetitia Orzeske
1 Einleitung
2 Aktueller Stand der Forschung
2.1 Cold Cases
2.2 Statistische Erhebung
3 Strukturiertes Literatur-Review
3.1 Suchstrategien und Ausfilterungsprozess
3.2 Grundsätze der qualitativen Inhaltsanalyse
4 Auswertung der Ergebnisse
4.1 Erfolgsbeeinflussende Faktoren
4.1.1 Ermittlungshemmende Faktoren
4.1.2 Ermittlungsfördernde Faktoren
4.2 Die wirksamsten Ermittlungsmethoden
4.2.1 DNA-Analyse
4.2.2 Cold-Case-Einheiten
4.2.3 Öffentlichkeitsarbeit
4.2.4 Operative Fallanalyse
4.2.5 Exkurs: Studierende in der Cold-Case-Bearbeitung
4.3 Reflexion
5 Diskussion
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Biometrische Gesichtserkennung
Stefan K. Braun
1 Einleitung
2 Gesichtserkennung und Identitätsfeststellung
3 Deepfake-Erkennung
3.1 Modell-Verwendungen für KI-generierte Inhalte
3.2 Kriterien der Kontextanalyse
3.3 Computer Generated Imagery
4 Diskussion und Fazit
Literaturverzeichnis
Daktyloskopie 2.0
Lorena Sternowski
1 Einleitung
2 Gegenstand, Aufgaben, Methoden
2.1 Grundlagen der Daktyloskopie
2.2 Sichtbarmachung und Sicherung von Hautleistenspuren
2.3 Ältere Entscheidungsfindungsmodelle
3 Fortschritte in der Daktyloskopie
3.1 Daktyloskopie 2.0
3.2 Daktyloskopie 3.0
3.3 Herausforderungen am Beispiel einer Fallstudie
3.4 Datenschutz
3.4.1 Speicherung und Nutzung von Fingerabdruckdaten
3.4.2 Missbrauchsmöglichkeiten und Datenschutzbedenken
3.5 Gerichtliche Verwertbarkeit
4 Diskussion
5 Fazit
Literaturverzeichnis
Sprecherverifikation in der Kriminalistik
Stefan K. Braun
1 Einleitung
2 Phonetik und Phonologie
2.1 Sprechererkennung
2.2 Automatische Sprecheridentifizierung
2.3 Standardsprache
2.4 Akzent
2.5 Dialekt und Umgangssprache
2.6 Stereotypen
3 Sprechprozess und Sprachsignal
4 Sprechermerkmale
4.1 Indirekte Sprechermerkmale
4.2 Direkte Sprechermerkmale
4.3 Individuelle Merkmale der Sprachanalyse
4.3.1 Phonem
4.3.2 Diphthong
4.3.3 Monophthonge (Vokalphoneme)
5 Stimmverstellung
5.1 Verstellungsarten
5.2 Einflüsse auf die Sprechstimmlage
5.3 Dialektimitation
5.4 Fehlertypisierungen
6 Interviewdurchführung mit dem/n (mutmaßlichen) Tatsprecher/n
6.1 Leitfadengestütztes Interview
6.2 Aufbau des Fragebogens
6.3 Fragestellungen zur Durchführung eines Interviews
6.4 Lesetexte für Sprachanalysen
6.5 Durchführen eines Pretests
7 Analyse Sprecherverifikation
8 Fremdsprachenvergleich
9 KI in der Sprachanalyse
10 Ausblick
Literaturverzeichnis
Resozialisierung von Sexualstraftätern
Kim Stefanie Kreins
1 Einleitung
2 Begriffsbestimmungen
2.1 Klassifizierung von Sexualstraftätern
2.1.1 Klassifizierung nach Knight und Prentky
2.1.2 Klassifizierung nach Rehder
2.2 Sexualstraftaten
2.3 Resozialisierung
3 Resozialisierung von Sexualstraftätern in Deutschland
3.1 Polizeiliche Kriminalstatistik
3.2 Behandlungsmöglichkeiten
3.2.1 Leitlinien integrativer Sozialtherapie
3.2.2 Sex-Offender-Treatment Programm (SOTP)
3.2.3 Anti-Sexuelle-Aggressivität-Trainings (ASAT)
3.2.4 Behandlungsprogramm für Sexualstraftäter (BPS)
3.3 Präventionsmöglichkeiten
3.3.1 KURS
3.3.2 Präventionsnetzwerk „Kein Täter werden“
4 Resozialisierung in den USA
4.1 Rechtliche Rahmenbedingung
4.2 Umgang mit Sexualstraftätern
4.2.1 Öffentliche Sexualstraftäterregistrierung
4.2.2 Kognitiv-Behaviorale Behandlung
4.2.3 Relapse Prevention (RP)
5 Diskussion
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Polizieren im digitalen Zeitalter
Julian Busch, Markus Höhner, Torsten Huschbeck
1 Einleitung
2 Zeitalter der digitalen Strukturen
2.1 Adoleszente Lebensphase
2.2 Cybergrooming
3 Staatliche Reaktionen zur Eindämmung
4 Diskussion und Fazit
Literaturverzeichnis
Artificial intelligence and how it is changing research and teaching in economics
Tobias Barthelt, Maximilian Maas
1 Introduction
2 Methodology
2.1 Definition of AI and the object of research
2.2 SLR
3 Findings
3.1 Impact of AI on the science of economics
3.2 Impact of AI on university teaching of economics
3.3 Challenges for science and teaching in economics through the use of AI
4 Discussion and Limitations
References
Von Daten zu Entscheidungen – Wie Künstliche Intelligenz Führungskräfte unterstützt
Alexander Burggraf
1 Einleitung
2 Grundlagen der KI und Big Data
2.1 Künstliche Intelligenz allgemein
2.2 Bedeutung von Daten und Big Data
2.3 Big Data Analytics
2.4 Big Data als Grundlage von Entscheidungen
3 Die Transformation zur datengetriebenen Organisation
4 Management im Spannungsfeld von KI, Big Data und Entscheidungen
4.1 Die neue Rolle der Führungskraft
4.2 Entscheidungsprozesse allgemein und im Management
4.3 Einsatz von KI und Big Data in Managemententscheidungsprozessen
5 Schlussbetrachtung und Handlungsempfehlungen
Literaturverzeichnis
Sachverzeichnis
Die Autoren
Backcover
Review Board
Der Gutachterausschuss ist ein selbstständiges, unabhängiges und an keinerlei Weisungen gebundenes Kollegialgremium mit der Aufgabe, eingereichte Beiträge im Peer Review-Verfahren zur Qualitätssicherung zu prüfen. Eine weitere Qualitätskontrolle findet zusätzlich im Lektoratsprozess statt.
Der Verlag dankt den Gutachtern für ihr Engagement und ihre unabhängige Überprüfung der eingereichten Autorenbeiträge.
Dr. Michael Beithe
eurias, Europäisches Institut für akademische Studien
Dr. Stefan K. Braun Dipl.-Sachverständiger (BWA) Dipl.-Ing. (FH)
Von der IHK öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Medienproduktion & Mediendesign; Handelsrichter am Landgericht Frankfurt am Main; Herausgeber Edition neowiss; Verlag MCDP International UG
Prof. M.A. Dagmar Cagáňová, PhD
Professor in Business Economics and Management, acts as the Ambassador / Representative for Foreign Affairs at the Institute of Industrial Engineering and Management, the Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, the Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia.
Dr. Torsten Huschbeck
Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW), Dozent und örtlicher Fachkoordinator für die Fächer „Kriminalistik und Kriminaltechnik“. Landesfachkoordinator für das Fach „Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens“ (HSPV NRW).
Prof. Ing. Dr. Peter Markovič
Wirtschaftsuniversität Bratislava, Fakultät für Betriebsführung, Dekan, Lehrstuhl für Betriebsfinanzen
Die Mörder unter uns
Laetitia Orzeske
ABSTRAKT
In einem strukturierten Literatur-Review wird der aktuelle Forschungsstand zu Cold Cases analysiert. Dabei werden erfolgshemmende und -fördernde Faktoren identifiziert. Die Arbeit bedient sich der qualitativen Inhaltsanalyse, um die in der Literatur beschriebenen Ermittlungsmethoden zu bewerten und ihre Wirksamkeit in der Aufklärung von Cold Cases zu bestimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass der technologische Fortschritt in der DNA-Analyse sowie die strukturierte Neubewertung von alten Ermittlungsdaten entscheidend zum Erfolg von Cold-Case-Ermittlungen beitragen.
ABSTRACT
The current state of research on cold cases is analysed in a structured literature review. Factors that inhibit and promote success are identified. The work uses qualitative content analysis to evaluate the investigative methods described in the literature and to determine their effectiveness in solving cold cases. The results show that technological progress in DNA analysis and the structured re-evaluation of old investigation data make a decisive contribution to the success of cold case investigations.
JEL Klassifikation / Classification: K14, K19, K39, O30, O33
Schlüsselwörter: Cold Case, Mörder, DNA-Analyse
Keywords: Cold case, murderer, DNA analysis
Laetitia Orzeske ist Absolventin des Bachelorstudiengangs für den Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen.
1 Einleitung
Eine Gruppe Kriminalfälle, welche in den letzten Jahren an öffentlichem Interesse dazugewonnen hat, stellt die Gruppe der ungelösten Tötungsdelikte (Cold Cases) dar, wie bspw. der Mord an Jutta Hoffmann. Am Abend des 29. Juni 1986 wurde die 15-jährige Jutta Hoffmann in einem Waldstück nahe ihrem Wohnhaus ermordet. Zuvor verbrachte sie den Nachmittag im städtischen Freibad mit ihren Freunden. Die Kriminalpolizei ermittelte lange Zeit erfolglos in ihrem Fall. Erst durch den Einsatz neuer und weiterentwickelter Ermittlungsmethoden konnte der Fall 37 Jahre später durch die Cold Case Einheit des Landeskriminalamts (LKA) Südhessen aufgeklärt werden. Neue kriminaltechnische Untersuchungsmöglichkeiten von körperzellhaltigem Material (DNA) führten die Ermittler zu einem Tatverdächtigen, der in den Jahren nach der Tat mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Um den Tatverdacht gegen ihn zu erhärten, wurde der Fall drei Jahre später in der Sendung „Aktenzeichen XY-Ungelöst“ vorgestellt. Hinweise aus der Bevölkerung verifizierten den polizeibekannten Tatverdächtigen und führten zur Ausfertigung eines Untersuchungshaftbefehls wegen des dringenden Verdachts des Mordes an Jutta Hoffmann. Am 15.12.2023 wurde der 62-jährige Angeklagte zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Dies stellte einen Erfolg in der Wiederaufnahme von Cold Cases dar. Ziel des vorliegenden Artikels ist es nunmehr, mithilfe eines strukturierten Literatur-Reviews den aktuellen Kenntnisstand über erfolgshemmende und -fördernden Faktoren bei der Aufklärung von Cold Cases zu beleuchten. Dabei wird, vom Erkenntnisinteresse der Verfasserin getragen, folgenden Forschungsfragen nachgegangen:
Welche Faktoren beeinflussen den Erfolg einer Cold-Case-Ermittlung?Welche sind die wirksamsten Ermittlungsansätze bzw. Ermittlungsmethoden, um eben diese Herausforderungen zu überwinden?Hierzu werden nach der Einleitung die für das bessere Verständnis des Artikels wichtigen Begriffe und Rechtsbestimmungen definiert. Im Anschluss daran erfolgt ein strukturiertes Literatur-Review, mit welchem der aktuelle Kenntnisstand zu der oben genannten Forschungsfrage analysiert und strukturiert zusammengefasst wird.
2 Aktueller Stand der Forschung
Für das Verständnis des vorliegenden Artikels wird in Kapitel 2.1 der Begriff „Cold Case“ bestimmt, damit der Leser den Ausführungen im Hauptteil besser folgen kann. Im anschließenden Kapitel 2.2 erfolgt eine statistische Erhebung ungelöster Fälle in Deutschland.
2.1 Cold Cases
Da es bisher keine einheitliche Definition für den Begriff „Cold Case“ gibt, existieren viele verschiedene Definitionen, die sich im Kern jedoch ähnlich sind. Der Ursprung des Begriffs findet sich im angloamerikanischen Rechtsraum wieder. Dort beschäftigen sich Ermittler bereits seit den frühen 1980er Jahren mit der Wiedereröffnung ungelöster Kriminalfälle. Dabei wurden neue und weiterentwickelte Technologien angewendet (Tofan, 2021, S. 11-12), die im Rahmen des strukturierten Literartur-Reviews näher erläutert werden. Das Houston Police Department definiert Cold Cases als ein den Polizeibehörden bekanntgewordenes Verbrechen, welches in einem Zeitraum von über einem Jahr nicht aufgeklärt werden konnte (City of Houston, 2024). Eine weitere gängige Definition, welche ebenfalls aus den Vereinigten Staaten von Amerika stammt, beschränkt den erfolglosen Ermittlungszeitraum auf drei Jahre (Law Insider, 2024). Auch bei den deutschen Polizeibehörden lassen sich Unterschiede in der Auslegung feststellen. Aus diesen lassen sich jedoch allgemeine Kriterien ableiten, die einen Kriminalfall zu einem Cold Case werden lassen. Unter Berücksichtigung dieser Kriterien handelt es sich um Kapitaldelikte, die nach Ausschöpfung aller Ermittlungsansätze und Ermittlungsmethoden nicht aufgeklärt werden konnten und deren Verfahren durch die Staatsanwaltschaft nach §170 (2) StPO eingestellt worden sind (Bettels et al., 2016, S. 270). Gemäß den Definitionen der Landeskriminalämter (LKÄ) handelt es sich bei den betroffenen Kapitaldelikten um ungeklärte Tötungsdelikte oder auch ungeklärte Vermisstenfälle. Zusätzlich zu einem ungeklärten Vermisstenfall müssen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diesem ein Tötungsdelikt zugrunde liegt (Griesbach, 2022, S. 3). Unter Tötungsdelikten versteht man in Deutschland den Mord nach §§211 StGB, den Totschlag nach 212 StGB, die Tötung auf Verlangen nach 216 StGB die Körperverletzung mit Todesfolge nach 227 StGB und die fahrlässige Tötung nach 222 StGB. Darüber hinaus gibt es die erfolgsqualifizierten Tötungsdelikte nach 249 (1), 251 StGB, 221 (1) und (3) StGB, 238 (1) und (3) StGB und 306 c StGB (Birkholz, 2022). Die Einstellung des Verfahrens bedeutet, dass die Fallakten vollständig durch die Polizei an die Staatsanwaltschaft übermittelt werden und keine weiteren Ermittlungen angestrebt werden. Dabei wird auf eine zeitliche Begrenzung, wie es sie in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt, verzichtet (Griesbach, 2022, S. 3).
2.2 Statistische Erhebung
In Deutschland werden Tötungsdelikte u. a. in der bundeseinheitlichen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst. Die Daten dafür liefern die 16 LKÄ der Bundesrepublik Deutschland. Die aufgeführten Daten beinhalten Fallzahlen, Tatort und Tatzeit, Opfer und Schäden sowie Informationen zu Tatverdächtigen. Darüber hinaus wird auch das prozentuale Verhältnis von aufgeklärten Fällen zu bekanntgewordenen Fällen angegeben. Dennoch werden Cold Cases nicht von ihr erfasst. Auch neben der PKS gibt es in Deutschland keine statistische Erfassung von Cold Cases. Grund dafür ist u. a., dass es bisher keine einheitliche Definition für Cold Cases gibt. Durch die unterschiedliche Auslegung des Begriffs ist es nicht möglich, diesen in eine bundeseinheitliche Kriminalstatistik zu überführen. Die genauen Fallzahlen werden in den Polizeibehörden der Länder ermittelt und digital erfasst (LT BW, Drs. 16/9433, S. 3). Diese Zahlen lassen sich jedoch nicht für alle Bundesländer recherchieren. Im Rahmen der Gründung einer Cold Case Einheit gab das LKA NRW an, 1.143 Cold Cases aus den Jahren 1970 bis 2021 bearbeiten zu wollen (Tack, 2023). In einer Stellungnahme des Bundesinnenministeriums gab dieses an, Baden-Württemberg habe 339 Cold Cases aus den Jahren 2000 bis 2020 erfasst (LT BW, Drs. 16/9433, S. 3). Auch das Land Berlin nahm 2022 Stellung zu der Anzahl seiner Cold Cases. Dort heißt es, dass für den Zeitraum 1968 bis 2021 insgesamt 286 Cold Cases dokumentiert wurden (LT BE, Drs. 19/11897, S. 1). Um einen größeren Überblick über die Gesamtsituation in Deutschland zu bekommen, werden im Folgenden Fallzahlen von Tötungsdelikten (einschließlich der Versuche) aus den Jahren 1970 bis 2020, die Anzahl der davon aufgeklärten Fälle und ihre Aufklärungsquoten in Prozent dargestellt und beschrieben. Die Daten entstammen den PKS der jeweiligen Jahre (PKS Sammelschlüssel 892500). In der PKS erfasste Delikte gelten als aufgeklärt, wenn mindestens ein Tatverdächtiger mit rechtmäßigen Personalien die Tat nachweislich begangen hat (BKA, 2022). Die Daten werden in tabellarischer Form in 5-Jahresschritten angezeigt, um den Umfang der vorhandenen Daten auf eine handhabbare Größe zu bringen. Der angegebene Zeitraum ist angelehnt an das LKA NRW, welches sich im Rahmen der Einführung seiner Cold Case Einheit auf die Bearbeitung von Cold Cases aus den Jahren 1970 bis 2021 beschränkte. Diese bieten die Chance, dass die Beteiligten der jeweiligen Fälle nicht bereits verstorben sind. Die Aufklärungsquote von Tötungsdelikten in Deutschland liegt stets über den 90 %. Eine Ausnahme stellt das Jahr 1995 dar. Die im Verhältnis niedrige Aufklärungsquote ist auf die seit 1993 erfassten ZERV-Fälle zurückzuführen. Dabei handelt es sich um Straftaten, die durch Mitglieder ehemaliger DDR-Regierungen begangen wurden und solche, die im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung stehen. Viele dieser Fälle konnten nicht aufgeklärt werden (Wenda, 2022, S. 88-90). Exakte Zahlen aufgeklärter Delikte wurden nur in den Jahren 1970, 1975, 1980, 1985 und 1990 angegeben. Danach erfolgte nur eine prozentuale Angabe. So blieben in den jeweiligen Jahren 45, 121, 113, 134 und 130 Tötungsdelikte ungeklärt (Tabelle 1).
Tabelle 2-1: Statistische Daten zu Mord und Totschlag (eigene Darstellung).
Berichtsjahr
1970
1975
1980
1985
1990
1995
Erfasste Fälle
779
2908
2705
2778
2387
3928
Aufgeklärte Fälle
734
2787
2592
2644
2257
k.A.1
Aufklärungsquote
94,2 %
95,8 %
95,8 %
95,2 %
94,6 %
88,3 %
Berichtsjahr
2000
2005
2010
2015
2020
Erfasste Fälle
2770
2396
2218
2116
2401
Aufgeklärte Fälle
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Aufklärungsquote
95,3 %
95,8 %
95,4 %
94,8 %
94,9 %
Zu beachten sind hier jedoch die Grenzen der PKS. Zunächst deckt diese nur das Hellfeld ab, wodurch unentdeckte Tötungsdelikte nicht aufgeführt werden. Weiterhin sind die Fallzahlen der jeweiligen Delikte insbesondere auf die Wahrnehmung und Bewertung der Polizeibehörden zurückzuführen. Das heißt, wenn ein Tötungsdelikt nicht als solches erkannt wurde, wird es nicht als ein solches statistisch aufgeführt. Experten der Rechtsmedizin gehen davon aus, dass die Hälfte aller Tötungsdelikte unentdeckt bleiben. Grund dafür seien unter anderem Fehler bei der Leichenschau und das Ausbleiben von Obduktionen (Meine, 2023). Darüber hinaus gibt die PKS keine Informationen über den Ausgang eines Verfahrens, sodass nicht gesagt werden kann, ob ein ungeklärtes Delikt in den Jahren darauf nicht doch noch aufgeklärt werden konnte.
4 Auswertung der Ergebnisse
In dieser Arbeit sollen die in der Einleitung vorgestellten Forschungsfragen: mithilfe einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse und einem induktiven Kategoriensystem beantwortet werden. Anstelle der Einordnung in ein Kommunikationsmodell und der Bildung von Analyseeinheiten, wurde aus dem herausgefilterten Material durch die Kombination der deduktiven und induktiven Vorgehensweise ein Kategoriensystem nach dem Ablaufmodell von Mayring und Fenzl entwickelt. Dabei wurden die Codes „Ermittlungsbeeinflussende Faktoren“, „Ermittlungsansätze“ und „Ermittlungsmethoden“ vorab deduktiv generiert. Alle weiteren Codes wurden induktiv durch die Sichtung des Materials generiert. Das Kategoriensystem ermöglicht eine kategoriengeleitete Sichtung des Materials und die Möglichkeit, relevante Textabschnitte in passende Kategorien einzuordnen. Die Erstellung des Kategoriensystems erfolgte mithilfe des Softwareprogrammes MAXQDA. Anhand des Kategoriensystems wird das Material im Hinblick auf seinen Erkenntnisstand bezüglich der Forschungsfragen analysiert. Zusätzlich wird an einzelnen Stellen eine Kontextanalyse eingebaut, um bestimmte Punkte weiter ausführen und so besser begründen zu können (Mayring & Fenzl, 2022, S. 695-696).
4.1 Erfolgsbeeinflussende Faktoren
Der Ermittlungserfolg von Cold Cases hängt zum einen von Faktoren ab, die die Beamten beeinflussen und solche, die sie nicht beeinflussen können. Nicht beeinflussbar ist der Faktor Tatgegebenheiten. Darunter fallen Aspekte wie z. B. das Delikt selbst, der Tatort, die Tatzeit und die Anzahl der Täter und Täterinnen, Zeugen und Zeuginnen und Opfer. Diese unveränderlichen Gegebenheiten legen den Grundstein für Ermittlungserfolg. So wirken sich bspw. viele Beteiligte positiv und wenig Beteiligte negativ auf den Erfolg aus (Griesbach, 2022, S. 5). Hinzu kommen Faktoren, die durchaus beeinflussbar sind. Diese werden in den folgenden Kapiteln 4.1.1 und 4.1.2 dargestellt.
4.1.1 Ermittlungshemmende Faktoren
Ein Faktor, der die Ermittler bei der Bearbeitung von Cold Cases besonders herausfordert, ist der Faktor Zeit. Cold Cases liegen zumeist weit in der Vergangenheit. Das hat u. a. zur Folge, dass eine Vielzahl von Akten und Asservaten aufgrund des Fehlens von Computern nicht digitalisiert wurden (Fischhaber & Klasen, 2017). So nimmt es mehr Zeit in Anspruch, die Fallzahlen zu erfassen, die Fälle zu kategorisieren, priorisieren und zu prüfen, ob und welche Asservate noch vorliegen. Dabei kommt es vor, dass ganze Akten oder Teile der Akten nicht auffindbar sind. In dieser Zeit werden die Fälle älter und die Chancen auf Aufklärung geringer. Das ist insbesondere der Fall, wenn eine Verjährungsfrist vorliegt. Bei einem Totschlag tritt die Verjährung nach 20 und bei einem besonders schweren Fall des Totschlags nach 30 Jahren ein. Nach Ablauf der Frist kann die Straftat nicht weiterverfolgt bzw. die Ermittlungen des Cold Cases nicht wieder aufgenommen werden (Marquardt, 2022). Darüber hinaus kommt es vor, dass Asservate vernichtet wurden, da die Fälle lange Zeit unbearbeitet blieben oder als vollständig ausermittelt galten und man Platz für neue Asservate schaffen wollte. Dann fehlen wichtige Beweismittel, die zur Aufklärung des Falls beitragen oder auch neu untersucht werden können (Moran, 2022). Zudem besteht die Möglichkeit, dass Beteiligte wie ehemalige Ermittler, Zeugen oder Tatverdächtige bereits verstorben sind und durch sie keine weiteren Hinweise erlangt werden können. Eine weitere Problematik, die sich dadurch ergibt, stellen Vernehmungen bzw. Aussagen vor Gericht dar. Verstirbt ein Zeuge oder Mitbeschuldigter, kann seine getätigte Aussage nur unter bestimmten Voraussetzungen in den Prozess eingebunden werden. Hier gilt §251 (1) Nr. 3 StPO. Demnach lässt sich die Aussage vor Gericht nur durch das Verlesen eines Vernehmungsprotokolls einer früheren Vernehmung oder einer Urkunde mit der Erklärung der aussagenden Person ersetzten. Vermerke zur Aussage, die durch die Ermittler gefertigt wurden, können nicht verlesen werden. Eine Vernehmung von Zeugen, die erst im Rahmen der Cold-Case-Ermittlung ermittelt werden konnten, kann durch ihren Tod nicht mehr stattfinden, sodass neue Informationen durch sie nicht zutage kommen. Die Beschuldigtenvernehmung kann nicht durch ein Vernehmungsprotokoll oder eine Urkunde ersetzt werden. Hier muss die Vernehmung durch einen Vernehmungsbeamten stattfinden. Darüber hinaus ist zu beachten, dass gegen Tote nicht ermittelt werden kann. Sollte auf einen Tatverdächtigen gestoßen werden, der während des Verfahrens verstirbt oder bereits verstorben ist, ist das Verfahren gegen ihn einzustellen. Bei nicht verstorbenen Beteiligten lassen die Erinnerungen oft nach oder gehen gänzlich verloren. Hier besteht jedoch nicht die Möglichkeit die Aussage durch das Vernehmungsprotokoll oder eine Urkunde zu ersetzten. Das Vernehmungsprotokoll darf bei Zeugen ausschließlich als Erinnerungsstütze verwendet werden, indem ihm oder ihr zunächst einzelne Abschnitte vorgelesen werden. Sollte dies erfolglos sein, darf das gesamte Protokoll vorgelesen werden. Setzten die Erinnerungen weiterhin aus, hat das Protokoll keinen Beweiswert mehr. Die Aussagen gehen somit verloren (Marquardt, 2020, S. 661). An den Faktor Zeit knüpft der Faktor Ermittlungsfehler an. Der Erfolg kann bspw. davon beeinflusst werden, wie die Ermittlungsakten geführt wurden. Vor der Verwendung von Computern für die Führung von Akten, wurde diese handschriftlich gefertigt, wobei sich oftmals Fehler einschlichen (Griesbach, 2022, S. 5). Dies erschwert heute insbesondere die Recherche zu einem bestimmten Fall. Darüber hinaus konnte auch festgestellt werden, dass manche Akten unvollständig waren. So auch in einem Cold Case von 1984. Dort fehlte u. a. ein Lichtbild eines Tatverdächtigen, welches die Beamten 1984 zu dessen Identifizierung ausgewählten Zeugen in ihren Vernehmungen vorlegten. Dadurch konnte das Durchführen einer Wahllichtbildvorlage nicht bestätigt werden. Darüber hinaus wurden in diesem Fall einige Vernehmungen ohne zeugenschaftliche Belehrung und nur in Form von Vermerken in der Akte niedergeschrieben, was zu den o. g. Problematiken führte. Bezüglich der Vernehmungen des Tatverdächtigen führte die fehlende Angabe über erfolgte Belehrungen ebenfalls zur Unverwertbarkeit der Aussagen (Marquardt, 2020, S. 661). Neben der unsorgfältigen Aktenführung sind auch Fehler im Bereich der Spurensicherung möglich. Im Rahmen der Cold Case-Aufbereitungsaktion in Österreich aus den Jahren 2005 bis 2006 wurden Spurenkontaminationen durch Beamte festgestellt werden. Dabei handelte es sich um DNA und Fingerabdruckspuren an Tatorten. Dies birgt die Gefahr von falschen Ermittlungsansätzen, in die viel Zeit und Ermittlungsarbeit investiert werden (Schmid, 2010, S. 253- 254). Ein weiterer Faktor, der eine erfolgshemmende Wirkung auf die Cold-Case-Ermittlungen auswirken kann, ist der Faktor Personal. Cold-Case-Ermittlungen sind sehr komplex und benötigen eine umfangreiche dienststellenübergreifende Recherche, bevor die eigentliche Ermittlungsarbeit beginnen kann (Albert, 2023, S. 267). Dies beansprucht viel Zeit. Neben den Cold Cases gibt es jedoch eine Vielzahl aktueller Fälle, die von der Staatsanwaltschaft und den Beamten bearbeitet werden müssen, sodass die personalen Kapazitäten sehr begrenzt sind (Marquardt, 2022).
4.1.2 Ermittlungsfördernde Faktoren
Neben den hemmenden Faktoren gibt es durch den Faktor Zeit und den Faktor Weiterentwicklung auch einige Aspekte, die die Cold-Case-Ermittlungen fördern können. Die Zeit scheint zunächst der Gegner des Erfolges zu sein. Dennoch können bspw. Veränderungen in Beziehungen die Ermittlungen fördern. Zerbrochene Partnerschaften, Freundschaften, Bekanntschaften oder veränderte Familienverhältnisse können Zeugen später dazu bewegen, doch noch gegen eine einstig nahestehende Person auszusagen. Auch der Tod eines Täters, den man lange fürchtete, kann dazu ermutigen ihn zu belasten, da die möglichen Konsequenzen durch den Täter ausbleiben (Horn, 2010, S. 247). Darüber hinaus ist es Ermittlern bereits gelungen nach vielen Jahren eine Übereinstimmung in den polizeilichen Auskunftssystemen zu erzielen, da ein Täter nach der Tat weiter durch andere Taten polizeilich in Erscheinung getreten ist und aufgrund dessen erkennungsdienstlich behandelt wurde. Dies gelang der Kommissarin Eva Gäbl, die der Sonderkommission Altfälle des Polizeipräsidium München angehörig ist im Fall des Viktualienmarkt-Mörders. Nachdem sie einen Zigarettenstummel und die Hose des Opfers 12 Jahre nach der Tat erneut auf DNA überprüfen ließ und diese dann mit den polizeilichen Auskunftssystemen abglich, erzielte sie dort einen Treffer. Der Täter war in den Jahren nach dem Mord wegen Diebstahls und Körperverletzung erkennungsdienstlich behandelt worden und hatte bereits eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt. 2008 wurde er dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt (Fischhaber & Klasen, 2017). Dieser Erfolg hängt auch mit dem Faktor Weiterentwicklung zusammen. Dabei spielt die Entwicklung forensischer Technologien eine wichtige Rolle. So ist es seit 1975 gängige Praxis, Spurenfolie zu verwenden, um bspw. die Kleidung des Opfers und das Opfer selbst abzukleben. Dafür wurden ca. 250 bis 300 Folien verwendet. Der Gedanke dahinter war zunächst, Faserspuren zu sichern. Heute weiß man, dass sich an diesen Folien auch Hautschüppchen befinden können. Dadurch besteht die Möglichkeit auch noch viele Jahre später DNA an den Folien zu finden und eine DNA-Analyse durchzuführen. Dadurch können dann neue Ermittlungsansätze entstehen, denen die Ermittler nachgehen können, so wie im Beispiel von Eva Gäbl (Menke, 2022). Doch nicht nur die Kriminaltechnik ist heute deutlich fortgeschrittener. Auch die Medien und sozialen Netzwerke haben in den letzten Jahren eine enorme Reichweite bekommen und können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden. Denkbar sind hier u. a. Facebook, Twitter, Instagram, die Internetseiten der Polizeibehörden, TV-Shows aber auch Zeitungen, Zeitschriften und neue Arten der Berichtserstattung wie z. B. Podcasts (Albert, 2023, S. 268). Auf die DNAAnalyse und die Öffentlichkeitsarbeit wird in den noch folgenden Kapiteln 4.2.2 und 4.2.3 näher eingegangen.
4.2 Die wirksamsten Ermittlungsmethoden
Vom Bewusstsein über die o. g. Faktoren kann bei den Cold-Case-Ermittlungen profitiert werden, denn jede Cold-Case-Ermittlung ist einzigartig und bedarf einer umfangreichen Aufarbeitung. Auch wenn die Ermittlungsmethoden für Hot und Cold Cases ähnlich sind bzw. die gleichen Methoden zur Aufklärung angewendet werden, müssen die Cold-Case-Ermittlungen als eine eigenständige Disziplin der polizeilichen Ermittlungsarbeit angesehen werden (Albert, 2023, S. 265). Grundsätzlich werden ein oder mehrere Fälle ausgewählt und alle Materialen wie z. B. die Fallakten und Asservate gesichtet, um diese hinsichtlich neuer Ermittlungsansätze zu bewerten. Das hilft bei der Entscheidung, ob ein Cold Case wieder aufgenommen werden kann und welche Fälle priorisiert werden können. Im weiteren Verlauf wird über Ermittlungsmethoden entschieden, mit denen den Ermittlungsansätzen nachgegangen werden soll (Tofan, 2021, S. 12). In den nachfolgenden Kapiteln 4.2.1 bis 4.2.4 werden vier einzelne Methoden vorgestellt, von denen in der Regel mindestens zwei zusammenwirken, um einen Cold Case aufzuklären.