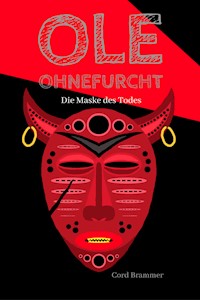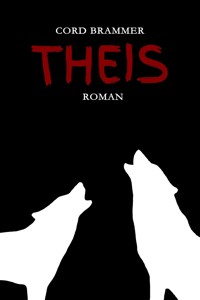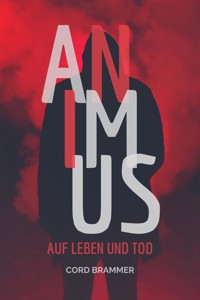
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Da Noah erfährt, dass für ihn die Möglichkeit besteht, nach Korpus zurückzukehren, überlegt er nur kurz. Als einer von zehn Huntern nimmt er an einem Turnier teil, das sich zu einer schonungslosen Hetzjagd entwickelt, an der ganz Animus beteiligt zu sein scheint. Dabei lernt er Iris kennen, ein Mädchen von der Straße. Sie begleitet ihn auf seiner Flucht vor den kaltblütigen Trackern, bis sich ihre Wege trennen müssen. Von da an beginnt für Noah ein rasanter Wettlauf gegen die Zeit ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
IN ANIMUS
AUF LEBEN UND TOD
CORD BRAMMER
Impressum
IN ANIMUS
AUF LEBEN UND TOD
Texte: Copyright © 2017 by Cord Brammer
Covergestaltung: Copyright © 2021 by Cord Brammer
Unter Verwendung von © Elti Meshau - canva.com
Impressum: Cord Brammer, Dorfstraße 6, 29362 Hohne, [email protected]
www.cordbrammer.de
www.instagram.com/cord_brammer
www.facebook.de/cordbrammerautor
www.twitter.com/cordbrammer
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die vollständige oder auszugsweise Verwendung jeglicher Art bedarf der schriftlichen Zustimmung des Autors. Dies gilt insbesondere für die Verbreitung, die Vervielfältigung, die Übersetzung und die Einspeicherung in elektronische Systeme.
Kapitelübersicht
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Erster Teil
Animus
21.07. / 08:34 / MEZ
Gleißend helles Licht durchdringt meine geschlossenen Augenlider. In mein Bewusstsein schleicht sich der Gedanke, nicht weiter schlafen zu dürfen, sondern langsam wach werden zu müssen.
Als ich blinzelnd meine Augen öffne, um nicht schlagartig geblendet zu werden, zieht ein stechender Schmerz, als müsse ich alles Leid und allen Kummer dieser Welt gebündelt ertragen, durch meinen gesamten Körper. Beginnend an meiner rechten Schläfe, die Wirbelsäule hinab, durch das linke Bein, bis an die äußerste Zehenspitze des daran hängenden Fußes. Wie gelähmt lasse ich diese kurz andauernde Folter über mich ergehen und beiße mit qualerfülltem Gesicht die Zähne zusammen. Schon nach wenigen Sekunden ist alles vorüber, als habe dieser Zwischenfall nie stattgefunden, und als sei der Schmerz durch meine Zehen entschwunden.
Ich liege auf einem harten, unbequemen und kalten Untergrund. Direkt über mir befindet sich eine grell leuchtende Deckenlampe, deren Leuchtstoffröhren ein metallisches Sirren von sich geben. Parallel zu ihr hängen in etwa zwei Metern Entfernung zu beiden Seiten die nächsten Lampen. Die zu meiner Rechten flackert in einem gleichmäßigen Takt, dem sich ein Pochen in meinem linken Unterarm angepasst zu haben scheint. Erst jetzt bemerke ich, dass sich dieser Arm ein wenig taub anfühlt. Hinzu kommt ein unangenehmer, nicht auszuhaltender Juckreiz. Als ich meinen Arm anheben möchte, um mir anzusehen, wovon dieser Juckreiz ausgelöst worden sein könnte, werde ich daran gehindert. Der Arm scheint festgeschnallt zu sein, auch den anderen kann ich nicht frei bewegen, er liegt ebenfalls dicht an meinem Körper. An beiden Handgelenken spüre ich einen unbezwingbaren Widerstand.
Ich versuche mich aufzurichten, doch dies gelingt mir nur bis zu einem gewissen Grad. Nach nur wenigen Zentimetern kommt mir ein Gurt in die Quere und spannt sich fest über meinen Brustkörper. Für meine Beine gilt das Gleiche, auch sie sind über den Knien und an den Knöcheln fixiert und beinahe unbeweglich. Allein meinen Kopf kann ich frei heben. Nachdem mir dies mühsam gelungen ist, erkenne ich, dass die Haut meines linken Unterarms im Bereich der Pulsadern in den verschiedensten Farben angelaufen ist. Woher die blauen, roten und gelben Flecken stammen, kann ich mir nicht erklären, genauso wie ich mir nicht erklären kann, wo ich hier bin. Befinde ich mich vielleicht in dem Aufwachraum eines Krankenhauses?
Dafür spricht einerseits, dass ich einen weißen Kittel trage, den ich bisher nur an meinem Großvater gesehen habe, als er kurz vor seinem Tod im Krankenhaus lag. Andererseits liegen links und rechts neben mir zwei weitere Patienten, die wie ich an ein Krankenbett gefesselt sind. Jedoch reagieren sie nicht, als ich sie anspreche, sie scheinen zu schlafen oder noch unter Narkose zu stehen. Oder sind sie vielleicht überhaupt nicht mehr am Leben? Bin ich hier in einer Art Leichenhalle? Liegen zu meinen beiden Seiten Tote?
»Hallo«, rufe ich, dabei zerre ich mit meinen Armen und Beinen an den Fesseln, die aber nicht nachgeben wollen. »Kann mich irgendwer hören?«
Als würde ich durch Kameras beobachtet werden, quietscht nun in meiner unmittelbaren Nähe eine Tür in ihren Angeln. Ich verhalte mich völlig still und lausche in den Raum hinein. Auf dem gummiartigen Fußboden höre ich Schritte näher kommen, bis sich schließlich eine Frau über mich beugt. Sie trägt ebenfalls einen Kittel, auch wenn ihrer grün ist. Ihre blonden Haare hat sie zu einem Zopf gebunden, der bis auf ihre rechte Schulter reicht. Vor einem ihrer leuchtendblauen Augen taucht plötzlich ein Gegenstand auf, mit dem sie nacheinander in meine Augen leuchtet, die sie mit ihren Fingern geöffnet hält.
Als sie mit ihrer Untersuchung fertig ist, spreche ich sie an: »Was ist passiert? Wo bin ich hier?«
»Du brauchst dich nicht zu fürchten. Alles ist gut. Du bist in den besten Händen«, sagt sie mit einer ruhigen Stimme, die vertrauenserweckend klingen soll. Ihre Sätze wirken einstudiert, als würde sie sie täglich mehrmals herunterbeten. »Wie fühlst du dich?«
»Es ging mir schon mal besser. Mein linker Arm tut über dem Handgelenk weh. Außerdem juckt es dort.«
»Das geht vorüber. Schon morgen wirst du es nicht mehr spüren«, sagt sie, zieht eine Dose aus ihrem Kittel und schmiert eine kühlende Salbe auf meine Wunde, die das Kitzeln auf der Haut für einen Augenblick stillt.
»Warum bin ich gefesselt? Hat das einen Grund?«
Anstatt darauf einzugehen, tritt sie ohne ein Wort an das Kopfende meines Bettes und setzt dieses in Bewegung. Gespannt darauf, wohin sie mich bringen wird, frage ich nicht weiter nach und denke auch nicht weiter an meinen linken Unterarm. Meine Aufregung legt sich über all meine Gedanken und all meine Neugier.
Mit einem ratternden Geräusch verschwindet die Deckenlampe vor meinen müden Augen. Ich werde in einen schmalen Flur geschoben, der nicht viel breiter ist als das Bett, auf dem ich liege. Als ich meinen Kopf nach vorne strecke, sehe ich einen schlauchartigen Korridor vor mir, an dessen weit entferntem Ende eine klitzeklein wirkende Tür ist, auf die wir geradewegs zusteuern.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier komische Dinge vonstattengehen. Der sterile Aufwachraum, die Fesseln an meinem Körper, die merkwürdige Krankenschwester. Sie weicht mir aus, wenn ich danach frage, was mir zugestoßen ist, was es mit meinem Arm auf sich hat, wo ich bin. Ihre Antworten kommen einem Schweigen gleich und sind inhaltslose Floskeln.
Ich habe den vagen Verdacht, in einer Anstalt zu sein, einer Anstalt für geisteskranke Menschen. Alles andere erscheint mir aufgrund der Räumlichkeiten und des Umgangs mit mir abwegig. Obwohl ich der Meinung bin, bei klarem Verstand zu sein, muss irgendeine Diagnose über mein Verhalten dazu geführt haben, dass ich hier eingewiesen wurde. Hatte ich vielleicht, obwohl es mir nicht ähnlich sehen würde, einen Wutanfall?
Ich versuche es mit weiteren Fragen, auch wenn ich damit rechne, dass auch diese unbeantwortet bleiben. »Warum antworten Sie mir nicht? Was haben Sie mit mir vor? Wohin bringen Sie mich?«
Und wieder erklingen ihre einstudierten Worte: »Du brauchst dich nicht zu fürchten. Alles ist gut. Du bist in den besten Händen.«
Über mir zieht eine Leuchtstofflampe nach der anderen vorbei, was sich beinahe einschläfernd auf mich auswirkt. Bis zum Ende des Flures zähle ich siebenundzwanzig Stück, die dortige Tür öffnet sich von allein.
Der Raum, in dem wir nun sind, ist so breit wie der Flur und gerade einmal so lang, dass zwei Menschen und das Krankenbett hineinpassen. An meinen Füßen taucht ein stämmiger Mann auf, wie seine Kollegin ist er mit einem grünen Kittel bekleidet. Er hat kurzgeschnittenes braunes Haar und trägt einen gepflegten Vollbart, mit dem er sein Doppelkinn kaschiert. Sein leerer Blick verrät, dass er wenig Freude an seinem Beruf hat. Mit einer lustlosen Stimme fragt er: »Wie viele kommen noch?«
»Für heute war es das. Die anderen sind noch nicht wach. Sie werden nachher von der anderen Schicht übernommen. Heute Abend geht es für uns weiter.« Sie übergibt ihm das Krankenbett. »Aber du weißt wie ich, dass es nie aufhört. Es kommen immer welche nach. Allein in der letzten Nacht hatten wir elf Zugänge. Der …«
»Verschone mich mit Details«, sagt er mit einem abfälligen Blick. »Das ist einfach alles zu frustrierend für mich. Bis heute Abend in alter Frische.«
»Ja, bis heute Abend.«
Sie verlässt den Raum, die Tür schließt sich. Erst jetzt fällt mir auf, dass ich in einem Fahrstuhl bin. Ich sehe, wie der Mann den Knopf für das Erdgeschoss drückt. Ein nach oben zeigender Pfeil leuchtet auf. Demnach sind wir gerade noch im Keller. Mit einem Ruck setzen wir uns in Bewegung.
»Wo bin ich hier? Wohin bringen Sie mich? Was haben Sie mit mir vor?«, frage ich meinen Begleiter.
Er schweigt wie ein Grab, starrt gegen die Tür und scheint darauf zu warten, dass sie sich wieder öffnet.
»Ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was mit mir geschieht«, brülle ich ihn an. »Also sagen Sie mir gefälligst, was hier vor sich geht.«
Sein Blick senkt sich in meine Richtung, und er erwidert in einem ruhigen Ton: »Du brauchst dich nicht zu fürchten. Alles ist gut. Du bist in den besten Händen.«
Die Mitarbeiter dieser Einrichtung sind anscheinend nicht befugt, sich länger mit den Patienten zu unterhalten, sie gehen einfach nur ihrer Arbeit nach. Dabei beruhigen sie uns, indem sie diese drei Sätze wiederholen, bis auch der aufsässigste Patient sie verinnerlicht hat.
Um nicht weiter unangenehm aufzufallen, halte ich von nun an meinen Mund, denn jede Art von Gegenwehr hat keinen Sinn. Wie ich bereits am eigenen Leib spüren musste, weder die mit vollem Körpereinsatz, und wie ich gerade eben erfahren habe, noch die mit Worten. Also lasse ich die Ungewissheit meiner Lage über mich ergehen und warte ab, was mir bevorsteht, wenn sich der Fahrstuhl im Erdgeschoss öffnet. Er gleitet noch immer nach oben. Ich kann schwer einschätzen, wie lange wir schon mit ihm unterwegs sind, doch mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir eben noch tief unter der Erde waren. Der Fahrstuhl wird langsamer, bis er schließlich hält. Kurz darauf öffnet sich die Tür.
Ich werde durch eine große Halle geschoben, deren Decke mit aufwändigen Malereien verziert ist. Obwohl diese stark angegriffen und teilweise nicht mehr vollständig sind, erkenne ich in ihnen biblische Szenen. Aus diesem Grund besteht für mich kein Zweifel daran, dass ich mich in einem Gotteshaus befinde.
Vom Altarbereich werde ich zum Turmraum gebracht. Bis auf die hallenden Schritte des bärtigen Mannes und das Rattern der Rollen meines Krankenbettes herrscht absolute Stille. Von außen dringen keine Geräusche nach innen, die darauf schließen lassen könnten, ob die Kirche in einem einsam gelegenen Dorf oder in einer belebten Stadt steht. Immerhin lässt das hereinströmende Licht, das sich durch die verschiedenfarbigen Fenster verfärbt, auf sonniges Wetter schließen.
Kurz vor dem Turmraum bleiben wir abrupt stehen. Der Mann tritt neben das Bett, schaut mir mit ernstem Blick in die Augen und redet mir ins Gewissen, als würde er ein Gedicht aufsagen: »Verhalte dich ruhig, wenn ich dich gleich losschnalle. Wage es nicht, einen Fluchtversuch zu starten, denn das hätte schwerwiegende Folgen für dich. Draußen stehen nämlich an jedem Ausgang zwei Wächter, die nur darauf warten, dich in Empfang zu nehmen. Hast du das verstanden?“
Ich nicke nur, auch wenn ich gerne wüsste, welcher Art die Folgen wären und was es mit den erwähnten Wächtern auf sich hat. Aber ich wollte keine Fragen mehr stellen, also lasse ich es sein.
Zuerst befreit er mich von dem Gurt, der über meinem Brustkorb gespannt ist. Dann geht er zu den Beinen über, um mich danach von den Fesseln an meinen Handgelenken zu befreien. Sofort kratze ich meinen Unterarm, worauf ich schon seit meinem Erwachen ungeduldig gewartet habe.
»Das geht vorüber. Schon morgen wirst du es nicht mehr spüren«, wiederholt er die Worte seiner Kollegin und bittet mich, vom Krankenbett aufzustehen.
Kaum bewege ich mich, kehrt auch schon der stechende Schmerz in meinen Körper zurück und schießt mir durch Mark und Bein. Auch dieses Mal verschwindet er so schnell, wie er aufgetaucht ist. Als ich auf meinen Füßen stehe und den ersten Schritt wage, fällt mir der Bewegungsablauf des Gehens schwer. Meine Knochen und Muskeln wollen nicht so wie ich, was nur daran liegen kann, dass ich sehr lange regungslos auf dem Bett gelegen habe. Der kräftige Mann greift mir unter die Arme und hilft mir bei meinen ersten Schritten. Nachdem ich diese mühsam hinter mich gebracht habe, fällt mir das Gehen zusehends leichter, sodass ich nicht mehr auf seine Hilfe angewiesen bin.
In dem kurzen Moment, in dem die Tür zum Turmraum geöffnet ist, erkenne ich andere Menschen, die wie ich gekleidet sind, etwa fünfundzwanzig an der Zahl. In mehreren Reihen sitzen sie in völliger Dunkelheit auf Holzstühlen, die dicht nebeneinander stehen. Von dem Licht überrascht, drehen sie sich verängstigt in unsere Richtung, als könnten wir Unheil über sie bringen. Als sie an meinem weißen Kittel erkennen, dass einer von ihnen hereingeführt wird, wirken sie alle erleichtert. Mit einer Taschenlampe werde ich zu einem der beiden letzten noch freien Stühle gebracht.
Der stämmige Mann weicht von meiner Seite, schlendert zurück zur Tür und lässt für einen kurzen Augenblick Licht herein. Anstatt erneut von völliger Finsternis begraben zu werden, als er die Tür von außen schließt, leuchtet vor mir ein Bildschirm auf, der die Größe einer Kinoleinwand hat. Auf ihr taucht eine Fünf auf, aus ihr wird eine Vier, eine Drei, Zwei, Eins.
Vor meinen Augen erscheint ein älterer Mann mit schlohweißem Haar. Ich schätze sein Alter auf Mitte fünfzig. Seine Stirn zieren furchenartige Falten, als habe er sich in seinem Leben häufig geärgert. Tief hängende Schlupflider verfinstern seinen ohnehin strengen Blick. Seine Lippen, über denen ein voller Schnurrbart thront, hält er zusammengepresst, während leise Orchestermusik im Hintergrund spielt.
In seinem tadellosen weißen Anzug steht er an einem Pult, an das ein Mikrofon angebracht ist. Es endet direkt vor seinem Mund. Hinter ihm schmückt ein weißes Zeichen die pechschwarze Wand. Es ist nicht vollständig zu erkennen, da es teilweise von seinen breiten Schultern verdeckt wird. Allein das Gradnetz der Erde lässt sich erahnen. Welches Wort in dem Zeichen geschrieben steht, kann ich mir nur zusammenreimen, als die Musik endet und der Mann mit kraftvoller Stimme zu sprechen beginnt: »Mein Name ist Kanzler Walter Stahl. Ich habe für Sie bedeutsame Informationen. Sie befinden sich in einer Zwischenwelt. Einer Welt zwischen Leben und Tod. In einer Welt namens Animus.«
21.07. / 09:03 / MEZ
Wie in einem Rausch aus Panik springt in der Reihe vor mir eine Frau auf und kämpft sich ohne Rücksichtnahme an ihren Sitznachbarn vorbei. Sie schaut sich in alle Richtungen um, auf der Suche nach einer Möglichkeit zu fliehen. Im Schein des Bildschirms, auf dem noch immer Kanzler Stahl zu sehen ist, spiegeln sich die Tränen auf ihren Wangen. Schließlich entscheidet sie sich dafür, zu der Tür zu rennen, durch die ich diesen Raum betreten habe. Aus dem Lauf prallt sie mit voller Wucht dagegen, und es entsteht ein Geräusch, als würden Zähne zermahlen werden. Die Frau rüttelt mit aller Kraft an dem Knauf, was aber nichts daran ändert, dass die Tür verschlossen bleibt.
»Lasst mich hier raus«, kreischt sie in einem schrillen Ton und hämmert mit aller Gewalt gegen die Tür. »Lasst mich zu meinen Kindern. Ich will zu meinen Kindern. Macht die Tür auf. Macht sie sofort auf. Das ist Freiheitsberaubung.«
Der Film wird unterbrochen. Von einem Sekundenbruchteil zum nächsten ist es stockdunkel, sodass man nicht einmal die Hände vor Augen sieht. Die Frau scheint darüber erschrocken zu sein, ihr Hämmern verstummt. Aus ihrer Richtung ist ein Schluchzen zu hören, das von einem Wimmern begleitet wird, mit dem sie weiter zum Ausdruck bringt, zu ihren Kindern zu wollen.
Die Tür öffnet sich. Das in den Raum drängende Licht blendet mich, sodass ich nur die Umrisse zweier Männer erkennen kann, die sich der Frau annehmen. Sie setzt sich zur Wehr, um damit zu verhindern, abgeführt zu werden. Mit aller Kraft klammert sie sich an den Türknauf, dabei schreit sie lauter als zuvor: »Bringt mich sofort zu meinen Kindern … Lasst mich gefälligst los … Ihr dreckigen Bastarde.«
Nach dieser Beleidigung zeigen die Männer kein Erbarmen mehr. Sie reißen die Frau los und schleifen sie mit sich. Als sie erkennt, dass es für sie nun keine Rettung mehr gibt, verfällt ihre Stimme sofort ins Weinerliche: »Nein, ich will von nun an gehorsam sein … Ich werde tun, was ihr von mir verlangt … Wo bringt ihr … Was habt ihr mit mir vor?“
Mit einem lauten Knall wird die Tür ins Schloss geworfen. Die verzweifelten Rufe der Frau um Hilfe verstummen. Schlagartig umgibt mich völlige Stille. Unruhe steigt mir bis in den Hals hinauf.
Ohne den Film zu beenden, öffnet sich neben der Leinwand eine weitere Tür, die ich bisher nicht wahrgenommen habe. Vier bewaffnete Männer treten ein, die die gleichen schwarzen Uniformen wie die Männer tragen, von denen die Frau abgeführt wurde. Sie sind von Kopf bis Fuß verhüllt, nicht ein Fleckchen Haut ist zu sehen. An den Händen tragen sie Handschuhe, auf dem Kopf einen Helm mit Visier. Auf mich wirken sie wie der Tod, anstatt der Sense haben sie aber ein Gewehr bei sich. Sie befehlen uns, den Raum zu verlassen. Als ich an ihnen vorbeigehe, erkenne ich auf ihrer linken Brust das weiße Zeichen, welches sich im Film hinter Kanzler Stahl an der Wand befand. Das Gradnetz der Erde, auf dem die Umrisse von sechs Kontinenten abgebildet sind. Darüber zieht sich, noch innerhalb der Erdkugel, ein Wort mit sechs Buchstaben: Animus.
Sofort schießt mir ein Gedanke durch den Kopf. Bei den Männern muss es sich um die Wächter handeln, vor denen ich gewarnt wurde. Sie bringen uns in einen kleinen, fensterlosen Nebenraum, in dem nichts weiter als ein großer, steriler Metalltisch steht. Darauf liegen schwarze Stoffbeutel, auf denen weiße Papierstreifen kleben, die unsere Namen tragen. Sofort sticht mir mein Name ins Auge: Noah Adler.
Die Wächter weisen uns an, unseren Beutel zu nehmen. Als ich hineinschaue, fällt mir ein riesengroßer Stein vom Herzen, denn ich erkenne darin meine Sachen wieder. Meine Hose, mein Shirt, meine Unterwäsche, meine Socken, meine Turnschuhe, meine Armbanduhr und mein Portmonee. Diese einfachen Dinge vermitteln mir ein Gefühl von Sicherheit, denn etwas Vertrautes in den Händen zu halten, beruhigt mich ungemein. Hatten meine beiden Pfleger recht damit, dass ich nichts zu befürchten habe?
Erst als ich weiter in dem Beutel wühle, fällt mir auf, dass eine Sache fehlt. Sofort spreche ich einen Wächter darauf an: »Mein Smartphone ist nicht dabei.«
»Smartphones sind verboten.«
»Warum das denn?«
»Smartphones sind in Animus verboten«, wiederholt der Wächter mit Nachdruck, ohne mir eine Begründung zu nennen, und er hält seine Waffe noch fester in seinen Händen als zuvor.
Ich lasse es gut sein, um nicht negativ aufzufallen, und übe mich lieber in Zurückhaltung. Was mit denen geschieht, die sich in den Vordergrund drängen, habe ich gesehen. Als ich als Letzter den Raum verlasse, bleibt ein Beutel auf dem Tisch zurück. Der Klebestreifen mit dem Namen der Frau, für die er bestimmt war, zeigt nicht in meine Richtung. Ich werde ihren Namen also nie erfahren. Und sie wird ihren Beutel vermutlich nie erhalten.
Zu Beginn des Films wurde uns gesagt, dass kein Grund zur Panik bestehe, und von uns wurde verlangt, dass wir uns ruhig verhalten. Wie man dies erwarten konnte, ist für mich nicht nachvollziehbar, denn die Worte von Kanzler Stahl fühlten sich an, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Wegen ihnen musste man doch erst recht Panik bekommen, denn sollte stimmen, was uns gesagt wurde, sind wir alle nicht mehr am Leben.
Dass die Frau derart auf diese Nachricht reagierte, kann ich gut nachvollziehen, da auch ich mich mit diesem unvorstellbaren Gedanken auseinanderzusetzen habe. Ich muss in Korpus, wie die Welt der Lebenden hier in Animus genannt wird, gestorben sein. Obwohl ich mich nicht daran erinnern kann, was mir zugestoßen sein könnte, sprechen die zeitweise auftretenden Schmerzen dafür, dass mir etwas passiert ist.
Auch wenn ich den Eindruck erwecken mag, mich damit abgefunden zu haben, nicht mehr am Leben zu sein, kann ich es doch nicht für wahr halten. Schließlich stehe ich hier, fühle meinen Körper und bin bei klarem Verstand. Den Tod habe ich mir anders vorgestellt, nämlich so wie die Zeit vor meinem Leben, an die ich mich nicht erinnere. Auch den Tod habe ich mir bisher wie eine alles einhüllende Schwärze vorgestellt. Warum sollte die Realität des Todes also eine andere sein?
Wegen dieser Auffassung blieb ich ruhig, als mir die Nachricht von meinem Tod übermittelt wurde, die Frau hingegen konnte es nicht. Im Gegensatz zu mir war sie davon überzeugt, zu ihren Kindern zu können, obwohl man ihr in dem Film gleichzeitig verdeutlicht hatte, dass dies nie wieder möglich sein würde. Die Situation als Ganzes muss sie überfordert haben, muss zu viel für sie gewesen sein. Die Ungewissheit darüber, wie sie hierhergekommen ist, nicht zu wissen, wie es ihren Kindern geht, und gesagt zu bekommen, sie sei nicht mehr am Leben. Das löste eine Panik in ihr aus.
Kanzler Stahl warnte uns davor, Widerstand gegen die Beamten zu leisten, die von der Instanz, der Regierung von Animus, eingesetzt werden. Er fügte hinzu, wer sich dieses Verbrechens schuldig mache, werde sofort von den Wächtern mitgenommen, um vor das Seelengericht gestellt zu werden. Aufgrund des Namens vermute ich, dass bei diesem Gericht über die Zeit nach dem Aufenthalt in Animus entschieden wird, über unser endgültiges Schicksal nach dieser Zwischenwelt. Doch das ist von meiner Seite reine Spekulation.
Nach einem nicht enden wollenden Marsch durch lange Korridore, deren bodentiefe Fenster aus Milchglas bestehen, geraten wir in einen weiteren Raum, in dem wir unsere Stoffbeutel an eine Garderobe hängen. Danach werden wir nach Geschlechtern getrennt, die Frauen und Mädchen gehen in eine Kammer zur Linken, uns Männer und Jungen schickt man in eine Kammer zur Rechten.
Ich finde mich in einem fensterlosen Duschraum wieder, grelle Halogenlampen leuchten auf uns herab. Die hellblauen Kacheln sind bis unter die Decke gefliest, aus den Wänden ragen zwölf einfache Duschköpfe, unter allen ist in den Boden ein Abfluss eingelassen.
»Ausziehen«, zwingt uns einer der Wächter und fuchtelt dabei mit seiner Waffe herum. Ich stelle mir vor, auf der Stelle von ihm erschossen zu werden, sollte ich dieser Aufforderung nicht sofort nachkommen. Aber ist das überhaupt möglich, da ich doch eigentlich schon tot sein soll? Könnte ich überhaupt erschossen werden? Ist es möglich, in Animus zu sterben?
Unsere Kittel werfen wir in einen fahrbaren Wäschekorb, der von einem Mann in grüner Kleidung aus dem Raum geschoben wird, als auch der letzte von uns nackt dasteht. Wir alle halten unsere Hände vor den Schritt, doch ich denke nicht aus Scham. Die verängstigten Augen der anderen sagen mir, dass es sich dabei eher um eine Schutzhaltung handelt, da wir nicht wissen, was uns nun bevorsteht.
»Ihr habt eine Minute.«
Die Tür wird von außen deutlich hörbar verriegelt. Im selben Moment plätschert das erste Wasser in den Raum. Es ist heiß und bildet sofort eine dünne Nebelschicht über dem Boden. Allmählich türmt sich der Wasserdampf bis zur Decke auf und wird dort von einer surrenden Belüftungsanlage nach draußen befördert.
Auf meiner Stirn bilden sich Schweißperlen und fließen an meinem Gesicht hinunter. Ich habe das unangenehme Gefühl, in einer Dampfsauna gekocht zu werden. Den anderen scheint es wie mir zu gehen, auch sie haben sehr mit der Hitze zu kämpfen. Da es keine Regler gibt, um die Temperatur zu verändern, stellt sich keiner unter das heiße Wasser. Niemand möchte sich verbrennen.
Bevor wir die Wächter auf diese Gefahr aufmerksam machen können, verkommt der Wasserstrom wieder zu einem Plätschern. Die Tür wird aufgerissen, und der Mann mit der grünen Kleidung tritt ein. Vor sich trägt er einen Stapel hellblauer Handtücher, die er unter uns verteilt. Mit ihnen trocknen wir uns ab.
In einem Nebenraum, eine Art Umkleidekabine für Gruppen, bekommen wir nun eine weitere Minute Zeit, um uns anzuziehen. Als ich meine Sachen nacheinander aus dem Stoffbeutel ziehe, strömt mir ein angenehmer Duft entgegen. Die Kleidung ist gereinigt worden. Ich beeile mich so schnell ich kann, doch am Ende der Zeit stehe ich barfuß auf den kalten Fliesen.
»Mitkommen.«
Überstürzt stopfe ich die Socken in meine Schuhe und nehme diese in die Hand. Beim Verlassen der Kabine schaue ich mich ein letztes Mal um, um mich zu vergewissern, nichts von dem vergessen zu haben, was mir geblieben ist. Ich scheine alles bei mir zu tragen und folge den anderen. Wohin wir wohl als Nächstes gebracht werden?
21.07. / 09:57 / MEZ
Nach einem weiteren Fußmarsch durch lange Flure betreten wir endlich unser Ziel, eine futuristisch gestaltete Halle aus Metall, Glas und Beton. Was einst eine Fabrik aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein könnte, mit einer Deckenkonstruktion aus gewaltigen Stahlträgern, an der zwei rostige Lastkräne befestigt sind, erfüllt heute eine andere Funktion. Diese wird mir auf einem riesigen Schild mit ebenfalls riesigen, kantigen Buchstaben mitgeteilt: Aufnahmeministerium.
Die Fabrikhalle steht bis auf zwei gläserne Kästen in ihrer Mitte leer. Vor ihnen treffen wir auf die Frauen und Mädchen, von denen wir bei den Duschräumen getrennt worden sind, und gemeinsam werden wir in einen der beiden gläsernen Würfel geführt. In dem anderen sitzen bereits Menschen, sie machen auf mich den Eindruck, als hätten sie auf uns gewartet. Neugierig blicken sie mit gestreckten Hälsen in unsere Richtung.
Der Glaskasten gleicht mit seinen ausgelegten Zeitschriften dem Wartebereich einer Arztpraxis, der einzige Unterschied ist nur, dass unser Wartezimmer streng bewacht wird. Zwei der vier Wächter positionieren sich draußen an der durchsichtigen Schiebetür, ihre Waffen halten sie noch immer in den Händen. Die beiden übrigen Wächter begeben sich zum weit entfernten Ausgang, den anderen Glaswürfel lassen sie unbeaufsichtigt.
Kaum haben wir alle Platz genommen, bewegt sich auch schon eine Frau in Stöckelschuhen auf uns zu. Sie ist groß gewachsen, hat eine schlanke Figur und gerade ein Lächeln auf dem Gesicht. Auch sie trägt das weiße Zeichen von Animus auf ihrer schwarzen Uniform. Mit Sicherheit ist sie eine Beamtin unter Kanzler Stahl.
»Anna Fox?«, fragt sie mehrmals in die Runde, bis sich schließlich eine Frau zögerlich meldet. »Seien Sie doch bitte so lieb, mir zu folgen.«
Die Frau, die Anna Fox heißt, hat keine andere Wahl, als das zu machen, was die Beamtin verlangt. Wir wissen alle, was uns bevorsteht, wenn wir ungehorsam sind. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, was uns in diesem Fall blüht. Allein deswegen lassen wir doch seit der Filmvorführung alles widerstandslos über uns ergehen. Fast scheint es so, als sei unser Wille gebrochen, und als seien wir Marionetten, deren Fäden in den Händen anderer liegen.
Mittlerweile wird Anna Fox einer älteren Dame mit Gehstock vorgestellt, die ihr leicht auf die Schulter fasst und dabei liebevoll schmunzelt. Nachdem sich die beiden von der Beamtin verabschiedet haben, gehen sie auf den Ausgang zu. Vorbei an den Wächtern verlassen sie das Gebäude durch eine sich automatisch öffnende Tür und tauchen in ein Meer aus Sonnenstrahlen ein.
Ich werde von einem Jungen angesprochen, dessen Alter ich auf etwa vierzehn schätze, zweifelsohne ist er jünger als ich. »Worüber haben die da gerade geredet?«
»Keine Ahnung«, sage ich achselzuckend, »aber wie es aussah, scheint Anna Fox aus freien Stücken mitgegangen zu sein. Oder wie siehst du das?«
»Ja, es sah so aus«, antwortet der Junge. »Aber wenn du mich fragst, ich habe das Gefühl, dass wir als Arbeitskräfte verkauft werden.«
Ich schaue ihn verwundert an, da ich diesen Gedanken überhaupt nicht nachvollziehen kann. »Wie kommst du denn darauf?«
»Hast du nicht gesehen, wie klapprig die Alte war?«, fragt er, während der nächste nach draußen gebeten wird, ein Mann namens Dimitri Mokalev. »Die braucht bestimmt irgendwen, der ihr den Haushalt schmeißt und sie pflegt, wenn sie nur noch im Bett liegt und an die Decke starrt. Ich sage dir gleich, wenn ich irgendwem den Arsch abwischen muss, mache ich einen riesigen Aufstand und gehe freiwillig vor dieses Seelengericht.«
»Warte erst mal ab. Du kannst so viele Vermutungen anstellen, wie du willst, trotzdem wirst du erst erfahren, was mit uns passiert, wenn du an der Reihe bist.« Im Gegensatz zu dem Jungen habe ich mir bisher keine Gedanken darüber gemacht, was uns bevorsteht, da ich nicht irgendwann den Verstand verlieren möchte.
Dimitri Mokalev verabschiedet sich von der Beamtin und begleitet dann einen Mann mittleren Alters. Ich habe die Hoffnung, dass er sich ein letztes Mal umdreht, um uns ein Zeichen zu geben, das uns verrät, ob wir beruhigt darauf warten können, selbst aufgerufen zu werden. Aber er wendet uns nur den Rücken zu, bis er nach draußen verschwindet.
»Ich habe eine Idee«, sage ich zu dem Jungen. »Wer von uns beiden zuerst aufgerufen wird, teilt dem anderen, bevor er geht, durch einen Daumen nach oben oder nach unten mit, ob alles in Ordnung ist. Abgemacht?«
»Okay, abgemacht.«
Als ich in die Runde schaue, sehen die anderen sehr betrübt aus. Viele kratzen sich an den Armen, und erst jetzt fällt mir auf, dass es bei allen der linke Arm ist. Wie bei mir ist er auch bei ihnen in den verschiedensten Farben angelaufen. Meiner Ansicht nach kann das kein Zufall sein. Was hat es damit bloß auf sich?
»Noah Adler?«
»Hier«, sage ich nur.
»Folgen Sie mir bitte.«
Ich wende mich an den Jungen, schaue ihm voller Zuversicht in die Augen, reiche ihm zum Abschied die Hand und sage: »Es war nett, dich kennenzulernen ... Wie heißt du eigentlich?«
»Ich bin Orma.«
»Und weiter?«
»Sanneh.«
»Orma Sanneh. Hat dein Name eine Bedeutung?«
»Zu meinem Nachnamen kann ich nichts sagen. Ich weiß nur, dass Orma aus dem Kenianischen stammt und so viel wie freier Mann bedeutet.«
»Freier Mann«, wiederhole ich. »Wenn das kein Zeichen ist. Hoffentlich gehen wir hier beide als freie Männer raus.«
»Herr Adler«, sagt die Beamtin ungeduldig. Neben ihr regen sich bereits die Wächter und geben mit ihren Waffen an, was ich als eine Drohung auffasse.
»Das hoffe ich auch«, sagt Orma abschließend.
Die Beamtin geht mit mir auf einen Mann Mitte fünfzig zu. Er trägt unauffällige Kleidung, ein dunkelgrünes Polohemd, eine schwarze Jeans und dazu schwarze Lederschuhe. Seinen Kopf bedeckt volles dunkles Haar. Im ersten Moment habe ich ein ungutes Gefühl, doch die düstere Gestalt, die er zu sein scheint, ist er nicht. Er grinst mich beruhigend an, womit sich meine Anspannung legt, und er streckt mir schon seine rechte Hand entgegen, als ich noch nicht einmal bei ihm bin. Er kann es nicht erwarten, mich kennenzulernen.
»Mein Name ist Rudi Fromm«, sagt er locker, und als würden wir uns schon ewig kennen, fügt er hinzu: »Sag einfach Rudi zu mir.«
»Ich bin Noah Adler.« Kaum habe ich mich vorgestellt, merke ich auch schon, dass meine Wangen wärmer werden. Blut schießt in sie hinein, und sie laufen knallrot an. »Sie können mich Noah nennen ... Ich meine, du kannst mich Noah nennen.«
»Du brauchst nicht aufgeregt zu sein. Es will dir keiner etwas Böses«, sagt Rudi und zeigt ein weiteres Grinsen, das tiefe Falten um seine Augen erscheinen lässt.
Die Beamtin schaltet sich in das Gespräch ein: »Herr Fromm wird dich während deiner ersten Tage in Animus als dein Mentor begleiten. Er wird dir alles Mögliche erklären, dir bei der Suche nach einer Wohnung und einer Arbeitsstelle helfen … In nächster Zeit erwarten dich viele neue Eindrücke.«
Mir fällt ein Stein vom Herzen, denn ich bin weder der Insasse einer Anstalt noch werde ich als Arbeitskraft verkauft. Dabei fällt mir ein, dass ich Orma ein Zeichen geben muss, unter keinen Umständen darf ich das vergessen. Als wolle ich mich kratzen, wandert meine rechte Hand auf meinen Rücken, mit dem ich zum Glaskasten stehe. Mein Daumen zeigt nach oben, die Finger liegen auf der Handfläche. Um Orma auf mich aufmerksam zu machen, bewege ich die Hand auf und ab. Hoffentlich versteht er meine Geste als unser vereinbartes Zeichen.
»Du musst das nicht hinter dem Rücken machen«, sagt Rudi und streckt nun auch einen seiner Daumen in die Höhe, sodass man es im Glaskasten deutlich sieht. Dabei erstrahlt wieder sein Gesicht, während ich ihn überrascht anschaue, weshalb er mich fragt: »Es wundert dich, woher ich das weiß?«
Völlig verblüfft nicke ich nur.
»Ich saß auch mal in solch einem Glasverschlag und hatte die gleiche Idee wie du«, sagt Rudi und deutet mit einem Nicken zu Orma. Als ich mich zu ihm drehe, winkt er uns strahlend mit der einen Hand zu, die andere Hand zeigt mir, dass auch bei ihm alles in Ordnung ist.
»Die anderen Mentoren warten darauf, dass es weitergeht. Ich muss mich an dieser Stelle leider von Ihnen verabschieden, Herr Fromm«, sagt die Beamtin und überreicht Rudi währenddessen einen Briefumschlag, den er gefaltet in einer Hosentasche verwahrt.
»Ach, machen Sie sich um die keine Sorgen. Die wissen sich schon zu beschäftigen. Es liegen genügend Zeitschriften in unserem Verschlag aus.« Rudi lacht kurz auf, doch sein Lachen wird nicht erwidert. »Wir wollen Sie nicht weiter aufhalten. Auf Wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen.«
Rudi und ich gehen auf den Ausgang zu. Ich bin nur noch gespannt darauf, was sich hinter der Schiebetür verbirgt, die sich in diesem Moment von allein öffnet.
21.07. / 10:17 / MEZ
Als wir das Aufnahmeministerium verlassen, wird mir sofort vor Augen geführt, in welcher Stadt ich bin. In der Ferne erblicke ich das wohl hervorstechendste Bauwerk, den in den Himmel reichenden Fernsehturm. Er ragt weit über die ihn umgebenden Gebäude hinaus. Sogar die Kirchtürme stellt er mit seiner Höhe in den Schatten. Nicht nur aus diesem Grund ist er eines der Wahrzeichen meiner vertrauten Heimatstadt Berlin.
»In welchem Bezirk sind wir?«, frage ich.
»Wir sind in Kreuzberg ... In der Lindenstraße.«
»Kreuzberg?«, wundere ich mich. »Wie bin ich denn hier gelandet? Ich wohne doch in Marienfelde.«
»Das heißt, du weißt nicht, was dir zugestoßen ist? Du weißt nicht, warum du in Animus bist?«, möchte Rudi wissen, und ich schüttele meinen Kopf. »Wie sieht deine letzte Erinnerung aus?«
Ich denke angestrengt nach. Vor meinem inneren Auge tauchen Bilder auf, die meine besten Freunde zeigen - Cara, Sophie, Amy, David und Jon. Wir stehen auf dem Pariser Platz, direkt vor dem Brandenburger Tor. Über uns scheint der Mond in Form einer Sichel am pechschwarzen Nachthimmel. Nur vereinzelt dringt das funkelnde Licht von Sternen bis zu uns.
Die fünf Gesichter vor mir strahlen mich an. Jon schaut ständig auf die Uhr und startet schließlich einen Countdown. Die anderen stimmen mit ein, ihre Lippen bewegen sich nun synchron. Anstatt am Ende des Zählens die Null zu nennen, schmeißen sie ihre Hände in die Luft und kommen nacheinander auf mich zu, um mich in ihre Arme zu schließen.
»Meine Freunde und ich haben am Brandenburger Tor in meinen siebzehnten Geburtstag reingefeiert«, sage ich abwesend. »Gegen zwei Uhr morgens habe ich mich von ihnen verabschiedet, das war am Alexanderplatz. Dort bin ich in die U-Bahn gestiegen, um nach Hause zu fahren. Nach Marienfelde.«
Der Film vor meinen Augen bricht an dieser Stelle von der einen auf die andere Sekunde ab, als habe irgendwer den Stecker meines Erinnerungsvermögens gezogen, ohne dass ich etwas dagegen unternehmen kann. Außerdem brummt mir der Schädel.
»Was ist dann passiert?«, fragt Rudi gespannt, doch darauf kann ich ihm leider keine Antwort geben, so sehr ich mir auch den Kopf darüber zerbreche. Da ich in Berlin-Mitte in die U-Bahn gestiegen bin und Kreuzberg zwischen Marienfelde und Berlin-Mitte liegt, muss ich aus irgendeinem Grund hier gestrandet sein. »Wie gesagt, ich bin in die U-Bahn gestiegen. An mehr kann ich mich leider nicht erinnern.«
»Das ist nicht ungewöhnlich. Wenn du es nicht mehr erwartest, fällt es dir wieder ein«, versichert Rudi. Neben dieser Zuversicht strahlt er auch noch Ruhe aus, weshalb er sich sehr gut als Mentor eignet. Einen besseren hätte ich mir nicht vorstellen können. Er fährt fort: »Ich wundere mich ein wenig über dein Verhalten, was sich aber vielleicht dadurch erklären lässt, dass du dich an nichts erinnerst.«
»Mein Verhalten? Wie meinst du das?«
»Na ja, da du im Gegensatz zu allen anderen Neuankömmlingen, die ich bisher begleitet habe, einen sehr gelassenen Eindruck machst, vor allem in deinem Alter, obwohl du gerade erfahren hast, nicht mehr am Leben zu sein. Viele reagieren darauf, indem sie bitterlich anfangen zu weinen oder sogar wild um sich schlagen, weil sie es einfach nicht fassen können, dass sie ihren oftmals unnötigen Tod nicht verhindern konnten. Doch du stehst hier neben mir, als wäre nichts gewesen und als befändest du dich nicht in Animus, sondern noch in Korpus. Wie erklärst du dir das?«
»Na ja, ich habe mir bereits Gedanken darüber gemacht«, fange ich an und überlege für einen Augenblick, wie ich fortfahren soll. »Natürlich kannst du recht haben, dass ich nur so ruhig bin, weil ich nicht weiß, was passiert ist. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Als uns gesagt wurde, dass wir in einer Zwischenwelt sind, habe ich an einen schlechten Scherz gedacht. Denn wer glaubt schon, nicht mehr am Leben zu sein, wenn er noch seinen Körper und seinen Geist fühlt. Dass Leben und Tod gleichzeitig zutreffen sollen, ist vollkommen merkwürdig und vor allem widersprüchlich. Denn man geht doch davon aus, dass der Körper mit dem Tod vergeht und der Geist erlischt.«
»Ja, aber das spiegelt doch nur eine von vielen Vorstellungen über den Tod wider. Was ist denn, wenn der Körper in Korpus zurückbleibt und der Geist hier in Animus weiterlebt? Wie denkst du darüber?«
»Wenn es so sein sollte, frage ich mich aber, warum ich meinen Körper sehe, und warum ich ihn spüre«, entgegne ich und bin auf Rudis Reaktion gespannt.
»Vielleicht gibst du mir recht, wenn ich sage, dass der Geist um einiges stärker ist als der Körper. Er verfügt nämlich über eine unglaubliche Macht, die Macht der Vorstellung, mit der er uns einen Streich spielen kann. Was ist also, wenn dein Körper und alles, was du hier in Animus siehst, gar nicht real ist, sondern von deinem Geist erschaffen wird?«
»Du meinst, dass Animus nur deshalb bestehen könnte, weil wir es mit unserer Fantasie erschaffen?«
»Ganz genau … Animus könnte im Grunde genommen alles, aber auch gar nichts sein. Es könnte wahrhaftig bestehen, aber es könnte auch ein Hirngespinst sein. Wie du gesagt hast, ein Produkt unserer Fantasie.«
»Das würde doch aber bedeuten, dass wir alle im Geiste miteinander verbunden sein müssten«, spinne ich den Gedanken weiter. »Sonst wären wir nicht alle zusammen hier, sondern jeder würde sich nach seinen Vorstellungen seine ganz eigene Welt zusammenreimen, in der er allein für sich lebt.«
»Was wiederum dafür spricht, dass Animus tatsächlich existiert und nicht nur ein Gedankengebilde ist. Aber was davon nun zutrifft, oder ob überhaupt eines von beidem zutrifft, kann niemand sagen.« Rudi schaut mich strahlend an. »Du erstaunst mich wirklich. Bisher habe ich, außer mit meiner Frau, mit niemandem eindringlich darüber sprechen können, was Animus sein könnte. Du wirst sie nachher kennenlernen. Ihr werdet euch gut verstehen. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel.«
»Ich bin gespannt«, sage ich mit einem Lächeln und komme auf unser Thema zurück. »Eine Frage habe ich noch und ich bin auf deine Antwort gespannt. Wenn es so sein sollte, dass wir uns diese Welt gemeinsam allein durch die Kraft unserer Gedanken erschaffen haben, warum machen wir dann nicht etwas völlig anderes aus ihr? Warum erfüllen wir uns nicht alles, wovon wir immer geträumt haben? Warum verwirklichen wir uns nicht den Wunsch, fliegen zu können?«
Rudi bittet mich, kurz darüber nachdenken zu dürfen, um die richtigen Worte zu finden, und antwortet dann: »Vielleicht liegt es daran, dass wir uns im Tod so sehr nach dem Leben sehnen, dass unser größter Traum darin besteht, dorthin zurückzukehren. In unserer Vorstellung ist der Tod also nichts weiter als das Leben.«
In dieser Antwort steckt so viel Sinn, dass ich dem nichts hinzufügen kann. Wer hat schließlich nicht Angst vor dem Tod, oder macht sich zumindest Gedanken darüber, und hängt deshalb an seinem Leben?
»Kann es sein, dass es dir schwerfällt zu glauben, in Animus zu sein?«, möchte Rudi nun wissen.
»Ja, ich werde nun mal das Gefühl nicht los, nichts weiter als der Proband eines Experiments zu sein«, muss ich gestehen. »Eine Laborratte, wenn du so willst.«
»Und was für ein Experiment soll das sein?«
»Wahrscheinlich will man herauszufinden, wie Menschen reagieren, wenn sie mit ihrem Tod konfrontiert werden. Und ob sie nach der Erfahrung, dass der Tod die Fortführung des Lebens sein könnte, mit weniger Angst auf das Älterwerden blicken.«
»Meinst du nicht, dass sich diese Erfahrung traumatisierend auf die Teilnehmer auswirken würde? War in deiner Gruppe niemand, der bei der Nachricht, tot zu sein, verzweifelt ist?«
»Doch, eine Frau ist völlig durchgedreht, weil sie unbedingt zu ihren Kindern wollte. Das war furchtbar.«
»Siehst du«, sagt Rudi. »Keine Erkenntnis aus einem Experiment ist die Erfahrung wert, die diese Frau durchmachen musste, nämlich gesagt zu bekommen, nicht mehr zu ihren Kindern zu können.«
Rudi hat recht. Aber auch wenn letzte Zweifel in mir bleiben, sagt mir meine innere Stimme, mich mit dem Gedanken anfreunden zu müssen, dass ich mich wirklich in Animus befinde. Doch mir fehlt ein letzter eindeutiger Beweis, um es endgültig zu glauben. Ein letzter Funke Gewissheit, der mich letztlich überzeugt.
Anstatt weiter darüber nachzugrübeln, was das für mich bedeutet, kann ich nicht aufhören, darüber nachzudenken, was aus der Frau wird, über die wir gerade gesprochen haben. Während ich mich angeblich auf einer Stufe zwischen Leben und Tod aufhalte, wird sie wegen des Seelengerichts dazu gezwungen, den nächsten Schritt zu gehen. Wie die nächste Stufe nach diesem Schritt aussieht, lässt mir keine Ruhe. »Was geschieht nun mit der Frau? Wird sie wirklich vor das Seelengericht gestellt, von dem Kanzler Stahl gesprochen hat?«
»Wurde sie denn von den Wächtern abgeführt?«
»Von denen wurde sie nicht bloß abgeführt«, erinnere ich mich nur ungern. »Sie hat sich so sehr gewehrt, dass sie aus dem Raum geschleift werden musste. Und selbst dabei hat sie noch um sich geschlagen.«
»Widerstand gegen die Staatsgewalt zu leisten, steht unter Strafe. Daher wird sie auf alle Fälle vor das Gericht gestellt«, bestätigt Rudi.
»Und was heißt das für sie? Was passiert mit ihr?«
»Das weiß ich nicht. Nur die Mitglieder der Instanz wissen das«, sagt Rudi. »Was beim Seelengericht passiert, wie es abläuft, welche Urteile gefällt werden, ist bisher nicht nach außen gedrungen. Ich kann nur so viel sagen, dass alle, die vor das Seelengericht gestellt wurden, nie wieder aufgetaucht sind. Bei der Frau wird es so sein, als habe es sie nie in Animus gegeben.«
»Was bedeutet, dass dort entschieden wird, was nach dieser Zwischenwelt mit einem passiert«, werfe ich ein.
»Ganz genau. Das gilt aber nicht nur für die von uns, die sich etwas zu Schulden kommen lassen haben, sondern für uns alle. Jeder wird irgendwann vor dieses Gericht gestellt, es ist nur eine Frage der Zeit.«
»Und wie lange dauert es, bis man an der Reihe ist?«, frage ich und erinnere mich daran, dass Rudi sich bereits fünf Jahre in Animus aufhält, wie er mir sagte. »Gibt es da eine bestimmte Regel?«
»Nein. In meinem Bekanntenkreis waren einige nach wenigen Monaten an der Reihe, andere wurden erst nach vielen Jahren von den Wächtern abgeholt.«
»Man wird abgeholt?«, frage ich erschrocken. »Und was ist, wenn ich mich vor den Wächtern verstecke?«
Rudi schaut mich mit ernster Miene an und macht eine unerträgliche Pause, bis er endlich weiterspricht: »Noah, du kannst dich nicht verstecken …«
»Aber warum denn nicht?«, frage ich.
»Wegen des Chips in deinem Arm.«
In Korpus lebte Rudi in Brasilien.
Seit seinem zwölften Lebensjahr arbeitete er auf einer Kaffeeplantage zwischen São Paulo und Rio de Janeiro. Seine Aufgabe bestand darin, Pflanzenschutzmittel an den steilen Hängen von Feldern zu verstäuben, die für Maschinen unerreichbar waren. Dafür wurde ihm in die eine Hand ein Eimer und in die andere Hand eine Schaufel gedrückt, sein einziges Arbeitsgerät. Mit der Schaufel holte er das Mittel aus dem Eimer und verteilte es mit ihr direkt an den Wurzeln der Kaffeepflanzen.
Rudi fühlte sich wie der glücklichste Mensch auf der Welt und wollte mit niemandem tauschen. Wenn er morgens aus dem Haus ging, strahlte er bereits über das ganze Gesicht. Er war dankbar für sein ruhiges, genügsames, und dennoch überaus erfülltes, zufriedenes Leben. Die meiste Freude bereitete ihm seine Anstellung bei der Plantage. Auch wenn die Arbeit hart war, ging er ihr gerne nach. Es gefiel ihm, dabei zusammen mit seinen Freunden unter freiem Himmel an der frischen Luft zu sein. Was konnte es Schöneres geben als das?
Doch Freud und Leid lagen in seinem Leben dicht beieinander, und seine Arbeit sollte letztendlich über sein Schicksal entscheiden. Denn dass es sich bei den Pflanzenschutzmitteln, mit denen er herumhantierte, um krankmachende Pestizide handelte, wusste Rudi nicht. Deshalb dachte er auch nicht im Geringsten darüber nach, sich beim Umgang mit ihnen vorzusehen. Die pulverartigen Mittel verteilten sich überall, so auch völlig ungehindert in Rudis Atemwege, mit jedem einzelnen Atemzug.
Fast dreißig Jahre lang.
Tagein und tagaus.
Rudi kämpfte bereits lange mit gesundheitlichen Problemen - Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schlaflosigkeit -, als er eines Morgens vor den Augen seiner Kollegen auf dem Feld erschöpft zusammenbrach, gerade als sie nach einem anstrengenden Marsch die Hänge erreicht hatten. Er fühlte ein unerträgliches Stechen, als steckten tausend Nadeln in seiner Brust. Darüber hinaus litt er unter heftigen Atembeschwerden, die ihn röcheln ließen und ihm das Gefühl gaben, ersticken zu müssen. Todesangst stand ihm ins Gesicht geschrieben. Seine Kollegen brachten ihn an einen schattigen Platz, wedelten ihm Luft zu, doch sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Rudi fiel wiederholt in Ohnmacht, wozu nicht zuletzt die schwülwarme Luft an diesem Tag ihren Beitrag leistete. Während die anderen weiterarbeiteten, kümmerte sich sein guter Freund Leandro um ihn und versorgte ihn mit Wasser. Obwohl er keinen Appetit hatte, nahm er etwas Brot zu sich. Doch davon erbrach er sich nur.
Abends, als es sich abgekühlt hatte und es Rudi ein wenig besser ging, trugen sie ihn unter unvorstellbarer Kraftanstrengung den Hügel hinab ins Dorf. Erst spät erreichten sie Rudis bescheidene Hütte, in der er mit seiner Frau Hilda lebte. Sie stürmte sofort hinaus, als sie sie kommen sah, und fragte Leandro danach, was geschehen war. Sie hatte sich bereits große Sorgen um Rudi gemacht und ungeduldig auf ihn gewartet. Als sie hörte, dass er einfach in sich zusammengesackt und daraufhin mehrmals in Ohnmacht gefallen war, weinte sie bitterlich.
Sie legten Rudi mit starkem Fieber in sein Bett. Er schlief sofort ein, wachte erst am Abend des nächsten Tages wieder auf. Als er versuchte aufzustehen, gelang es ihm nicht, seine Beine waren schwer wie Blei. Hinzu kamen die üblichen Symptome wie Übelkeit und Erbrechen, die nun verstärkt auftraten. Hilda konsultierte einen Arzt, der ihr dazu riet, Rudi in ein Krankenhaus zu bringen. Doch wegen des geringen Lohns, den beide verdienten, konnten sie sich die dortige teure Behandlung nicht leisten. Lediglich die Medikamente, die Rudi vom Arzt verschrieben bekam, ließen sich von ihrem letzten ersparten Geld bezahlen. Eine Krankenversicherung hatten sie nicht.
Rudi kam nicht mehr auf die Beine. In den nächsten Wochen verschlechterte sich sein Zustand zusehends. Ganze Tage verschlief er, seine Atmung wurde immer flacher und setzte teilweise für Augenblicke aus, in denen Hilda in Panik verfiel. Sie wich nicht von seiner Seite, und wenn sie arbeiten musste, bat sie Bekannte, Freunde oder Familienmitglieder, nach Rudi zu sehen.
An einem Sonntagmorgen wachte Rudi nicht mehr auf. In der Nacht davor war er friedlich neben Hilda eingeschlafen. Er wurde am Fuße der Hügel begraben, auf denen er gearbeitet hatte. Seine genaue Todesursache wurde nie festgestellt.
21.07. / 10:32 / MEZ
Ich umschließe meinen linken Unterarm mit der rechten Hand und schaue auf mein linkes Handgelenk, doch ich kann keine große Narbe erkennen. Erst bei genauerem Hinsehen fällt mir ein kleines Brandmal auf, als sei eine Wunde verödet worden.
Mir wurde ein Chip in den Arm transplantiert, der hauptsächlich dazu dient, dass die Instanz mich überwachen kann. Alle sechs Stunden wird mein Aufenthaltsort durch Scans erfasst, die von Satelliten durchgeführt werden. Aus diesem Grund ist es niemandem möglich, sich vor den Wächtern zu verstecken, wenn man zum Seelengericht abholt werden soll. Sie finden einen überall, an den entlegensten Orten.
Darüber hinaus dient der Chip als Personalausweis. Auf ihm sind Name, Größe, Augenfarbe, Haarfarbe, Geburtstag, Geburtsort, Todestag und Todesort gespeichert. Rudi muss nun diese Daten überprüfen. Dabei kann der zuletzt genannte Punkt darüber Auskunft geben, wo ich gestorben bin. Vielleicht hilft dies meinem Gedächtnis auf die Sprünge, sich daran zu erinnern, was mir zugestoßen ist.
Auf dem Weg zum nächsten Chipport, der sich an der südlichen Spitze der Museumsinsel befindet, taucht vor mir plötzlich eine unförmige Erscheinung aus dem Nichts auf. Ich kann nur nebelartige Schleier ausmachen, die sich allerdings zu etwas verdichten. Die verschwommenen Konturen werden schärfer, die Erscheinung nimmt Gestalt an. Da dieses Wesen direkt auf uns zukommt und nicht den Anschein erweckt, uns aus dem Weg gehen zu wollen, mache ich ihm Platz. Doch Rudi bleibt stehen und stellt sich ihm in den Weg.
»Geh zur Seite«, sage ich. »Das Ding rennt dich um.«
Rudi reagiert nicht darauf. Während sich mir der Magen zusammenzieht und meine Beine weich werden, wartet er auf den Zusammenstoß mit dem Nebelschleier. Erschrocken wende ich mich noch einmal an ihn und wundere mich, dass er im Gegensatz zu mir gelassen kommentiert: »Bleib ganz ruhig.«
Nun ist zu erkennen, dass es sich bei der Erscheinung um ein menschliches Wesen handelt, worauf ich nur aufgrund seiner Umrisse und Bewegungen schließen kann. Auch wenn Augen, Nase und Mund nicht zu erkennen sind, lassen sich Arme, Beine und Kopf erahnen. Doch keinen Moment lang legt es die Beschaffenheit einer grau schimmernden, sich unaufhörlich windenden Nebelschwade ab.
Mir fehlen die Worte für das, was sich vor meinen Augen abspielt. Entschieden läuft das Nebelwesen durch Rudi hindurch, wonach es einen langen grauen Dunstschleier hinter sich her zieht. Je weiter es sich von uns entfernt, desto mehr verlieren seine festen Konturen an Form. Es verfällt zu der formlosen, nebelartigen Erscheinung, die es gerade schon einmal war. Diese löst sich schließlich in Luft auf.
»Was war das?«, frage ich fassungslos.
»Du bist gerade deinem ersten Schatten begegnet.«
»Meinem ersten Schatten?«, wundere ich mich.
»Wenn ich Schatten sage, geht es nicht um Schatten, wie du sie kennst. Es geht um etwas vollkommen anderes, das es nur hier gibt«, erklärt Rudi. »Animus und Korpus sind nicht voneinander losgelöst. Zwischen ihnen besteht eine Verbindung, die so aussieht, dass wir die Lebenden aus Korpus sehen können. Und zwar in Gestalt des Nebeldunstes, der dich eben erschreckt hat. Und wie schaut dieser deiner Meinung nach aus?«
»Wie ein Schatten«, sage ich, als zwei weitere von ihnen erscheinen, beinahe schwebend an uns vorbeiziehen, um dann wieder zu verschwinden.
Da ist der Beweis dafür, dass ich mich in einer anderen Welt befinde, nach dieser Begegnung besteht für mich absolut kein Zweifel mehr. Diese Einsicht ist weniger schmerzlich, als ich gedacht habe, denn einerseits kam mir die Vorstellung einer Zwischenwelt widersinnig vor, andererseits zweifelte ich aber immer mehr daran, noch in der Welt der Lebenden zu sein. Ich war also bereits auf dem Weg, mich mit dem Gedanken abzufinden, mich wahrhaftig in Animus aufzuhalten. Doch erst jetzt ist mir dieser Gedanke endgültig gewiss.
Das hier ist nun meine Realität, auch wenn sie vorerst unbegreiflich bleiben wird. Deshalb brennt mir eine weitere Frage unter den Nägeln, die aber nur meinem Verständnis dienen soll: »Warum sehen wir die Schatten nur, wenn sie unmittelbar in unserer Nähe sind?«
»Das kann ich dir nicht genau sagen.«
»Aber hast du dazu vielleicht eine Vermutung?«
»Ja, die habe ich, auch wenn sie sehr weit hergeholt klingen mag«, sagt Rudi und räuspert sich mit vorgehaltener Faust. »Wenn du dir vorstellst, in einer dichten Nebelfront zu stehen, kannst du doch nur das sehen, was sich in deiner näheren Umgebung befindet. Weißt du, was ich meine?«
»Ja, das habe ich selbst schon erlebt.«
»Gut.« Rudi wirkt erleichtert. Wahrscheinlich hat er schon anderen versucht, seine Vorstellung über die Schatten zu beschreiben, doch dabei nur wenig Erfolg gehabt. »Dann kannst du dich vielleicht meiner Vermutung anschließen, dass für uns in Animus nur dann jemand aus Korpus sichtbar wird, wenn er in den Bereich tritt, der uns unmittelbar umgibt. Kannst du nachvollziehen, wie ich das meine?«
»Ja, absolut. Ich finde sogar, das klingt nicht weit hergeholt, sondern ist sehr einleuchtend. Das würde auch erklären, warum wir sie nicht als wirkliche Menschen, sondern als diese nebelartigen Wesen sehen.«
»Genau, denn sie sind eigentlich Teil des Nebels, den Korpus um uns herum bildet. Aber natürlich bleiben die Schatten dabei in ihrer Welt.«
Mein linker Unterarm fängt ein weiteres Mal an zu jucken, als seien die Erkenntnisse, die ich soeben gewonnen habe, der Auslöser für diesen erneuten Schub. Ich kann dem Drang widerstehen, daran zu kratzen und übe mich weiterhin in Geduld, dass der Spuk bald ein Ende hat. Hoffentlich schon morgen, wie mir von dem Personal der Krankenstation gesagt wurde.
Mittlerweile haben wir Kreuzberg hinter uns gelassen und sind nun im Bezirk Berlin-Mitte. Wir überqueren den Spreekanal auf der Gertraudenbrücke. Als ich die Statue einer Frau auf dem linken Brückengeländer sehe, fällt mir auf, dass ich hier schon einmal mit der Schule gewesen bin, als wir in Geschichte an einer Stadtführung teilgenommen haben. Wer die Frau war, zu deren Ehren die Statue aufgestellt wurde, bekomme ich nicht mehr zusammen. Ich weiß aber noch, dass ich meinen Eltern von ihr erzählt habe.
Meine Eltern.
Blitzartig fällt mir ein, dass die beiden für mich nicht außer Reichweite sind. Ich kann mich hier in Animus nach ihnen auf die Suche begeben, genauso wie nach meinem kleinen Bruder. Am liebsten würde ich auf der Stelle kehrtmachen, um nach Marienfelde zu meinem Elternhaus zu gehen, wo sich die drei bestimmt aufhalten. Doch Rudi zügelt mich: »Wir sind gleich bei dem Chipport. Wenn wir dort fertig sind, können wir gern versuchen, sie zu finden.«
Das hört sich für mich danach an, als bestehe nur eine geringe Chance auf Erfolg. Doch ich bin fest davon überzeugt, dass ich sie alle zu Hause antreffen werde. Wo sollten sie sonst sein?
Von außen sieht der Chipport auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Ticketschalter aus. Er besteht aus einer Einzahlungsmöglichkeit, einer Tastatur und einem Bildschirm, auf dem das Animus-Zeichen leuchtet. Daneben befindet sich eine Vorrichtung, an die man sein linkes Handgelenk halten muss, damit der Chip gelesen werden kann. Als ich mich dieser Vorrichtung nähere, taucht ein blauer Lichtstrahl auf, der mir mit angenehmer Wärme über die Haut fährt, im selben Moment erscheint ein Steckbrief. Er zeigt ein Bild von mir, das von meinem Personalausweis, den ich in Korpus bei mir getragen habe, und gibt Auskunft über meine Person.
»Schau bitte nach, ob alle über dich gemachten Angaben richtig sind«, fordert Rudi mich auf. »Ansonsten müssen wir Veränderungen vornehmen. Das nächste Mal ist das erst in einem Jahr möglich, aber du wirst dann ohnehin daran erinnert, alle Informationen zu überprüfen, da es immer mal wieder Störungen im System gibt. Außerdem musst du dann ein neues Bild von dir anfertigen, was über jeden beliebigen Chipport möglich ist. Und zum Schluss muss ich dich noch darauf hinweisen, dass Falschangaben hart bestraft werden. Sei also immer ehrlich, wenn du etwas noch einmal eingeben musst.«
Laut des Steckbriefs ist mein Name Noah Adler. Ich bin einen Meter vierundachtzig groß, habe helle blaue Augen und kurze braune Haare. Am einundzwanzigsten Juli zweitausend wurde ich hier in Berlin geboren. Nur siebzehn Jahre später, und zwar am gleichen Tag, bin ich in derselben Stadt gestorben.
»Alle Angaben stimmen«, sage ich irgendwie erleichtert und bin trotzdem enttäuscht. »Dass ich in Berlin gestorben bin, habe ich mir schon gedacht. Ich wüsste nur gerne Genaueres über die Umstände.«
Mit seiner unendlichen Zuversicht redet Rudi mir gut zu: »Das kann dir dein Chip leider nicht sagen. Aber glaube mir, schon in den nächsten Tagen wird es dir wieder einfallen. Ich verspreche es dir sogar, denn bei allen, die ich kenne, war es bisher so.«
»Wie lange hat es bei dir gedauert?«
»Zwei Tage, wenn ich mich nicht irre.«
Die vielen Eindrücke, die gerade wie ein Sturzregen auf mich niederprasseln, reichen mir völlig aus. Die Erinnerung an meinen Tod wird früh genug zurückkehren, vermutlich wird sie nicht einfach zu verarbeiten sein. Die nötige Kraft dafür könnte ich gerade sowieso nicht aufbringen. Warum sollte ich mir die Erinnerung also im Moment herbeisehnen?
Ich gehe den Steckbrief weiter durch. »Bei meinem Wohnort und meinem Arbeitsplatz steht noch nichts. Was soll ich denn dort eintragen?«
»Diese Angaben kannst du wegen eines Umzugs oder einer neuen Arbeitsstelle immer verändern. Das mit dem Arbeitsplatz hat noch Zeit, da müssen wir noch etwas für dich suchen«, meint Rudi. »Bei dem Wohnort tragen wir vorerst meine Adresse ein, bis wir über das Immobilienministerium etwas für dich gefunden haben. Gehe mal bitte kurz zur Seite, damit ich das ändern kann. In dir steht ohnehin gerade ein Schatten.«
Mit einem Schreck springe ich hoch. Ich winde mich, als wolle ich eine Ratte abschütteln, die auf meiner Schulter sitzt. »Muss das denn sein?«
Rudi fängt lauthals an zu lachen. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft das vorkommt.