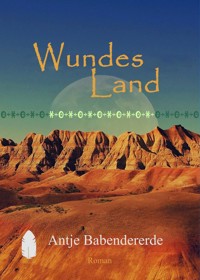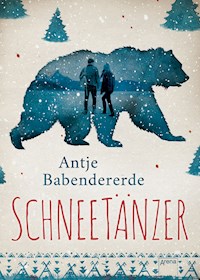Inhaltsverzeichnis
Lob
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Copyright
Listen to the long wind blow Moaning »Don’t you know?« The dark mystical night Like shadow from light
Covers the Two-Hearted one Hovers til calamity is done.
Vor langer Zeit
Düster und unheimlich war der Anfang allen Seins. Finsternis wallte wie schwarzer Nebel, es war kühl und feucht. Die Erste Welt erschien als eine Insel unter Wolken. Sie barg den Ursprung allen Lebens. In ihr hausten übernatürliche Wesen, genannt diyin, die Wissenden Leute. Paare von Wolken berührten einander und daraus entstanden Erster Mann und Erste Frau.
Auch Kojote gab es schon in dieser Schwarzen Welt, halb Mensch halb Tier. Zweiherz war sein Name, und man sagt, dass er schon länger lebt als alle übrigen Wesen.
Getrieben von Unzufriedenheit und Zanksucht, waren die unsterblichen Wanderer gezwungen, nach einer neuen Heimat zu suchen. Sie stiegen auf und verließen die Schwarze Welt. Mit ihnen Erster Mann, Erste Frau und Zweiherz, der Kojote. Sie alle waren auf der Suche nach Licht und nach einem Ort, an dem sie existieren konnten.
Doch in der Zweiten, der Blauen Welt, trafen sie auf gefährliche Säugetiere und Ungeheuer. Sie zankten untereinander pausenlos fort, verletzten Tabus und fielen in Ungnade. So mussten sie aufsteigen in die Dritte Welt.
In der Gelben, der Dritten Welt, wurden die vier heiligen Berge der Navajo geschaffen, wie sie heute noch existieren. Doch Kojote stahl Wassermonster, dem Herrn der unwirtlichen Fluten, ein Kind und beschwor mit seiner Boshaftigkeit eine Flut herauf. Die Wissenden Leute – und mit ihnen Erster Mann und Erste Frau – mussten fliehen. Sie erreichten die Vierte, die Weiße Welt. Aber auch in dieser Welt stiftete Zweiherz Unheil unter den unsterblichen Lebewesen und trieb sie damit weiter. Vier unvollkommene Welten hatten sie durchwandert und stiegen nun in die Fünfte, die schillernde, sich ewig wandelnde Welt der Gegenwart.
Dort angekommen mussten sie erkennen, dass auch diese Welt von Flut, Streit und Chaos beherrscht war. Erst als Kojote sich einsichtig zeigte und eine Zeit lang aufhörte, Unheil zu stiften, lichtete sich das Durcheinander. Die Gestirne, Tiere und Pflanzen wurden erschaffen. Die Zeit wurde unterteilt in Tag und Nacht; der Kreis eines Jahres in Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Erster Mann und Erste Frau fanden ein Baby und nahmen sich seiner an. In nur vier Tagen wurde aus dem kleinen Mädchen eine Frau, Changing Woman. Sich Wechselnde Frau schenkte zwei Söhnen das Leben, den Krieger-Zwillingen. Danach schuf sie aus Fetzen ihrer Haut die Menschen, um nicht länger einsam zu sein.
Die Menschen erhielten von den Wissenden Leuten jene Kenntnisse, die man zum Überleben braucht, und erfuhren, wie man nach hózhó, dem Zustand allumfassender Harmonie, strebt.
Erster Mann baute ein achteckiges Haus aus Steinen, Lehm und Balken – einen Hogan. Danach ruhte er sich auf der Erde aus, lag Kopf an Kopf mit Erster Frau und ihre Gedanken vermischten sich. Aus ihrer beider Ideen entstand die Ordnung der Welt, so wie sie heute noch existiert.
Der Unheilstifter aber, Kojote, leise und mit silbergrauem Fell, durfte zur Strafe für sein zerstörerisches Wesen an dieser Ordnung nicht teilhaben. Deshalb wurde er zornig und manchmal ist er es noch heute. Er heißt auch: Erster Zorn.
Mit dürren Beinen und hängendem Kopf streift er durch die weiten Schluchten der Canyons und über die Ebenen der Mesas. In den kühlen Nächten lässt er die Menschen sein schauriges Heulen hören. Wenn er ein gefügiges Opfer gefunden hat, dessen Zustand der Harmonie gestört ist, dann schleicht er zwischen den zusammengedrängten Lehmhütten umher, umkreist ein Ranchhaus oder drückt seinen mageren Körper unter einen abgestellten Wohnwagen.
Er ist auf der Jagd.
Und noch immer kann er seine Gestalt wechseln. Für jede hat er einen anderen Namen: Graubein Kojote. Erster Zorn. Zweiherz.
1. Kapitel
Bleib nicht so lange, Kaye!« Arthur Kingleys dunkle Stimme kam unter dem aufgebockten Ford Pickup hervor, einem zerschrammten Lieferwagen, der auch schon bessere Tage gesehen hatte.
»Ja, Dad«, rief das Mädchen in den ausgewaschenen Jeans. »Ich bringe Großvater Sam nur sein Essen.« Mit Schwung warf sie ihren schweren geflochtenen Zopf über die Schulter. Kaye stellte den Korb mit den beiden Emailletöpfen vorsichtig auf den Beifahrersitz und stieg hinter das Lenkrad ihres roten Geländewagens. Jazz – ein zotteliger Mischlingshund mit hellbraunem Fell – hockte schon auf der Rückbank des Jeep Wrangler und blickte sie aus seinen runden Hundeaugen erwartungsvoll an. Sein Fell war staubig und steckte voller trockener Halme und Samenkörner. Weiß der Teufel, dachte Kaye, wo er sich wieder herumgetrieben und nach Mäusen gejagt hatte.
»Das sagst du jedes Mal«, brummte Arthur, während er sich unter dem Ford hervorschob. Er wischte sich Schweiß und ölige schwarze Schmiere aus dem sonnengebräunten Gesicht, um seiner Tochter nachzusehen, die vor dem Abend nicht zurückkommen würde.
Kaye fuhr los und sofort legte sich eine dichte Staubwolke um ihren Jeep. Im Vorbeifahren winkte Kaye den beiden indianischen Rancharbeitern, die den Weidezaun ausbesserten. Ashie Benally und Hoskie Whitehead winkten zurück. Shádi, Kayes dunkelbraune Stute, rannte noch eine Weile auf der Koppel neben dem Jeep her, bis der Elektrozaun am Ende des Fahrweges sie daran hinderte, Kaye weiter zu folgen. Der Jeep ratterte über das Viehgitter und bog von der Schotterpiste auf die glatte Teerstraße.
Mit offenen Fenstern fuhr Kaye in Richtung Süden. Der Jeep hatte Klimaanlage, aber sie mochte es, den Fahrtwind zu spüren. Schon seit Tagen blies der Sommer seinen heißen Atem über das Land. Dabei war es erst Anfang Juni. In wenigen Wochen würde das große Navajo-Reservat im nördlichen Arizona unter der Mittagssonne zu glühen beginnen.
Kaye liebte das Land und den Wechsel der Jahreszeiten. Ihr Vater, ein Schafrancher, war ein Weißer, aber ihre Mutter Sophie war eine Vollblut-Navajo gewesen. Sie hatte ihrer Tochter die Liebe zu diesem weiten Land vererbt. Kaye war mit der staubigen roten Erde, den von Wind und Regen geformten Felsen, den Pinienwäldern und den Wüstenpflanzen aufgewachsen. Das Big Res, das große Navajo-Reservat auf der Hochebene des Colorado Plateaus, das sich bis nach New Mexiko und Utah erstreckte, war ihr Zuhause.
Nach knapp zwei Meilen drosselte sie das Tempo. Das einst gelb gestrichene, nun arg verwitterte Holzhaus von Sam Roanhorse war von der Straße aus zu sehen. Kaye bog auf eine ausgewaschene Sandpiste, durchquerte hundert Meter Steinwüste, die von Salbei- und Wacholderbüschen gesprenkelt war, und parkte den Jeep unter einer Pappel hinter dem Haus.
Ein paar schwarze Hühner stiebten gackernd davon. Großvater Sams Schafe begannen zu blöken, das Motorengeräusch hatte sie aus ihrem Mittagsschlaf geweckt. Es waren ungefähr zwanzig Tiere, die in einem Korral im Schattendreier Pappeln und eines verkrüppelten Pflaumenbaumes standen und ihre dünnen Leiber aneinanderdrängten. Sie waren vor vier Wochen erst geschoren worden und die Wolle noch nicht wieder nachgewachsen. Zwei von Sams Schafen waren so schwarz wie die Kohle von der Black Mesa.
Ein Ebenbild von Jazz umrundete freudig bellend den Wagen. Kaye öffnete die Tür, und Jazz sprang heraus, um seinen Bruder Jasper zu begrüßen. Die beiden sahen einander verblüffend ähnlich, nur dass Jaspers Fell um eine Nuance dunkler war.
Sams Hütehund, der im Augenblick von seinen Pflichten entbunden war, weil die Schafe mit ihren Lämmern im Korral standen, führte Jazz zu einer Stelle, an der Pinyonmäuse ihre Löcher hatten. Beide Hunde begannen winselnd zu graben. Damit würden sie eine Weile beschäftigt sein.
»Yá’át’ééh, Großvater, ich bringe dein Essen!«, rief Kaye. Sie blieb eine Weile auf der überdachten Veranda stehen, damit der alte Mann Zeit hatte, sich auf ihren Besuch einzustellen.
Sam Roanhorse war nicht wirklich Kayes Großvater, auch wenn sie ihn liebevoll so nannte. Die Eltern ihrer Mutter waren früh gestorben. Vielleicht war das der Grund, warum Sophie angefangen hatte, dem Alten sein Sonntagsessen zu bringen. Sie begann damit, als Sams Sohn John sich zum Militärdienst meldete und nach Deutschland versetzt wurde. Kayes Mutter kannte John Roanhorse von ihren Versammlungen und hatte sich für seinen alten Vater verantwortlich gefühlt.
Sophie hatte ihr »Essen auf Rädern« nur einmal für kurze Zeit eingestellt. Es war in den Wochen, die zwischen Johns Rückkehr aus Deutschland und jenem schwarzen Tag lagen, an dem er sich in den Bergen hinter dem gelben Haus eine Gewehrkugel in den Kopf gejagt hatte.
Niemand wusste, warum John Roanhorse mit fünfundvierzig Jahren seinem Leben ein Ende gesetzt hatte. Vielleicht hatte der alte Sam eine Erklärung für den Tod seines Sohnes. Doch wenn es so war, dann behielt er sein Wissen für sich.
Johns Freitod hatte den alten Mann schwer getroffen. Aber das Leben ging weiter, und Sam brauchte jemanden, der sich um ihn kümmerte. Er hatte einen Enkel, Will, doch der Junge saß in einem Staatsgefängnis in Texas und konnte nicht für seinen Großvater sorgen.
Sophie war vor zwei Jahren bei einem Autounfall tödlich verunglückt und Kaye hatte den Dienst ihrer Mutter übernommen. Jeden Sonntag brachte sie dem alten Mann sein Essen. Kaye tat es gern, weil sie Sam mochte. Aber ihre sonntäglichen Besuche bei ihm hatten noch einen anderen Grund. Es war der Junge: Will Roanhorse. Seit fünf langen Jahren saß Sams Enkel verurteilt wegen Totschlags hinter Gittern und hatte noch weitere fünf Jahre abzusitzen. Bei einem heftigen Streit hatte Will den Direktor seiner Internatsschule getötet und war von einem Gericht zu zehn Jahren Haft verurteilt worden – obwohl er damals erst vierzehn Jahre alt gewesen war.
Kaye und Will, das war von Anfang an etwas Besonderes gewesen. Dass der Junge fort war, hinderte das Mädchen nicht daran, an ihn zu denken. Und wenn sie bei Großvater Sam am Küchentisch saß, dann konnte sie sogar über Will reden.
Kaye fand, dass sie dem Alten nun genug Zeit gelassen hatte, und trat durch die klapprige Fliegengittertür ins Haus. Großvater Sam saß schon am zernarbten, aber blank gescheuerten Holztisch in der Küche und wartete. Kaye holte einen zerkratzten Emailleteller aus dem Wandschrank und tat dem Alten auf. Geröstete Kartoffeln, Bohnen und Lammgulasch. Das Essen war noch heiß. Für den Weg von der Ranch bis zum Holzhaus von Sam Roanhorse brauchte Kaye nur zehn Minuten.
»Setz dich, Tochter!«, sagte der alte Indianer, der das gute Essen und die Gesellschaft des Mädchens zu schätzen wusste.
Kaye reichte ihm Messer und Gabel und setzte sich ihm gegenüber. Er schnitt sich das Fleisch sehr klein, denn er hatte nur noch wenige Zähne. Zu einem Gebiss hatte Kaye ihn bisher nicht überreden können. Ebenso wenig wie zu einer Brille, die er dringend brauchte, weil seine Augen immer schlechter wurden. Sams spärliches, grau meliertes Haar endete in einem winzigen länglichen Knoten am Hinterkopf, der typischen Haartracht der Navajo. Der Indianer war sehr alt. Aber in Wahrheit wusste Kaye nicht, wie alt er wirklich war.
Um die faltige Stirn hatte Sam ein ausgeblichenes rotes Tuch gebunden. Er trug ein sauberes blau-weiß kariertes Baumwollhemd, denn Kaye kümmerte sich auch um die Wäsche des Alten. Seine abgetragenen Kordhosen wurden von breiten Hosenträgern gehalten. Die Haut des Indianers war sehr dunkel und die Hände knotig vom Alter. Kaye wunderte sich immer wieder aufs Neue, wie er mit diesen Händen und seinen schlechten Augen noch so wunderbare Dinge schaffen konnte.
Sam Roanhorse war Silberschmied. Silberklopfer, wie die Navajo dazu sagten. Die kunstvollen Schmuckstücke, die in seiner kleinen Werkstatt entstanden – Halsketten, Armreifen, Ringe und Gürtelschnallen aus getriebenem Silber und Türkisen -, waren bei den Touristen als Souvenirs sehr begehrt. Und Kaye sorgte in ihrem Laden im dreizehn Meilen entfernten Window Rock dafür, dass sie gut verkauft wurden. Auf diese Weise sicherte sie dem alten Mann sein Auskommen – auch wenn er eines Tages nicht mehr arbeiten konnte. Die Unterstützung, die er vom Staat bekam, war knapp und reichte kaum für ein einfaches Leben.
»Hat Will geschrieben?«, fragte Kaye, nachdem sie eine Weile gewartet hatte.
Es war die eine Frage, die sie Sam Roanhorse immer wieder stellte. Jeden Sonntag, wenn sie ihm das Essen brachte. Und fast immer war die Antwort des alten Mannes dieselbe: Er richtete seine Augen auf das Mädchen und schüttelte bedauernd den Kopf. Auch diesmal war ein Kopfschütteln die Antwort, doch etwas war anders, das spürte Kaye sofort.
»Es ist jetzt fast zwei Monate her, dass du den letzten Brief von ihm bekommen hast, Großvater. Ich mache mir Sorgen.«
Der alte Mann schluckte hinunter, was er sorgsam zwischen Gaumen und Zunge zermahlen hatte, und stellte eine unerwartete Behauptung in den Raum: »Mein Enkelsohn wird bald nach Hause kommen, Tochter. Du und ich, wir haben lange genug gewartet.«
Ein freudiger Schreck jagte durch Kayes Körper. Sie spürte, wie Röte ihre Wangen überzog und es in ihrer Magengegend seltsam zu flattern begann. Einige Zeit verstrich, bis sie ihre Gedanken ordnen und darüber nachdenken konnte, was der Alte gesagt hatte. Großvater Sam konnte manchmal voraussehen, was passieren würde. Er hatte ein Gespür für solche Dinge, einen Sinn mehr als andere Menschen. Sam Roanhorse war ein hataalíí, ein Sänger und Heiler; jemand, der in der Lage war, schwierige Fragen zu beantworten und Dinge vorherzusehen. Für ihn war das Universum erfüllt von mächtigen Kräften, die allesamt das Potenzial von Gut und Böse in sich trugen. Fehlte die Balance zwischen beidem, wurden die Menschen krank. Der alte Sam konnte herausfinden, welche Ursache eine Krankheit hatte, und durch sein Wissen den richtigen Gesang bestimmen, der Heilung bringen würde.
Kaye war mit den alten Geschichten ihres Volkes aufgewachsen. Sie glaubte an hózhó, den Pfad der Schönheit, der die Regeln der Ausgewogenheit und Harmonie lehrte. Und sie glaubte auch an die Wirksamkeit der geheimnisvollen Heilzeremonien der Navajo. Aber Kaye hatte keine Angst vor den diyin, den Wissenden Leuten, und erst recht nicht vor Großvater Sam. Vielleicht war er ja in der Lage, zukünftige Geschehnisse vorherzusehen, doch bewirken konnte er sie nicht. Sonst wäre sein Enkelsohn Will längst wieder zu Hause.
Kaye warf einen Blick auf den Kalender an der Wand, an dem der alte Mann die Tage abstrich. Sie wusste, er zählte die Tage von Wills Haft und befürchtete, die Rückkehr seines Enkels nicht mehr zu erleben. Doch heute war das anders. Irgendetwas war eingetreten, das ihm Hoffnung machte. Was das wohl war? Einen Brief hatte der Alte jedenfalls nicht bekommen, denn den hätte sie ihm sonst vorlesen müssen.
Vorsichtig entgegnete sie: »Will ist zu zehn Jahren verurteilt worden, Großvater, und er hat erst fünf davon abgesessen. Was macht dich so sicher, dass er bald nach Hause kommt?«
Insgeheim wünschte sie, der alte Mann würde eine plausible Erklärung für seine Behauptung haben. Eine Erklärung, an die sie glauben konnte. Wie sehr sie sich nach Will sehnte. Kaye sah ihn in der Erinnerung ganz deutlich vor sich. Er war vierzehn gewesen, als sie ihm das letzte Mal gegenübergestanden hatte, und er hatte geweint. Dann war er davongelaufen und hatte sie allein im Water Hole Canyon zurückgelassen. Am nächsten Tag war er wieder nach New Mexico gefahren, und vier Wochen später hatte Sophie ihr erzählt, dass Will im Gefängnis saß.
Wie er jetzt wohl aussah? Was für ein Mensch war aus ihm geworden, nach einer so langen Zeit hinter Gefängnismauern? Er, der die meiste Zeit seines Lebens unter freiem Himmel verbracht hatte, war nun schon fünf Jahre in einer winzigen Zelle eingesperrt. Vielleicht hatte er Schlimmes gesehen und erlebt im Gefängnis. Kaye hatte Angst, Will könnte nicht mehr derselbe sein, wenn er eines Tages ins Reservat zurückkehren würde. In solchen Momenten zweifelte sie daran, dass sie es schaffen konnte, noch einmal fünf Jahre auf ihn zu warten.
Bald wurde sie achtzehn und musste ihren Vater nicht mehr um Erlaubnis bitten, um Will zu besuchen. Sie hatte schon oft daran gedacht. Aber Will Roanhorse saß in einem Staatsgefängnis in Texas, mehrere hundert Meilen vom Reservat entfernt. Sie war noch nie so weit weg von zu Hause gewesen. Und sie wusste nicht, ob er sich überhaupt über ihren Besuch freuen würde. Auf keinen ihrer vielen Briefe hatte er jemals geantwortet. Alles, was sie von ihm hatte, waren die wenigen Briefe, die er an seinen Großvater geschrieben hatte. Und darin stand meist nur, dass es ihm gut gehe und der Alte sich nicht um ihn sorgen solle.
»Atsá, der Adler, hat es mir gesagt«, antwortete Sam schließlich leise auf ihre Frage und schob sich ein weiteres Stück Fleisch in den Mund. »Will wird bald wieder hier sein. Es ist nun genug.«
Genug war es tatsächlich, schon lange. Kaye fragte nicht weiter nach. Was der Adler Sam Roanhorse erzählte, war meistens eingetroffen, auch wenn es dafür keine Erklärung gab. Der Adler konnte sehr viel mehr sehen als die Menschen, denn seine ausgedehnten Flüge führten ihn weit über die großen Mesas und die tiefen Schluchten der Canyons. Seine Sicht der Dinge war eine völlig andere.
Doch der Adler hatte dem alten Navajo noch etwas anderes erzählt, etwas, das er dem Mädchen verschwieg. Außer ihm und der jungen Frau gab es noch jemanden, der auf Will Roanhorse wartete. Jemand, vor dem man auf der Hut sein musste, weil es ihm gefiel, die Schwächen anderer für sich selbst auszunutzen. Jemand, für den das Leben ein Spiel war, eine ewige Jagd. Dass auch Zweiherz, der Kojote, auf Wills Ankunft lauerte, würde Sam wohlweislich für sich behalten.
2. Kapitel
Staatsgefängnis von Gatesville, Texas
Will Roanhorse pickte langsam die vergilbten Fotos und Zeitungsausschnitte von seiner Zellenwand und verstaute sie in einem Schuhkarton. Der Karton war voller Briefe. Es waren ungeöffnete Briefe.
Der junge Navajo-Indianer strich sich das schulterlange Haar aus der Stirn, nahm eines der abgegriffenen Schwarz-Weiß-Fotos in die Hand und betrachtete es genauer. Er selbst war darauf zu sehen und Kaye Kingley. Er hatte den Arm um das Mädchen mit den dünnen Beinen und dem langen Zopf gelegt und sie griente ihn zufrieden an. Auf ihrem Schoß ein winziges Fellbündel. Das Foto war an ihrem zehnten Geburtstag entstanden. Damals hatte er ihr einen kleinen Mischlingshund geschenkt und sie hatte ihn Jazz genannt.
Will erinnerte sich daran, dass Kaye vor Freude über den kleinen Hund am ganzen Körper gezittert hatte. Beim Gedanken daran, wie sie versucht hatte, ihre Freude nicht zu überschwänglich zu zeigen, weil die Navajo-Geister das nicht mochten, musste er lächeln.
Er legte das Foto zu den anderen in den Karton zurück und fragte sich, ob Jazz wohl noch lebte. Möglicherweise stand die Antwort auf seine Frage in einem dieser vielen Briefe. Vielleicht stand in diesen Briefen auch, dass Kaye bald heiraten würde. Irgendeinen netten jungen Mann, vielleicht sogar einen bilagáana, einen Weißen. Es war durchaus möglich, schließlich war sie selbst zur Hälfte weiß.
In zwei Monaten hatte sie ihren achtzehnten Geburtstag. Dieses Datum hatte er nicht vergessen und dieser Tag war in den vergangenen Jahren immer besonders schlimm für ihn gewesen. Weil er nicht bei ihr sein konnte. Weil er ausgeschlossen war aus ihrem Leben, ausgeschlossen von allem, was hózhó, was schön war. Will wusste, dass Kaye ihre kinaaldá, die Reifezeremonie, längst hinter sich hatte. Seitdem war sie nach altem Brauch heiratsfähig – eine junge Frau.
Kaye war mit zwölf schon hübsch gewesen, mit ihren großen blauen Augen im runden Gesicht und dem feinen rötlichen Schimmer im dunklen Haar. Wie sehr sie sich auch verändert haben mochte in den vergangenen fünf Jahren, er würde sie überall wiedererkennen.
Will schnürte den Karton zu und schob ihn in seinen Rucksack. Auf der Pritsche lagen die Mappe mit seinem Highschool-Abschlusszeugnis und die neuen Kleidungsstücke, die Hank, sein Freund und Zellennachbar, ihm besorgt hatte. Ein Jeansanzug der Marke Lee, ein schwarzes T-Shirt und Schnürschuhe aus Rindsleder.
Schon mehrere Male hatte Will seine Nase an dieses Leder gepresst, um den intensiven Geruch einzusaugen. Die Schuhe waren das Einzige in seiner winzigen Zelle, das nach Freiheit roch. Diese 2x4 Meter waren zwei lange Jahre der Raum für sein Leben gewesen. Ein Käfig. Die schmale Stahlpritsche an der Wand mit der dünnen Matte, ein Waschbecken und eine Stahltoilette waren seine Einrichtung. Nach drei Jahren im Jugendgefängnis hatte man ihn ohne Angabe von Gründen eines Tages hierherverlegt.
Inzwischen hatte er auch herausgefunden, warum: Die Jugendgefängnisse waren überfüllt mit jungen Straftätern, die noch nicht einmal sechzehn waren. Und die Unterbringung in einem Staatsgefängnis war zudem weitaus billiger.
Für ihn waren die vergangenen beiden Jahre die Hölle gewesen. Er hatte Dinge gesehen und erlebt, die er niemals vergessen würde. Sie hatten Narben an Körper und Seele hinterlassen.
Will hasste den Lärm der Nächte, der in ihn eindrang und ihn nicht zur Ruhe kommen ließ. Das Gefängnis war ein dunkler, ein freudloser Ort. Ein Ort voller Gewalt und Hass. Niemand wurde besser hier drin. Es gab nur zwei Möglichkeiten: Entweder man passte sich den rauen Bedingungen an oder man drehte durch. Will hatte sich nicht angepasst. Und er hatte gesungen, um nicht durchzudrehen. Anfangs hatten ihn die anderen dafür verlacht und ihm mit grausamen Späßen das Leben schwer gemacht. Aber irgendwann hatten sie den verrückten Indianer in Ruhe gelassen.
Obwohl Will in den vergangenen Monaten an nichts anderes als an Kaye, seinen Großvater und die Freiheit gedacht hatte, war ihm jetzt, wo die Zeit seiner Haft ganz unvermutet beendet werden sollte, mulmig zumute. Er hatte Angst. Würde er zurechtkommen dort draußen? Würde er sich nicht verloren vorkommen, wenn die Welt plötzlich nicht mehr von Mauern und Gitterstäben begrenzt war?
Sein Vater lebte nicht mehr. An seine Mutter konnte Will sich nicht einmal erinnern, sie war gestorben, als er zwei Jahre alt war. Ihre Familie lebte irgendwo in Flagstaff, sie waren Stadtindianer. Er hatte nie etwas mit ihnen zu tun gehabt. Ihren Eltern und den Brüdern seiner Mutter hatte es nicht gefallen, dass sie den gut aussehenden, aber wenig geschäftstüchtigen John Roanhorse geheiratet hatte. Und dann war sie auch noch an dieser Krankheit gestorben. Krebs, wie die bilagáana, die Weißen, sagten. Graue Krankheit, wie die Navajos sie nannten. Aber welchen Namen man ihr auch gab, seine Mutter war daran gestorben.
Seit Will denken konnte, waren sein Vater und der Großvater für ihn da gewesen. Bis John ihn auf dieses Internat bei Santa Fe schickte. Es war eine staatliche Schule, in der Indianerkinder besonders gefördert wurden. Will hatte sich dem Wunsch seines Vaters gefügt, was ein Fehler gewesen war. Aber schon als kleiner Junge hatte er gelernt, die Wünsche der Erwachsenen zu respektieren. Das war navajo.
Nun war er neunzehn und geblieben war ihm sein Großvater. Der alte Mann lebte noch in dem Holzhaus, in dem Will aufgewachsen war. Großvater Sam wartete auf ihn. Bei ihm würde er ein weiches Bett und ein Zuhause haben. An Kaye wagte er kaum noch zu denken, je näher der Tag rückte, an dem er sie wiedersehen würde. Er verabschiedete sich von seinen Träumen und Wünschen, weil die Chance, dass sie in Erfüllung gehen könnten, verschwindend gering war. Die Enttäuschung wollte Will sich ersparen.
Aber er hatte Pläne. Wollte sich Arbeit suchen und seinen Großvater unterstützen. Vielleicht würde er sich im Herbst am College einschreiben und studieren. Im Gefängnis hatte er seinen Highschool-Abschluss gemacht. Wenigstens diese Möglichkeit stand jugendlichen Straftätern offen. Es war ihm nicht schwergefallen, er hatte mit Sehr gut abgeschlossen. Dieses Zeugnis war seine Chance.
Gedankenverloren streifte Will mit den Fingern über die neuen Kleider auf der Pritsche. Gestern hatte er von einem Aufseher zurückbekommen, was er angehabt hatte, als er vor fast fünf Jahren aus dem Gerichtssaal ins Gefängnis gebracht worden war. Aber er hatte es nicht gebrauchen können, denn diese Kleider waren ihm längst viel zu klein geworden. Die Gefängniskost war nicht sonderlich schmackhaft gewesen im Staatsgefängnis von Gatesville, aber das hatte nicht verhindert, dass Will einen Kopf größer geworden war und sein Körper kräftig. Jeden Tag hatte er in seiner Zelle einhundert Klimmzüge gemacht. Fünfzig am Morgen und fünfzig am Abend. Das hatte seine Muskeln gestärkt und seinen Körper beweglich gehalten.
Eine Zeit lang war er auch gelaufen, wenn er Freigang hatte. Laufen war früher seine Leidenschaft gewesen. Er liebte es, durch die Arroyos, die trockenen Flussbette der Canyons, zu rennen, die schmalen Mesapfade hinauf und wieder hinunter. Manchmal hatte er sich dabei so frei und schwerelos wie ein Adler gefühlt. Aber Laufen im Gefängnis war etwas ganz anderes. Es hatte ihm schmerzhaft bewusst gemacht, dass er nicht frei war. Irgendwann war Will es leid gewesen, immer im Kreis zu rennen.
»He, Willy Boy!«, raunte ihm eine dunkle Stimme von nebenan zu. »Was werde ich bloß anfangen, wenn du nicht mehr da bist? Ohne dich wird es verdammt traurig sein. Wer wird mir Geschichten erzählen?«
Das war Hank, Wills Zellennachbar.
»Du musst durchhalten, Hank«, antwortete er. »Denk immer daran, was ich dir beigebracht habe: Warten kann auch ein Geschenk sein. Zeit, um über sich selbst und andere wichtige Dinge nachzudenken.«
Aus der Nachbarzelle kam ein Stöhnen. »Aber ich bin schwarz, Will, und keine verdammte Rothaut«, schimpfte Hank mit verhaltener Stimme. »Ich brauche Bewegung, sonst drehe ich durch. Ich hab doch schon mehr als genug gewartet. Ich kann nicht mehr, Willy. Ich kann nicht mehr, verstehst du das? Ich wünschte, ich könnte mit dir gehen.«
Das wünschte Will auch, denn er mochte Hank. Die beiden waren fast zeitgleich ins Staatsgefängnis von Gatesville gekommen und schnell Freunde geworden. Hank war ein Riese, ein schwarzer Ringer, der bei einem Streit zu fest zugeschlagen hatte und seinen Widersacher dabei ungewollt getötet hatte. Es war ein Unfall gewesen, aber Hank war schwarz und das Gericht hatte ihn wegen Totschlags verurteilt. Ihr ähnliches Schicksal hatte die beiden zueinandergebracht und Hank war zu Wills Beschützer geworden. Er war es auch gewesen, der ihn dazu angehalten hatte, Sport zu treiben.
Hank schob seine tiefbraune Hand durch die Gitterstäbe um die Ecke in Wills Zelle. »Das ist für dich, Bruder, damit du mich nicht vergisst.«
Will nahm das Lederband, an dem eine kleine weiße Figur baumelte. Es war eine winzige mollige Afrikanerin mit hervorstehenden Brüsten und dicken Schenkeln.
Will berührte die Figur, drehte sie, schüttelte den Kopf und reichte sie Hank zurück. Seine schlanken Finger waren auch braun, aber um einiges heller als die des schwarzen Freundes. »Nimm das wieder, du Idiot. Vermutlich ist das Ding auch noch wertvoll«, sagte er.
Hank lachte heiser. »Das ist es, Willy Boy, ist es wirklich. Das ist eine afrikanische Fruchtbarkeitsgöttin aus Elfenbein. Meine Oma hat sie mir geschenkt, sie gehörte ihrer Urgroßmutter. Die Göttin hat afrikanische Sonne gesehen. Du wirst sie behalten oder der alte Hank ist schwer beleidigt.«
Will zog die Hand zurück, zuckte mit den Achseln und hängte sich die Figur um den Hals. Dann zog er seine neuen Kleider an und legte sich auf seine Pritsche. Er verschränkte die Arme hinter dem Kopf und sagte leise: »Auf Wiedersehen, Hank, und lass dich nicht unterkriegen. Mach keinen Unsinn, es lohnt sich durchzuhalten. Wir sehen uns im Big Res. Du weißt, wo du mich findest.«
Von nebenan murmelte es: »Auf Wiedersehen, Willy Boy. Grüß die Freiheit von mir und die Mädchen. Ich bin wirklich gespannt auf die Kleine, von der du mir immer erzählt hast. Bald musst du nicht mehr träumen, dann kannst du sie in deinen Armen halten. Ich beneide dich.«
Will hörte ein irres Lachen aus seiner anderen Nachbarzelle und wusste, das war das Signal für eine weitere, qualvolle Nacht. Aus den übrigen Zellen auf dem Gang kamen anzügliche Bemerkungen und Rufe, die zu wilden Schreien wurden. Jemand schlug mit etwas Hartem gegen die Gitterstäbe, ein anderer drosch seinen Kopf gegen die Zellenwand. Will presste seine Hände auf die Ohren und schloss die Augen. Noch genau zehn Stunden und er würde dieser Hölle entkommen sein. So viele Türen und Tore bis zur Außenwelt, doch morgen sollten sie sich für ihn öffnen, und die Freiheit würde ihn in Empfang nehmen.
Eine genaue Vorstellung, was diese Freiheit für ihn bedeutete, hatte er nicht. Dafür war er einfach zu lange hinter Stahl und Beton gesperrt gewesen; zu lange weg aus dem Reservat, weg von seinem Land. Will wusste nur eines: Sein Großvater würde da sein und das Holzhaus, das, seit er denken konnte, sein Zuhause war. Vielleicht würde auch Kaye da sein. Aber daran sollte er sich lieber nicht festhalten.
Kojote war durstig. Seine raue Zunge lechzte nach Wasser. Es war eine mondlose Nacht und feuchte Kühle lag in diesem ausgetrockneten Flussbett. Zweiherz trabte lautlos einen schmalen Mesapfad hinauf und trank aus einer Nachtquelle, die in einer Felsspalte entsprang. Er schüttelte sich, streckte seine mageren Glieder. Die Nacht war seine Zeit. Seine Augen glühten rot in der Dunkelheit der Halbwüste. Er schnüffelte und hielt inne.
Dieser Ort war gut. Gleich dort drüben war der Steinhügel, der von einem seiner vergangenen Siege kündete. Ein unglücklicher Mann, zu schwach, zu unsicher. Wenn Kojote sich Mühe gab, konnte er das Widerhallen des Schusses in den Bergen hören, obwohl sein Sieg schon Jahre zurücklag. Ah-rr-ah, was für ein Klang. Wie naiv diese Menschen manchmal doch waren. So gutgläubig. So dumm. So leicht zu verwirren und ihren Gefühlen vollkommen ausgeliefert.
Das Quellwasser hatte den Vierbeiner munter gemacht. Ein Zittern durchlief seinen Körper und verstärkte die Aufregung, die er spürte. Eine Jagd stand bevor, ein neues Spiel.
Window Rock, Arizona
Kaye trat ihrer Freundin unter dem Tisch auf den Fuß und steckte ihren Zeigefinger in Shelleys Becher mit Eistee. »Gib sofort meinen Burger zurück, ich muss wieder an die Arbeit.«
Shelley kicherte. »Au, verdammt noch mal, musst du immer gleich so rabiat werden?« Sie donnerte den stibitzten und angebissenen Hamburger zurück auf Kayes Pappteller.
Kaye zog ihren Finger aus Shelleys Eistee und leckte ihn ab.
»Arbeit!«, spottete die blonde Shelley. »Tu doch nicht so, als ob du wirklich arbeiten würdest. Wer kauft in diesem gottverlassenen Nest schon ein Buch? Das war so eine typische verrückte Idee von deiner Mutter, ausgerechnet in Window Rock einen Laden mit Büchern aufzumachen. Falls du es noch nicht mitbekommen hast: Wir leben hier am Ende der Welt. Da kaufen die Leute Hamburger und Cola, sie hüten Schafe, spielen Bingo, aber sie lesen keine Bücher.«
»Das stimmt nicht«, sagte Teena, das dritte Mädchen am Tisch. »Ich habe in Kayes Laden schon eine Menge Bücher gekauft.«
»Du bist ja auch nicht normal.« Shelley winkte ab. »Wie kann man nur den ganzen Tag in irgendwelchen Büchern lesen? Du lebst fremdes Leben, Teena. Das eigene ist viel spannender, glaube mir.«
Kaye fragte sich, an welcher Stelle Shelley Gardens Leben spannend sein sollte, abgesehen vielleicht von ihren Jungsgeschichten. Sie hörte dem Geplänkel ihrer beiden Freundinnen nur noch mit halbem Ohr zu. Es ärgerte sie, wenn sich jemand über ihren kleinen Laden auf der anderen Seite des Parkplatzes lustig machte, auch wenn der Spott von ihrer zweitbesten Freundin Shelley kam und nicht wirklich ernst gemeint war. BÜCHER – POSTKARTEN – KUNSTGEWERBE stand über ihrem Schaufenster.
»Ich verkaufe ja nicht nur Bücher«, verteidigte sich Kaye. »Der Silberschmuck und die Webteppiche gehen wirklich gut. Die Keramik auch.« Nach dem Tod ihrer Mutter hatte Kaye den Laden übernommen. Sie öffnete ihn am Nachmittag, wenn die Schule beendet war, und in den Sommerferien und an den Sonnabenden hatte sie den ganzen Tag über auf. Wenn die anderen aus ihrer Klasse Spaß hatten, zusammen zum Baden fuhren oder zum Picknick, stand Kaye hinter dem Ladentisch und verkaufte indianische Kunstgewerbearbeiten und Bücher über die Kultur ihres Volkes. Sie hätte das nicht tun müssen, denn ihr Vater war kein armer Mann. Aber sie hatte sich vorgenommen, den Laden ihrer Mutter weiterzuführen, solange das möglich war. So bewahrte sie etwas, das ihrer Mutter wichtig gewesen war, und zugleich war sie finanziell nicht völlig von ihrem Vater abhängig.
»Ja, im Sommer vielleicht«, sagte Shelley, »wenn sich ein paar Touristen auf dem Weg zum Grand Canyon hierherverirren.« Sie rümpfte die Nase.
»Was willst du, Shelley?« Kaye breitete die Arme aus und lachte versöhnlich. »Es ist Sommer.«
Vor einer Woche hatten die drei Mädchen ihren Highschool-Abschluss gemacht. Sie wollten nun ein Jahr lang arbeiten, um sich etwas Geld zu verdienen, und dann zusammen aufs College nach Santa Fe gehen. Kaye würde in den kommenden Monaten in ihrem Laden stehen und Navajokunst verkaufen. Shelley würde ihrer Mutter als Kellnerin in dem kleinen Schnellrestaurant helfen, in dem sie gerade saßen, und Teena würde auf der Pferderanch ihrer Eltern Reitstunden geben und geduldig die Fragen der Touristen beantworten.
Kaye stand auf und küsste beide Freundinnen flüchtig auf die Wange. »Jetzt muss ich wirklich gehen. Der Mittagsbus ist gerade durch und vielleicht verirrt sich jemand in meinen Laden. Außerdem hast du Kundschaft, Shelley.« Sie deutete auf eine alte Indianerin, die mit ihrem Enkel an einem Tisch in der Ecke die Karte studierte. »Bis heute Abend!«, verabschiedete sie sich.
»Ja, wir sehen uns bei Rob«, erwiderte Teena Tommy, die ein dunkelhäutiges Navajomädchen war und Kayes beste Freundin.
Teena lebte mit ihren Eltern und Großeltern auf einer kleinen Ranch nahe Chinle, am Eingang zum Canyon de Chelly. Die Familie betrieb Pferdezucht und bot Touristen Ausritte in den Canyon an. Teena war eine hervorragende Reiterin und hatte Kaye eine Menge über Pferde beigebracht. In den Sommermonaten war Kayes Freundin dann jedoch immer so eingespannt auf der Ranch ihrer Eltern, dass die beiden kaum Zeit hatten, sich zu sehen. Deshalb freuten sie sich auf die Geburtstagsparty ihres gemeinsamen Kumpels Robert Lindsay, die am Abend steigen sollte.
Kaye winkte ihren Freundinnen zu und grüßte im Hinausgehen Laura Garden, Shelleys Mutter und Besitzerin des Green-Garden-Schnellimbisses. Dann eilte sie über den großen Parkplatz zu ihrem Laden hinter der Shell-Tankstelle. Der dunkle Asphalt glühte unter der Mittagshitze, die Luft flimmerte und machte das Atmen schwer. Nur schnell in den Laden, der zum Glück eine Klimaanlage hatte …
Auf halbem Wege blieb Kaye so abrupt stehen, als hätte ihr jemand einen heftigen Stoß gegen die Rippen versetzt. Nun blieb ihr wirklich die Luft weg. Trotz der Hitze überfiel sie ein Zittern, das bis in die Magengrube zu spüren war. Ihr Herz schlug, als wolle es aus ihrer Brust springen. Vor dem Schaufenster ihres Ladens stand jemand. Sie hatte ihn fünf Jahre lang nicht mehr gesehen und dennoch sofort wiedererkannt, obwohl er ihr den Rücken zuwandte. Das konnte nur er sein: Will Roanhorse. Der Adler hatte sein Kommen angekündigt. Aber sie hatte nicht damit gerechnet, dass es so schnell passieren würde.
Kayes Beine weigerten sich weiterzugehen, und ihr Körper fühlte sich auf einmal ganz schwer an. Sie sah Wills und ihr eigenes Spiegelbild in der Schaufensterscheibe, und ihr war klar, dass auch er sie sehen musste. Kaye versuchte, ihr Herz zu beruhigen, und schaffte endlich ein paar Schritte auf ihn zu.
»Hallo Will«, sagte sie zaghaft. »Yá’át’ééh!«
Ohne sich umzudrehen, sagte er: »Hallo Kaye!« Er sprach sehr leise. Langsam wandte er sich vom Schaufenster ab.
Will war einen ganzen Kopf größer als sie, aber das war schon damals so gewesen, als sie noch Kinder waren. Das Erste, was sie sah, als er sich umdrehte, waren seine Augen. Sie schimmerten immer noch schwarz wie die rohe Kohle von der Black Mesa. Doch aus dem schlaksigen Halbwüchsigen war ein junger Mann geworden. Brust und Schultern waren breiter, seine Hände sahen schmal aus und wirkten doch kräftig.
Erst als Kaye bewusst wurde, dass sie Will unverwandt anstarrte, fiel ihr auf, dass er sie mit dem gleichen Blick der Neugier und Verwirrung musterte. Auf einmal spürte sie, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. Wie ein sandiger Wüstenwind tobten die verrücktesten Gefühle durch ihren Körper und sie senkte den Blick auf ihre Schuhe. So oft hatte sie sich diesen Moment ausgemalt. Doch jetzt, wo Will vor ihr stand – so nah und doch so fremd -, fühlte sie sich völlig unvorbereitet.
»Großvater Sam hat gewusst, dass du kommst«, sagte sie und strich sich verlegen eine Strähne, die ihrem Haarknoten entschlüpft war, hinter das Ohr. Sie hob den Kopf, versuchte noch einmal, ihn anzusehen.
»Bist du das Empfangskomitee?«, fragte Will mit einem merkwürdigen Lächeln. Es schien ihm Schwierigkeiten zu bereiten, als ob das Lachen wehtun würde.
»Nein.« Kaye schluckte beklommen. Hunderte Male hatte sie sich vorgestellt, wie sie einander in den Armen liegen würden bei diesem ersten Wiedersehen nach so langer Zeit. Doch nun war alles ganz anders. Eine unsichtbare Mauer schien zwischen ihnen zu stehen. Schlagartig erwachte sie aus all ihren Träumen.
»Ich wusste natürlich nicht, dass du heute kommen würdest. Aber Großvater Sam hat behauptet, es würde bald sein.«
»Und, hast du ihm geglaubt?«
»Natürlich«, erwiderte sie, einen Anflug von Trotz in der Stimme. »Warum nicht?«
»Die zehn Jahre sind noch nicht um.«
»Nein«, gab sie zu. »Aber wenn Großvater Sam sagt, du kommst, dann stimmt das auch. Du bist hier, oder?«
Will lächelte. Diesmal klappte es schon besser, das Lächeln erreichte sogar seine Augen. »Großvater ist eben ein weiser Mann.«
In diesem Moment bemerkte Kaye, dass man hinter der Scheibe des Restaurants zu ihnen herübersah. »Ich muss den Laden aufschließen«, sagte sie schnell.
Will deutete in das Schaufenster hinein. »Hilfst du deiner Mutter beim Verkauf?«
Kaye ließ den Schlüssel sinken. Sie starrte ihn an und begriff nicht. Alle Farbe wich aus ihrem Gesicht. Sollte er wirklich nicht...? Wie konnte das sein!
Will schien es unter Kayes Blick unbehaglich zu werden. »Ist alles klar bei dir? Ich hab dich bloß was gefragt.«
Sie wich einen Schritt zurück. »Meine Mutter ist seit zwei Jahren tot, Will. Ich habe es dir geschrieben. In meinen Briefen habe ich dir geschrieben, wie weh es getan hat und wie sehr ich sie vermisse.«
Ein Ausdruck der Bestürzung trat in Wills Gesicht. »Ich habe sie nie gelesen«, stieß er hervor. »Ich habe deine Briefe nicht gelesen.«
Ihr stummes »Warum?« hing in der Luft, aber er gab keine Erklärung.
Abrupt wandte er sich um und ging fort, ohne noch einmal zurückzublicken.
3. Kapitel
Will ist wieder da«, sagte Kaye. Ungewollt zitterte ihre Stimme, als sie ihrem Vater diese Neuigkeit beim gemeinsamen Abendessen offenbarte.
Arthur Kingley hob den Kopf und sah seiner Tochter aufmerksam in die Augen. Er hatte sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmte, als sie am späten Nachmittag aus Window Rock zurückgekommen war. Sie hatte verstört gewirkt und war schweigsam gewesen. Aber Arthur hatte sie nicht nach dem Grund dafür gefragt, weil er zu diesem Zeitpunkt keine Antwort von ihr bekommen hätte. Das war typisch für das Volk ihrer Mutter und Arthur hatte es in langen Jahren mühsam lernen müssen. Alles brauchte seine Zeit bei den Navajo. Es hatte keinen Sinn, mit der Tür ins Haus zu fallen.
»Hat er nicht erst die Hälfte seiner Zeit abgesessen?«, fragte Arthur schließlich. Es gelang ihm nicht, seine Beunruhigung zu verbergen.
Dad hat mitgezählt, dachte Kaye, und sich in Sicherheit gewähnt. Nun muss er mit der unerwarteten Tatsache fertig werden, dass Will wieder da ist. Genauso wie ich.
»Vielleicht hat man ihn wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Vielleicht hat sich auch herausgestellt, dass Will unschuldig ist«, erwiderte Kaye gereizt. Sie stocherte lustlos mit der Gabel in dem Essen auf ihrem Teller herum, das langsam kalt wurde.
Arthur zog prüfend die Augenbrauen nach oben. »Hast du Will getroffen?«
»Ja.« Sie nickte. »Er stand auf einmal vor dem Laden. Sehr gesprächig war er nicht.« Ihr traten Tränen in die Augen und Arthur griff nach der Hand seiner Tochter.
»Na komm, nun heul mal nicht. Nach fünf Jahren im Gefängnis ist es nicht so leicht, plötzlich wieder zu Hause zu sein. Niemand weiß, was all die Monate in Will vorgegangen ist. Vielleicht hat er im Gefängnis Schreckliches gesehen oder erlebt, Dinge, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Du musst ihm schon etwas Zeit lassen, sich zurechtzufinden im normalen Leben. Sogar Freiheit bedarf einer gewissen Gewöhnung. Für ihn hat sich hier eine Menge verändert. Auch du hast dich verändert.«
Kaye schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte laut. Sie hatte mit Ablehnung und Sturheit von Seiten ihres Vaters gerechnet, aber dass er jetzt auf einmal Verständnis signalisierte, brachte sie völlig durcheinander. »Er hat keinen meiner Briefe gelesen, Vater, keinen.« Sie schniefte und suchte nach einem Taschentuch.
Arthur schüttelte ungläubig den Kopf. »Das ist allerdings etwas merkwürdig. Dass er dir nie geschrieben hat, fand ich schon seltsam. Aber dass er deine Briefe nicht gelesen hat … Was für einen Grund sollte es dafür geben?«
»Es waren 99 Stück, Daddy. 99 ungelesene Briefe«, stieß sie hervor. »Ich habe Stunden damit verbracht, ihn an meinem Leben teilhaben zu lassen. Und er hat all die Jahre nichts von mir wissen wollen. Er wusste nicht mal, dass Mom tot ist.«
Arthur fuhr seiner Tochter zärtlich übers Haar, das unter seinen Fingern leise knisterte. »Es gibt noch andere junge Männer als diesen Will Roanhorse«, sagte er sanft. »Ich muss zugeben, es verursacht mir einige Bauchschmerzen, dass meine Tochter in jemanden vernarrt ist, der einen Menschen auf dem Gewissen hat.«
Vernarrt, dachte Kaye empört. Das hörte sich an, als wäre sie immer noch zwölf Jahre alt und als wären ihre Gefühle für Will die eines Kindes. Aber so war das nicht. Schon lange nicht mehr und erst recht nicht, seit sie ihm heute begegnet war. Ihr Inneres war ein einziges Chaos, so aufgewühlt und durcheinander war sie seit dem Tod ihrer Mutter nicht mehr gewesen.
Kaye wusste, es hatte ihrem Vater ganz gut in den Plan gepasst, dass sie in den vergangenen Jahren keinen Blick für Jungs gehabt hatte, weil sie nur an Will dachte. Ihr Freund Rob hatte seine Mutter und Kayes Vater vor einiger Zeit bei einem Gespräch belauscht und ihr alles brühwarm erzählt.
»Du bist ein braves Mädchen, hat dein Dad gesagt, um das man sich nicht sorgen muss und das nie Ärger macht.« Robs Augen hatten dabei spöttisch gefunkelt.
»Und was hat er noch gesagt?«, hatte Kaye gefragt.
»Dass er Will Roanhorse nicht mag.«
Dad mag Will nicht. Daran musste sie jetzt denken.
»Es war ein Unfall«, erwiderte Kaye trotzig, fest entschlossen, an Wills Unschuld zu glauben. All die Jahre hatte sie sich an diesem Gedanken festgehalten. Will Roanhorse hatte ein gutes, ein mitfühlendes Herz, und sie liebte ihn, seit er ihr Jazz geschenkt hatte.
Arthur schüttelte den Kopf. »Die Richter sahen das anders, Kaye.«
»Weil er ein Indianer ist«, verteidigte sie ihn.
»Vielleicht war es ein Unfall«, sagte Arthur. »Aber Will ist in die Wohnung seines Direktors eingedrungen und auf den Mann losgegangen. Du erwartest doch nicht, dass ich das normal finde?«
Kayes Tränen waren getrocknet. »Ich glaube, er hatte einen Grund für das, was er getan hat. Irgendetwas muss da passiert sein. Will war nie gewalttätig, Vater, ich kenne ihn.«
»Du kanntest ihn, Kaye. Damals war er noch ein Kind. Jetzt ist er ein Mann von zwanzig Jahren.«
»Neunzehn«, verbesserte sie ihren Vater und begann, das Geschirr vom Tisch in die Spülmaschine zu räumen.
Mochte er denken, was er wollte. Sie wusste, Will Roanhorse war kein schlechter Mensch. Und für das, was er getan hatte, war er bestraft worden. Mit fünf langen Jahren hinter Gefängnismauern.
»Deine Mutter hat Will geliebt wie einen eigenen Sohn«, sagte Arthur mit belegter Stimme.
Kaye nickte. »Mom war eine echte Navajo. Sie liebte ihr Volk. Sie liebte auch die, die vom Pfad der Schönheit abgekommen waren.«
»Und sie liebte mich«, sagte Kingley.
Bevor John Roanhorse sich zur Armee gemeldet hatte und nach Deutschland versetzt worden war, hatten Wills Vater und Kayes Mutter ein Verhältnis gehabt. Arthur war durch einen Zufall dahintergekommen. Es war eine schlimme Zeit gewesen, in der sie versucht hatten, Kaye nichts von ihren Problemen merken zu lassen. Das war ihnen gelungen. Bis heute wusste das Mädchen nichts davon und dabei sollte es auch bleiben.
Kaye lächelte ihren Vater traurig an. »Ja, vermutlich hatte Mom vor Liebe zu dir den Verstand verloren, denn sonst hätte sie niemals so ein rothaariges, sommersprossiges Bleichgesicht geheiratet.«
Bilagáana - weiße Person, hatte Sophie Arthur manchmal genannt, wenn sie wütend auf ihn gewesen war. Sie hatte es aber auch hin und wieder zärtlich gesagt.
Kaye legte ihm versöhnlich einen Arm um die Schulter. »Ich liebe dich, Daddy.« Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange – dorthin wo die Haut weich und ohne Bartstoppeln war. »Ich fahre jetzt rüber zu Rob nach Window Rock, er hat heute Geburtstag. Warte nicht auf mich, ich schlafe bei Shelley.«
Arthur Kingley seufzte. Kaye war siebzehn und schön wie ein erwachender Morgen. Noch konnte er von ihr verlangen, in der Nacht nach Hause zu kommen. Aber das würde die Beziehung zwischen ihnen nicht einfacher machen. In letzter Zeit widersprach sie ihm oft und hatte aufgehört, seine Ratschläge zu beherzigen. Er hatte Angst, sie zu verlieren, und wusste nicht, wie er es verhindern konnte. War er zu streng, schürte das ihren Trotz und ihren Widerstand nur noch mehr. Also ließ er sie schweren Herzens ziehen.
»Grüß Robert von mir«, sagte er, »Garland und Rita auch.«
Kaye ahnte, dass es ihrem Vater schwerfiel, sie nicht zu bitten, doch nach Hause zu kommen. Dass es ihm schwerfiel, ihr nicht zu sagen, dass sie vorsichtig sein sollte, denn in der Nacht war es gefährlich auf den Straßen im Reservat. Auf einer dieser einsamen Straßen war ihre Mutter gestorben.
Aber sie konnte Auto fahren, seit sie dreizehn war. Und sie konnte es gut, davon hatte er sich mehr als einmal überzeugt. Ihr Vater tat ihr leid, als sie ihn so hilflos sah, aber er würde begreifen müssen, dass sie kein Kind mehr war.
»Mach ich, Daddy.«
Kaye sprang die Treppen hinauf in ihr Zimmer. Sie duschte, schlüpfte in ihre Lieblingsjeans – die ausgeblichene mit dem Loch im Knie – und holte ihre weiße Leinenbluse aus dem Schrank. Ihr schweres, leicht rötlich schimmerndes Haar steckte sie am Hinterkopf wieder zu einem Knoten zusammen. Diesen Knoten hatte ihre Mutter sie gelehrt. Sie brauchte nur zwei gebogene Silbernadeln, um ihn zu befestigen.
Kaye war froh, dass sich – was ihr Äußeres betraf – die Gene ihrer Mutter durchgesetzt hatten. Zugegeben, der rötliche Schimmer in ihrem Haar und die blauen Augen waren nicht sehr indianisch, aber ihre Haut schimmerte dunkel wie die Schale einer Haselnuss, und die winzigen Sommersprossen auf der Nase konnte man nur entdecken, wenn man ihrem Gesicht ganz nahe war.



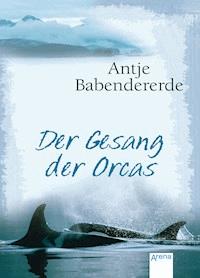
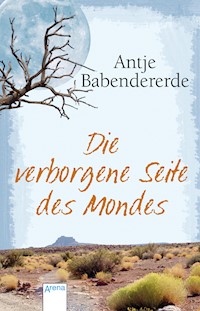


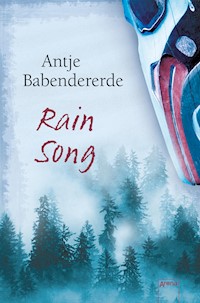

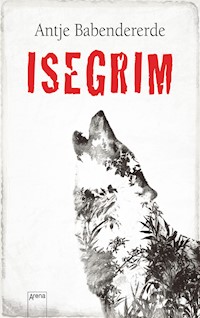
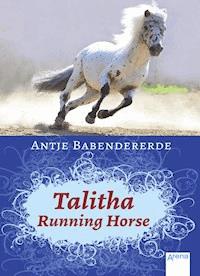

![Triff mich im tiefen Blau [Ungekürzt] - Antje Babendererde - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/75f072b5b02089501721ce263e658ce1/w200_u90.jpg)