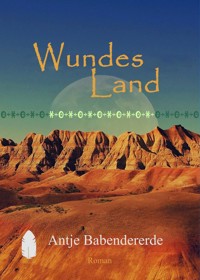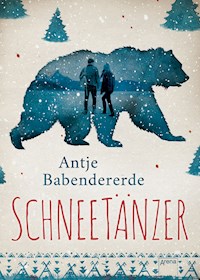13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Einfühlsam beschreibt DELIA-Literaturpreis-Gewinnerin Antje Babendererde das Lebensgefühl einer ganzen Generation, hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch nach Leichtigkeit, Liebe und in vollen Zügen leben und der Angst vor einer Zukunft in ungewissen Zeiten. Wild wogen die Wellen um die kleine Hebrideninsel Orasay, wo Leonie bei ihrer Mutter Zuflucht sucht. In Leonie dagegen ist alles verstummt, denn sie trägt ein Geheimnis mit sich herum, das sie fast erdrückt. Erst die Begegnung mit dem Inseljungen Tam und seine besondere Verbindung zu einem wilden Delfin wecken ihre Neugierde. Stück für Stück locken Tam und der Delfin Leonie zurück ins Leben und sie öffnet sich der Magie der Insel und dem faszinierenden Jungen, hinter dessen sturmgrauen Augen ein stiller Schmerz lauert. Doch als Meeresschützer auf Orasay auftauchen, muss Leonie zu ihren Überzeugungen stehen und gerät damit zwischen die Fronten. Können die beiden es schaffen, gemeinsam zu kämpfen? Für die Insel, für das Meer, für sich selbst – und für ihre Liebe? Tragisch, romantisch und bittersüß – Leonies und Tams Geschichte trifft mitten ins Herz! Für alle ab 14, die nicht ganz alltägliche Liebesgeschichten und wild-romantische Natur lieben! Weitere Romane von Antje Babendererde im Arena-Verlag (Auswahl): Im Schatten des Fuchsmondes Der Sommer der Blauen Wünsche Schneetänzer Libellensommer Der Gesang der Orcas
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Weitere Bücher von Antje Babendererde im Arena Verlag:
Schneetänzer
Wie die Sonne in der Nacht
Der Kuss des Raben
Isegrim
Julischatten
Rain Song
Indigosommer
Die verborgene Seite des Mondes
Libellensommer
Der Gesang der Orcas
Lakota Moon
Talitha Running Horse
Findet mich die Liebe?
Sommer der blauen Wünsche
Im Schatten des Fuchsmondes
Triff mich im tiefen Blau ist auch als Hörbuch erhältlich
Antje Babendererde,geboren 1963, wuchs in Thüringen auf und arbeitete nach dem Abi als Hortnerin, Arbeitstherapeutin und Töpferin, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Seit vielen Jahren gilt ihr besonderes Interesse der Kultur, Geschichte und heutigen Situation der Indigenen in Nordamerika, ihre einfühlsamen Romane zu diesem Thema für Erwachsene wie für Jugendliche werden von der Kritik hoch gelobt. In weiteren Romanen entführt Antje Babendererde ihre Leser*innen in ihre thüringische Heimat sowie in die schottischen Highlands, an die sie auf ihren Reisen ihr Herz verloren hat.
Für meine Enkeltochter Lailaund die kommenden Generationen
Ein Verlag in der Westermann Gruppe
1. Auflage 2024
© 2024 Arena Verlag GmbH
Rottendorfer Straße 16, 97074 Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Text: Antje Babendererde
Lektorat: Frank Griesheimer, Starnberg
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München, unter Verwendung von Motiven von AdobeStock
Hintergrund: © stock.adobe.com/golubovy;
Landschaft: © stock.adobe.com/Maciej Olszewski;
Glitter: © stock.adobe.com/sKjust, stock.adobe.com/agratitudesign;
Goldschlieren: © Johannes Wiebel; Delphin: © Johannes Wiebel
Innenvignetten: Johannes Wiebel
Umschlagtypografie und Gestaltung des Farbschnitts auf Basis der Gestaltung von Johannes Wiebel: Sora Kim
Layout und Satz: Malte Ritter
E-ISBN 978-3-401-81078-2
Besuche uns auf:
www.arena-verlag.de
@arena_verlag
@arena_verlag_kids
Niemand ist eine Insel,
die nur aus sich selbst besteht.
Jeder Mensch ist Teil eines Kontinents,
Teil eines Ganzen.
John Donne
SECHS JAHRE ZUVOR
Das junge Delfinweibchen stieß Blas durch ihr Atemloch und gab ein mattes Pfeifen von sich, in der Hoffnung, ihre Kameraden würden sie hören und ihr helfen. War ihr ausgelassenes Spiel den anderen wieder einmal zu grob gewesen? Offenbar hatte sich die Gruppe unmerklich von ihr entfernt und nun war sie in diese missliche Lage geraten. Es herrschte Ebbe und ihr Körper war bedeckt von schwerem Seetang. Verzweifelt bewegte sie ihre Schwanzflosse, nur um erneut den scharfen Schmerz zu spüren, der sich in ihrem ganzen Körper ausbreitete. Ein Nylonfaden hatte sich um den Stiel ihre Fluke gewickelt und schnitt bei jeder Bewegung tiefer ins Fleisch.
Das Delfinweibchen kämpfte schon seit Stunden, doch dem Nylonfaden hatte sie nichts entgegenzusetzen und ihre Kräfte schwanden. Mit steigender Flut hätte sie sich aus Tang und Seegras selbst befreien können, doch die Angelschnur hielt sie fest. Stieg das Wasser, würde sie jämmerlich ertrinken.
Ihr Lebenswille schwand von Minute zu Minute, längst war sie bereit, sich dem Tod zu ergeben. Doch auf einmal hörte das Delfinweibchen wieder diese seltsamen Töne, die schon seit Tagen ihre Neugier geweckt und sie immer wieder veranlasst hatten, sich von ihrer Gruppe zu entfernen. Töne, die unverständlich für sie waren, weil sie nur wirre Bilder erzeugten. Und die doch etwas anrührten in ihrem Inneren. Die Töne gehörten zu diesem Wesen im Boot, das manchmal in der kleinen, geschützten Bucht dieser Insel ankerte. Sie hob den Kopf aus dem Tang und pfiff. Hilf mir, rief sie, wer auch immer du bist.
Als Tam diesen seltsamen Laut vernahm, hörte er auf zu schluchzen und hob den Kopf. Mit tränenverschleiertem Blick suchte er das Seegrasbett am Rand der dunklen Felsen ab. Er wischte sich mit dem Ärmel über die Augen und schließlich entdeckte er die große, sichelförmig gebogene Finne, die aus den Tangbüscheln ragte. Ein Orca, dachte Tam im ersten Moment erschrocken. Doch Killerwale hatten sich bisher noch nie in die Gewässer um Orasay verirrt. Offenbar hatte sich ein Delfin im Seegras verfangen.
Tam zog die Ruder aus den Dollen und nahm eines zu Hilfe, um mit seinem kleinen Holzboot näher heranzustaken. Sein Herz überschlug sich beinahe, denn auch Delfine waren wilde Tiere, aber die Neugier hatte ihn fest im Griff. Er wusste, dass eine Gruppe von Großen Tümmlern in den Gewässern um die Inseln zu Hause war, an die zwanzig Tiere. Die Einheimischen nannten sie die Deagh Boys, die guten Jungen, obwohl es nicht nur Jungen waren, das hatte sein Da, sein Vater, ihm versichert. Dieses Jungtier schien in Not geraten zu sein, aber die hereinströmende Flut würde dem Delfinkalb helfen, sich zu befreien.
Als sich die Fluke des Delfins aus dem Tang bewegte, entdeckte Tam die blutigen Einschnitte. Das Tier hatte sich rettungslos in einer Angelschnur verheddert. Wie oft hatte sein Da die beiden halbwüchsigen Söhne von AaronMacPheil schon gebeten, sie sollten keine Angelschnüre oder Krabbenleinen im Wasser zurücklassen, weil sich Robben, Otter oder andere Meerestiere darin verfangen konnten. Jetzt war es also passiert.
Wenn er dem jungen Delfin helfen wollte, musste Tam sich beeilen. Er war erst zwölf, pummelig und zu klein für sein Alter, und er hatte Respekt vor dem Meer und seinen Bewohnern. Das Tier im Seegras war über zwei Meter lang, fast so groß wie sein Boot. Tam hatte einige Male dabei geholfen, als sein Da Tiere aus Nylonschnüren befreit hatte, einmal sogar eine Robbe. Er selbst hatte mal eine Möwe gerettet, aber einen Delfin? Tams Körper bebte vor Furcht.
Manchmal müssen wir Dinge tun, die uns Angst machen, hatte sein Da mal zu ihm gesagt. Deshalb stakte Tam Stück für Stück mit dem Ruder weiter durch den Tang, bis er den Delfin erreicht hatte. Instinktiv konnte er die Verzweiflung und Panik des Tieres spüren, also beugte er sich über das Dollbord und legte beruhigend seine Hand auf die graue, gummiartige Haut. Sie war kühl, aber erstaunlich lebendig und sogleich spürte Tam die Verbindung. Sein Inneres durchfuhr etwas, das er noch nie erlebt hatte. Es schien, als ob sich die Empfindungen des Tieres auf seinen eigenen Körper übertrugen: Panik, Schmerz, Verlorensein. Gefühle, die seit Màiris Tod auch Tam beherrschten.
Der Delfin hob seinen Kopf aus dem Wasser und Tam schluckte verwirrt. Was war das? So sah doch kein Tümmler aus. Das Tier hatte eine viel zu kurze Schnauze und eine steile Stirn. Der Delfin betrachtete ihn aus einem großen, intelligenten Auge. Hilf mir, schien sein flehender Blick zu sagen.
Ohne darüber nachzudenken, zog Tam sein Taschenmesser aus der Hosentasche und glitt aus dem Boot. Das eisige Wasser des Atlantiks reichte ihm bis zur Hüfte und sekundenlang verschlug die Kälte ihm den Atem. Doch dann konzentrierte sich sein ganzes Sein auf dieses Wesen, das seine Hilfe brauchte. Er konnte spüren, dass der junge Delfin ihm vertraute. Tam murmelte beruhigende Worte, während er mit seinem Messer vorsichtig die Angelschnüre von der Schwanzfluke schnitt. Blut trat aus den Schnitten, dickes Blut, das seine Finger glitschig machte und die Befreiung erschwerte.
Erneut hob der seltsame Delfin seinen Kopf aus dem Tang und beobachtete den Jungen bei seinem Tun. Da hatte das Tier längst einen Platz gefunden in Tams wundem Herzen.
Das Wasser färbte sich rot, aber der Delfin war frei. Tam hoffte, die Wunde würde heilen und das Tier überleben. Mit klammen Fingern hievte er sich in sein Boot zurück und bahnte dem Tier damit einen Weg durch den Tang ins offene Wasser. Der Delfin umrundete das Boot, in dem Tam zähneklappernd, aber lächelnd saß. Er schlug mit der befreiten Fluke platschend aufs Wasser und eine Fontäne aus Blas schoss mit einem Fauchen aus seinem Atemloch. Schließlich dankte ihm das Tier mit seltsamen Klicklauten und verschwand aufs offene Meer hinaus.
Tam blickte dem seltsamen Delfin sehnsüchtig nach, voller Hoffnung, ihn eines Tages wiederzusehen.
Ainʼt got no tears left to cry, singt Ariana Grande. So Iʼm pickinʼ it up, pickinʼ it up. Charlottes Lieblingslied. Meine beste Freundin steht auf Ariana Grande, deshalb ist dieser Song auf meiner Playlist gelandet. Wegen Milo reden Charly und ich nicht mehr miteinander, aber No tears left to cry habe ich behalten.
Mein Magen macht einen Hüpfer bis zum Herzen und ich öffne die Augen. Durch Risse in der grauen Wolkendecke unter mir kommt Orasay in Sicht, eine kleine, zerklüftete Insel in Form einer Schildkröte, die in einem grün schäumenden Meer schwimmt. Ich ziehe die Stöpsel von Pas altem MP3-Player aus den Ohren. Wieder sackt die Twin Otter ab und mein Magen hebt sich erneut.
Der kleine Flieger ruckelt und hüpft inselwärts. Es gibt keine richtige Trennung zwischen Cockpit und Kabine, und als ich meinen Kopf verrenke, um einen Blick aus dem Cockpitfenster zu werfen, sehe ich ein paar dunkle Hügel, die vor uns aus den Wolken tauchen. An der Küste verstreut stehen kleine Häuser, dunkle Klippen wechseln sich ab mit von Gischt überzogenen hellen Sandbuchten. Mein Magen tanzt, das Herz klopft schneller. Früher hatte ich nie Angst vorm Fliegen, aber die Twin Otter mit mir und der Handvoll anderen Passagieren an Bord ist klein und wackelt im Wind wie ein Spielzeug. Eine riesige Bucht kommt in Sicht, begrenzt von grasbewachsenen Dünen, in denen ein orangefarbener Windsack leuchtet.
Der Pilot fährt das Fahrwerk aus und beginnt, einen weiten Bogen zu fliegen. Nirgendwo eine feste Rollbahn, keine Markierungen, nur heller, nasser Sand.
Die Hebrideninsel Orasay hat den einzigen Flughafen der Welt, an dem regelmäßig ein Linienflieger auf dem Strand landet und wo Start- und Landezeiten sich nach Ebbe und Flut richten. Ich war nicht wild gewesen auf diese Erfahrung, aber mir war schlichtweg nichts anderes übrig geblieben, denn Ma hatte gemeint, die Fährverbindungen zu den Hebriden würden ständig aus irgendwelchen Gründen ausfallen. Gerade bin ich mir nicht sicher, ob das nicht das kleinere Übel gewesen wäre. Oder ob ich nicht doch besser im sicheren Hafen meines Berliner Zimmers geblieben wäre. Zu Hause, bei meinem Vater und Doreen.
Meine Eltern ließen sich scheiden, da war ich fünf. Pa sagt, wir wären lange Zeit glücklich gewesen zu dritt, aber an ein zu dritt kann ich mich nicht mehr erinnern. Nur daran, dass ich eine Woche bei meiner Mutter und eine bei meinem Vater wohnte. Das war nicht, was ich mir wünschte, aber ich kam klar. In meiner Klasse war ich nicht die Einzige mit diesem Familienmodell und es hatte durchaus seine Vorteile.
Als ich elf war, erfüllte Ma sich ihren großen Traum und gründete den Reiseblog GlobalViewpoint.de. Von da an war sie entweder auf Reisen oder megagestresst, denn ihr Blog war supererfolgreich. Ein paar Mal habe ich sie in den Ferien auf ihren Recherche-Reisen begleitet: Rumänien, Korsika, die Kanaren, Norwegen. Das war abenteuerlich gewesen und ich hatte es geliebt. Hatte mir ausgemalt, von nun an würde es immer so sein: Ma und ich und die fremden Länder. Aber meistens erkundete meine Mutter ohne mich die Welt und überließ mich der beständigen Fürsorge meines Vaters.
Pa, der als Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten arbeitet, war fast immer müde und geschafft, wenn er aus dem Büro kam. Aber er sorgte für mich, war immer da und hörte zu. Ich liebte ihn und die meiste Zeit kamen wir gut miteinander aus. Allerdings endete sein väterliches Verständnis, als er herausfand, dass ich jeden Freitag Schule schwänzte, um bei den Fridays for Future-Demonstrationen mitzumachen.
Mein Vater verbot mir, dem Unterricht fernzubleiben. Aber inzwischen war ich dreizehn und tat es trotzdem. Pa arbeitete weniger, versuchte, mehr Zeit mit mir zu verbringen. Doch die Fürsorge meines Vaters war wie ein Kokon, aus dem ich mich befreien wollte. Endlich meine Flügel ausbreiten und losfliegen. Es besser machen, richtig, oder einfach nur anders.
Dann brach die Pandemie über uns herein und der lange Lockdown legte sich wie eine Decke über unser Leben. Ma steckte in Amerika fest und ich quälte mich mit Unterrichtsausfall, Home-Schooling (mehr Home als Schooling) und meiner unglücklichen Liebe zu Anton, einem schüchternen Jungen aus meiner Klasse.
Padatete immer mal wieder jemanden, aber länger als ein paar Wochen hielten diese Beziehungen nie. Als ich ihm das bei einer unserer zahlreichen Reibereien mal unter die Nase hielt, meinte er, zwischen Job und Vatersein bliebe ihm einfach nicht genug Zeit, um sich den Bedürfnissen eines weiteren Menschen zu widmen. Ich würde ihn schließlich gehörig auf Trab halten.
Vor einem Jahr bescherte Pa mir dann doch noch eine Stiefmutter: Doreen, die als neue Mitarbeiterin im Büro des Bundestagsabgeordneten angefangen hatte und die inzwischen bei uns wohnt, denn es ist Nachwuchs im Anmarsch.
Letzten September rief Fridays for Future zum Klimastreik auf. Meine Freundin Charly, ich und noch fünf andere aus unserer Klasse waren dabei, als in Berlin hunderttausend auf die Straße gingen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, haben wir im Chor der Hunderttausend gerufen. So viele Menschen – und mittendrin sind Milo und ich uns begegnet.
Dass jemand wie Milo Wegener, der so viel älter war als ich, sich für mich interessierte, brachte mein Inneres gehörig durcheinander. Ich verliebte mich Hals über Kopf, weil sich mit Milo eine neue Welt für mich auftat, eine neue Dimension des Kämpfens. Milos Haltung war so unbedingt, dass mir meine dagegen auf einmal nur noch halbherzig vorkam.
Zwei Monate lang gab es nur noch ihn und mich und den Klimaprotest. Jemanden an meiner Seite zu haben, der Antworten auf meine Fragen hatte und der mich an seinen rebellischen Ideen teilhaben ließ, war ein großartiges Gefühl. Ich kam mir ungeheuer frei und erwachsen vor.
Milo und ich diskutierten und küssten und stritten. Auf dem Bett seines chaotischen WG-Zimmers breitete er seine komplexe Weltsicht vor mir aus und dann schliefen wir miteinander. Es war mein erstes Mal und das alles gehörte irgendwie zusammen, das Kämpfen und die Liebe. Ich war ein Teil von Milos Welt – jedenfalls glaubte ich das damals. War wie berauscht von großen Gefühlen und dem Kampf um die Zukunft unseres Planeten.
Pa erzählte ich nichts von Milo, aus Furcht, er würde mir verbieten, mich mit einem jungen Mann zu treffen, der sieben Jahre älter als ich und noch dazu ein radikaler Umweltschützer war. Denn die Demos reichten Milo damals schon nicht mehr, er wollte größere Wellen machen im Meer der Veränderung.
Während Charly und ich und die anderen fünf aus meiner Klasse an einer Klage gegen Deutschland feilten, die wir beim Obersten Gerichtshof einreichen wollten, schmiss Milo sein Lehramtsstudium, schloss sich der Klimabewegung Letzte Generation an und klebte sich mit anderen auf der Straße fest. Eine schriftliche Klage wäre keine Option mehr für das Klima, das würde alles viel zu lange dauern, schließlich sei es längst fünf nach zwölf.
Dann kam dieser Montag Ende November. Nach glühenden Diskussionen hatte Milo mich davon überzeugt, bei einer dieser Straßenaktionen mitzumachen. »Bekenne Farbe, Leonie«, hatte er gesagt, »du bist doch eine Kämpferin. Solange wir nur reden, hört niemand zu.«
Ich war da und klebte mit meinen Händen am Asphalt.
Wer nicht kam, war Milo.
Während ich mit den anderen an der Straße klebte, wurden wir von Leuten an den Haaren gezogen, angepöbelt und bespuckt. Widerliches Gesindel! und Ich hoffe, du atmest nicht mehr lange! waren noch die harmlosesten Beschimpfungen. Aber sie waren wie Gift für mich.
Die Polizei kam, um die Blockade aufzulösen. Der ältere Polizist, der meine Hand mit Nagellackentferner, Öl und einem Strick vom Asphalt löste, rief meinen Vater an. Weil ich noch minderjährig war, wurde ich nicht mit den anderen auf die Wache gebracht. Pa holte mich ab und er tobte. Ich würde seiner Karriere schaden, schrie er, und was ich mir dabei gedacht hätte.
Ich hätte doch Glück. Wäre privilegiert. Schließlich wären wir nicht auf der Flucht vor einem Krieg. Ich hätte es warm, trotz Energiekrise, genug zu essen und alles, was ich brauche. Im selben Atemzug verhängte er wochenlangen Hausarrest, gegen den ich nicht mal protestierte, denn nach diesem Tag war nichts mehr, wie es mal war für mich.
Von heute auf morgen verlor ich jegliche Motivation, war ziellos, planlos, mutlos. Der Hass, der der Klimabewegung entgegenschwappte, ließ mich nicht mehr schlafen. Ich ertrank in bad news – apokalyptischen Bildern und Berichten von Bränden, Dürren und Überschwemmungen rund um die Uhr.
Meine Noten sackten in den Keller, ich zog mich von meinen Freunden zurück und wollte irgendwann auch Charly nicht mehr sehen. Oder vielleicht war sie es auch, die mich nicht mehr sehen wollte. Im Unterricht bekam ich Panikattacken, also meldete ich mich krank oder schwänzte und schließlich schaffte ich es nicht mehr, meine Schutzzone zu verlassen. Nach den Winterferien ging ich nicht mehr in die Schule. Wozu noch lernen? Welchen Sinn hatte es, Abi zu machen und zu studieren, wo ich doch jeden Glauben an eine Zukunft verloren hatte?
Wieder auf die Straße zu gehen, wenn Milo nicht mehr an meiner Seite war, erschien mir sinnlos. Ein Gefühl der Machtlosigkeit erfasste mich, als wäre es auch meine Schuld, dass die Welt den Bach runtergeht. Weil ich zu schwach war und nicht mehr in der Lage, etwas dagegen zu tun.
Ständig beobachtet von meinem erst wütenden, dann zunehmend besorgten Vater, verbrachte ich den Rest des Winters zum überwiegenden Teil in meinem Bett. Es war mein Kahn, meine Arche, auf der ich ohne Ruder und ohne Kompass ziellos dahindümpelte, in der irrationalen Hoffnung, eines Tages in einer besseren Welt zu stranden.
Schließlich schleifte Pa mich zu einer Seelenklempnerin. Zweimal die Woche sollte ich Ildiko Brenner mein Herz ausschütten. Immerhin konnte ich die junge Therapeutin gut leiden und wir hatten einen Draht zueinander. Sie hörte zu und versuchte nicht, mir einzureden, ich bräuchte vor Idioten keine Angst zu haben, und außerdem würde die Welt schon nicht so schnell untergehen.
Sie sagte: »Das Leben ist nicht nett, Leonie. Es ist chaotisch und tut weh und man kann es nicht beherrschen.« Sie sagte auch: »Niemandes Leben ist in Ordnung.«
Als es mir im Frühling besser ging und die elfte Klasse ohnehin gelaufen war, schlug Frau Brenner einen Umgebungswechsel vor. Was ich davon halten würde, den Sommer bei meiner Mutter auf Orasay zu verbringen? Weg von Berlin. Weg von meinem überforderten Vater und seiner schwangeren Doreen. Weg von Milo.
Tam sitzt in seinem schaukelnden blau-roten Boot. Er ankert auf der Ostseite der Insel Farransay, in einer versteckten Bucht, die von den Inselchen Crannag im Westen und Eilean Rhuada im Osten geschützt wird. Es herrscht Ebbe und das Meer ist kabbelig. Im April waren die Äußeren Hebriden von einem furchtbaren Frühjahrssturm heimgesucht worden, dem schlimmsten seit Jahren. Dabei entkamen aus der Lachszuchtanlage vor Eilean Ròin, für die sein Da arbeitet, erneut Abertausende Lachse aus den Käfigen ins offene Meer. Sein Vater hatte wochenlang enorm unter Druck gestanden deswegen. Die Lachszuchtanlage des norwegischen Konzerns Norwegian Salmon, genannt NOSA, ist den Fischern von Orasay inzwischen ein Dorn im Auge, weil sie das Meer verschmutzt und die Wildlachsbestände gefährdet.
Auch in den letzten beiden Maiwochen hatte es so wild gestürmt, dass die Insulaner ihre Häuser nicht verlassen konnten und der Fährverkehr eingestellt werden musste. Doch jetzt zeigt sich das Meer wieder von seiner friedlichen Seite und Tam hält Ausschau nach Kila, seiner Meeresfreundin. Noch einmal klopft er gegen die Bootsplanke, schiebt zwei Finger in den Mund und stößt einen lauten Pfiff aus.
Der Wetterbericht hat eine lange Schönwetterperiode für die Äußeren Hebriden vorhergesagt, gerade rechtzeitig zum Start der Touristensaison. Zwar werden die meisten Urlauber erst mit Beginn der Ferien in drei Wochen eintreffen, aber der Juni ist ein beliebter Monat für Wanderer, Radfahrer, Seekajakfahrer und Leute, die die Inseln mit ihren Camper-Vans bereisen.
Es ist halb drei und Tam hört die Twin Otter, die über dem Cockle Strand, dem Herzmuschelstrand, im Landeanflug ist. Er verfolgt den Flug des kleinen blau-weißen Fliegers der Loganair am grauen Himmel und wird unvermittelt von einem diffusen Vorgefühl erfasst: Jemand wird kommen.
Im selben Moment wundert Tam sich über diesen Gedanken, denn: Viele werden kommen. Seit Orasay den Wettbewerb Most beautiful Island of Great Britain gewonnen hat, besuchen noch mehr Touristen die Insel. Sie wird immer beliebter, der weißen Strände und des karibisch türkisfarbenen Wassers wegen, die ihr den Namen Orabados eingebracht haben.
Auf Orasay und dem noch südlicheren Inselchen Caolas, das durch einen Fahrdamm mit Orasay verbunden ist, leben nur rund eintausend Menschen, aber im Sommer werden die Inseln von Touristen überschwemmt. Sie bringen das ruhige Inselleben durcheinander, sind jedoch gleichzeitig ein Garant fürs Überleben der Einheimischen.
Jemand wird kommen und etwas wird sich verändern, sagt ihm sein Gefühl. Tams Brust wird eng, denn er mag keine Veränderungen. Niemand auf der Insel tut das.
Sein Boot beginnt zu schaukeln und ein vergnügtes Pfeifen dringt an seine Ohren. Aus dem kabbelnden Wasser neben der Bordwand taucht Kilas graues, gummiartiges Gesicht mit dem immer gleichen freundlichen Lächeln auf. Sie öffnet ihr Maul, mit den sieben spitzen Zähnen im Unterkiefer. Im Oberkiefer hat sie nur Stummel, das ist ihr Risso-Delfin-Erbe.
Zu Beginn ihrer Freundschaft hatte Tam versucht, Kila mit Fisch zu füttern, aber davon war das Delfinmädchen wenig begeistert gewesen. Es hatte nur ab und zu eines seiner Almosen angenommen, wohl um ihm eine Freude zu machen. Inzwischen weiß Tam, dass Kila mehr auf Oktopusse steht als auf Fisch, denn sie ist ein äußerst seltenes, ein beinahe magisches Wesen: ein Hybride aus Großem Tümmler und Rundkopfdelfin.
Kila betrachtet ihn mit einem vergnügten Auge, sie ist guter Laune. Tam kennt seine Meeresfreundin jetzt seit mehr als sechs Jahren und er weiß, dass sie sich während des Sturms in einem der zahlreichen langen Meerarme hier an der Ostküste in Deckung gebracht hat.
Sie taucht unter und bringt das Boot gefährlich ins Schwanken. Delfin-Schabernack. Kila ist genauso glücklich darüber, dass der Sturm vorüber ist, wie er. Tam hält sich an den Seiten des Bootes fest, um nicht ins Wasser zu fallen. Die auf über drei Meter Länge angewachsene Kila kann manchmal im Eifer des Spiels ihre Kräfte nicht richtig einschätzen.
Noch einmal schaut Tam sich um, aber sie sind ganz allein in der Bucht von Farransay, abgesehen von ein paar Kormoranen, die auf den Felsen am Ufer ihre Flügel ausgebreitet haben, um ihr schwarzes Gefieder zu trocknen. Er zieht sich bis auf seine Badeshorts aus und lässt sich aus dem Boot ins kalte Wasser gleiten, um eine Weile mit Kila zu schwimmen.
Seit drei Jahren schwimmt Tam jetzt schon ohne Neoprenanzug, so wie Màiri es getan hatte. Das Wasser wird hier auch in den Sommermonaten niemals wärmer als fünfzehn Grad, doch die hat es Anfang Juni noch lange nicht erreicht.
Kila hat neue Schrammen auf ihrer Haut, weiße Linien, die wie seltsame Hieroglyphen anmuten, Zeichen aus der Unterwasserwelt. Vielleicht war sie ihren Tümmler-Verwandten begegnet, vielleicht hatte sie sich ihre empfindliche Haut auch während des Sturms an einem Riff verletzt oder beim Kampf mit einem Oktopus.
Delfine sind gesellige Tiere und normalerweise leben sie in Gruppen. Doch Kila ist eine Lone Ranger, eine Einzelgängerin, ob nun freiwillig oder unfreiwillig, das hatte sie Tam bisher noch nicht verraten. Vielleicht wird sie aufgrund ihrer Andersartigkeit von den Deagh Boys gemieden. Wegen ihres Russo-Delfin-Anteils ist Kila größer und stärker als die Mitglieder der Gruppe Großer Tümmler, die sich permanent um die Inseln aufhalten. Und sie taucht nach Oktopussen, statt Fisch zu fressen. Es ist aber auch durchaus möglich, dass Kila ihre Einsamkeit selbst gewählt hat. Dass sie es aufregender und interessanter findet, ihre Zeit mit Tam zu verbringen als mit den Tümmlern.
Kila taucht zwischen seinen Beinen auf, dieses Spiel liebt sie ganz besonders. Tam hält sich an ihrer Finne fest und lässt sich ein Stück von ihr ziehen, doch bevor Kila ihn zu weit aufs Meer hinaustragen kann, lässt er los. Sie beginnt, ihn zu umkreisen, stößt prustend ihren fischigen Blas in die Luft, und als er zum Ufer zurückschwimmt, verliert sie das Interesse an ihm. Mit ein paar schnellen Schwanzbewegungen ist sie fort. Kila entscheidet selbst, ob sie Lust hat, mit ihm zu spielen, oder nicht.
Auf den letzten Metern vor der Landung halte ich den Atem an. Die Räder setzen auf und meine inneren Organe schlagen Purzelbäume. Mehrere Male erhebt sich ein Vorhang aus Gischt, durchsetzt mit Algenbüscheln, vom Strand, wenn der Flieger durch Pfützen rollt, die die zurückweichende Flut hinterlassen hat. Die Twin Otter holpert noch ein Stück näher an den kleinen Terminal heran, dann stehen die Propeller still. Die anderen Passagiere klatschen anerkennend, aber ich kann mich noch nicht rühren. Erst jetzt wird mir bewusst, dass ich am ganzen Körper schweißgebadet bin.
Als ich mit den anderen Reisenden über den feuchten Sand zum kleinen Flughafengebäude laufe, wäre ich beinahe auf grünem Tang ausgerutscht. »Rabhadh – Vorsicht!« Eine ältere Frau packt mich fest am Arm und verhindert, dass ich mich auf den Hosenboden setze.
»Danke«, murmele ich. Und als ich den Blick wieder nach vorne richte, sehe ich meine Mutter, mit beiden Armen winkend, hinter der Holzbrüstung auf dem Parkplatz stehen. Ich winke zurück, doch meine Schritte verlangsamen sich. Mein Körper ist gelandet, meine Seele noch im Transit. Ich bin freiwillig hier, aber nicht auf eigenen Wunsch. Bei Ma auf Orasay zu sein, ist eine Art rettende Zuflucht.
Schließlich stehe ich vor meiner Mutter und hole tief Luft. Ma nimmt mich in die Arme. Ihre Freude ist überschäumend, ich spüre das wilde Klopfen ihres Herzens an meinem. Es gab Zeiten, da habe ich sie schrecklich vermisst, und Zeiten, da war ich wütend auf sie, weil sie nicht für mich da war, wenn ich sie brauchte. Aber jetzt ist sie da und ihre feste Umarmung ist so tröstlich, dass mir doch ein paar Tränen über die Wangen rinnen.
»Hey, nicht weinen, Leonie. Alles wird gut, kleine Löwin.«
Sag das noch mal, denke ich. Denn daran, dass alles gut wird, glaube ich schon lange nicht mehr. Dafür weiß ich zu viel und manchmal kann Wissen auch lähmen. Ich stecke in einer Sackgasse, deshalb bin ich hier.
Vom Flugpersonal, zwei Männern in orangefarbenen Warnwesten, bekomme ich meinen Koffer und die Reisetasche ausgehändigt. Ma verstaut mein Gepäck in ihrem Camper, der offensichtlich als Transportfahrzeug dient, denn er ist voller Farbeimer, Holzleisten, Blumenerde und einer alten Teppichrolle. Den Schriftzug Global Viewpoint hat sie mit Farbe übersprüht.
»Mit dem Bloggen habe ich endgültig abgeschlossen und will hier auf der Insel auch nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden«, erklärt Ma die blauen Wolken auf dem weißen Van.
Ma, die nach ihrem letzten Blogbeitrag über den Golden Highway in Colorado einen üblen Shitstorm geerntet hat, ist fest entschlossen, auf ihrer Lieblingsinsel sesshaft zu werden und ein vollkommen neues Leben zu beginnen. Meine Mutter war neunzehn, als sie zum ersten Mal nach Orasay kam, eine der südlichen Inseln der Äußeren Hebriden. Damals studierte sie zur selben Zeit wie mein Pa mit einem Erasmus-Stipendium Journalismus in Edinburgh und zusammen mit ihrer schottischen Freundin Catriona besuchte sie in den Ferien deren Eltern auf Orasay. Damals schien eine Woche lang die Sonne und meine Mutter verliebte sich auf der Stelle in die kleine Insel, als sie die vom Flieger aus zum ersten Mal sah.
Doch für immer hier leben, will sie das wirklich?
»Die Menschen auf Orasay sind freundlich und hilfsbereit«, sagt Ma, »aber ich fürchte, jeder hier hält mich für eine verwöhnte Deutsche. Sie haben geglaubt, nach dem ersten Herbststurm bin ich wieder weg. Und ich sage dir, es hat mächtig gestürmt in den letzten Monaten.« Sie lacht.
Ich hole mein Handy aus dem Flugmodus und wähle die Nummer meines Vaters, um ihm zu versichern, dass ich gut gelandet bin. Pa sitzt in einem Teamgespräch im Büro seines Abgeordneten und das Telefonat ist kurz. Danach steige ich zu Ma in den Van. Sie startet den Motor und wir biegen auf eine einspurige Straße in Richtung Osten. Linker Hand erstreckt sich die große Herzmuschelbucht, rechts weiden braune Highland-Rinder auf einem blühenden Rasenmeer und dahinter liegt der weite, endlose Nordatlantik. Dreitausend Kilometer offenes Meer bis … Neufundland?
Die Straße entlang der Küste ist schmal, nur ab und zu verbreitert sie sich zu einer versandeten Ausweichbucht. Als sie sich eine Anhöhe hinaufwindet, beginnt es zu nieseln und Ma stellt den Scheibenwischer an, der trübe Schlieren auf der Scheibe hinterlässt. Ich bin froh, im Van meiner Mutter und nicht mehr im Flieger zu sitzen.
Für mich ist es der zweite Besuch auf der Insel, den ersten habe ich nur noch vage in Erinnerung. Damals war ich sechs und mir ist eine lange, wilde Fährfahrt im Gedächtnis geblieben, auf der mir so übel war, dass ich einen Tag brauchte, um mich davon zu erholen. Ich erinnere mich an Sturmwellen, an dichten Nebel und tagelangen Regen, aber auch an türkisfarbenes Meer, ein gemütliches Steinhaus, in dem es nach Torf roch, an Krabbenkörbe, Netze und an den Duft von frisch gebackenen Haferkeksen.
Wir hatten einen Sommer im B&B von Catrionas Eltern verbracht, weil Ma über Orasay und die anderen Inseln der Äußeren Hebriden schreiben wollte. AnnagMacPherson und ihr Mann Graham waren im vergangenen Jahr zu ihrer Tochter und ihren beiden Enkeln aufs Festland gezogen. Ma hatte Catriona ihr Elternhaus kurzerhand abgekauft und war mit ihrem wenigen Hab und Gut auf die Insel gezogen.
»Keine Bange«, sagt Ma. »Für die nächsten beiden Wochen ist sonniges, windstilles Wetter angesagt. Du kannst Orasay mit dem Rad erkunden und es wird sich von seiner besten Seite zeigen.«
Bis zum Haus meiner Mutter auf der Ostseite der Insel sind es jetzt nur noch drei Kilometer und kurz hinter dem Ortsschild Leanish biegt sie nach links in eine noch schmalere Teerstraße ein. Leanish besteht aus ein paar in den Schären verteilten Häusern, aber oben an der Straße habe ich nur zwei Briefkästen gesehen. Nach ein paar Metern führt rechter Hand eine Zufahrt zu einem grauen Haus, vor dem sich Hummerreusen stapeln. Am Ende der Straße steht Taigh an Sollas, das Haus des Lichts, ein einfaches, einstöckiges Steinhaus mit zwei Schornsteinen an den Giebelseiten und einem Dach aus dunklen Schieferplatten. Die frisch getünchten Mauern leuchten weiß durch den Nieselnebel.
Ma hat Kübel mit Blumen vor der rot glänzenden Haustür stehen, aber alles um uns herum scheint seine Farben verloren zu haben, sogar das Meer, das nur wenige Meter entfernt in seinem stetigen Rhythmus rauscht.
Ein Shepherds Hut, eine Art holzverkleideter Bauwagen, steht ein Stück abseits. Ma hat vor, die Schäferhütte, die bisher als Schuppen gedient hat, komplett zu renovieren und irgendwann an Touristen zu vermieten.
Zusammen tragen wir meine Sachen ins Haus, in das Zimmer, in dem ich den Sommer über wohnen werde. Es ist gleich die erste Tür auf der rechten Seite des kleinen Flurs, dasselbe Zimmer, in dem wir vor elf Jahren Gäste gewesen waren. Ma knipst das Licht an und der Raum beginnt zu leuchten. Damals war alles verwohnt und plüschig gewesen, daran erinnere ich mich. Die Möbel dunkel und Rosenmustertapete an den Wänden. Jetzt hat der Raum eine türkisfarbene Wand, vor der das Bett und ein Bücherregal stehen. Die Holzmöbel sind hell und auf den alten Dielen liegt ein bunter Flickenteppich. Der kleine Kamin mit einem Schaukelstuhl davor ist sauber gefegt. Ein Tisch steht unter einem der beiden Fenster, die zum Meer hinausgehen, von dem allerdings hinter den grauen Regenschleiern nicht viel zu erkennen ist. Trotz geschlossener Fenster riecht es nach Salz und Tang und ich kann das Rauschen der Brandung hören.
Stumm stehe ich da und schaue hinaus ins wabernde Grau. Zweitausend Kilometer bin ich durch die Lüfte gereist – und nun das. Beinahe muss ich lachen, aber aus meiner Kehle kommt nur ein hilfloser Laut.
Ma nimmt mich noch einmal fest in die Arme, dann sieht sie mir in die Augen. »Ich freue mich so, dass du da bist, Leo. Vor elf Jahren hat es dir auf Orasay und in diesem Haus gefallen und du wirst es auch diesmal lieben. Hier kommst du in Ordnung, das verspreche ich dir.«
Ich nicke zögerlich. Das haben Pa und Doreen auch gewollt: dass ich schnell wieder in Ordnung komme. Normal werde. Dass ich zur Schule gehe und mein Abi mache wie all die anderen aus meiner Klasse. Dass ich eine tolle große Schwester für das Baby sein werde, das im Juli kommt.
Meine Therapeutin hat mich aus meiner Schutzzone geholt und mir eine wirksame Strategie gegen meine Panikattacken beigebracht. Aber für die elfte Klasse war es zu spät. Ich würde mich mit einem Realschulabschluss zufriedengeben oder das Schuljahr wiederholen müssen. Dazu fehlt mir allerdings immer noch der Sinn. Denn auch wenn ich diese Gedanken inzwischen wohlweislich für mich behalte: Wofür Abi machen, wenn nicht klar ist, was ich mit meinem Leben anfangen will? Wenn nichts mehr gut wird auf dieser Welt und ich keine Ahnung habe, wie ich das ändern soll.
»Hunger?«, fragt Ma.
Ich nicke.
Ask it of the ravens, and of the hoodie-crows, and the ridge-beam of your house.Ma sagt, es gibt eine Menge alte Regeln und schräge Weisheiten auf Orasay. Wenn man zum Nachbarn geht, um ihn um etwas zu bitten, sollte man immer erst ein wenig um den heißen Brei herumreden, bevor man auf sein Anliegen kommt.
»Sonst sagen die Nachbarn: Frag die Raben oder die Krähen oder den Firstbalken deines Hauses.« Ma lacht. »Die meisten Regeln beginnen jedoch mit Es ist nicht recht, dass …«
Oje, denke ich und setze mich an den Küchentisch, wo frisch gebackene Scones unter einem Tuch und Erdbeermarmelade auf mich warten.
Ma lebt seit letztem September auf der Insel. Den Herbst und den Winter hat sie damit zugebracht, das Haus zu renovieren und nach ihrem Geschmack einzurichten. Viel helles Holz, viel Weiß und helle, warme Farben. Die kleine Küche mit der Granitspüle, dem funkelnd roten AGA-Herd und den blauen Tontöpfen mit Kräutern auf den Fensterbänken ist urgemütlich – dafür hatte meine Mutter schon immer ein Händchen.
»Die Schotten schwören auf diese AGA-Herde«, sagt Ma, während sie Teewasser aufsetzt und Clotted Cream aus dem Kühlschrank holt. »Die Dinger sind ungeheure Energieschleudern, weil sie sich nicht abstellen lassen. Aber Cat hat mir geraten, ihn zu behalten, der langen, kalten Winter wegen. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich damit klarkam, aber jetzt möchte ich das Schätzchen nicht mehr missen.« Sie lächelt mich an und ich lächele zurück.
»Heute Abend gibt es gegrillten Lachs, er kommt von der Lachsfarm, für die ich arbeite«, erklärt mir Ma und stellt die gläserne Teekanne auf den Tisch. »Fisch ist auf Orasay ein Hauptnahrungsmittel, na ja, wie wohl auf jeder Insel«, meint sie. »Du isst doch noch Fisch, oder? Jedenfalls hast du früher gerne welchen gegessen.«
Ich nicke brav. Von all dem, was ich früher gerne getan habe, sind nur Schatten übrig geblieben. Aber ich will meine Mutter, die sich so viel Mühe gibt, mir das Hiersein zu erleichtern, nicht enttäuschen. Seit zwei Jahren steht kein Fleisch mehr auf meinem Speiseplan. In den Wochen, in denen ich mit Milo zusammen war, habe ich auch keinen Fisch mehr gegessen. Die Ozeane leiden aus vielen Gründen, hatte er gesagt. Aber die Fischerei übertrifft alles.
»Ja, alles gut. Ich esse Fisch.«
»Wie war eigentlich dein Flug?« Ma gießt Tee in unsere Becher und Milch in ihren Tee.
»Lief super«, antworte ich. Am Morgen war ich von Berlin nach Glasgow geflogen und von dort drei Stunden später weiter nach Orasay. Das Flugticket hatte ein kleines Vermögen gekostet, aber Pa wollte nicht, dass ich in einer Stadt wie Glasgow allein übernachten muss.
Anfangs hatte mein Vater nicht viel von Ildiko Brenners Vorschlag gehalten, dass ich den Sommer bei Ma auf der Insel verbringe. Für ihn war das Ganze die Schnapsidee einer jungen Therapeutin. Obwohl Pa und ich kaum noch miteinander redeten, wollte er mich nicht gehen lassen. Doch als klar wurde, dass Doreen es durchaus für eine gute Idee hielt, gab er nach. Wenn das Baby, es wird ein Junge, erst da ist, wollen sich die beiden auf den Neuankömmling konzentrieren und nicht auf eine Siebzehnjährige, die sich in ihrem Zimmer verschanzt und es für unverantwortlich hält, Kinder in diese verkorkste Welt zu setzen.
Ma und ich haben uns neun Monate lang nur auf einem kleinen Bildschirm gesehen und jetzt fallen mir die Fältchen um ihre braunen Augen auf. Meine Mutter ist achtunddreißig. Sie hat naturblonde Locken, eine weibliche Figur und einen unerschrockenen Kampfgeist. Früher wurde sie immer von allen jünger geschätzt, doch nun sieht man ihr die Jahre an. Hat das die Insel mit ihr gemacht?
Die Haare habe ich von Ma geerbt, die Figur nicht. Ich habe knochige Glieder, einen kleinen Busen und mein Kampfgeist ist mir letzten November auf einen Schlag abhandengekommen.
Ma trinkt einen Schluck Tee und erzählt mir von ihren Startschwierigkeiten auf der Insel. Wie mühsam es war, das Haus auf Vordermann zu bringen, und dass sie jetzt erst nach und nach persönliche Kontakte zu den Inselbewohnern knüpft.
»Auf Orasay mag man Leute, die Geld hierlassen und wieder verschwinden«, sagt sie. »Leute, die bleiben, mag man weniger. Aber seitdem ich Schichten im St. Barrs-Pflegeheim in Clachanbay mache, wird es besser.«
Schichten im Pflegeheim? Meine Mutter?Wow, Ma scheint es wirklich ernst zu meinen mit dem vollkommen neuen Leben. Sie lacht, als sie mein verblüfftes Gesicht sieht. »Ist kein einfacher Job, aber ein dankbarer. Die Übersetzungsarbeiten für Norwegian Salmon mache ich mehr oder weniger nebenbei. Ich brauche das Geld dringend, und wie du weißt, ist mein Norwegisch ziemlich gut.«
Ma und ich sind mal zwei Wochen lang mit ihrem Camper durch Norwegen gefahren und ihr Norwegisch hatte mich tatsächlich beeindruckt. Ma hat ein Talent für Sprachen. Sie deutet auf das Gälisch-Wörterbuch auf dem Küchentisch und meint: »Ich habe einen Online-Gälisch-Kurs mitgemacht, aber an dieser Sprache beiße ich mir die Zähne aus.«
»Wird Gälisch denn überhaupt noch gesprochen?«, frage ich.
»Oh ja. Über die Hälfte der Einheimischen auf der Insel spricht Gälisch fließend. Kannst du ihre Sprache nicht, hast du bei ihnen verloren.«
»Klingt alles ziemlich anstrengend«, bemerke ich, »die Regeln, das Gälisch.«
»Das ist es in der Tat.« Ma seufzt. »So hatte ich es mir nicht vorgestellt. Aber es wird langsam besser und irgendwann will ich wieder vom Schreiben leben.« Ma deutet meinen erschrockenen Blick richtig. »Keine Angst, meine Zeiten als Reisebloggerin sind endgültig vorbei, Leo. Ich habe vor, einen Roman zu schreiben, das ist mein Traum. Angefangen habe ich schon, aber jetzt muss ich erst mal hier ankommen und meinen Platz finden.«
Erleichtert atme ich aus.
»Meine Schichtdienste im Seniorenheim … hoffentlich ist es kein Problem für dich, dass du jede dritte Woche die Nächte allein im Haus verbringen musst?« Fragend schaut Ma mich an, ehrliche Besorgnis im Blick.
Okay. Von diesen Nachtschichten hat Pa mit Sicherheit keine Ahnung, sonst hätte er mich nicht gehen lassen. »Nein, natürlich nicht«, erwidere ich und schlucke trocken. Nachts allein in diesem einsamen Haus am Meer? Das fängt ja gut an. Aber ich habe diesen Deal gewollt und nun muss ich mit den Gegebenheiten hier klarkommen. Wird schon, denke ich. Ist alles besser als Berlin.
Ma zeigt durch das Küchenfenster nach oben zur Straße. »Bis zu den MacKinnons ist es ein Katzensprung«, sagt sie, »nur die paar Meter die Straße rauf. Unsere Nachbarn Melanie und Eachan sind typische Inselbewohner, sozusagen der Inbegriff gälischer Höflichkeit und Zurückhaltung. Ihr Sohn Tam ist übrigens nur ein Jahr älter als du und sieht ziemlich gut aus.« Verschwörerisch zwinkert sie mir zu.
»Ma«, sage ich und verdrehe die Augen. Zwischen Milo und mir ist nichts geklärt und irgendwelche Inseljungs, so gut aussehend sie auch sein mögen, interessieren mich nicht. Mich interessiert überhaupt nichts mehr, das ist mein Problem.
Ma ist tough und insgeheim bewundere ich sie dafür, wie sie ihren neuen Lebenstraum verwirklicht. Meine Mutter hat mich stets darin bestärkt, an meinen Träumen festzuhalten, sie niemals aufzugeben. Allerdings klang das zuletzt für mich auch immer ein wenig nach einer Rechtfertigung dafür, dass sie ihr eigenes Ding gemacht hat, während ich dabei meist nur an zweiter Stelle gestanden habe.
Ma fragt mich nach Pa und was mein Problem mit Doreen sei. Meine Eltern glauben, die Tatsache, dass mein Vater eine neue Frau hat und die beiden Nachwuchs erwarten, überfordert mich. Das stimmt insofern, dass ich null Bock auf Babygeschrei und Kackwindeln habe. Dass ich es unverantwortlich finde, in diese dem Untergang geweihte Welt überhaupt noch Kinder zu setzen. Aber es ist nicht der wahre Grund für meine Mutlosigkeit.
»Sie ist okay und passt gut zu Pa«, antworte ich. »Zu mir nicht.«
Seit ihrer Schwangerschaft ist Doreen so von Glück durchdrungen, dass sie überhaupt nicht mehr wahrnimmt, was auf der Welt und um sie herum geschieht. Deshalb hatten wir uns immer wieder gestritten, ich hatte unfaire Dinge zu ihr gesagt und oft war sie dabei in Tränen ausgebrochen.
»Ich hätte gedacht …« Ma schaut mich an. »Na ja, du bist siebzehn und gehst ohnehin bald aus dem Haus. Früher hast du dir immer ein Brüderchen gewünscht. Ist doch schön, dass dein Vater wieder jemanden gefunden hat und glücklich ist.«
Ja. Und es ist auch nicht so, dass ich ihm das nicht vergönne. Aber wenn wir so weiterleben wie bisher, wird die Erde bald unbewohnbar, und die Regierung, für die er und Doreen arbeiten, tut einfach nicht genug, um den Lauf der Dinge aufzuhalten. Über diese Angst, keine lebenswerte Welt mehr für eine Zukunft zu haben, kann ich nicht mit meinem Vater sprechen. Weil er glücklich sein will und einfach so weitermachen, obwohl er es besser weiß.
Ich zucke die Achseln. Soll Ma in dem Glauben bleiben, das Baby wäre mein Problem. Das erspart mir Erklärungen.
Nachdem ich ein Scone verdrückt habe, übergibt meine Mutter mir einen Haustürschlüssel. »Das ist deiner«, sagt sie. »Im Grunde brauchst du ihn gar nicht, denn auf Orasay bleiben alle Türen offen. Wer abschließt, hat etwas zu verbergen, meinen die Einheimischen.« Ma hebt die Hände und lacht. »Aber wenn ich auf Nachtschicht bin, fühlst du dich ja vielleicht sicherer, wenn du abschließen kannst.«
Oh ja.
Das gebrauchte Fahrrad, mit dem ich die Insel erkunden soll, hat drei Gänge und einen roten Anstrich. Orasay, was sich laut Ma vom altnordischen Wort Örfirisey ableitet und »Gezeiteninsel« bedeutet, ist nur dreizehn Kilometer lang und acht Kilometer breit. Eine zweiundzwanzig Kilometer lange Ringstraße führt um ein paar Hügel herum, von denen der höchste der Nueval ist, ein kahler Berg, knappe vierhundert Meter hoch.
Da ich die letzten Wochen mehr oder weniger in meinem Zimmer verbracht habe, ist meine Kondition im Eimer. Fahrrad fahren klingt nach Anstrengung und ich verspüre nicht die geringste Lust, mich anzustrengen.
»Niemand zwingt dich zu etwas, Leo«, meint Ma, die meinen desinteressierten Blick bemerkt hat.
»Danke für den schicken Drahtesel«, erwidere ich mit einem Lächeln. »Und für den hier.« Ich halte den Haustürschlüssel hoch, an dem ein buntes, gestricktes Wollstück hängt.
»Dann lasse ich dir mal Zeit, um anzukommen. Die Reise hat dich bestimmt müde gemacht – jedenfalls siehst du ganz müde aus. Ich bin drüben im Shepherds Hut, zum Ausmisten. Wenn du Lust hast, können wir später einmal um die Insel fahren, sie ist ja nicht groß. Der Regen soll bald aufhören und hier ist es im Sommer lange hell.«
Im Zimmer packe ich meine Siebensachen aus und räume meine Klamotten in den Kleiderschrank: Funktionskleidung, eine Jeans und eine Cordhose, zwei Fleecejacken, Shorts und T-Shirts und ein Sommerkleid, türkisgrün mit kleinen weißen Fischgräten. Ma hat mich gewarnt, dass es keinen Laden auf Orasay gibt, in dem man Kleidung kaufen kann. In den letzten Monaten habe ich ein paar Kilo abgenommen und alles, was ich eingepackt habe, schlackert mir am Körper. Doch vor meiner Abreise in der City einkaufen zu gehen, dazu hatte ich keine Lust gehabt.
Einen Roman und mein Tagebuch lege ich in die Schublade meines Nachtschränkchens. Alles in allem kleines Gepäck. Doch meine Angst, meine Schuldgefühle und die No-Future-Stimmung sind mit mir gereist und ich frage mich, wo ich die hinpacken soll.
Mein Smartphone deponiere ich im Fach mit den T-Shirts. Pa weiß, dass ich es auf den dringenden Rat meiner Therapeutin erst einmal ausgeschaltet lasse, und diese Tatsache hat ihm überhaupt nicht gefallen. Aber dann hat er doch nach seinem alten MP3-Player gesucht und ihn mir vermacht, damit ich im Exil meine Playlist hören kann. Von Doreen habe ich am Abreisetag noch eine kleine, nagelneue Digitalkamera geschenkt bekommen. Ich lege sie neben das Handy in den Schrank. Fotos macht man, um sich später erinnern zu können, aber ich bin nicht mal in der Lage, über diesen Sommer hinausdenken.
Wenn man das überhaupt Sommer nennen kann. Mir fröstelt und ich greife nach der wunderschönen Strickdecke, die auf dem Bett liegt und die aus Karos in verschiedenen Mustern besteht. Weil die Decke einfarbig ist, habe ich nicht gleich erkannt, wie unglaublich fein das Muster ist. Es besteht aus senkrecht, waagerecht und schräg verlaufenden Reihen von dichten Maschen, was ein Rauten- oder Zickzackmuster ergibt. Bewundernd streiche ich mit der flachen Hand über die Decke, bevor ich mich darin einwickele.
Ich schiebe den Schaukelstuhl vor das Fenster, setze mich hinein und beginne, leicht zu schaukeln. Lausche dem Anbranden des Meeres. Diesen Platz, so beschließe ich, werde ich nicht mehr verlassen. In den kommenden Wochen werde ich hier sitzen, Musik hören und schaukelnd aufs graue Meer starren, bis August ist und ich wieder in den kleinen Flieger steige.
Vermutlich bin ich eingenickt, denn ein heftiges Klopfen lässt mich aufschrecken und im ersten Moment weiß ich nicht, wo ich bin. Mein Herz jagt los.
Wieder das Klopfen. »Jemand da?«, ruft eine dunkle Stimme. »Sabine?« Es klingt wie Säbbin.
Als ich meine Zimmertür einen Spalt öffne, steht ein baumlanger Typ in Jeans und blauem Strickpullover vor mir im Hausflur, einen Plastikbeutel mit orangeroten Fischfilets in der Hand. Unter dem Rand der tief über die Augen gezogenen Strickmütze quellen dunkle Locken hervor. Seine Augen blitzen, als sie mich mustern. Sie sind vom selben Blaugrau wie der Pullover und wirken riesig in seinem schmalen Gesicht voller Sommersprossen.
»Hi, du musst Leonie sein«, sagt der Fremde. »Ich bringe den Lachs, den deine Mum bei uns bestellt hat.« Er wartet keine Bestätigung seiner Vermutung ab und reicht mir den Beutel. »Macht acht Pfund.«
»Ich, ähm, ich habe kein Geld. Bin gerade erst angekommen. Aber meine Ma ist drüben im Shepherds Hut.«
»Okay«, er zuckt die Achseln, »dann komme ich auf dem Rückweg noch mal vorbei.« Seine Augen werden schmal. »Ich wohne gleich dort oben.« Durch die offene Eingangstür deutet er auf das graue Haus weiter oben an der Straße, unsere einzigen Nachbarn. MacSowieso.
Als er geht, folge ich ihm nach draußen.
»Übrigens, ich bin Tam«, offenbart er mit einem Lächeln, bevor er auf sein Rad steigt, mir winkt und wieder hoch zu seinem Haus fährt.
Nachdem ich die Fischfilets im Kühlschrank verstaut habe, suche ich nach Ma und finde sie im Wohnwagen, der im Inneren erstaunlich geräumig ist. Sie ist dabei, eine Menge Gerümpel in mehrere Kartons zu verteilen.
»An das schottische Mülltrennungssystem habe ich mich immer noch nicht gewöhnt«, klagt sie. »Große blaue Tonne, kleine blaue Tonne, graue Tonne …« Ma seufzt. »Jedenfalls sind sie sehr streng hier, was das angeht.«
»Finde ich gut.« Ich spüre einen klitzekleinen Impuls, mich nützlich zu machen und meiner Ma zu helfen, doch der verschwindet auf der Stelle wieder. Heute nicht. Ein anderes Mal. »Aber warum liegen Steine auf den Tonnen?«
»Damit der Wind die Deckel nicht auffliegen lässt, wenn es stürmt, und den ganzen Müll in der Gegend verteilt.«
»Oh, okay.«
Während die Lachsfilets zwischen Kartoffeln und Karotten im AGA-Herd garen, kommt Tam zurück. Ma bittet ihn in die Küche, doch er nickt mir nur zu und verschwindet wieder, nachdem er sein Geld bekommen hat.
»Na, wie findest du ihn?« Ma versucht, beiläufig zu klingen, aber das gelingt ihr nicht. Meine Mutter hat nichts übrig für Schönlinge, deshalb mag sie Tams Gesicht, das, abgesehen von den großen Augen und den vollen Lippen, nur aus Sommersprossen zu bestehen scheint.
»Nimm du ihn doch, wenn er dir so gut gefällt«, erwidere ich.
»Würde ich ja«, kontert sie, »aber ich glaube, Tam steht nicht auf reife Damen.« Sie zwinkert mir zu. »Allerdings haben sämtliche Inselmädchen eine Schwäche für ihn und er ist ein sehr begehrter Heiratskandidat.«
Aus meiner Nase sprudelt der Schluck Mineralwasser, den ich gerade erst getrunken habe. »Wie alt, sagtest du, ist er?«
Ma lacht. »Nun ja, darum geht es hier wohl bei den meisten Mädchen in deinem Alter: ums Heiraten.«
»Wow.«
Mas Lachs schmeckt köstlich, aber ich esse wie ein Spatz, einfach, weil mein Magen seit Monaten wie zugeschnürt ist und kaum noch etwas Platz darin findet.
»Du bist ganz schön dünn geworden, Leo. Aber die gute Inselluft wird deinen Appetit schon zurückbringen«, verkündet Ma hoffnungsvoll.
Ich nicke, gebe ihrer Hoffnung eine Chance. »Wie steht es eigentlich um dein Liebesleben?«, frage ich, um von mir abzulenken. Was das Thema »Sex« angeht, war Ma immer sehr offen gewesen und hatte sich nie um Antworten herumgedrückt.
»Miserabel.« Sie schnaubt theatralisch. »Es gibt nur wenige unverheiratete Männer passenden Alters auf Orasay und die seltenen Exemplare werden von den Inselfrauen mit Argusaugen bewacht.« Sie zieht die Mundwinkel nach unten und öffnet die Hände zu einer ratlosen Geste. »Ich habe keine Chance.«
Ma hatte seit ihrer Trennung von meinem Vater keine feste Beziehung mehr, aber ein Kind von Traurigkeit ist sie auch nicht. Sie tanzt gerne, lacht gerne und Männer verlieben sich schnell in sie. Doch hier auf Orasay scheint die Männerwelt anders zu ticken. Bestimmt ist das nicht leicht für sie.
»Mach dir mal keine Gedanken um mich, Leo. Ich bin immer gut allein klargekommen und werde es auch weiterhin tun. Ich bin glücklich, dass du hier bist, bei mir. Wir haben einiges nachzuholen, da bleibt gar keine Zeit für einen Mann.«
Nach dem Essen entscheiden wir, die Inselumrundung auf morgen zu verschieben, denn Regenwolken verdunkeln immer wieder die Sonne und schicken Schauer über die grünen Hügel und das Meer. Aber wir schlüpfen in unsere Regenjacken und laufen den kurzen Trampelpfad, der hinter dem Haus beginnt und nach fünfzig Metern an einer flachen Klippe endet, unter der das Meer gegen den Felsen schlägt. Salzige Gischt weht uns ins Gesicht. Ich öffne den Mund und schmecke das Meer, das im Sonnenlicht türkisblau leuchtet.
»Bis zu diesem Felsen gehört das Land uns«, sagt Ma.
Sie sagt uns, nicht mir. Vielleicht hat sie das nur so dahingesagt, aber ich merke, wie sehr ich mir auf einmal wünsche, dass sie es genauso gemeint hat. Dass ich zu ihr gehöre und ihrem verrückten neuen Leben auf einer abgelegenen schottischen Insel. Dass ich mit meiner Arche hier anlegen kann und wieder Boden unter den Füßen bekomme.
»Die Flut hat jetzt ihren höchsten Stand erreicht. Bei Ebbe ist dort unten ein kleiner Strandstreifen.«
Wir stehen nebeneinander und lauschen dem Gesang der Flut. Der Herzschlag des Meeres überträgt sich auf den Felsen und bringt meinen eigenen Herzschlag durcheinander. Das ist verwirrend, doch gleichzeitig fühlt es sich gut an. Wir haben die Sonne im Rücken und das Wasser unter uns ist so klar, dass ich durch das kabbelige Durcheinander von Licht und Schatten, Muscheln, kleine Fische und Blasentang sehen kann. Ich kann den Himmel spüren, den Felsen, das Meer. Ich spüre etwas.
»Ich komme jeden Tag mindestens einmal hierher.« Ma legt einen Arm um meine Schulter. »Bei jedem Wetter.« Sie sieht mich an. »Ich möchte nie wieder getrennt sein vom Meer, Leo. Kannst du das verstehen?«
Später, als ich im Bett liege, eingelullt vom leisen Branden des Meeres, denke ich über ihre Worte nach. Die Nacht ist anders als die Stadtnächte. So still und friedlich. Der Schlaf nicht zerrissen von Sirenen und grölenden Betrunkenen, nicht gestört vom nie abreißenden Dröhnen des Verkehrs. Statt der Geruchsmischung von Cannabis und Döner habe ich Salzgeruch in der Nase.
Meine Mutter hat ihren Ort gefunden. Sie hat Berlin, der Stadt, in der sie aufgewachsen ist, den Rücken gekehrt und hat sich für ein abgeschiedenes, einfaches Leben entschieden. Um nicht mehr getrennt vom Meer zu sein, nimmt sie in Kauf, weit weg von mir zu sein. Warum wühlt mich das auf einmal so auf, wo ich doch schon vor Jahren gelernt habe, es zu akzeptieren?
Am Sonntagmorgen sitzt Tam neben seiner Mutter in der katholischen Kirche von Northbay und schaut auf die fein gestickten Worte auf dem Altartuch: Sith agus Fois. Ruhe und Frieden. Sonnige Streifen Lichts, die durch die hohen Spitzbogenfenster fallen, erleuchten die dunklen Mauern der Kirche. Es riecht nach Weihrauch. Hingebungsvoll lauscht seine Mum der Sonntagspredigt von Pfarrer Ronald Campbell aus Oban. Seit dem Tod ihrer Tochter hat MelanieMacKinnon Trost in Gottes Wort gefunden und nie auch nur eine Predigt ausgelassen. Als könne der Glaube die Lücke füllen, die Màiri hinterlassen hat.
Tam glaubt an das Meer, die Insel und an Kila, aber an keinen Gott. Doch er mag den Gedanken an Ruhe und Frieden. Sein Blick streift über die Hinterköpfe seiner Schulkameraden, von deren Eltern und Verwandten. Zwei Reihen vor ihm sitzt RachelMacInnes aus Mingarry mit ihrem bunten Tuch im Haar. Ihre Eltern sind Crofter, Kleinbauern, und betreiben nebenbei ein B&B. NicholasMacColl, der durch und durch schwul ist und es vor seinen Eltern, seinen Freunden und der ganzen Insel zu verbergen sucht, sitzt ein Stück links von ihm. Hinter sich hört Tam das leise Geflüster von EuanBeagMacPheil und LauraStevensen, die seit einem halben Jahr zusammen sind. Die jetzt wahrscheinlich heimlich Händchen halten in der Kirche und an nichts anderes denken als daran, wann und wo sie das nächste Mal Sex haben können.
Tams Blick bleibt an JamieMacLeans rotem Haarschopf hängen. Er und seine Eltern Donald und Jenna sitzen direkt vor ihm und seiner Mum. Die MacLeans wohnen im einzigen herrschaftlichen Haus auf der Insel, es steht in einem Tal bei Northbay in einem kleinen Wald aus Kiefern, Bergahorn und Kastanien, der vor zwanzig Jahren angepflanzt wurde. Es ist der einzige Wald auf Orasay.
JamieMacLean ist ein Nachfahre der MacLeans von Orasay, den ursprünglichen Besitzern der Insel, deren Clansitz ArnamulCastle war. Vor über zwanzig Jahren hat Jamies Vater die Burg in der Bucht an HistoricScotland vermietet, für ein Pfund und eine Flasche Talisker Whisky pro Jahr.
Schräg vor Tam, auf der anderen Seite des Ganges, sitzt IslaFrazer mit ihren Eltern, ihrem Bruder Alex und seiner Frau Alena, die hochschwanger ist. Islas Vater und ihr Bruder sind Fischer, wie viele andere Ehemänner, Väter und Söhne auf der Insel. Die meisten Familien sind zusammen hier, nur Tam und seine Mum kommen immer allein.
Tams Da ist mit der Seawind zum Fischen rausgefahren. Früher wäre EachanMacKinnon gar nicht auf diese Idee gekommen, denn niemand hätte ihm den Fang, den er an einem Sonntag eingeholt hat, abgenommen. Doch die drei Hotels der Insel sind jetzt schon gut gebucht und die jeweiligen Küchen reißen sich um den frischen Fang: Schellfisch, Kabeljau, Makrelen und natürlich die Krabben und Hummer, die sein Vater in den Körben fängt. Seit zwei Jahren sogar Oktopusse, eine in den Hotelküchen immer beliebter werdende Delikatesse.
Tams Blick verfängt sich in IslaFrazers schimmerndem schwarzem Haar. Sie ist zwei Jahre älter als er und war Màiris beste Freundin gewesen. Isla arbeitet im ClachanbayBúth, dem Gemeindeladen im Hauptort der Insel. Außerdem strickt sie Bettüberwürfe, Mützen, Schals und Fischerpullover – die berühmten Ganseys –, um das Familienbudget aufzubessern.
Isla fährt sich mit der Hand durch ihren Pony, mit dem sie geschickt ihre Narbe über dem rechten Auge verdeckt. Als sie ihren Kopf halb nach hinten dreht, treffen sich ihre Blicke und unwillkürlich muss Tam an sein erstes Mal denken, das er mit Isla hatte. Drei Jahre ist das jetzt her. Isla und er am dritten Jahrestag des Attentats, betrunken und von Schmerz und Verlust beherrscht. Obwohl der Sex schön gewesen war, denkt Tam nicht gerne daran. Weil er hinterher das verstörende Gefühl hatte, mit seiner eigenen Schwester geschlafen zu haben.
Es ist nie wieder passiert. Auch mit keinem anderen Inselmädchen. Tam ist mit den Töchtern der Fischer und Crofter aufgewachsen. Es sind Mädchen, mit denen er zur Schule geht, die er schon ein Leben lang kennt. Auf gewisse Weise sind sie alle wie Schwestern für ihn und deshalb tabu. Er hält sich lieber an die Sommermädchen, die für ein paar Tage oder Wochen nach Orasay kommen und die nur zu gerne bereit sind, ein romantisches Abenteuer mit einem Inseljungen zu erleben.
Tam richtet seinen Blick auf Ronald Campbell, aus der unerklärlichen Furcht heraus, der Pfarrer könne Gedanken lesen. Aber Campbell stimmt nur die Liturgie an und Tam denkt an Leonie, das Mädchen mit dem abwesenden Blick und den hängenden Schultern. Das aussieht, als ob es ein Geheimnis hat. Oder mehrere.
Danach ist die Sonntagsmesse zu Ende. Draußen steht Tam noch ein paar Minuten mit den anderen jungen Leuten der Gemeinde zusammen. Sie flicken mit Worten, Gedanken und Ideen an dem Netz, dass die Insel auch in Zukunft zusammenhalten soll.
Dann fahren seine Mum und er nach Hause.
In ausgeleierten Retro-Shorts, zwei Cool-Pads zwischen den Beinen, sitzt Milo auf seiner abgewetzten WG-Couch, als ich ihn besuchen komme. Da kennen wir uns seit vier Wochen. Kleine Schritte reichen nicht, Leonie, das haben sie schon auf der Klimakonferenz in Glasgow festgestellt, sagt er zu mir, als ich ihn fragend anschaue. Und offenbart mir gleich darauf mit schmerzverzogenem Gesicht, dass er sich am Vormittag im Krankenhaus hat sterilisieren lassen.
Mit pochendem Herzen und einem klebrigen Schweißfilm auf der Haut erwache ich aus meinem Traum von Milo. Schnell stelle ich mich unter die Dusche, um diese unfreiwillige Erinnerung abzuspülen. Höre dabei Ozean von AnnenMayKantereit: Ich will nicht traurig sein und ich will nicht drüber reden. Ich will ein Meer zwischen mir und meiner Vergangenheit. Ein Meer zwischen mir und allem, was war …
Es liegt ein tiefes blaues Meer zwischen mir und allem, was war. Aber es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht einfach so hinter sich lassen.
Nach einem ausgiebigen Porridge-Frühstück brechen Ma und ich zu unserer Inselumrundung auf. Noch ist alles in zähen grauen Nebel gehüllt, aber laut Mas Wetter-App soll sich das später ändern. Zuerst fahren wir in den nördlichen Teil von Orasay, auf die Halbinsel Mingarry. Der Tower des Flughafens ist kaum zu erkennen im feuchten Grau. Auf dem Flugfeld graben zwei Leute in Gummistiefeln mit Stöcken nach Herzmuscheln.
Wir kommen an einer winzigen Siedlung mit ein paar Häusern vorbei, die gegenüber der Grundschule liegt, und fahren hinter einem Hügel durch einen Ort, der denselben Namen trägt wie die Halbinsel: Mingarry.
Ma zeigt mir Cille Bharra


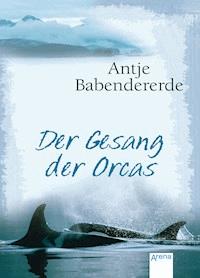
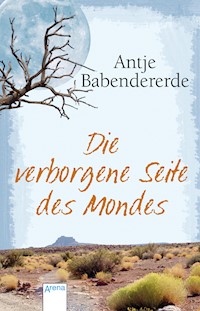


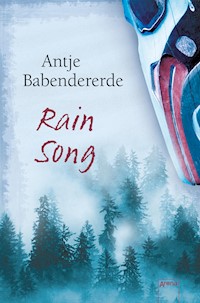

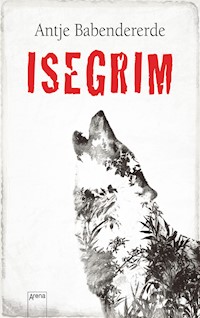

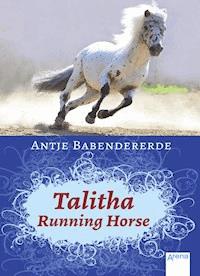

![Triff mich im tiefen Blau [Ungekürzt] - Antje Babendererde - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/75f072b5b02089501721ce263e658ce1/w200_u90.jpg)