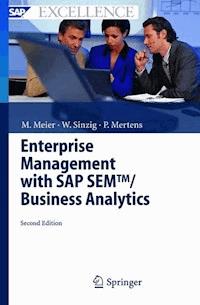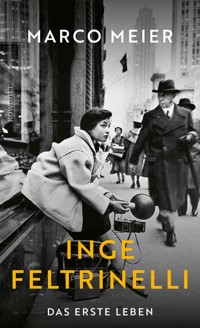
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine ungewöhnliche, schillernde Frauenbiographie: Das erste Leben der späteren Verlegerin Inge Feltrinelli Die junge Inge Schönthal stolpert eher in ihren Beruf als Fotografin, als dass sie ihn sich ausgesucht hat. Und doch ist es eine Fügung des Schicksals, als sie in Hamburg bei Rosmarie Pierer die Kamera zum ersten Mal in die Hand nimmt. Es klickt – und Inge stürzt sich fortan mit Mut, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen in die männerdominierte Welt des Fotojournalismus der 1950er-Jahre. Mit ihrem Gespür für Motive und Menschen und einer großen Portion Abenteuerlust erobert sie in atemberaubendem Tempo die Konferenzräume großer Zeitschriften, sie reist für Fotoreportagen um die halbe Welt, verbringt auf Kuba Zeit mit Hemingway, porträtiert Picasso in Frankreich, erwischt Greta Garbo an einer Ampel in New York und hält in Hamburg Einzug in die intellektuellen Zirkel der pulsierenden Stadt. Bis eine folgenreiche Begegnung beim Verleger Heinrich Maria Ledig-Rowohlt mit dem italienischen Verleger und glühenden Kommunisten Giangiacomo Feltrinelli ihrem Leben eine andere Wendung gibt. «Inge Feltrinelli war die letzte Königin der Verlagswelt». (FAZ) «Wenn sie kam (meist orange gekleidet), ging ein Sonnenstrahlen von ihr aus. Die vor Lebenslust sprühende, die lustige und laute, schicke, unkonventionelle, charmante, exzentrische Inge». (Susanne Schüssler, Die Zeit) «Inge Feltrinelli witzug, schnell, frivol wie immer». (Fritz J. Raddatz, Tagebücher)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Marco Meier
Inge Feltrinelli
Das erste Leben
Über dieses Buch
Die erste Biographie der wohl berühmtesten europäischen Verlegerin. Mit zahlreichen Fotografien.
Inge Schönthal wird 1930 geboren und wächst als Tochter eines jüdischen Vaters und einer nichtjüdischen Mutter in Essen auf. Nachdem die Mutter dem Vater 1938 zur Flucht in die Niederlande verhilft, heiratet sie einige Jahre später einen deutschen Berufsoffizier. Inge verbringt ihre Jugend in Göttingen, wo sie mit ihrer besten Freundin Bälle und Tanzveranstaltungen im akademischen Milieu besucht. Ein Parkett, das sie vorbereitet auf die große weite Welt, nach der sie sich sehnt. Mit neunzehn schnappt sich Inge ihr gelbes Fahrrad und radelt nach Hamburg, wo sie in Eppendorf eine Ausbildung in einem Fotoatelier beginnt.
Bald ist Inge eine gefragte Fotoreporterin in der wichtigsten deutschen Medien- und Kulturstadt der Nachkriegszeit. Von dort aus wird sie in alle Welt geschickt, um berühmte Persönlichkeiten zu porträtieren, darunter Hemingway, Picasso und de Beauvoir. Als Inge eines Tages bei einem Fest in der Villa Rowohlt dem aufstrebenden linken und kosmopolitischen Verleger Giangiacomo Feltrinelli vorgestellt wird, nimmt eine einzigartige Liebesgeschichte ihren Lauf.
«Inge Feltrinelli war die letzte Königin der Verlagswelt.» (FAZ)
«Wenn sie kam (meist orange gekleidet), ging ein Sonnenstrahlen von ihr aus. Die vor Lebenslust sprühende, die lustige und laute, schicke, unkonventionelle, charmante, exzentrische Inge.» (Susanne Schüssler, Die Zeit)
«Inge Feltrinelli hat sich stets als uneigennütziger Copain erwiesen, sie hat nie gegeizt mit ihren weltumspannenden Beziehungen.» (Fritz J. Raddatz)
Vita
Marco Meier wurde 1953 in Luzern geboren. Er studierte zeitgenössische Philosophie, Sozialethik und Moraltheologie an der Universität Freiburg. Meier arbeitete als Chefredakteur, Redaktionsleiter und Radioproduzent in verschiedenen Kulturformaten. Zahlreiche mit Inge Feltrinelli geführte persönliche Gespräche sowie Material des Archivs Inge Feltrinelli aus der Fondazione Giangiacomo Feltrinelli sind Grundlage dieser Biographie.
Julika Brandestini, geboren 1980 in Berlin, arbeitet seit 2008 als freiberufliche Übersetzerin und Redakteurin. 2011 erhielt sie den Förderpreis des Deutsch-Italienischen Übersetzerpreises.
Verena von Koskull, Jahrgang 1970, studierte Italienisch und Englisch für Übersetzer sowie Kunstgeschichte in Berlin und Bologna. 2020 erhielt sie den Deutsch-Italienischen Übersetzerpreis. 2022 war sie Stipendiatin der Casa di Goethe in Rom.
Impressum
Die italienische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel «Ingemaus» in «Varia» bei Giangiacomo Feltrinelli Editore, Mailand.
Das Zitat auf S. 138 stammt aus Stefan Zweig, «Tagebücher», S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1984, S. 363.
Das Zitat auf S. 315 stammt aus Johan Huizinga, «Homo Ludens – Vom Ursprung der Kultur im Spiel», aus dem Niederländischen übertragen von H. Nachod,
Rowohlt Verlag, Hamburg 1956, S. 14–15.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2024
«Ingemaus» Copyright © 2023 by Giangiacomo Feltrinelli Editore, Mailand
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Archivio Inge Feltrinelli
ISBN 978-3-644-02167-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Antonia und Sibylle
1 «Mischling ersten Grades»
Was hinter dieser Tür geschieht, weiß die kleine Inge nicht mit Sicherheit. Was weiß man schon mit nicht einmal sechs Jahren? Man weiß, dass es eine Mama gibt, einen Papa und dass die beiden immer da sein werden, um ihre Ingemaus zu beschützen. Man weiß, dass ihre Stimmen, die durch die Wände dringen, auch wenn du nicht verstehst, was sie sagen, und es wohl kaum mehr als die üblichen allabendlichen Gespräche sind, die magische Fähigkeit haben, dich ins Land der Träume zu schicken.
Es sind die Stimmen deiner Eltern.
Aber warum schreien sie heute Abend so?
Das kann Ingemaus nicht wissen. Sie kann nichts weiter tun, als die Augen zu schließen und zuzulassen, dass die Nacht alles mit sich fortträgt.
Siegfried Schönthal und Johanna Emma Gertrud Rosenmüller, für alle Trudel, hatten keine Zeit verloren. Ende Februar des Jahres 1930 haben sie geheiratet, eine kleine Wohnung in einem Neubau in der Königgrätzstraße 7 in Essen gefunden, und am 24. November desselben Jahres erfüllte sich ihr größter Wunsch, Eltern zu werden. Sie könnten nicht glücklicher sein. Jetzt sind sie unauflöslich miteinander verbunden.
Über ihnen verschleiert die Industrie der Essener Werke den Himmel, aber unter dieser Dunstglocke gelingt es Ingemaus, wie Trudel die kleine Inge nennt, die Tage zu erhellen.
Es sollte noch zwanzig Jahre dauern, bis auf dem Dach des majestätischen Hotels ‹Handelshof›, das gegenüber dem Hauptbahnhof aufragt, eine Leuchtreklame mit der Aufschrift ‹Essen – Die Einkaufsstadt› angebracht wird. 1930 dominiert in der Stadt an der Ruhr noch die Stahlindustrie. Fast anderthalb Jahrhunderte zuvor hatte Essens Aufstieg mit der kleinen Werkstatt einer Familie begonnen, der Krupps – Kohle, Eisen, Stahl, Produkte von immer höherer Qualität –, die schließlich zur Waffenschmiede ganz Deutschlands werden würde.
Siegfried ist Führungskraft bei der Neumann & Mendel in Essen, einer Firma, die Arbeitskleidung herstellt. Sein Chef, Ludwig Neumann, liebt sein Land so sehr, dass er sich im Ersten Weltkrieg freiwillig gemeldet hat und das Eiserne Kreuz Erster Klasse erwarb. Neumann ist eine hoch angesehene Persönlichkeit; die Bürger von Essen vertrauen diesem Mann, der seine Geschäfte sowohl mit Blick auf die Zukunft als auch auf die Vergangenheit führt, auf die Generationen, die ihm in der Führung der Firma vorausgegangen sind: Tradition und Unternehmergeist, eine perfekte Kombination für eine Industrie, die vielen die Gelegenheit gibt, sich verlässlich, konkret, unternehmungsfreudig zu erweisen, eben als echte Geschäftsmänner.
Siegfried Schönthal und Ludwig Neumann teilen mehr als nur den Arbeitsplatz. Beide sind Juden, doch die Religion der Väter zählt für sie nicht viel. Sie tragen ihre germanischen Namen mit Stolz und fühlen sich in jeglicher Hinsicht als gute Deutsche. Als solche sind sie seit jeher von allen, mit denen sie in Essen zu tun haben, respektiert worden: Sie sind produktive Bürger einer Stadt, in der Arbeitsethik stets ein hohes Gut war. Nicht einmal nach Hitlers Machtergreifung im Januar 1933 zeigten Schönthal oder Neumann die geringste Besorgnis, weder um die Familie noch um die Firma. Ihr Ruf und ihr Ansehen würden sie vor dem wachsenden Antisemitismus schützen. Ihre Firma ist für ihren Patriotismus allseits bekannt. Davon sind sie überzeugt. Und doch waren die vergangenen Jahre in Deutschland schwere Krisenjahre. Die Zahl der Arbeitslosen ist exponentiell gestiegen. Im Lauf von fünf Monaten – von September 1929 bis Februar 1930 – wächst die Zahl der Beschäftigungslosen um zwei Millionen. Eine Wirtschaftskrise also, aber auch eine politische Krise. Der Wirtschaftskrise folgt eine gesellschaftliche und politische Krise.
Inges Vater und sein Chef sind natürlich nicht naiv, und manch einer hat auch versucht, sie zu warnen. 1934 hat ein niederländischer Freund Neumanns, ein Herr Joosten, klar und deutlich zu ihm gesagt: Verkaufe, solange es noch geht. Joosten ist Juniorpartner einer großen Fabrik für Arbeitshosen, die er mit seinem Onkel in Tilburg betreibt. Bereits mehrere Firmen jüdischer Deutscher haben ihren Betrieb liquidiert, das Geld außer Landes geschafft und im Ausland neu angefangen. Neumann ist zu stolz, um auf den Ratschlag einzugehen, zu sehr hängt er an dem, was er aufgebaut hat, und am Mutterunternehmen, doch Siegfried steht es frei, Joostens Angebot anzunehmen: eine Arbeitsstelle in den Niederlanden. Siegfried lehnt ab. «Solange mein Chef in Deutschland bleibt, bleibe ich auch.»
Trudel dagegen ist beunruhigter. Warnzeichen gibt es überall. Nicht nur die für alle sichtbaren – die ‹Für Juden verboten›-Schilder in den Schaufensterscheiben, in Kinos und Theatern –, sondern auch subtilere, aber nicht weniger aufschlussreiche, die Inges Mutter aufmerksam registriert und die Papa, ihr geliebter Väti, vielleicht zu übersehen vorgibt.
Da sind zum Beispiel ihre Nachbarn, die Neubergs, Juden und ebenso angesehen wie sie selbst. Die Männer der Familie nehmen Englischunterricht. Warum? Trudel kennt die Antwort, doch ist es nicht ratsam, sie laut auszusprechen, allenfalls vor dem eigenen Ehemann, und darum schreibt sie sie nur in ihr Tagebuch: «Sie denken bereits an eine mögliche Auswanderung.» Auf diesen Seiten vermerkt sie kleinere und größere Verfolgungen gegenüber den Juden; die Zeilen sind gespickt von Übergriffen und Schikanen. Ihr Tagebuch ist das Mittel, mit dem sie Zeugnis davon ablegen kann, was um sie herum geschieht, ohne das Risiko einzugehen, dass Ingemaus die Worte hört. Sorgen und Ängste sollen aus dem Leben ihrer Tochter ferngehalten werden.
«Siegfried hatte keine Wahl.»
Diesmal bemüht sich Trudel besonders, leise zu sprechen. Hinter der Tür schläft Ingemaus, dessen ist sie sich sicher, schließlich war es ein sehr anstrengender Tag, aber man weiß ja nie. Mutter und Tochter hatten fröhlich das Haus verlassen und trotz der Blicke der Passanten hüpfend die Straße überquert, die sie von der Grundschule trennt. Der Augenblick war gekommen, Inge in der Schule anzumelden. Ein neues Leben für sie, für alle, in diesem von düsteren Vorzeichen überschatteten Jahr 1936.
Im Sekretariat war man freundlich, bis Trudel anfing, die persönlichen Daten des Mädchens zu nennen: Vater Jude, Mutter Arierin.
«Jüdischer Mischling ersten Grades», lautete der Kommentar des Angestellten, als hefte er ihr ein Etikett an.
Erst ein Jahr zuvor sind die Nürnberger Gesetze verabschiedet worden und mit ihnen die Regeln, nach denen man sich mit deutschem Blut und deutscher Ehre rühmen darf. Im Fall der kleinen Inge bedeutet das, keine deutsche Schule, es sei denn, fügt der Angestellte hinzu, das Schulamt entscheidet anders.
Trudel traut ihren Ohren nicht. Natürlich kennt sie die Regeln gut, jeder kennt sie, aber niemand darf es wagen, sich in das Leben ihrer Tochter einzumischen. Und so erhebt sie an diesem Tag in der Schule zornig die Stimme, damit alle genau hören, was sie zu sagen hat, auch die Eltern der ‹reinrassigen› Kinder. Sie brüllt, wenn man Inge nicht annehme, würde sie auf einer jüdischen Schule landen. Und wenn heute schon von einem Tag auf den anderen jüdische Lehrer verschwänden, wer weiß, was dann eines Tages mit den Kindern geschehe.
«Wenn die Dinge so stehen», schloss Trudel, ohne die Stimme zu senken, «dann wird meine Tochter nicht in die Schule gehen.» Dann nahm sie die Kleine bei der Hand und ging mit ihr nach Hause.
Jetzt erzählt sie ihrem fassungslosen Ehemann haarklein, was sie am folgenden Tag zu tun gedenkt.
Auf der anderen Seite der Tür kämpft Ingemaus gegen den Schlaf: Bei all der Aufregung des Tages, die ihr die Lider schwer macht, gelingt es ihr einfach nicht, wach zu bleiben und den aufgeregten Stimmen zu lauschen. Das Einzige, was sie mit Sicherheit weiß, ist, dass sie ihre Mutter noch nie so wütend erlebt hat.
Am nächsten Tag hat sich Trudels Zorn keinen Deut gelegt. Gleich in der Frühe geht sie zum Schulamt. Von dort wird sie zum Oberinspektor Thomas Elgering geschickt. Er ist derjenige, der über die Schulzulassungen der ersten Klasse entscheidet.
Oberinspektor Elgering kennt nur zwei Arten, seine Arbeit zu verrichten: Strenge und Unfreundlichkeit. Die Kombination der beiden erlaubt es, Dinge schnell abzuarbeiten. Wer nicht vor der ersten kuscht, die auf eisernen Regeln und Bürokratie fußt, ist gezwungen, vor den pampigen Antworten, die keine Widerrede dulden, den Rückzug anzutreten. Genau solche bekommt Trudel zu hören, als sie auch bei ihm darauf besteht, dass die Tochter keinesfalls an einer jüdischen Schule angemeldet werden dürfe.
«Und wo dann?»
Oberinspektor Elgering liebt rhetorische Fragen, die er vor allem für Menschen wie Inges Mutter übrighat. Kämpferische Personen, aber mit stumpfen Waffen gegenüber einem Staatsdiener.
Mühsam ihren Zorn im Zaum haltend, bemüht sich Trudel, ihm das Offensichtliche zu erklären, nämlich die Gefahren, die ihrer Tochter drohen.
«Das können Sie nicht zulassen, Herr Oberinspektor.»
Doch der hebt nur die Augenbraue, wie um sie herauszufordern, diesen Satz noch einmal zu wiederholen.
Trudel bleibt nichts anderes übrig, als das Büro zu verlassen, doch fühlt sie sich weder geschlagen noch entmutigt, denn sie hat noch ein letztes Ass im Ärmel und bittet darum, vom Schulrat empfangen zu werden, der für das Schulsystem verantwortlich ist.
Der Schulrat ist ein ganz anderer Mensch als Elgering. Alt, gutmütig, freundlich. Sicherlich kein Nazi, denkt sich Trudel, und als sich der Beamte schweigend ihre Klagen anhört, ist sie überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Doch gute Manieren können gegen das vom deutschen Reich errichtete bürokratische Labyrinth wenig ausrichten. Der Schulrat empfiehlt Trudel, einen förmlichen Antrag bei der Obersten Schulaufsichtsbehörde in Düsseldorf einzureichen und sich, sollte dieser unbeantwortet bleiben, direkt an den Kultusminister zu wenden. Ein endloser Aufstieg zu den Gipfeln der Bildungsinstitutionen. Ein Unterfangen, an dem jeder verzweifeln würde, nicht aber Trudel, die sich das nicht zweimal sagen lässt und im Laufe weniger Tage die Anträge fertig macht und abschickt.
Schweigen. Monatelang. Keine Nachricht, weder von der Obersten Schulaufsichtsbehörde noch vom Minister. Für Inge hat dieses Schweigen wieder einmal die Form der aufgeregten Stimmen ihrer Eltern angenommen, die auf den späten Abend warten, um über das weitere Vorgehen zu diskutieren. Inge ist zwar noch klein, aber ihr ist trotzdem klar, dass die Zeit allmählich knapp wird: Für sie soll die Schule nach Ostern des Jahres 1937 beginnen, und sie kann es kaum erwarten, die Stifte und Hefte zu benutzen, die sie mit ihrer Mutter gekauft hat.
Eines Abends klingen die Stimmen der Eltern noch aufgeregter als sonst, vielleicht weil Trudel entschieden hat, persönlich nach Düsseldorf zu fahren, um noch höhere Instanzen zu bemühen, und jetzt ihren Ehemann, der am folgenden Tag in der Filiale in Mönchengladbach zu tun hat, zu überzeugen versucht, sie mitzunehmen. Trudel ist es egal, wenn sie stundenlang auf den Ämtern herumsitzen muss, sie will nur eine Antwort. Und die Antwort kommt. Der Zuständige im Referat für Bildung bestätigt ihr, dass ihr Kind der deutschen Schule zugewiesen wird. Trudels Eingabe hat einen langen Weg genommen, doch am Ende hat sie es bis auf den Schreibtisch des Ministers Bernhard Rust in Berlin geschafft, der bekräftigen wird, dass Inge qua ihres Geburtsjahres 1930 und der evangelischen Taufe das Recht habe, die deutsche Schule zu besuchen. Der Leviathan der Gesetze hat sich selbst bezwungen.
Für eine Weile kehrt im Hause Schönthal wieder Fröhlichkeit ein. Gleich nach der wunderbaren Nachricht hat Trudel sich vor lauter Glück einen kleinen Luxus erlaubt: einen Fünf-Uhr-Tee im Düsseldorfer Café Tabari, wo der Akkordeonspieler und Polka-König Will Glahé spielt, der in jenen Jahren mit seinem Tanzorchester Furore macht. Alles würde sich finden. Alles würde gutgehen. Das besagt schließlich auch der Brief des Bürgermeisters von Essen, Doktor Bubenzer, den Trudel in Händen hält: «Hiermit wird bestätigt, dass Ihre Tochter der deutschen Schule in der Steelerstraße 342 zugewiesen ist.» Mit diesem Brief kehrt Trudel am folgenden Tag zum Oberinspektor des Essener Schulamts, Thomas Elgering, zurück. Sie hat nicht die geringste Lust, noch einmal mit diesem schrecklichen Beamten zu sprechen, doch zu gerne möchte sie das Gesicht des Bürokraten sehen, wenn er von ihrem Sieg erfährt. In einer Welt, in der sich Rechte unaufhaltsam erodieren, ist es Trudel gelungen, ihr Recht geltend zu machen. Herr Elgering empfängt sie mit der üblichen Kälte, und Trudel teilt ihm nicht minder ungerührt mit, dass ihre Tochter nach Ostern den Unterricht besuchen wird. «Ich hab’s Ihnen ja gesagt», schließt sie, um zu unterstreichen, dass sie nie vorgehabt hatte, diesen Kampf zu verlieren.
Wenige Wochen nach Ostern kommt Inge tränenüberströmt nach Hause. Der Lehrer hat ihr mit dem Rohrstock auf den Kopf geschlagen, weil sie, so behauptet er, den Unterricht gestört habe.
«Das stimmt nicht, Mama, mir ist nur die Tafel runtergefallen!»
Bisher hat Trudel noch nie am Wort ihrer Tochter gezweifelt, und wegen einer aus den Händen gerutschten Schiefertafel wird sie bestimmt nicht damit anfangen.
«Herr Schandry ist ein Nazi», sagt Trudel am Abend zu ihrem Mann. Das genügt, um zu sagen, wie die Dinge liegen. Das Kind ist an der deutschen Schule aufgenommen worden, doch das bedeutet sicher nicht, dass das Etikett des «Mischlings ersten Grades» aus den Köpfen der Lehrer gestrichen ist. Hier geht es nicht darum, dass Inge wie vor Kurzem gezwungen wird, mit der rechten statt mit der linken Hand zu schreiben. Hier steht weit mehr auf dem Spiel.
Die Stimmen hinter der Tür sind zurückgekehrt, und jetzt weiß Inge, was sie bedeuten. Es wird etwas passieren.
Trudel geht direkt zu Lehrer Schandry. Sie deutet auf den Rohrstock, den er in der Nähe seines Pultes verwahrt, und sagt, so, wie er diese Waffe benutzt habe, um ihre Tochter zu bestrafen, werde sie ihm damit ins Gesicht schlagen, sollte er es wagen, dies noch einmal zu tun. Und sie endet: «Ich werde so heftig zuschlagen, dass Ihnen ein Striemen bleibt. Und zwar vor der ganzen Klasse.»
Das ist einer der vielen rebellischen Akte, die Monat für Monat von einem Meer beängstigender Neuigkeiten verschluckt werden. Immer mehr jüdische Läden werden mit dem Davidsstern und der Aufschrift ‹Jude› gekennzeichnet. Die Gestapo beginnt, systematisch in jüdische Wohnungen einzudringen und die Männer festzunehmen. Ein Jahr später, 1938, ist die Bedrohung allgegenwärtig, und im November desselben Jahres verändert sich alles. Nach der Reichspogromnacht werden im ganzen Land etwa dreißigtausend Juden verhaftet. Hunderte Synagogen werden in Brand gesteckt, jüdische Versammlungs- und Gebetsräume zerstört. Jetzt verändert sich auch der scheinbar unerschütterliche Väti, er wird schweigsamer, fast resigniert. Trudel ist die Erste, die in ihrem Mann diese fatalistische, verzagte, fast ergebene Haltung gegenüber der Unausweichlichkeit eines Schicksals erkennt, das sich gerade in dieser Nacht, vom 9. auf den 10. November, über das Familienoberhaupt zu senken scheint.
In Essen gibt es viele jüdische Geschäfte, und sie werden von der SA und der SS verwüstet und niedergebrannt. Juden werden aufgefordert, alle Waffen, die in ihrem Besitz sind, beim Polizeirevier abzugeben. Trudel rennt in die Innenstadt, will zur Firma, in der Väti arbeitet, bevor die Nazis dort ankommen, die, so hört man, die Wohnungen nach männlichen Juden durchkämmen. Siegfried und Neumann wissen, was vor sich geht. Ein ehemaliger Kommilitone von Neumann hat ihn vorgewarnt, was bald passieren würde, dabei soll Göring persönlich vor einiger Zeit gesagt haben, den jüdischen Ex-Soldaten werde nie etwas geschehen. So hat es Trudel in ihrem Tagebuch notiert. Warum sich also sorgen? Pflichtbewusst schaut Ludwig Neumann bei seiner Mutter vorbei, um seine alte Waffe aus dem Ersten Weltkrieg zu holen, die er abgeben muss. Väti ist zum Glück einsichtiger, und Trudel überzeugt ihn, sich im Schuppen des Schrebergartens ihrer Mutter an der Schillerwiese im Süden der Stadt zu verstecken. Dort soll Väti bleiben, bis sich die blinde Raserei dieser verfluchten Nacht gelegt hat. Ludwig Neumann wird auf dem Polizeiposten von der Gestapo verhaftet, als er seine Pistole abliefern will.
In den folgenden Tagen ist Inge der Geruch der Stadt unerträglich. Verbranntes Holz, Rauchschwaden, eine Dunstglocke, die diesmal nichts mit den Krupp’schen Stahlwerken zu tun hat. Die Nazis haben versucht, auch die Synagoge in Brand zu stecken, aber zum Glück ist sie stehen geblieben, zu solide, um einzustürzen. Hand in Hand steht Inge mit ihrem Vater davor, wie in der Zeit vor diesem Albtraum, als Vater und Tochter gemeinsam durch die Straßen der Stadt spazierten. Inge mag es, an der Seite ihres Vaters zu sein, seine Hand zu spüren, die sich sanft und zugleich fest um ihre schließt und ihr das Gefühl gibt, dass er sie niemals loslassen wird. Der stattliche, leicht korpulente, kahlköpfige, introvertierte und schweigsame Mann ist das Gegenteil ihrer Mutter, dieser zierlichen, kämpferischen, resoluten und dennoch liebevollen Frau, die Wert darauf legt, sich ebenso akkurat wie schlicht zu kleiden. Er meidet Entscheidungen, spielt auf Zeit, in seiner hilflosen Ruhe liegt etwas Weiches, in seiner ständigen Unentschlossenheit eine anscheinende Gelassenheit, die alles blockiert. Trudel dagegen packt das Leben an, sie ist eine Naturgewalt. Doch die vielleicht einprägsamste Kindheitserinnerung, die Inge für immer mit sich tragen wird, ist ihre Kinderhand, klein in der großen des Vaters: ein so großer Trost, dass die ganze Welt darin Platz findet.
Inges Mutter drängt ihren Mann. Reicht ihm das alles nicht? Will er weiterhin auf das Prestige der Firma als Schutzbrief vertrauen?
Die Resignation weicht in Siegfried einem neuen Bewusstsein: Er ist nicht mehr in Sicherheit, und seine bloße Anwesenheit setzt das Leben seiner Frau und seiner Tochter aufs Spiel. Denn in der Reichspogromnacht sind tatsächlich Gestapo-Beamte bei ihnen gewesen. Sie haben nach Siegfried gefragt, und Trudel ist es irgendwie gelungen, sie fortzuschicken, mit der Beteuerung, dass sie wirklich nicht wisse, wo ihr Mann sei, dass sie ruhig die ganze Wohnung auf den Kopf stellen könnten. Und sie waren gegangen. Doch was würde beim nächsten Mal geschehen?
Der Schuppen im Gemüsegarten an der Schillerwiese kann ihn nicht für immer retten. Mann und Frau sprechen lange darüber, und eine Frage liegt in der Luft, die nicht laut ausgesprochen zu werden braucht, so sehr durchdringt sie ihr Leben. Wann werden die Nazis Siegfried Schönthal verhaften?
Er muss weit fort, vielleicht ins Ausland, vielleicht in die Niederlande, das Angebot des jüdischen Partners der Firma Hedemann-Joosten annehmen. Ja, das ist der perfekte Plan, und jetzt ist auch Väti überzeugt, dass eine Ausreise die richtige Entscheidung ist.
Trudel weiß, was zu tun ist. Am Tag nach der Verhaftung hat sie die Mutter von Ludwig Neumann besucht. Sie fand sie in Tränen, verzweifelt, dieser allzu selbstsichere Sohn ist das Letzte, was ihr noch geblieben ist, und Trudel verspricht ihr, dass sie ihr Möglichstes tun wird, um ihn zu retten; vielleicht ist der Moment gekommen, den Kontakt zu den niederländischen Partnern wieder aufzunehmen. Frau Neumann hört auf zu weinen und gesteht ihr, dass sie, wie der Zufall es will, eine gute Freundin des holländischen Konsuls in Essen sei. Und bei ihm spricht Trudel vor, um eine Einreiseerlaubnis für Siegfried zu erwirken, doch der Konsul, sichtlich zerknirscht, sagt ihr, dass er keine mehr ausstellen könne, dass nach der Reichspogromnacht die Grenze zu den Niederlanden von Soldaten der Wehrmacht patrouilliert werde. «Im Augenblick kann kein Deutscher ohne Genehmigung die Niederlande betreten, es ist alles zu.»
Wenn es ihr gelungen ist, die Tochter, «Mischling ersten Grades», an eine deutsche Schule zu bringen, dann würde es Trudel auch gelingen, den Ehemann ins Ausland zu bringen. Sie ist eine Arierin, genießt alle Rechte, und wenn sie nach Tilburg in die Niederlande reisen möchte, kann sie niemand aufhalten. Trudel lässt keinerlei Einwände gelten und denkt, dass sie im schlimmsten Fall einfach zurückgeschickt werden wird.
Inges Mutter fährt mit dem Zug. Erste Etappe, die deutsch-holländische Grenze. Und dort beginnen die langwierigen Überprüfungen, erst durch die SS, dann durch die holländische Polizei. Sie kontrollieren ihren Reisepass und das Einreiseformular, durchsuchen sie und versichern sich, dass sie keine Zeitungen bei sich trägt. Dasselbe tut die holländische Polizei, doch anstatt sie mit den anderen Passagieren in ihr Abteil zurückzulassen, wird sie abgewiesen und an der Grenze zurückgelassen.
Daraufhin bittet sie, mit dem obersten Zollbeamten zu sprechen, und sie bringen sie zu ihm. Jetzt muss sie sich nur eine glaubhafte Geschichte ausdenken, und sie muss sich beeilen. Und so erklärt sie dem Beamten, dass auf der anderen Seite der Grenze ihr Verlobter auf sie warte. Ob er denn wirklich so grausam sein könne, sie aufzuhalten?
Irgendwie gelingt es Trudel, dem obersten Zollbeamten das Herz zu erweichen, und es wird ihr gestattet, die Grenze zu überqueren, mit der Auflage, beim Zoll ihren Pass und eine Adresse zurückzulassen, wo man sie erreichen könne. Kehrt sie nicht nach zwei Tagen zurück, wird die Polizei nach ihr suchen.
Trudel hat es geschafft, sie hat niederländischen Boden betreten. Gut, und was jetzt? Zuerst fährt sie nach Tilburg, zur Firma Hedemann-Joosten. Doch Herr Joosten, derjenige der beiden Partner der gleichnamigen Firma, der Siegfried die Stelle angeboten hat, ist nicht da. Zusammen mit seinem Kompagnon Hedemann ist er zu einer Familienfeier nach Almelo gefahren, einer Stadt, die hundertfünfzig Kilometer weiter im Norden liegt. Trudel setzt sich an das Tischchen eines Cafés, wägt die Alternativen ab, holt Informationen ein, einige Unbekannte neben ihr mahnen sie zur Vorsicht, in diesem Land besser kein Deutsch zu sprechen. Dann steht Trudel auf. Der Plan ist der übliche: direkt auf das Ziel zuzusteuern, und wenn sie dort angekommen ist, Hedemann und Joosten die Dinge genau so zu schildern, wie sie stehen.
Nach mehreren Stunden im Zug erreicht Trudel Almelo. Und gerät mitten in die Feier hinein.
Bis tief in die Nacht erklärt sie den beiden jüdischen Unternehmerfreunden die Situation, in der sich ihre Familie befindet. Und am folgenden Morgen knüpft sie da wieder an, wo sie geendet hat. Joosten verspricht, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um als Bürge für Siegfried Schönthal zu fungieren. Hedemann sagt ihr zu, er werde dasselbe für Ludwig Neumann tun. Sie machen sich sofort an die Arbeit, die nötigen Genehmigungen einzuholen, es wird nur ein paar Tage dauern. In der Zwischenzeit muss Trudel nach Essen zurückkehren, bereit, in die Niederlande zurückzukehren, um das Verfahren für den Ehemann abzuschließen. Sobald die entsprechenden Stellen den beiden holländischen Partnern die Genehmigung zukommen lassen, werden sie ihr ein Telegramm schicken, dass sie sie so bald wie möglich und persönlich zu einer dringenden Besprechung treffen möchten; auf der Einladung wird auch das Datum des Treffens stehen. Mit diesem Telegramm wird Trudel keine Probleme haben, den Zoll zu passieren, ohne erneut nach einer Ausreiseerlaubnis gefragt zu werden.
Sie dankt den beiden Unternehmern, verabschiedet sich und fährt den Weg wieder zurück, bis zur Grenze, bis zu ihrem Pass, und dann zurück nach Essen.
Zwei lange Tage des Wartens vergehen, und am dritten kommt endlich das so dringend ersehnte Telegramm. Trudel bricht erneut auf in die Niederlande.
Trotz der Beschwichtigungen von Hedemann und Joosten beschließt sie, einen anderen Grenzübergang zu nutzen und wieder die Geschichte mit dem Verlobten vorzubringen. Sollte das nicht reichen, würde sie das Telegramm herausholen. Glücklicherweise läuft alles glatt.
Als sie in Almelo ankommt, raten ihr die beiden Unternehmer, direkt beim holländischen Innenminister um die Einreiseerlaubnis für den Ehemann zu ersuchen, und das tut Trudel. Die Kosten der Ausreise und die Zusicherung einer Arbeitsstelle übernimmt die Gesellschaft Hedemann-Joosten.
Die Zukunft, die Trudel für ihren Ehemann plant, baut sich über gestempelte Urkunden und Beglaubigungen, Papiere und Unterschriften, Genehmigungen und Erlaubnisse auf, in gewisser Weise nicht unähnlich der Art, wie sie Inges Schulanmeldung erwirkt hat.
Ein falscher Schritt, und alles, was sie mit solch großer Mühe zu konstruieren versucht, könnte in sich zusammenstürzen.
Jetzt ist Siegfried an der Reihe. Nachdem er persönlich in Köln war, um sich bei der Auswanderungsbehörde registrieren zu lassen, sollte alles in Gang kommen. Die Kräfte, die in diesem Feld wirken, sind so unvorhersehbar und zahlreich, dass sich im Lauf einer Nacht alles ändern kann, und so verwandelt sich das Leben der Familie Schönthal plötzlich in einen Spionageroman. Das Einschreiben, das einige Tage später aus den Niederlanden kommt, bittet Frau Schönthal, sich umgehend zur niederländischen Grenze zu begeben. Dort würde ein holländischer Staatsbürger mit einem Automobil auf sie warten. Das Kennzeichen ist in dem Brief genannt. Trudel bleibt nichts anderes übrig, als sich wieder aufzumachen. Und an der Grenze hält wirklich ein Automobil, auch das Kennzeichen stimmt. Der Mann am Steuer ist kurz angebunden, er hat keine Zeit zu verlieren, und kaum ist Trudel eingestiegen, sagt er ihr, dass die Dinge sich verkompliziert haben. Die Zahl der Juden, die versuchen, heimlich die Grenze zu überqueren, steigt stetig, und die Regierung beginnt Schwierigkeiten zu machen. Das Ergebnis sind längere Wartezeiten, um die Einreiseerlaubnis zu erhalten, und diese Zeit haben die Schönthals nicht. Darum heißt es handeln.
«Die Grenze bei Kevelaer wird von einer SS-Patrouille bewacht. Die kennen wir. Sie haben schon mehr als einmal ein Auge zugedrückt, aber sie stehen kurz vor der Ablösung. Ihr Mann muss die Grenze so schnell wie möglich überqueren.»
Trudel hört schweigend zu und macht stenografische Notizen. Der Holländer fügt hinzu, sie solle das Geld für den Helfer bezahlen, der die Flüchtlinge in die Garage eines katholischen Priesters bringen würde.
«Ihr müsst zu einem Lokal an der Grenze fahren, es ist ein kleines Café. Früh am Morgen. Ein Mann in einer blauen Arbeitshose wird euch ansprechen. Er wird euch fragen, ob ihr Feuer habt. Ihr müsst eine Essener Zeitung bei euch tragen. Haltet sie gut sichtbar. Alles Weitere besprecht ihr mit ihm. Sein Name ist van Larsen.»
Jetzt oder nie. Siegfried scheint am Rande eines Nervenzusammenbruchs zu sein. Trudel steht dem großen, korpulenten Mann hilflos gegenüber, der kaum atmen kann und wie ein Fisch nach Luft schnappt. Die emotionale Achterbahnfahrt hat ihn zermürbt, und der Gedanke, dass das Martyrium, vielleicht von einem Augenblick auf den anderen verhaftet zu werden, bald beendet sein wird, ist nur ein kleiner Trost. Auf der einen Seite seine Freiheit, auf der anderen Trudel und die kleine Inge. Es ist die einzige Alternative, aber trotzdem ist es schmerzhaft: Trudel ist Arierin, und sie und ihre Tochter werden in Deutschland bleiben.
Um früh am Morgen an der Grenze zu sein, besteigen die Eheleute Schönthal tags zuvor einen Zug nach Kleve, wo sie in einem Hotel übernachten. Das letzte Stück, vom Hotel bis zur Grenze, werden sie mit dem Taxi zurücklegen. Das wird die gefährlichste Strecke sein. Siegfried reist ohne Pass – der wurde ihm beim Auswanderungsbüro in Köln entzogen –, und es ist nicht schwierig, zu erahnen, was ihm durch den Kopf geht, als die Männer der Gestapo das Taxi zur Kontrolle anhalten und er gezwungen ist, ihnen ein Blatt zu reichen, auf dem ein großes ‹J› steht. Jude.
Gibt es Wunder? Wer darauf mit Ja antwortet, hat sicher schon häufig selbst welche erlebt. Die Männer der Gestapo lassen Siegfried und Trudel gehen, die vielleicht kaum Zeit haben, sich zu fragen, was gerade geschehen ist, weil ein zweites Wunder geschieht. In dem kleinen Café an der Grenze zu den Niederlanden taucht tatsächlich ein Herr van Larsen in blauer Arbeitshose auf. Siegfried Schönthal geht mit ihm hinaus in den Flur, um mit ihm zu sprechen, Trudel kommt wenig später hinzu. Versteckt in ihrer Tasche hat sie sechshundert Mark. Der Holländer, den sie einige Tage zuvor getroffen hat, hat ihr nicht gesagt, wie teuer die Dienste van Larsens sein würden, und so hat Trudel einen Großteil ihrer Ersparnisse bei sich. Würden sie ausreichen?
Ja, das Geld reicht, aber es ist noch nicht an der Zeit aufzubrechen, zuerst muss van Larsen sich um zwei Juden aus Berlin kümmern, die ebenfalls die Grenze überqueren wollen. Er würde später zurückkommen, gegen Mittag.
Worüber sprechen die Eheleute Schönthal in diesen wenigen Stunden? Nutzen sie die Zeit, um sich zu verabschieden, oder bleiben sie still und zermartern sich die Köpfe, für ein drittes Wunder betend, dass Herr van Larsen wirklich zurückkehren möge?
Mittags kommt der Holländer zurück und sagt Siegfried, er solle ihm folgen.
«Auf Wiedersehen. Viel Glück.» So verabschieden sich Mann und Frau. Ist es damit vorbei? Ist Siegfried für immer fort? Ist die kleine Ingemaus jetzt ohne Vater?
Trudel Schönthal bleibt noch lange in dem Café sitzen, neben sich die Tasche mit dem Geld. Wie lange braucht van Larsen, um zurückzukommen und ihr zu sagen, dass alles gutgegangen ist? Sie kann es nicht erwarten, ihn zu bezahlen und nach Essen zurückzukehren.
In diese Gedanken versunken, bemerkt sie nicht einmal den Mann in Zivil, der an ihren Tisch tritt. «Frau Schönthal?»
«Ja?»
«Kommen Sie bitte mit mir!», sagt er und versucht, nach ihrer Tasche zu greifen. Trudel reagiert sofort, sagt, sie sei selbst in der Lage, ihre Tasche zu tragen, doch der Mann schubst sie brüsk vor sich her.
«Sie sind verhaftet.»
Diesmal ist es wirklich vorbei. Wie es aussieht, haben Männer der SS Siegfried aufgehalten, bevor er die holländische Grenze überquert hatte. Wahrscheinlich haben die Kollegen von der Gestapo, die sie am Morgen angehalten hatten, sie verraten, und van Larsen konnte nichts für Siegfried tun. Vielleicht gibt es doch keine Wunder, denkt Trudel.
Trudel wird ins Grenzpolizei-Kommissariat geschleppt, die Beamten der SS um sie herum mustern sie lange. Ist es, weil sie wissen, was mit ihr geschehen wird? Im Büro des Leiters des Grenzkommissariats blenden sie sie mit einer Lampe, und sie erzählt alles: warum sie sich in diesem Café befindet, über den Ehemann, der in die Niederlande ausreisen will, von der Wahl dieses Grenzübergangs, weil er von der SS patrouilliert wird, die weniger grausam gegen die Juden ist, von dem Geld, das sie bei sich hat, um den Mann zu bezahlen, der dem jüdischen Mann bei der Ausreise helfen sollte.
«Sie lügen», sagt der Beamte, als sie geendet hat, bevor er sie in ein anderes Zimmer schickt. Sie fordern sie auf, sich komplett auszuziehen, und eine Frau mit Gummihandschuhen macht ihre Arbeit.
«Eine Bestie», beschreibt Trudel sie später auf den Seiten ihres Tagebuchs.
«Sie hat nichts bei sich», verkündet die SS-Beamtin schließlich in verachtungsvollem Ton. Daraufhin wird Trudel zurück zum Leiter des Grenzbüros gebracht, der jetzt viel freundlicher scheint, beinahe als wollte er sich für diese Behandlung entschuldigen. Oder vielleicht hat er sich nur beruhigt, nachdem er seine Kollegen in Essen angerufen und sich versichert hat, dass die Frau, die vor ihm steht, nicht lügt. Johanna Emma Gertrud Rosenmüller wohnt tatsächlich in dieser rheinländischen Stadt, hat eine kleine Tochter, die sich gerade bei der Großmutter befindet, und der Ehemann ist der Einzige, der auswandern möchte. Trudel erfährt, dass Siegfried, der kurz vor ihr vernommen worden war, Angst bekommen und angegeben hat, er sei alleine zur Grenze gekommen.
Wie viele Geschichten wie diese hat der Grenzbeamte wohl in den vergangenen Monaten gehört? Die Familie Schönthal wird weder die erste noch die letzte sein, die nach einer besseren Zukunft für eines ihrer Mitglieder sucht.
Trudel fleht ihn an. Siegfried hat eine Bürgschaft für die Auswanderung bekommen, und wenn er sich auf dieses Abenteuer eingelassen und gelogen hat, dann nur für sie und ihre Tochter. Der Grenzkommissar nickt, aber er kann ihn nicht durchlassen.
«Sie und ihr Mann müssen so schnell wie möglich nach Essen zurückkehren. Die Ausgangssperre für Juden beginnt um 18 Uhr.»
Trudel will etwas antworten, doch der Beamte bremst sie mit einer Handbewegung. Er ist noch nicht fertig.
«Für die Auswanderung genügt ein Bürge nicht. Sie müssen sich auch eine Steuerunbedenklichkeitserklärung besorgen.»
Ein weiteres Dokument! Doch die Worte des Beamten klingen, als hätte sie der Himmel geschickt.
«Und wer garantiert mir, dass mein Mann, wenn er an die Grenze kommt, nicht erschossen wird?», fragt Trudel.
«Ich.»
Trudel muss sich mit der Garantie des Grenzkommissars begnügen. Für den Rest wird sie auf ihre Entschlossenheit zählen und auf ihren Vater, der in der Polizeiinspektion in Essen gearbeitet hat. Dank ihm kommt nach einigen aufregenden Tagen zwischen Kriminalpolizei, Handels- und Industriekammer vom Essener Rathaus die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung. Und so ist Siegfried Schönthal am 8. Dezember 1938 erneut alleine am Grenzposten von Kevelaer. Er bezahlt zehn Mark Zollgebühr, um die Grenze zu überqueren, während Herr van Larsen, der Helfer, der Siegfried auf holländischem Boden begleiten wird, fünfhundert einstreicht, um ihn in die Garage des katholischen Priesters zu bringen. Trudel bittet ihren Mann, ihr ein Telegramm zu schicken, sobald er bei Hedemann-Joosten in Tilburg ist, mit dem folgenden Text: «Alles Gute zum Geburtstag!»
Und das Telegramm kommt am folgenden Tag, gerade noch rechtzeitig, denn am 12. Dezember vollzieht sich pünktlich die Ablösung der ‹barmherzigen› SS-Wachen, die am Grenzposten von Kevelaer stationiert waren. Von diesem Tag an, erzählt man sich, ist es keinem Juden mehr gelungen, die Grenze zu überqueren.
Und Ludwig Neumann? Hat auch er es geschafft? Trudel geht zu Frau Neumann, sie will ihr die gute Nachricht von Siegfried überbringen, um ihr ein bisschen Hoffnung für den Sohn zu machen. Und sie ist nicht wenig erstaunt, als sie Ludwig persönlich antrifft. Er ist erschöpft, das ist deutlich zu sehen, sein ausgezehrter Körper spricht Bände. Und obwohl er es versucht, gelingt es ihm nicht, die verbundenen Füße in den Pantoffeln zu verstecken. Er will nicht erzählen, was ihm in diesen vier Wochen in Dachau geschehen ist, die auf seine Verhaftung in der Reichspogromnacht folgten; er sagt nur, dass er durch seinen englischen Freund die Erlaubnis erwirkt hat, mit der Mutter nach London zu emigrieren. Nach diesem Tag wird Trudel die beiden nie wiedersehen.
Wenn die Gefahr vorüber ist, bleibt die Leere. Es bleibt das Auf und Ab von dem Schmerz des Verlustes und einem Gefühl von Befreiung. Es bleibt die Frage, wie man einem Mädchen von acht Jahren den Sinn all dieser Diskussionen am späten Abend erklärt. Und unbeantwortet bleibt die Frage, warum Inge kürzlich so viel Zeit in den Hügeln bei Bottrop verbringen musste, der Stadt nördlich von Essen, in der die Großmutter lebt.
Viele, zu viele Fragen, die Johanna Emma Gertrud Schönthal, geborene Rosenmüller, wenigstens anfangs mit dem üblichen Pragmatismus anpackt. Während sie einen Koffer mit Kleidern, Schuhen, Unterwäsche und allem, was ihrem Mann nützlich sein könnte, packt, während sie die Zollprozeduren durchläuft, die nötig sind, um ihn an die Firma Hedemann-Joosten zu schicken, können wir nicht wissen, ob ein Teil ihrer Gedanken auf die Hoffnung gerichtet ist, ihren Siegfried eines Tages wieder in die Arme schließen zu können. Auch weil an jenem 8. Dezember 1938 nicht nur der Ehemann und Vater von Inge gegangen ist, sondern auch derjenige, der für das Auskommen der Familie sorgte, und Trudel ist sich bewusst, dass sie bald eine Arbeit finden muss. Zum Glück muss sie nicht lange suchen, und nach einer ersten Ablehnung wegen ihres jüdischen Nachnamens findet Inges Mutter eine Anstellung als Vertrauensperson in der Telefonzentrale einer lokalen Baufirma.
In der Zwischenzeit kommen die ersten Nachrichten aus den Niederlanden. Siegfried ist in ein Lager bei Hoek van Holland interniert worden, zusammen mit allen illegal eingereisten Juden. «Hier herrscht ein großes Durcheinander, und was man so hört, laufen selbst die christlichen Ehefrauen von Juden Gefahr, als Juden deklariert zu werden», schreibt er ihr. Außer den Juden findet sich alles Mögliche im Lager: Protestanten, Katholiken, politische Abweichler, aber auch ganz regulär eingewanderte Männer und Frauen.
Als sie diese Zeilen liest, hat Trudel vielleicht nicht einmal Gelegenheit, sich zu fragen, was schiefgegangen sein mochte, weil Siegfried ihr kurz darauf rät, die Scheidung einzureichen. «So läufst du und das Kind nicht Gefahr, in ein Lager deportiert zu werden.» Er steht noch immer unter dem Schutz von Hedemann und Joosten, und sobald eine ordnungsgemäße Aufnahme erfolgt ist, würden die beiden Partner sich bemühen, eine Auswanderung in die Vereinigten Staaten zu organisieren. Auch in den Niederlanden wird es für die Juden jetzt schwierig. Es gibt keine andere Lösung.
Die Scheidung einzureichen bedeutet jedoch, sich erneut in die zermürbenden Höllenkreise der Bürokratie zu begeben. Die Mutter wendet sich daraufhin an den Anwalt Jaegermann. Das Beste, was sie tun könne, erklärt dieser, sei es, das Internierungslager ihres Mannes aufzusuchen und sich von ihm eine schriftliche Erklärung geben zu lassen, in der er versichert, im Licht der politischen Entwicklungen in Deutschland einer Scheidung zuzustimmen. Auf diese Weise würde kein Rechtsbeistand notwendig sein. Darüber hinaus besagte ein Gesetz, dass die Nazis im Moment ihrer Machtergreifung erlassen hatten, dass Ehen, in denen einer der Partner Jude war, «mit sofortiger Wirkung annulliert werden könnten».
Ein weiterer Scheideweg. Und wie an allen Scheidewegen, die bisher Trudels dreißig Lebensjahre geprägt haben, liegt der Weg, den es einzuschlagen gilt, klar und deutlich vor ihr, auch wenn dieser selten mit dem übereinstimmte, was die junge Frau sich für sich selbst gewünscht hätte. Nie hätte sie ihren Mann verlassen wollen, doch immer ist ihr die Rolle der Kämpferin zugefallen, das ist ihr Schicksal. Und den Weg in die Niederlande kennt sie inzwischen gut.
Wieder ohne ein Einreisevisum, nur mit einem Brief ihres Anwalts, in dem steht, dass sie anlässlich der Scheidung dringend mit ihrem im Lager in Hoek van Holland internierten Mann sprechen muss, erreicht Trudel die holländische Grenze, wo sie die üblichen Fragen beantworten muss. Diesmal geht alles glatt, Trudel kann erleichtert aufatmen: Sie würde Siegfried wiedersehen. Er beruhigt sie. Er ist nicht mehr in Gefahr. Er bestätigt ihr, dass er, wenn es ihm gelingt, dort aufgenommen zu werden, und wenn die Bürgschaft von Hedemann-Joosten akzeptiert wird, bald in die Vereinigten Staaten auswandern werde. Er hat ihr auch bereits sein schriftliches Einverständnis zur Scheidung aufgesetzt. Doch zuerst muss Trudel eine letzte Schikane ertragen. Es obliegt dem Gericht zu entscheiden, ob die Trennung anerkannt wird. Der Vorsitzende des Gerichts, ein Herr von gewissem Alter, erhebt zum Glück keine Einwände. Anders als ein junger Nazi-Anwalt, der die Absicht zu haben scheint, sich aufzuspielen.
«Ich würde gerne wissen, warum Sie nicht längst die Möglichkeit genutzt haben, die Ehe zu annullieren, nachdem Ihr Mann Jude ist. Und darüber hinaus, wenn Sie keinen Juden geheiratet hätten, müssten Sie sich jetzt nicht scheiden lassen und beantragen, den Ehenamen abzulegen.»
Der Anwalt ist dabei, sich einzuschalten, als Trudel ihn bremst und selbst das Wort ergreift. Sie steht auf, und an den Richter gewendet, sagt sie: «Ich habe meinen Mann 1930 geheiratet, damals gab es keine Rassengesetze. Meine Tochter ist protestantisch getauft worden. Natürlich, wenn ich damals so klug gewesen wäre, wie Sie es scheinbar sind, hätte ich wahrscheinlich keinen Juden geheiratet. Doch um meine Tochter durchzubringen, muss ich arbeiten, was mit einem jüdischen Nachnamen schwierig ist. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Jetzt tun Sie, was Sie für richtig halten, gestatten Sie mir die Scheidung oder nicht. Aber gegen meinen Ehemann kann ich nichts Schlechtes vorbringen.»
Als ihre Ansprache beendet ist, dreht Trudel Schönthal sich um und verlässt erhobenen Hauptes den Gerichtssaal. Ihr Anwalt läuft ihr hinterher, keuchend und mit unverhohlenem Vorwurf in der Stimme sagt er: «Schön, jetzt haben Sie alles verdorben.»
Doch am 30. Juni 1939 erklärt das Landgericht Essen die Ehe für rechtmäßig aufgelöst. Kosten des Gerichtsverfahrens: 280,98 Reichsmark. Von da an trägt Inges Mutter wieder ihren Mädchennamen: Rosenmüller. Es beginnt abermals ein neues Leben. Mutter und Tochter werden auch nach dem Gesetz untrennbar.
Für kurze Zeit kehrt, bei allem Schmerz, das Gefühl von Leichtigkeit und Glück zurück, das die Familie Schönthal Jahre zuvor kennengelernt hatte. Aber Inge hat den Vater verloren und weiß nicht genau, warum. Inzwischen müsste er sich in den Vereinigten Staaten aufhalten, in New York, und für sie könnte er auch auf einem anderen Planeten sein. Juden, Arier? Was hat das alles mit ihr zu tun? Sie ist Deutsche und Protestantin, aber auch das bedeutet nicht viel, außer der Freude, Geschenke unter dem Baum zu finden und Weihnachtslieder zu singen wie alle anderen. Für sie sind das nichts als Worte. Der einzige Trost ist, dass die Stimmen hinter der Tür verstummt sind. Das Leben geht weiter, so ist es nun einmal, und in Inges Leben gibt es wunderschöne Dinge, wie das Meer, das sie liebt. Die Schule fährt mit ihr und ihren Mitschülern jedes Jahr ans Meer, immer dasselbe Ferienlager, dieselben Schlafsäle mit fünfzig Betten und der Erbsensuppe, die sie verabscheut und nicht hinunterbekommt. Aber dann ist da das Meer, das für alles entschädigt.
Von August bis September 1939 ist Inge im Ferienlager zwischen den Sanddünen der Insel Amrum, an der Nordseeküste. Mitten in der Nacht werden sie und ihre Mitschüler von den Lehrern geweckt. Sie müssen nach Hause zurückkehren, so schnell wie möglich. Deutschland ist in Polen einmarschiert. Der Zweite Weltkrieg bricht aus.
2 Die tanzenden Physiker
Wer weiß, wie schwer es Inge fällt, angesichts dieses Reiters, der mit seinem scheuenden hellen Fuchs kämpft, ein Lächeln zu unterdrücken. Der Mann versucht angestrengt, den federnden Gang und einen Ausdruck würdevoller Eleganz aufrechtzuerhalten, doch jedes Mal, wenn er bemerkt, dass seine Beine nicht parallel zum Rumpf des Pferdes sind, lässt er eine Grimmasse der Enttäuschung sehen. Mann und Pferd wirken wie zwei voneinander getrennte Einheiten.
Es ist Sonntag, und Sonntage hasst Inge aus ganzem Herzen. Eintönig, langweilig, endlos, und wenn sie es nicht mehr aushält, beginnt sie die Mutter mit der Forderung zu bestürmen, die sich in einem einzigen Wort zusammenfassen lässt: «Siegen!»
In Siegen, hundert Kilometer von Essen entfernt, leben Tante Paula, Vätis Schwester, Onkel Adolf und die Cousine Anneliese, und dort sind die Sonntage ganz anders. Trudel sträubt sich immer ein wenig, aber dann gibt sie doch gerne nach, auch ihr gefällt Siegen, und noch mehr gefällt es ihr, an Paulas Arm spazieren zu gehen, genau wie sie es in diesem Augenblick tut, die vom ersten Schnee herabhängenden Zweige bestaunend.
Außerdem sind sie jetzt alleine, sie und Inge, und Paula und Adolf sind im Augenblick die richtigen Gesprächspartner, denn sie sind das Spiegelbild von Trudel und Siegfried. Adolf ist Arier und Paula, natürlich, Jüdin. Was aus Anneliese einen ‹Mischling ersten Grades› macht, genau wie Inge. Es gibt jedoch einen Unterschied: Ein Vater bietet mehr Schutz als eine Mutter, weil er eine stärkere Position in der Gesellschaft innehat und darüber hinaus dafür einsteht, dass Vermögen und Zukunft der Familie arisch sein werden. Aber die Dinge ändern sich schnell, und Trudel hofft, dass die Familie der Schwägerin nicht am Ende dasselbe Schicksal ereilt wie die ihre.
Siegfrieds Auswanderung, das holländische Abenteuer, die Scheidung. Das sind Ereignisse, um ein ganzes Leben zu füllen, stattdessen haben sie sich im Laufe weniger Monate ereignet, und es wäre verständlich, wenn es Trudel in diesen letzten Wochen des Jahres 1939 noch nicht gelänge, sie alle in die rechte Perspektive zu rücken. Ist es wirklich geschehen? War sie wirklich so verrückt, bei wenigstens zwei Gelegenheiten das Schlimmste zu riskieren, um schließlich als Alleinerziehende in Kriegszeiten mit ihrer Tochter zurückzubleiben?
Und vor allem Ingemaus, wie verkraftet sie das alles?
Kurz zuvor, bei dem üppigen Mittagessen bei Tante und Onkel auf der Veranda, ist es ihr nicht gelungen, ihren Blick aufzufangen, aber als sie sie jetzt beobachtet, wie sie herumspringt und zügellos mit ihrer Cousine lacht, wirkt sie, als könnte ihr nichts etwas anhaben. Einen Augenblick lang wünscht sie sich vielleicht, dass diese anscheinende Unempfindlichkeit gegen das Gewicht der Tragödien in einer nicht allzu fernen Zukunft zum Schild gegen die Übel der Welt werden möge. Sollte ihre Mutter einmal nicht mehr da sein, wer wird sie sonst beschützen?
Trudel lässt Paulas Arm nicht los, und Inge tollt, eingewickelt in ihren roten Mantel, zwischen den Erdschollen der Felder herum. Draußen ist es angenehm. Die Sonne scheint, die Luft ist schneidend, die Landschaft märchenhaft.
Und dann ist da dieser Mann auf dem Pferd. Um ehrlich zu sein, bemerkt Trudel ihn nicht sofort. Sie spürt, wie ihr Arm aus Paulas Armbeuge gerissen wird, und als sie den Blick senkt, sieht sie Anneliese, die Trost bei der Mutter sucht. Sie ist verängstigt und schaut auf einen Punkt in ihrem Rücken. Trudels erster Gedanke gilt daraufhin Inge. Wo ist sie? Hat sie sich wehgetan? Ihr Blick huscht herum auf der Suche nach ihrer Tochter, ihrem roten Mantel. Auch Paula schreit auf, und Trudel weiß, dass ihre Schwägerin nur wegen einer Sache so schreien würde, die ihr am meisten Angst einjagt: Pferde.
Die Wiese vor ihnen steigt leicht an, bis hinauf zum Waldrand. Sie sehen den Reiter über sein Tier gebeugt, wie er ihm das helle Fell streichelt, wie um sich zu bedanken, dass es sich beruhigt hat. Und da steht Inge, gefesselt von der Szene; sie ist nähergetreten, um das Pferd zu streicheln.
«Entschuldigen Sie, meine Damen», sagt der Reiter. Aus der Nähe erkennen die Frauen seinen Dienstgrad: Er ist ein Offizier. «Ich wollte Sie nicht erschrecken.»
«Das haben Sie nicht, oder höchstens ein bisschen, keine Sorge», antwortet Trudel. Sie möchte hinzufügen, dass auch sie Pferde mag, schon immer, aber Inges Stimme unterbricht sie.
«Onkel Soldat, lässt Du mich auch mal reiten?»
Typisch Inge, denkt Trudel. Ihre Tochter ist ein Wirbelwind, das ist inzwischen klar, und entschieden frech; sie verabscheut es, an der Hand laufen zu müssen, übernimmt gern selbst die Initiative, genau wie jetzt mit diesem Fremden.
Einen Augenblick später sitzt Inge kerzengerade im Sattel dieses großen Rosses, während der Offizier es am Zügel hält. Der improvisierte Zug bewegt sich im Schritttempo, am Wald entlang, in respektvollem Schweigen, das nur von Inges Lachen und dem Schnauben des Pferdes durchbrochen wird.
«Meine lieben Damen», sagt der Offizier, «ich würde mich gerne für den kleinen Schrecken entschuldigen, indem ich Sie einlade, die Stallungen zu besichtigen.»
Für Trudel ist das die Gelegenheit, ihm zu antworten, dass sie sich nicht erschreckt haben, dass dieser Fuchs mit dem rötlichen Schimmer wirklich wunderschön ist, doch sie wird wieder von der Stimme ihrer Tochter unterbrochen.
«Die Ställe!»
Keck und auch ein bisschen unverschämt …
Inges Begeisterung hat die Macht, das Misstrauen ihrer Cousine zu überwinden, die sich schließlich von der Hand ihrer Mutter löst, um vorauszulaufen zu der kleinen Reitbahn.
Die Ställe sind wenige hundert Meter entfernt, und als sie schließlich dort ankommen, lässt Inge sich aus dem Sattel gleiten, der Offizier fängt sie auf und setzt sie auf den Boden. Die Cousinen rennen los, schlüpfen zwischen die Boxen und Ställe, bleiben einen Augenblick stehen, um die Schnauze eines der Pferde zu streicheln, und beginnen dann wieder hin und her zu flitzen. Die Ermahnungen Trudels und Paulas erreichen sie nicht, die Cousinen sind außer sich vor Begeisterung, beachten die Erwachsenen nicht. «Onkel Offizier, wie heißen Ihre Pferde, welche sind die bravsten und welche die mutigsten? Können wir ihnen zu fressen geben? Bitte?»
Und mit diesem Wortschwall hat Inge bereits den Offizier erreicht, der bis zu diesem Augenblick die Szene etwas abseits beobachtet hat. Jetzt bückt er sich, um eine Handvoll Hafer aufzuheben.
«Gestatten», sagt er und geht hinüber zu Anneliese. Sobald sie das martialische Klappern der Sporen hören, verstummen die beiden Mädchen.
«Macht es so wie ich», sagt der Offizier. «Nehmt ein bisschen Hafer, dann sucht ihr euch ein Pferd aus. Aber achtet darauf, die Handfläche ganz flach ausgestreckt zu halten. Ihr müsst euch sein Vertrauen erst verdienen.»
Während Inge und Anneliese die Pferde füttern, ziehen die Erwachsenen sich nach draußen zurück. Tante Paula ist plötzlich sehr gesprächig geworden, und sie beginnt zu erzählen, seit wann sie in Siegen wohnen, wie gut es ihnen gefällt, wie schön alles dort sei.
«Inge und ich bleiben bis morgen hier», mischt Trudel sich irgendwann ein, beinahe instinktiv. Der Offizier nickt leicht mit dem Kopf.
Am darauffolgenden Tag, als der Offizier an die Haustür ihrer Schwägerin kommt, um sich, wie er sagt, noch etwas zu unterhalten, ist Trudel keinesfalls überrascht.
Weihnachten. Die schlimmste Zeit, um sie in Gesellschaft der Einsamkeit zu verbringen, auch wenn man zu zweit ist. Darum kehren Trudel und Inge nach Siegen zurück, und obwohl der Winter kalt ist, bleibt die Gewohnheit des Spaziergangs nach dem Mittagessen unantastbar.
Inge und ihre Mutter treffen erneut auf den Offizier. Und wieder bei einem Waldspaziergang, so als habe dieser Mann die ganze Zeit damit verbracht, die Gegend zu patrouillieren, in der Hoffnung, sie wiederzusehen. Es beginnen wieder die Höflichkeiten, die Spaziergänge, der Weg zwischen Haus und Ställen, auf dem sie sich besser kennenlernen können. Nach den Feiertagen, als der Moment gekommen ist, nach Essen zurückzukehren, bittet Inge, noch einige Tage bei ihrer Cousine Anneliese bleiben zu dürfen. Die Mutter stimmt nach einigem Zögern zu: Dort wäre Inge in Sicherheit. Und so, nachdem sie sich von ihrer Tochter verabschiedet hat, steigt Trudel in das Auto von Onkel Adolf.
Am Bahnhof herrscht ein Kommen und Gehen von Soldaten. Inzwischen ist ihre Anwesenheit zu einem neutralen Hintergrund geworden, zu einem so gewohnten Anblick, dass er beinahe selbstverständlich ist. Vielleicht aus diesem Grund, oder vielleicht als letzter Versuch, den Kontakt zu ihrer Tochter aufrechtzuerhalten, hebt Trudel, noch auf dem Trittbrett des Wagons stehend, die Stimme, um den ohrenbetäubenden Lärm des abfahrenden Zuges zu übertönen.
«Adolf, denk dran. Ingemaus darf nicht den Zug am 3. Januar versäumen. Am Tag danach ist mein Geburtstag, und ich würde ihn so gerne mit ihr feiern.»
Adolf beruhigt sie, Inge wird in diesem Zug sitzen, er selbst wird sie begleiten. Trudel bedankt sich bei ihm und setzt sich zusammen mit einigen Soldaten in ein Abteil.
«Ist der Platz neben Ihnen frei, verehrte Dame?»
Diese höfliche, korrekte Ausdrucksweise und diese Betonung auf der ‹Dame›! Das genügt ihr, um Offizier Heberling wiederzuerkennen, ihren Offizier.
Als Trudel den Kopf hebt, um ihm zu sagen, dass der Platz frei sei, kommt als Antwort wieder Heberlings kleines, angedeutetes Kopfnicken.