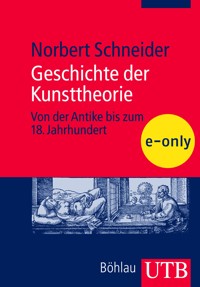Contents
Impressum
Widmung
Warum ich dieses Buch geschrieben habe?
Herzbild - Warum ich erzähle
Prolog Wind bei Oia
Herzbild – Atlantikkante
Kapitel 1 Ein großes Haus
Herzbild - Ein Haus, ein Sofa, ein Klick
Kapitel 2 Isch bin dann mal ford
Herzbild – Flurlicht
Kapitel 3 Die Zeit dazwischen
Herzbild – Rucksacknacht
Kapitel 4 Frankfurt-Hahn, Wolken
Herzbild – Erster Abend am Meer
Kapitel 5 Holz, Salz und erste Müdigkeit
Herzbild – Holzweg
Kapitel 6 Wenn Gehen Alltag wird
Herzbild – Zwei Tempi
Kapitel 7 Die Nacht des Kreuzes
Herzbild – Nacht in Rubiães
Kapitel 8 Zwischen Portugal und Spanien
Herzbild – Bettwäsche
Kapitel 9 Oia – ein Stein für einen
Herzbild – Ein Mann auf dem Felsen
Kapitel 10 Ankunft in Caldas de Reis
Herzbild – Füße im Wasser
Kapitel 11 Die letzten Kilometer vor dem Ziel
Herzbild – Platz vor der Kathedrale
Kapitel 12 Rückkehr nach Hause
Herzbild – Haus in Hessen am Abend
Kapitel 13 Vom Schraubenzieher zum Zuhören
Herzbild – Schraubenzieher in der Schublade
Kapitel 14 Ein leiser Camino im Alltag
Herzbild – Mappen auf dem Tisch
Kapitel 15 Mein Weg zu uns
Herzbild – Küchentischlicht
Herzbild – Wohnwagenlicht am Meer
Schlusswort Ein Weg, der weitergeht
Herzbild – Buch im Regal
Danksagung
über den Autor
Persönliche - Herzbilder
Herzbild 1 – Leise wach werden
Herzbild 2 – Sofa, Strickzeug & irgendwas im Fernsehen
Herzbild 3 – Unterwegs nach irgendwo
Herzbild 4 – Zaubern in der Küche
Herzbild 5 – Kinder & stiller Stolz
Herzbild 6 – Einfach zusammenwohnen
Herzbild 7 – Gedankenleser
Herzbild 8 – Nur da sein, wenn es schwer ist,
Herzbild 9 – Stille nebeneinander gehen
Herzbild 10 – Nichts finden und ankomme
Herzbild 11 – Mein eigener Erklärkanal
Herzbild 12 – vierzig in der Fünfziger-Zone
Herzbild 13 – Suchen, was wirklich passt
Herzbild 14 – Wenn sie singt
Herzbild 15 – Wenn jemand stolz auf ist
Herzbild 16 – Tetris im Schrank
Herzbild 17 – Vorgestellt werden
Herzbild 18 – Plan und kleine Abweichung
Herzbild 19 – Ein Tag unterwegs
Herzbild 20 – Nach einem schweren Tag
Herzbild 21 – Ein Tier, das mit uns wohnt
Herzbild 22 – Nach einem Streit
Herzbild 23 – Ein Tisch im Restaurant
Herzbild 24 – Kleine gemeinsame Zukunft
Bonus Making of – Isch bin dann mal ford
Zwischenkapitel: Eine kleine Zeitleiste
Bonus Anhang The-Work Session
Die zweite Work: „Mit KI schreiben ist Schummeln“
Ende
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Hinweis zur Methode „The Work“: „The Work“ und „The Work of Byron Katie“ sind eingetragene Marken von Byron Katie International, Inc. Die hier beschriebenen Anwendungen beruhen auf meinen persönlichen Erfahrungen; es besteht keine geschäftliche Verbindung zu Byron Katie oder Byron Katie International, Inc.
© 2025 Norbert SchneiderLektorat: Norbert SchneiderKorrektorat: Norbert Schneider
Druck: Libri Plureos GmbH, Friedensallee 273, 22763 Hamburg
ISBN: XXX-X-XXXX-XXXX-X
Widmung
Für meine beiden Töchter,
die mich auf meinen Wegen begleiten, hinterfragen,
anfeuern und mir immer wieder zeigen,
dass Liebe manchmal heißt,
jemanden gehen zu lassen und trotzdem verlässlich
da zu bleiben.
Für die Frau an meiner Seite,
die ihren eigenen Weg geht und ihren Raum braucht
und mich gerade dadurch lehrt,
dass ein „Wir“ nicht aus Verschmelzung entsteht,
sondern aus zwei Menschen,
die einander die Freiheit lassen, sie selbst zu sein.
Für Georg,
der diesen Weg nicht mehr mit mir gehen konnte
und den ich doch in vielen Schritten dabei hatte.
Der Stein in Oia gehört dir.
Ein Stück der Schritte danach auch.
Für all die Menschen,
die meinen beruflichen Weg gekreuzt haben –
Teilnehmende, Kolleginnen und Kollegen,
die mit ihren Geschichten in meinen Raum gekommen sind
und mir gezeigt haben,
dass Brüche keine Schwäche sind,
sondern oft der Anfang von etwas Ehrlichem.
Und für alle,
die selbst gerade aufbrechen,
weil sie spüren, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann –
dieses Buch ist kein Reiseführer,
aber vielleicht ein leiser Beweis dafür,
dass sich ein erster Schritt lohnt.
Wenn du dieses Buch in der Hand hältst, darfst du wissen:Ich habe es auch mit dir im Blick geschrieben.
Warum ich dieses Buch geschrieben habe?
Es gibt Wege, die man geht, ohne genau zu wissen, wo man ankommt.
Mein Camino 2017 war so ein Weg.
Von außen sah es aus wie eine Auszeit: ein Mann, der nach einer Pleite, einem zu großen Haus und vielen offenen Fragen seinen Rucksack packt und losläuft. Nach innen war es mehr. Ich wollte verstehen, wie ich an diesen Punkt gekommen bin – und ob ich mein Leben noch einmal anders drehen kann, ohne alles zu verlieren, was mir wichtig ist.
Lange war dieser Weg nur in meinem Kopf und in ein paar Notizen. Bruchstücke von Tagen: der Wind in Oia, eine Brücke zwischen zwei Ländern, eine heiße Quelle in Caldas de Reis, ein Platz vor einer Kathedrale, auf dem es seltsam still war. Dazwischen Bilder von Zuhause, von einem „Wir“, das leiser geworden war, als ich es mir je gewünscht hätte.
Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich gemerkt habe, dass dieser Weg mich verändert hat – und dass ich das nicht einfach in einer Schublade verschwinden lassen möchte. Nicht, weil mein Camino wichtiger wäre als andere, sondern weil er eine Antwort auf eine Frage berührt, die viele kennen: Was mache ich, wenn das Leben, das ich aufgebaut habe, mir nicht mehr guttut?
Es ist kein Ratgeber geworden. Keine Anleitung, wie man „innere Stärke“ in sieben Schritten findet. Es ist eine Geschichte. Mein Weg vom großen Haus in Hessen bis nach Santiago.
Mit Umwegen, mit Leere, mit Angst, mit leisen Momenten von Humor, mit den Menschen, die mir unterwegs begegnet sind – und mit denen, die ich in Gedanken dabeihatte, auch wenn sie nicht mitgelaufen sind.
Ein Teil dieses Buches ist für diejenigen, die an einem ähnlichen Punkt stehen: zwischen „Eigentlich geht es doch“ und „So kann es nicht weitergehen“. Vielleicht hilft es, einen fremden Weg zu lesen, um den eigenen klarer zu sehen.
Ein anderer Teil ist leiser gemeint.
Für einen Menschen, der meinen Weg ein Stück begleitet hat – mit Gitarre, Gesprächen und einer Freundschaft, die nicht zu Ende erzählt war, als sein Leben aufgehört hat. Ich konnte ihn nicht mehr besuchen, wie wir es einmal vorhatten. Also habe ich ihn auf diese Reise mitgenommen: in meinen Gedanken, in einem kleinen Stein in Oia, in den Schritten, mit denen ich „Für dich“ gesagt habe, ohne dass er neben mir stand.
Dieses Buch ist auch ein spätes Zeichen: „Ich habe dich nicht vergessen“ – und ein stiller Abschied. Ein Versuch zu zeigen, dass etwas von dem, was wir geteilt haben, weitergeht: in meinem Blick auf Menschen, die still werden, bevor sie etwas sagen.
Unterwegs auf dem Camino hat sich in mir etwas leise gedreht. Ich habe gemerkt, wie wenig ein Mensch wirklich braucht, um innerlich satt zu werden: ein Bett, ein Teller Suppe, zwei, drei gute Gespräche – und das Gefühl, bei sich zu sein. Das war weit weg von schnellen Autos, vollen Kalendern und dem Satz: „Ohne Sie geht hier nichts.“
Dieser Weg hat mein Bewusstsein verschoben: weg von „Wie halte ich das noch aus?“ hin zu der Frage „Wie will ich eigentlich leben?“
Heute arbeite ich als Coach. Ich sitze nicht mehr in Serverräumen, sondern mit Menschen am Tisch, die sich ähnlich festgefahren fühlen wie ich damals. Oft in einem Landstrich, in dem Menschen „Moin“ sagen. Ich höre zu, stelle Fragen, halte Stille aus. Ich helfe ihnen, eigene Wege zu finden – nicht meine.
Dieses Buch schreibe ich, weil ich glaube, dass Wege verschwinden, wenn man sie nicht erzählt. Und weil ich dankbar bin für all das, was diese Brüche in meinem Leben angestoßen haben und was mich dorthin geführt hat, wo ich heute bin.
Manchmal stelle ich mir vor, wie Georg irgendwo sitzt, vielleicht mit einer Gitarre, vielleicht einfach nur mit einem stillen Lächeln, und diese Seiten mitliest. „Na, Norbert“, höre ich ihn dann sagen, „du hast den Weg doch gefunden. Anders, als wir dachten – aber du bist gegangen.“
Und genau davon erzählen diese Kapitel:
davon, wie ein Mann, der sich selbst lange gut verstecken konnte, nach und nach sichtbar wurde – zuerst für sich, dann für andere.
In meinem heutigen Alltag tauchen immer wieder kleine Szenen auf, bei denen ich denke: Genau so fühlt sich mein neues Leben an. Ich nenne sie Herzbilder – kurze Momentaufnahmen, die nichts erklären, sondern einfach zeigen, wie es sich gerade anfühlt.
Das erste davon möchte ich hier festhalten
Herzbild - Warum ich erzähle
Herzbild – Warum ich erzähle
Auf einem Tisch liegt ein dünner Stapel bedruckter Seiten. Zwischen den Zeilen stehen Jahre, in denen vieles einfach „weiterging“, obwohl innen längst etwas müde war.
Ein Mann sitzt davor, streicht mit der Hand über das Papier und denkt an Menschen, die an ähnlichen Punkten stehen: zwischen „Eigentlich geht es doch“ und „So kann es nicht weitergehen“.
Er merkt, dass dieser Weg nicht nur ihm gehört.
Dass in jedem Stolpern, jedem Losgehen, jeder stillen Entscheidung etwas steckt, das anderen Mut machen kann.
Vielleicht schreibt er dieses Buch nicht, weil er Antworten hat, sondern weil er zeigen will, dass man Fragen aushalten und trotzdem weitergehen kann.
Und während er den nächsten Satz tippt, spürt er leise: Wenn ich diese Geschichte nicht erzähle, verschwindet ein Weg, der mir das Leben gerettet hat.
Prolog Wind bei Oia
Der Wind vom Atlantik schlug mir ins Gesicht, als wolle er mich ein letztes Mal fragen, ob ich das wirklich ernst meine.
Ich stand auf den Felsen vor Oia. Unter mir das Krachen der Wellen gegen die dunklen Steine, vor mir das Meer, salzig und weit. In mir all die Jahre, in denen ich mir eingeredet hatte, dass „später“ schon irgendwann kommen würde. Der Rucksack zog an meinen Schultern. Die Muskeln brannten von den vergangenen Tagen, die Finger waren kalt, die Socken seit Stunden feucht. In den Füßen dieser lange, stumpfe Schmerz, der sich irgendwann nicht mehr wie Schmerz anfühlt, sondern wie die Hintergrundmusik des Gehens.
Und trotzdem wusste ich: Wenn ich jetzt einfach zurück in mein altes Leben ginge – in das Haus in Hessen, in die Firma, in den Alltag –, würde ich es dort nicht mehr aushalten. Nicht noch einmal dieses „Weiter so“, bei dem man immer häufiger über das Weitermachen spricht, statt wirklich zu leben.
Der Wind zerrte an der Jacke, fuhr mir in die Kapuze, brüllte mir ins Gesicht, als wolle er erklären, dass er hier schon länger steht als alle meine Pläne zusammen. In mir war es still. Nicht die gemütliche Stille eines Sonntagnachmittags, sondern diese besondere Ruhe, die entsteht, wenn man alle Argumente schon hundertmal mit sich selbst diskutiert hat und irgendwann merkt: Die Entscheidung ist längst gefallen.
Weiter oben im Rucksack lag ein kleiner Stein. Unspektakulär, unsauber abgeschlagen, ein Stück vom Weg, das ich für einen Mann mitgenommen hatte, den ich besuchen wollte und den es nicht mehr gab. Für Georg.
„So hatten wir uns das nicht vorgestellt“, sagte ich in den Wind hinein. Die Antwort kam von innen, wie immer, wenn es ernst war. Sie brauchte keinen Mund: Du bist trotzdem hier.
Es hätte ein Moment fürs große Infragestellen sein können: Was machst du hier eigentlich? Was fällt dir ein, in deinem Alter mit Rucksack am Atlantik herumzulaufen? Mein inneres Aufregungsbarometer stand irgendwo zwischen „Was tust du da?“ und einer ruhigen Form von „Endlich“. Und genau in diesem Zwischenraum bemerkte ich, dass zum ersten Mal seit Langem nichts in mir gegen diesen Augenblick argumentierte. Keine innere Buchhaltung, die Kosten und Nutzen abwog. Kein innerer vernünftiger Mann Mitte fünfzig, der auf Rentenpunkte und Sicherheit zeigte.
Du bist da, sagte eine leise innere Stimme. Genau hier, mitten im Wind. Und du läufst nicht mehr weg, nur noch nach vorne – auch wenn du noch nicht genau weißt, wohin. Du tust etwas, worüber du seit Jahren nur geredet hast.
Rein äußerlich, dachte ich, könnte ich nach diesem Weg einfach wieder in den Zug steigen, in Hessen aufschließen, die Jacke an den Haken hängen, am Montag wieder in irgendeinem Serverraum stehen. Niemand dort wüsste, wie es sich angefühlt hatte, auf diesen Felsen zu stehen. Und trotzdem wäre alles, was ich dann tat, nicht mehr dasselbe.
Der Weg hatte schon angefangen, Dinge in mir zu verschieben. Langsam, fast unmerklich. Schritt für Schritt, Gespräch für Gespräch, Blase für Blase. Das Haus, die Firma, das „funktionierende System“, das ich mir aufgebaut hatte – all das stand plötzlich nicht mehr so selbstverständlich da wie früher. Der Wind von Oia blies nicht nur Salz in mein Gesicht, er blies auch den Staub von einer einfachen, alten Einsicht: So, wie es bisher war, will ich nicht weitermachen.
Ich zog die Kapuze etwas fester, tastete nach dem Stein im Rucksack und atmete tief ein. Dann setzte ich den Fuß wieder auf den Weg. Der Atlantik rauschte, als hätte er Besseres zu tun, als mich zu kommentieren. Und doch fühlte es sich an, als hätte jemand einen gelben Pfeil direkt in mein Leben gemalt.
Herzbild – Atlantikkante
Herzbild – Atlantikkante
Ein Mann steht am Rand Europas und zum ersten Mal seit langem läuft er nicht weg vor dem, was in ihm laut wird.
Der Wind tut, was er immer tut, aber in ihm wird etwas still.
Er weiß noch nicht, wohin der Weg ihn führt, nur, dass er nicht zurück in die alte Spur gehen kann.
Vielleicht wartet irgendwo ein anderer Alltag, ein anderes Zuhause, ein Mensch, der ihn so nimmt, wie er ist.
Heute reicht es, dass er diesen einen Schritt nicht mehr verschiebt.
Kapitel 1 Ein großes Haus
Ein großes Haus in einem kleinen Dorf
Im Oktober 2017, als ich den Camino gegangen bin, wohnte ich noch in einem kleinen Ort in Hessen. Ein Dorf, das man auf der Landkarte suchen muss. Wenn man es gefunden hat, merkt man schnell, dass dort vieles langsamer läuft. Man kennt sich, die Wege sind kurz, die Busse fahren selten, und abends geht das Licht früh aus.
Mein Haus stand ein wenig am Rand. Es war groß, mit mehreren Zimmern, Keller, Dachboden, Garten – gebaut für ein Leben, das Platz braucht. Früher fühlte es sich an wie „unser Haus“. Jetzt fühlte es sich nicht mehr so an, als würde ich wirklich dazugehören.
Früher hatten hier Stimmen geklungen, Schritte, Türen, die ins Schloss fielen. Schulbücher lagen auf dem Tisch, Wäschekörbe im Flur, Einkaufszettel auf dem Küchentisch, die nach Alltag rochen. An Weihnachten saßen wir alle zusammen im Wohnzimmer, die Kinder, meine Frau, Kerzenlicht, der Baum. Auf dem Tisch stand dieser Aschenbecher von Martin Schneider, den ich immer irgendwie cool fand. Es war laut, warm, voll. In diesen Momenten fühlte sich Familie dicht an.
Später blieb das Wohnzimmer dasselbe, aber die Szene wechselte. Die Trennung hatte alles verändert. Sie war frisch, nicht schön gewesen, und nichts war wirklich geklärt. Es gab keinen sauberen Schnitt, keine sortierte Vereinbarung. Eher ein Auseinanderbrechen, bei dem man erst hinterher merkt, wie viele offene Enden bleiben. Eine Zeitlang badete ich im Selbstmitleid – und ich war darin ziemlich gut. Es fühlte sich an, als wäre mein ganzes Leben – Firma, Ehe, das Bild von Familie – auf einmal brüchig geworden.
Ich hatte viel Energie in diese Beziehung zurückgepumpt, in der Hoffnung, dass sie noch einmal trägt. Ich wollte es „wieder hinbekommen“, für uns, für die Kinder, für dieses Wir-schaffen-das-Bild, an das ich lange geglaubt habe.
Freunde und Familie sagten später, dass es schon in den letzten Jahren keine wirkliche Beziehung und keine Liebe mehr gewesen sei, sondern eher Aushalten und Wegschauen. Heute weiß ich, dass sie recht hatten. Damals hielt ich trotzdem noch an der Idee fest, dass man nur genug investieren müsse, dann würde es irgendwann wieder gut.
Abends, wenn ich die Tür aufschloss, hörte ich zuerst das Klicken des Schlosses und dann den Hall im Flur – ein Klang, der eher zurückfragte, ob wirklich jemand gekommen war. Manchmal stellte ich den Fernseher an, nicht um zuzuhören, sondern damit überhaupt jemand im Haus sprach.
Zwei Töchter mit eigenen Wegen
Meine Töchter hatten längst ihr eigenes Leben. Ines, die Ältere, lebte mit ihrer Familie in Gießen. Sie war verheiratet, hatte mir einen Enkel geschenkt, auf den ich sehr stolz war. Beide – sie und ihr Mann – hatten gute Jobs und standen mit beiden Beinen im Leben.
Sarah, die Jüngere, war nach Hamburg gezogen. Wir hatten gemeinsam eine Wohnung gesucht, Regale aufgebaut, Kartons geschleppt. Zwischen Baumarktbesuchen und Umzugskartons dachte ich zum ersten Mal: Der Norden, Hamburg – das könnte irgendwann auch meine Heimat werden. Zum ersten Mal hörte ich Menschen „Moin“ sagen und merkte, wie sich dieser Gruß ganz still in mir festsetzte.
Beide waren, jede auf ihre Weise, in ihrem Leben angekommen. Ich war stolz, wie sie ihren Weg gegangen sind, manchmal auch gegen den Wind. Und trotzdem saß ich abends in einem Haus, das sich mehr nach Erinnerungsort als nach Zuhause anfühlte.
Das wolltest du doch: dass die Kinder ihr eigenes Leben haben, sagte eine leise, sachliche Stimme.
Ja, dachte ich. Das wollte ich wirklich. Ich hatte mir nur nie ausgemalt, wie es sich anfühlt, wenn sie es dann tatsächlich tun – und man selbst in einem viel zu großen Haus sitzt und nicht mehr genau weiß, wo der eigene Platz ist.
Später, als wir offener darüber gesprochen haben, haben mir beide etwas gesagt, das gesessen hat: dass ich durch meine Arbeit oft wenig für sie da war. Dass ich vieles nicht wahrgenommen habe, was bei ihnen los war. Kein Vorwurf im Ton, eher eine Bestandsaufnahme. Es tat weh – und es war wahr.
Rückblick – Die Firma, die nicht mehr zu halten war
Die Geschichte beginnt nicht erst mit der Trennung. 1990 habe ich meine eigene IT-Firma gegründet. Die 90er waren eine gute Zeit für jemanden, der Computer verstand. Unternehmen holten sich Netzwerke ins Haus, Läden bekamen neue Kassensysteme, vieles wurde umgestellt – und es brauchte Menschen, die „sich damit auskennen“.
Ich war einer dieser Menschen. Es lief – anstrengend, aber gut.
Irgendwann wurde die Arbeit so viel, dass ich einen Partner brauchte. Aus einem guten Freund wurde ein Geschäftspartner. Wir kannten uns privat, feierten zusammen, hatten einen gemeinsamen Freundeskreis. Die Firma war nicht nur ein Job, sondern ein Stück gemeinsames Leben. Es fühlte sich nach etwas an, das trägt.
Dann kam der Bruch. Meine große Tochter Ines und mein Geschäftspartner wurden ein Paar. Für uns alle – als Eltern, als Freunde, als Geschäftspartner – war das ein Erdbeben. Unsere Freundschaft bekam einen Riss, der nicht mehr wirklich zuging. Wir mussten trotzdem weiter zusammenarbeiten. Du warst mit dem Kopf in der Firma und mit dem Herzen im Feuer, würde ich heute sagen.
Ines stand damals zwischen den Stühlen, und ich habe erst später verstanden, wie viel es sie gekostet hat. Zum Glück fanden wir später wieder zueinander. Heute haben wir ein gutes Verhältnis, und ich bin mit meinem damaligen Partner innerlich im Frieden. Damals aber fühlte es sich an, als würde mir gleichzeitig etwas unter den Füßen wegrutschen: beruflich, freundschaftlich, familiär.
Etwa 2005 zogen wir in neue Räume um, investierten in eine größere Infrastruktur, mehr Fläche, mehr Ausstattung. Es sah nach Wachstum aus – auf den Fotos. In Wirklichkeit war es eine müde Firma, die so tat, als würde sie noch einmal durchstarten.
Die Kunden wurden weniger, die Umsätze brachen ein. Mein Geschäftspartner und ich waren längst kein wirkliches Team mehr. Eine angeschlagene Freundschaft und eine angeschlagene Partnerschaft sind keine guten Voraussetzungen, um eine Firma durch schwierige Zeiten zu führen.
Am Ende ging die Firma unter – und ich war derjenige, der sie formell in die Insolvenz führen musste. Auf dem Papier war es ein Geschäftsfall. Für mich war es der Abschied von einem Lebensmodell.
Und mitten darin stand meine eigene Tochter, deren Beziehung zu meinem Geschäftspartner auch nicht gehalten hatte. Zwei Ebenen gleichzeitig: beruflich und familiär. Kein großer Knall, eher ein langes Knacken.
Die One-Man-Show
Nach dem Ende der Firma hatte ich – wie man so sagt – „Glück im Unglück“. Ein erster Wechsel in eine Festanstellung sah auf dem Papier nach Sicherheit aus. In der Realität war es ein kleiner Betrieb, viel Druck, wenig Gestaltungsspielraum. Es passte von Beginn an nicht. Nach kurzer Zeit war klar: Das war kein Ort, an dem ich bleiben konnte.
Danach bot mir einer unserer großen ehemaligen Kunden eine Stelle an. Wieder sah es von außen nach Sicherheit aus, nach neuer Perspektive. Innen fühlte es sich schnell weniger nach Ankommen an, sondern eher wie ein weiterer Rettungsversuch, der langsam zeigte, wie brüchig er war.
Früher hatte ich mit der eigenen Firma gut verdient. Wir hatten schnelle Autos, Urlaube, Essen gehen, PS unter dem Hintern. Den Kindern fehlte materiell nichts. Heute weiß ich, dass ihnen etwas anderes gefehlt hat: Zeit mit einem Vater, der nicht ständig gedanklich bei Arbeit und Problemen war. Ines und Sarah haben mir später genau das gesagt. Kein Drama, nur dieser Satz: dass ich oft nicht wirklich da war. Das bleibt hängen.
Damals war ich auch ein anderer Autofahrer. Ungeduldig, schnell, immer unterwegs, nie wirklich Zeit. Ich fuhr, als müsste ich ständig irgendwo ankommen, nur selten bei mir. Vieles, was direkt neben mir passierte, habe ich gar nicht wahrgenommen.
Erst viel später, auf dem Camino, habe ich begriffen, wie wenig Dinge man wirklich braucht – und wie viel eine Tasse Kaffee, ein einfaches Essen, zwei, drei gute Gespräche und das Gefühl, bei sich zu sein, wert sind. Heute bin ich eher der Fahrer, bei dem sich die Mitfahrer manchmal schämen, weil ich innerorts entspannt vierzig fahre und es angenehm finde, so im Fluss zu sein. Dass ich das einmal über mich sagen würde, hätte der Mann von damals wohl für einen schlechten Witz gehalten.
In der neuen Firma wurde ich schnell zu dem, den man anrief, wenn es ernst wurde. Wenn irgendwo etwas ausfiel und nichts mehr ging, hieß es: „Rufen Sie Herrn Schneider an, der kriegt das hin.“
Mein Chef war gut im Versprechenmachen. „Rundum-Service“, „immer erreichbar“, „Wir lassen unsere Kunden nicht im Stich.“ Auf dem Papier klang das beeindruckend. In der Praxis bedeutete es oft: Ich fuhr los.
Während er „wichtige Termine“ hatte, saß ich unter Schreibtischen, in Serviceräumen, in Filialen, reparierte, beruhigte, erklärte. Ich war Techniker, Feuerwehr und manchmal Seelsorger – alles gleichzeitig. Mein inneres Aufregungsbarometer stand immer öfter deutlich über Normalbetrieb.
Eine Zeitlang hat mir das sogar gefallen. Ich mag es, Probleme zu lösen. Ich mag es, wenn Menschen erleichtert „Danke“ sagen, weil ihr Laden wieder läuft. Aber nach und nach kippte etwas.
Ich war immer öfter allein verantwortlich. Der Satz „Ohne Sie läuft hier nichts“ war als Kompliment gemeint – fühlte sich aber irgendwann an wie eine Fessel. Die Fahrten wurden häufiger, die Erreichbarkeit selbstverständlich. Das Handy lag ständig griffbereit, der Sonntag war nie ganz frei, der Feierabend eher ein Vorschlag als ein Zustand.
Von außen sah das zuverlässig aus. Von innen fühlte es sich an, als hätte jemand sämtliche Sicherheitsnetze abgebaut. Meinem Chef vertraute ich längst nicht mehr. In den letzten Monaten dort hatte ich das Gefühl, dass selbst dieses „Sicherheitsmodell“ wackelt, als würde auch dort jemand an den Pfeilern rütteln.
Gleichzeitig spürte ich: IT und Dauerbereitschaft sind nicht das, was ich bis zur Rente machen möchte. Ich wusste nur noch nicht, was stattdessen kommen sollte. Auf Hessisch hätte ich wahrscheinlich gesagt: Isch kann das so net ewig weitermachen. Einen Plan B hatte ich trotzdem noch nicht.
Ehe, Retterrolle, der Punkt, an dem es nicht mehr geht
Zu der beruflichen Schieflage kam die private dazu. Meine damalige Frau kämpfte schon länger mit schweren Phasen, die wir damals nicht klar benannt haben. Wir funktionierten, erledigten, hielten aus – und sprachen doch immer weniger darüber, wie es uns wirklich ging.
Ich versuchte lange, die Ehe zu „retten“ – vor allem wegen der Kinder. Ich wollte der sein, der bleibt, um jeden Preis. Die Kinder waren da längst erwachsen. Im Rückblick sagen sie, dass sie eher erleichtert waren, als ich später die Trennung ausgesprochen habe. Sie hatten viel mehr gesehen, als wir wahrhaben wollten.
Du musst sie retten, sagte damals eine strenge Stimme in mir. Du kannst doch jetzt nicht auch noch gehen.
Eine andere, leisere, hielt dagegen: Und was ist mit dir?
Heute weiß ich: Niemand kann einen anderen Menschen vor sich selbst retten. Man kann da sein, unterstützen, zuhören – aber die Entscheidung zu leben und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, kann einem keiner abnehmen.
Nach der Trennung war nichts wirklich sortiert. Kein klarer Plan, keine saubere Lösung. Nur dieses Gefühl von: Jetzt ist erst einmal alles offen. Ich war müde vom Kämpfen, leer vom ständigen Reinstecken von Energie, von dem Versuch, etwas zusammenzuhalten, das längst auseinandergegangen war. Und gleichzeitig fühlte ich mich schuldig, als hätte ich versagt – als Partner, als Mann, als Vater.
Heute schaue ich milder auf diesen Mann in dem großen Haus. Er hat Fehler gemacht, ja. Aber er hat auch gekämpft, oft bis weit über seine Kräfte. Kein Held, eher jemand, der spät merkt, wie müde er ist.
In dieser Zeit waren meine Töchter da. Mit Ines führte ich viele Gespräche – am Telefon, am Küchentisch, wenn ich sie besuchte. Bei Sarah spürte ich, dass sie mich im Norden im Notfall jederzeit auffangen würde. Beide waren für mich da.
Und genau das wollte ich irgendwann nicht mehr: dass meine Kinder mich dauerhaft mittragen müssen. Ich merkte, dass ich ihnen nicht noch jahrelang dieselben Geschichten vorsetzen wollte – von Stress, von Erschöpfung, von „eigentlich müsste ich…“.
Ich wollte, dass sie mich als jemanden sehen, der Verantwortung für sein Leben übernimmt – nicht als jemanden, der immer nur erzählt, wie schwer alles ist.
„Eines Tages“ wird zu eng
Mit der Zeit wurde mir klar: So, wie es war, konnte es nicht bleiben. Ich fühlte mich wie in dem Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Es bewegte sich nichts. Jeder Tag sah gleich aus. Es ging mir schlecht, und ich war zu erschöpft, um etwas zu verändern. Die Frage tauchte auf: Kann man das noch drehen?
Damals hätte ich dem keinen Namen gegeben. Ich sagte Sätze wie: „Ich bin im Stress“ oder „Gerade ist viel los.“ Heute würde ich sagen: Es war gefährlich nah daran, mich selbst zu verlieren. Ein langsames, zähes Versinken, in dem die Farben blasser werden und man trotzdem weitermacht.
Manchmal saß ich abends am Küchentisch, die Hände um eine Tasse, deren Inhalt längst zu kalt war, um noch zu wärmen, und fragte mich leise: Kann man mit Mitte fünfzig sein Leben noch einmal ernsthaft drehen – ohne alles hinzuschmeißen?
Eine Stimme antwortete sofort: Sei realistisch. Du hast Verantwortung. Du kannst nicht einfach alles anders machen.
Eine andere dachte weiter: „Und was, wenn genau das unrealistisch ist, zu glauben, du hältst das so bis zur Rente durch?“
Ich hatte keine Antwort. Ich vertröstete mich auf „Eines Tages“. Eines Tages mache ich weniger. Eines Tages kümmere ich mich um mich. Eines Tages gehe ich den Camino.