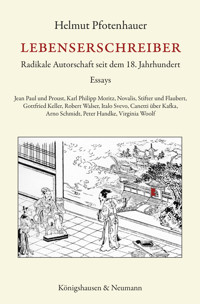Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Jean Paul schuf eine Welt aus Schrift. Alles in seinem Leben musste dem Schreiben dienen: die Tag- und die Nachtstunden, die Familie und die Liebschaften, das Essen und der Alkohol. Wie wird an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert aus dem Pfarrerssohn in der Provinz ein gefeierter Autor in den Salons von Berlin, der dann bald doch wieder ins fränkische Bayreuth zurückkehrt? Wie und woraus entstehen seine vielschichtigen Werke, die sich weder der Weimarer Klassik noch der Romantik zuordnen lassen? Anlässlich des 250. Geburtstags hat Helmut Pfotenhauer, wie kaum ein anderer vertraut mit Jean Paul, eine profunde und dabei genussvoll zu lesende Biografie über den großen deutschen Romancier geschrieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 843
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Faszikel XIV, Konvolut 09, August 1809, Deckblatt (mit Tintenrezeptur). Aus den Vorarbeiten zum Leben Fibels
Helmut Pfotenhauer
Jean Paul
Das Leben als Schreiben
Biographie
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-24274-6
Alle Rechte vorbehalten
© Carl Hanser Verlag München 2013
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
für Margot
Inhalt
Vorwort. Selber-Lebenserschreibung
Anfänge
Illiterate Anfänge, Alphabetisierung. Wunsiedel, Joditz, Schwarzenbach, 1763–76
Frühe Schriften Schwarzenbach, Hof, Leipzig, 1776–1784
Exzerpte
Schulreden, Übungen im Denken, Notizhefte
Jean Paul als Briefschreiber
Frühe Briefe
Erster Romanversuch: Abelard und Heloise, 1781
Erste Satiren. 1782/83: Grönländische Prozesse
Erfolglosigkeit: Hof, Töpen, Schwarzenbach, 1784–1790/93, Teufelspapiere, Briefe, Exzerpte, Poetische
Weitere Satiren
Briefe. Poetische Miniaturen. Erotik als Akademie
Neue Lektüren, Exzerpte und Abhandlungen
Revolution als Literatur?
Um 1790. Weitere literarische Neuanfänge
Satire mit ernsthaften Zwischenakten: Abrakadabra oder Baierische Kreuzerkomödie, 1789/90
15. November 1790: »Wichtigster Abend meines Lebens«
Satirische Charaktere, 1790/91: Freudel, Fälbel
Leben des vergnügten Schulmeisterleins Maria Wuz in Auenthal. Eine Art Idylle, Anfang 1791
Lehrer in Schwarzenbach. 1790–94. Schreibunterricht
Die Aufforderungen: Romane!
Der erste Roman: Mumien oder Die unsichtbare Loge. Eine Biographie, 1790–92, erschienen 1793
Der Roman, »an dem ich laiche«
Der neue Autor und sein neuerfundener Name: Jean Paul. 9. Mai 1792
Der Roman
Moritz
Schwarzenbach, Hof, Leipzig, Weimar
1792–1800
Historisches und Privates
Der zweite Roman: Hesperus oder 45 Hundsposttage. Jean Paul als Erfolgsautor
Der neue Roman
Nachgeschichte: Der große Bucherfolg
Weimar 1795, 1796. Jean Paul, Goethe, Schiller. Eine Irritation Quintus Fixlein, Geschichte meiner Vorrede zur zweiten Auflage
Beredte Nicht-Verständigung: Jean Pauls Brief an Goethe vom 4. Juni 1795
No 2
Der Stein des Anstoßes: Hesperus im Konflikt mit den Weimarer Kunstkonzepten
Schillers Bildnis
Jean Pauls erster Besuch in Weimar. Juni / Juli 1796
Nach der Begegnung. Sommer 1796
Ausblick: Jean Pauls Weimar-Aufenthalt Herbst 1798 bis Mai 1800
Nachträge zu Jean Paul und Weimar: 1804, 1808, 1816/18, 1822/24
Hofer Schriften 1794/97
Simultanproduktion
Quintus Fixlein, Siebenkäs
Nachspiel
Briefe, 1795/98. Empfindsame Routinen »Weiber die Menge«
Exzerpte. Taschenbibliothek
Biographische Belustigungen, Jubelsenior, Kampaner Thal, Holzschnitte
Leipzig 1797/98: Die triumphale Rückkehr. Palingenesien, Briefe und bevorstehender Lebenslauf, Konjekturalbiographie
Weimar 1798–1800. Vorweggeschriebenes, Vorausgeschriebenes
Lichtenberg: Sommer/Herbst 1798
Weimar, August/September 1798. Brief an Christian Otto: Fichte, Friedrich Schlegel, Wieland, Herder, Goethe, Heinrich Meyer
Brief an Jacobi: Beginn des Gedankenaustauschs
In Weimar, Ende 1798/Anfang 1799: Momentaufnahmen aus den Briefen
Herder
Wieland
Friedrich Schlegel
Jacobi und Fichte. Clavis Fichtiana
Weimar, Berlin 1799/1800
Frauen: Verlobungen II, Fürstinnen. »Weiber die Menge« II
Literarische Nebenprodukte, 1800/1801
Der Titan
Zwischen Berlin und Bayreuth
1800–1804
Berlin 1800/01. Metropole oder Provinz?
Das Leben in Schreib- und Leseszenen
Meiningen 1801/03
Coburg 1803/04
Flegeljahre I. Erstes bis drittes Bändchen
Ästhetische Vorschule
Flegeljahre II. Viertes Bändchen
Jean Paul und die Musik
Die ersten Bayreuther Jahre
1804–1812
Schreib-Szenarien
Schreibmaterialien, Arbeitsweisen
Handschrift
Häusliches Schaltier
Außer Haus
Schwierige Autorschaft: materielle Nöte, politisch-historische Wirrnisse
Werke und Werkchen
Almanachs-Aufsätze und ihre Sammlung: Herbst-Blumine, erstes Bändchen, 1810
Freiheits-Büchlein, 1805
Neuauflagen
Levana oder Erziehungslehre, Ergänzungs-Blatt zur Levana, 1807
Schriften zur Politik: Friedens-Predigt an Deutschland, 1808, Dämmerungen für Deutschland, 1809
Poetische Schriften: Schmelzle, Katzenberger, 1809
Leben Fibels
Begegnungen
Die späten Bayreuther Jahre
1813–1825
Essayistik: Museum, 1814
Späte politische Schriften: Mars und Phöbus Thronwechsel, 1814, Politische Fastenpredigten, 1816
Sprach-Vorschriften. Der Streit um die Doppelwörter und das Fugen-s, 1818–20, Jacob Grimms Zorn und Betrübnis
Sommerreisen 1816–1822
Selberlebensbeschreibung, 1818/19. Eine zersplitternde Autobiographie
Der letzte Roman. Der Komet, 1820–22. Ein Fragment
Fortsetzungs-Pläne, Schlußstriche. Ausschweife für künftige Fortsetzungen von vier Werken, 1824, Papierdrache, Sämtliche Werke
Letztes vorausgeschriebenes Leben. Tode. Wetterprophezeiungen, Gesundheits-Voraussagen. Tod von Max, 1821, von Voß, 1822
Das letzte Werk. Selina oder über die Unsterblichkeit, erschienen posthum 1827
Krankheit, Tod, Begräbnis
Erstes Nachleben
Anhang
Anmerkungen
Bibliographie
Chronik
Bildnachweise
Personenregister
Ich bin nicht der Mühe werth gegen das was ich gemacht.
Vorarbeiten zur Selberlebensbeschreibung
Oft weiß ich kaum, was ich eigentlich aus mir machen soll als Bücher.
Vita-Buch
Und eben dieses, daß die Hand des Menschen über so wenige Jahre hinausreicht und daß die so wenige gute Hände fassen kann, das muß ihn entschuldigen, wenn er ein Buch macht: seine Stimme reicht weiter als seine Hand, sein enger Kreis der Liebe zerfließet in weitere Zirkel, und wenn er selbst nicht mehr ist, so wehen seine nachtönenden Gedanken in dem papiernen Laube noch fort.
Die unsichtbare Loge
Vorwort.
Selber-Lebenserschreibung
»Ich bin nicht der Mühe werth gegen das was ich gemacht.« Dieser Satz, 1818 vom fünfundfünfzigjährigen Jean Paul während der Vorarbeiten zu seiner Autobiographie, der Selberlebensbeschreibung, niedergeschrieben, ist keine vereinzelte, mürrische Bemerkung eines alternden, vielleicht resignierenden Mannes. Der Satz wiederholt sich so oder so ähnlich bei ihm immer wieder. Die Lebensbeschreibung wird für diesen Autor zur Lebens-erschreibung. Das Leben ist nur der Mühe wert, insofern es Buch wird. Denn das, was er »gemacht«, sind Bücher. Bücher, die sich an die Stelle des Lebens setzen, Bücher, die diesem erst Sinn und Dauer verleihen. Und so will Jean Paul auch in jener Autobiographie nicht ein gelebtes Leben nachträglich beschreiben, sondern sich im Schreiben seiner als Schreibender, der ein Schreibleben führt, allererst versichern. Nur das Leben zählt für ihn, das zur Schrift wird. Es geht in dieser erinnernden, autobiographischen Verwandlung in Schrift, aber auch sonst in Jean Pauls Werken, nur um ein dem Schreiben, dem Büchermachen dienendes Leben. Und so handelt diese späte Jean Paulsche Lebensbeschreibung (1818/19) denn vor allem auch von einem: vom Werden des Schriftstellers. Dies, obwohl sie bereits in der frühen Schwarzenbacher Zeit von 1776, mit der Konfirmation des 13jährigen, wieder aufhört und also eigentlich nur die vorliterarische Zeit behandelt.
Kein anderer Autor der Zeit um 1800 hat sich mit solchem Nachdruck und mit solcher Konsequenz ausschließlich als Schriftsteller verstanden. Keiner, so könnte man sagen, hat so wenig gelebt, um so viel schreiben zu können. Über 11.000 gedruckte Seiten sind dabei – nimmt man die damals vollständigste, die zweite Reimersche Gesamtausgabe von 1840–42, als Grundlage – herausgekommen, ca. 40.000 Seiten nachgelassene Schriften; die Briefe, die in acht Bänden auf über 4000 Seiten erschienen sind, gar nicht gerechnet. Aber nicht die Zahlen allein sind ungewöhnlich, auch die Radikalität, mit der Jean Paul alle Lebensumstände, auch die elendsten und traurigsten, alle Freundschaften, alle Liebesbeziehungen zum Katalysator des Schreibens macht. Goethe, der sich immer wieder irritiert mit diesem Schreibbesessenen auseinandergesetzt hat, hat dies als Ausdruck von Weltlosigkeit, von Lebensferne und Provinzialismus gesehen. Noch in einem späten Gespräch mit Eckermann nennt er seinen Gegenspieler einen Philister. Die harsche Äußerung bezieht sich auf die Autobiographie Jean Pauls, die mit seiner, Goethes, konkurriere. In seiner eigenen Selbstbiographie habe er, Goethe, sein Leben über die niedere Realität hinausheben und als ein Symbol des Menschenlebens geben wollen. Dichtung steigert das Leben zur Wahrheit. In Jean Pauls Selbstbiographie wie in all seinen anderen Schriften ist die Dichtung hingegen selbst die einzige Wahrheit. Nicht: Dichtung und Wahrheit, sondern Dichtung als Wahrheit. Jenes Sich-Zurückziehen, dieser nachgerade fanatische Provinzialismus, dieses Schalentierdasein dienen dem Werk. Das Werk ist alles, das Ich ist nichts, lautet die Devise. Warum? Nur im Schreiben ist Dauer; nur in ihm verewigt man sich. Wir werden sehen, wie Jean Paul bereits als junger Mann geradezu exemplarisch alle weltanschaulichen Verunsicherungen, alle geistigen Unruhen durchmacht, die das Zeitalter, jene Umbruchszeit zur Moderne, für die Intellektuellen bereithält – aber auch, wie er alle Triumphe auskostet, die sich nun abzeichnen, den Triumph vor allem des selbsterschriebenen, des gegenüber allen metaphysischen Fraglichkeiten selbstherrlich auf Dauer gestellten Daseins: papierene Unsterblichkeit in einer Zeit, in der die der Seele ungewiß geworden ist. Schon als junger Mann, als Schüler in Hof, dann als Student der Theologie und Philosophie in Leipzig, durchlebt Jean Paul die Krisen der Zeit und entschließt sich, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, in die Schreibhand. Feder und Tinte und – wenn es geht – das gedruckte eigene Buch ersetzen ihm Orthodoxie und Schulweisheit. Literarische Fiktionen inszenieren und umspielen das, was man als eindeutige Wahrheit nicht mehr fassen kann.
Dies hat Konsequenzen für die Biographie dieses Bio-Graphen, dieses Leben-Schreibers: Nicht die äußeren Ereignisse seines Lebens und die Chronologie ihrer Abfolge sind entscheidend, sondern die Stationen des Schreibens, dessen Impulse, dessen Krisen, Umbrüche und Durchbrüche. Geschichte bzw. Biographie seines Schreibens, Geschichte des eigentlichen Jean Paulschen Lebens, des Schreiblebens, meint daher auch der Titel dieses Buches. Das heißt, daß sich die vollständige Chronologie dieses Lebens in einer Chronik im Anhang findet. Der Text soll damit von dieser chronikalischen Aufgabe entlastet werden und deshalb Schreibszenen in ihrer Abfolge, ihrer Verschiedenheit, ihrem Zusammenhang exemplarisch darstellen. Vollständigkeit kann bei einem Vielschreiber, der Jean Paul auch ist, dabei nicht die Absicht sein.
Der Autor als Bio-Graph lautet das Motto. Auch in Jean Pauls Texten, die selbst zumeist fiktive Biographien sind, spielen Biographen eine entscheidende Rolle. Immer wieder finden sich solche Lebensbeschreiber, die sich gerne »Jean Paul« nennen und die hinter den Materialien für die Biographie ihres Helden herjagen. In seinem kleinen Roman Das Leben Fibels, der 1811 erschienen ist, ist das auch so. Der angebliche Erfinder der Lesefibel und damit der Promotor unser aller Alphabetisierung steht da im Mittelpunkt. Ein Biograph, »Jean Paul« eben, sucht nach den Überresten einer früheren Biographie Fibels, aus welcher er seine von ihm selbst geschriebene Fibel-Biographie zusammenleimt. Der Text steht beispielhaft für die Vielfalt der Reflexionsmöglichkeiten auf biographisches Schreiben, die Jean Paul durchspielt. Alle Anmaßungen und Erfolge, alle Einbildungen und Verzweiflungen, alle Tricks und Mängel der Lebensbeschreibung oder Lebenserschreibung werden da durchdekliniert. Die Kontingenzen des Lebens und die Strategien der literarischen Zufallsbewältigung sind von allen nur erdenklichen Seiten aus beleuchtet.
In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist viel von der Krise der Biographie die Rede gewesen. Man warf dieser Erfolgsgattung vor, sich ihre Beliebtheit durch unreflektierte Mythenbildungen vom Subjekt, der Einheit seines Lebens und der Signifikanz seines Daseins in der Welt, erschlichen zu haben. Speziell wenn dieses Subjekt ein Autor, ein Schriftsteller ist, wurde seine Biographie unter Verdacht gestellt. Man sprach von der Legende des Schöpferischen, Unbedingten, welche das Konstrukthafte jeder Biographie und das sozusagen Romantische, das Romanhafte jeder Autoren-Biographie, außer acht lasse. Vom Tod des Autors war deshalb die Rede und vom Tod seiner Biographie. Am Erfolg der Gattung hat das nichts geändert. Im Gegenteil: Von der kompensatorischen Sehnsucht nach Lebensweltlichem, wie es die Biographien bieten, ist heute, im Zeitalter zunehmend fleischlos werdender virtueller Welten, die Rede. Und dem entspricht der exorbitante Biographie-Bedarf unserer Zeit, dem auch vorliegender Versuch Rechnung trägt.
Man kann als Jean Paul-Leser und speziell als Jean Paul-Biograph nur staunen über die ahnungslose Nachträglichkeit jener heutigen Kritik des Biographischen. Was da heute als kritische Reflexion eingefordert wird, war vor 200 Jahren längst gegenwärtig – in einer in aller Ausgepichtheit geführten Debatte und der schlechterdings unüberbietbaren 40-jährigen Dauerreflexion dieser Materie in den Schriften Jean Pauls. Sein Biograph braucht deshalb nur deren Geschichte zu dokumentieren, um jeglichem heutigen Reflexionsanspruch gerecht zu werden.
Dieser Schriftsteller Jean Paul, Schriftsteller also im emphatischen Sinne, war anfangs und lange, quälende Jahre erfolglos. Dann wurde er, zumindest für eine Weile, zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren seiner Zeit. Mit seinem zweiten Roman, dem Hesperus, gelingt ihm 1795 der Durchbruch. Er findet Zutritt zu den wichtigsten literarischen Zirkeln der Zeit, vor allem in Weimar. Und sein Roman Titan, erschienen 1800 bis 1803, wird dann sogar höher honoriert als Goethes Wilhelm Meister.
War Jean Paul aber auch einer der meistgelesenen Schriftsteller seiner Zeit? Man muß die Frage wohl verneinen. Denn schon für die Zeitgenossen galt er als ein ausgesprochen schwieriger Autor. Schon zu Lebzeiten erschien ein Wörterbuch zu Jean Pauls Levana, um der Flut von witzigen Vergleichen, Vergleichen aus den entferntesten und absonderlichsten Wissensgebieten, in seinen Schriften Herr zu werden – von den unzähligen Wortneuschöpfungen ganz zu schweigen. Als Goethe 1816 bis 1818 mit den Noten und Abhandlungen seine Gedichtsammlung West-östlicher Divan besser verständlich machen will, nimmt er darin auch einen Abschnitt über einen anderen, mitunter schwer verständlichen Autor auf: eben Jean Paul – nun aber mit ausdrücklicher, wenn auch hier von Irritation nicht freier Bewunderung (Vergleichung). Um diesen »vertrackten« Autor, der in einer vertrackten Welt schreibe, gerecht zu werden, bringt er darin eine Sammlung merkwürdiger, weil unerhörter Wörter aus dem Hesperus: »Barrierentraktat«, »Extrablätter«, »Nebenrezeß« findet sich da u.a. – aber auch der uns heute so vertraute »Schmutzfink«. Wir haben vergessen, daß es sich dabei um eine der zahllosen Wortschöpfungen Jean Pauls handelt. Sie stammt aus dem 10. »Hundsposttag« des Hesperus.
Berühmt, aber nicht unbedingt vielgelesen oder gar vielverstanden, muß man sagen. Vielgelesen allenfalls in Gestalt jener schon zu Jean Pauls Lebzeiten – meist sehr zu seinem Ärger und ohne seine Einwilligung – erschienenen Blütenlesen, Anthologien mit Auszügen aus den Schriften, die als Häppchen leichter konsumierbar waren. So die Chrestomathie (nützliche Textsammlung, H.P.) der vorzüglichsten, kräftigsten und gelungensten Stellen aus seinen sämtlichen Schriften, die 1801 bis 1816 in vier Teilen erschien und erfolgreicher war als alle Originalveröffentlichungen von Jean Paul.
Die Aufgabe des Biographen ist es, diese Herausforderung an das Verstehen, die das Werk dieses Autors darstellt, nicht wegzuerklären, sondern sie in ihrer Genese aus der Besonderheit der Schreibweise begreifbar zu machen. Nicht der unanstößige, geglättete Jean Paul ist das Ziel, sondern der in seiner ihm eigenen Schwierigkeit an Beispielen transparent gemachte.
Die Darstellung der Entwicklung von Jean Pauls Schreibweise macht sich die neue Historisch Kritische Ausgabe seiner Werke zu einer ihrer Aufgaben. Vorliegende Biographie geht aus der Arbeit daran hervor. Einzelne Bände, wie der Hesperus in den verschiedenen, zu Lebzeiten seines Verfassers erschienenen Auflagen, sowie den Vorarbeiten aus dem handschriftlichen Nachlaß liegen bereits vor bzw. sind in Arbeit (Siebenkäs, Vorschule der Aesthetik, Quintus Fixlein, Leben Fibels). Im Umfeld dieser Ausgabe bzw. im Laufe der Fertigstellung der von Eduard Berend begonnenen und von Götz Müller bzw. Winfried Feifel fortgesetzten Edition der Nachlaßabteilung wurden viele neue Materialien erschlossen, so insbesondere die über 12.000 Seiten der Exzerpthefte, die zwar bekannt waren, aber noch nie systematisch genutzt werden konnten. Diese Exzerpte, so hat es Jean Paul selbst immer gesehen, bilden die Grundlage seiner Textwerkstatt. Sein halbfiktionaler Aufsatz Die Taschenbibliothek von 1795 gibt darüber Aufschluß. »Um meine Lebensgeschichte zu haben, brauch ich bloß die Bände der Exzerpte vor mir aufzuschlagen: an jedem extrahierten Buch hängt ein glimmendes Stük meiner Geschichte«, schreibt er einmal. Als er verreist, trägt er seiner Frau auf, im Falle eines Brandes zuerst die Exzerpte in Sicherheit zu bringen – nicht sich selbst und die Familie. Hinzu kommen autobiographische Materialien, philosophische Gedankensplitter, Aphorismensammlungen wie die Gedankenhefte, Reservoirs für geschriebene oder nicht geschriebene Werke (Einfälle, Bausteine, Erfindungen, Satiren und Ironien). Aus all diesen Materialien lassen sich heute jene Schreibprozesse und ihre lebensgeschichtliche Entwicklung besser verstehen. Hinzu kommt, daß mit der neuen Ausgabe der Briefe, die an Jean Paul gerichtet worden sind, auch im engeren Sinne biographisch wichtige neue Einsichten zu gewinnen sind. Eine neue Jean Paul-Biographie, eine Geschichte seines Schreib-Lebens, ist also fällig.
Diese Vorrede schließt mit einem Wort zur bisher wichtigsten Jean-Paul-Biographie, der von Günter de Bruyn von 1975. Vorliegende Geschichte seines Schreibens will sie nicht ersetzen. Denn de Bruyns Biographie stellt sich eine andere Aufgabe. Sie berichtet vom Leben und den Zeitumständen in chronologischer Abfolge. Die Schriften sind dabei gegenwärtig, aber in ihrer Entwicklung nicht eigentlicher Gegenstand. Vor nunmehr knapp 40 Jahren wäre das – trotz der Editionsleistung von Eduard Berend – auch gar nicht so wie heute möglich gewesen. Komplementär zu de Bruyn erscheint hier nun also eine neue Biographie: nicht eine erneute Erzählung seines Lebens, sondern eben jene Präsentation seines erschriebenen Lebens – in all seinen Aspekten – und der Frage, welchen Zusammenhalt es in seiner Vielgestaltigkeit geben mag.
Anmerkungen
Anfänge
Illiterate Anfänge, Alphabetisierung. Wunsiedel, Joditz, Schwarzenbach, 1763–76
Jean Paul ist am 21. März 1763 in »Wonsiedel«, wie er sagt, im Fürstentum Bayreuth, geboren. Der Vater, Johann Christian Christoph Richter, damals 36 Jahre alt, ist Lehrer und Organist in Wunsiedel. Er ist nur Tertius, dritter Lehrer. Nach zwei Jahren wird er im Dörfchen Joditz, ein paar Meilen nördlich von Hof, auf Fürsprache der Freifrau von Plotho zum Pfarrer ernannt. Er wechselt dorthin mit seiner Gemahlin Sophia Rosina, geborene Kuhn, und dem inzwischen zweijährigen Fritz, wie der kleine Richter genannt wird.
Geburtshaus in Wunsiedel
Kirche in Joditz
Zieht man, wie das meistens geschieht, Jean Pauls Selberlebensbeschreibung, also seine späte Autobiographie von 1818/19, zu Rate, so erfährt man, daß dies zugleich die Zeit des Hubertusburger Friedens gewesen sei, also des Endes des siebenjährigen Krieges zwischen Österreich/Sachsen und Preußen. – Wir betrachten nun diesen Lebensanfang aus der Sicht des alten Schriftstellers, weil wir sonst kaum Zeugnisse haben. Aber wir wollen uns dabei auch immer bewußt halten, wie sehr der Autor seiner Geschichte diese stilisiert – und mit welchen Mitteln er sie stilisiert. Wir werden also immer wieder vom Beschriebenen zum Vorgang und der Art des Schreibens wechseln.
Seine Geburt gerät dem sich an den jungen erinnernden alten Autor sogleich zu einem Einfall oder auch Witz, wie es in der damaligen Sprache heißt: Jener Hubertusburger Friede und er seien gleichzeitig auf die Welt gekommen. Und: dieser Tag, der Anfang seines Lebens, sei zugleich der Anfang des Lenzes gewesen. Die Geburt eines Kindes, die große politische Geschichte und die Naturgeschichte – also scheinbar ganz verschiedene Dinge – werden da auf einen gemeinsamen Nenner, den des schieren Datums, gebracht und kurzgeschlossen. Das ist ein für Jean Paul überaus charakteristisches stilistisches Verfahren. Witz wie gesagt, die Vereinbarung des scheinbar Unvereinbaren, nennt man das damals. An anderer Stelle fügt sich dem noch ein weiterer Einfall hinzu, der, daß die Tag- und Nachtgleiche, das Äquinoktium, zugleich Zeichen für ein weiteres Merkmal seines Stiles sei, nämlich des Ineinander von satirisch-humoristischem und empfindsamem Schreiben. Äquinoktialstil heißt das denn auch folgerichtig.
Damit sind wir aber bereits übergegangen vom Beschreiben eines Lebensanfanges zum Beschreiben des Schreibens darüber. Das ist ein Sprechen über das Sprechen, eine Metasprache – nicht nur des Jean Paul-Biographen, sondern auch seines Autors selbst. Jean Paul hebt durchweg immer zugleich hervor, wie er schreibt, nicht nur was. Diese ständig sich selbst thematisierende Sprache signalisiert auch: Nicht das, was tatsächlich gewesen ist, ist wichtig, sondern was darüber gesagt wird. Das erzählte Leben ist Dichtung, nicht pures Faktum. In den Vorarbeiten zur Autobiographie, deren erste Überlegungen bis ins Jahr 1810 zurückgehen, schreibt Jean Paul zum Beispiel: »Ein Dichter hat es unendlich schwer, blos dem Gedächtnis knechtisch wie ein Schreiber nachzuschreiben ohne Selberschaffen«. Er erwägt, ob er neben das erinnernd gedichtete Leben, das »blos eine Idylle« sei, eine trockne Chronik oder eine nackte Aneinanderreihung von Dokumenten stellen solle, um »Wahrheit« und »Dichtung« besser auszutarieren. Jedenfalls gilt: Das autobiographisch geschilderte Leben ist in Literatur transformiertes Leben.
Auch sonst ist der erschriebene Anfang Literatur, ist Dichtung und nicht nur Wahrheit des Lebens. Die berühmten ersten Sätze sprechen von den gelben und grauen Bachstelzen, den Rotkehlchen, dem Kranich, der Rohrammer und mehreren Schnepfen und Sumpfvögeln, die mit dem Kind zugleich angekommen seien – wie Ackerehrenpreis und Hühnerbißdarm und andere Blumen und Kräuter. Darin versteckt sich auch ein literarischer Wettbewerb. Der Anfang von Goethes Dichtung und Wahrheit nämlich wird indirekt zitiert – ein aus der Sicht des alten Goethe anmaßender Wettbewerb, der seinen Zorn hervorruft. Ist es bei Goethe der Blick in die Sterne, nach oben also, ins Große und Weite, der die Bedeutung dieses Lebensanfangs erheischen soll, so ist es hier der Blick nach unten auf das ganz Kleine. Dieser ist aber, so will Jean Paul sagen, zu nicht weniger Bedeutsamkeit fähig, nur eben ganz anders. Im Kleinen, Unscheinbaren, Idyllischen sieht er die Wiegenstunden des Poeten, eines Poeten, der gar nichts anderes braucht als das beschränkteste irdische Dasein, um sich in ihm über es dichtend erheben zu können.
Der Autor nennt seine Erzählungen von sich Vorlesungen, die der Professor der Geschichte seiner selbst autobiographisch gebe. Man möge dabei nicht nur auf die allgegenwärtige Selbstthematisierung des alternden, sich erinnernden Autors achten, sondern auch darauf, wie der Autor die Entstehungsgeschichte dieser Autorschaft in diesen Anfang der Lebensgeschichte hinein verwebt. Es gibt dafür, wie gesagt, keine anderen Dokumente als diese seine von ihm aufgeschriebene Lebensgeschichte selbst. Die Zeitzeugnisse außerhalb der Erinnerung Jean Pauls sind spärlich, da es sich ja bloß um den unbedeutenden Jungen eines Dorfpfarrers handelt. Aber die Motive einer sich abzeichnenden Autorschaft schon beim Kind Johann Paul Friedrich Richter werden vom späteren Autobiographen so sehr in den Mittelpunkt gestellt und tauchen auch oft in den sonstigen kindheits- und idyllennahen Werken des Autors, etwa im Schulmeisterlein Wutz, im Quintus Fixlein, im Fibel, wieder auf. Sie spielen in der Erinnerung Jean Pauls eine so große Rolle, daß man in ihnen wohl mehr als bloß eine schöne Erfindung wird sehen dürfen. Man darf also dem alten Schriftsteller bei aller Stilisierung seines frühen Lebens doch auch vorsichtig Glauben schenken.
Zunächst ist darauf zu achten, woraus sich in Jean Pauls Darstellung diese Keime der Autorschaft entwickeln. Es ist vor allem das Elend – es sind die beschränkten Verhältnisse, die »Hungerquelle«, aus der in seiner Familie habe geschöpft werden müssen, wie er schreibt. Das bezieht sich auf den Großvater Johann Richter, der Schul-Rektor, Kantor und Organist in Neustadt am Kulm war. Wasser bzw. Bier und Brot seien geblieben im Gefängnis, genannt Schulhaus, bei 150 Gulden jährlich. Seinem Sohn, Friedrich Richters Vater, ist es nicht viel anders ergangen. Lehrerelend stand damals auf der Tagesordnung. Nur die wohlhabenden Schwiegereltern, Tuchhändler in Hof, konnten es lindern. »Schilderung der Hungers Noth« heißt es in den Vorarbeiten denn auch programmatisch. Das bezieht sich nun schon auf die nächste Lebensstation, Schwarzenbach, wo sich, nach dem Tod des Vaters 1779, die Verhältnisse der Mutter mit den inzwischen fünf Söhnen noch einmal verschlechterten.
In vielfacher Hinsicht gilt für Jean Paul, daß das Kleine die Bedingung für das Große ist. Die Verwandlung von Leben in Literatur setzt einen Rohstoff voraus, den man sich unscheinbarer und ärmlicher gar nicht vorstellen kann. Denn daran erweist sich erst die Kraft der Literatur. Ihr muß ein Element von Verzweiflung, von Kampf gegen die Not und auch gegen die Hinfälligkeit des Lebens, gegen den Tod, beigemengt sein. Erst dann, durch die Erhebung, wird sie erhaben und dauerhaft. Schreiben ist nach diesem Konzept immer Anschreiben, Einspruch gegen unsägliche Verhältnisse.
Von der »Unabhängigkeit vom verächtlichen kleinen Menschenkörperchen« schreibt Jean Paul in der Selberlebensbeschreibung, welche sich das frühe keimende Bewußtsein erringe. Mit diesem allmählichen Sichunabhängigmachen von den äußeren Bedingungen gelangt man zu den ersten Versuchen, sich eine eigene Welt selber zu erschaffen. Dies geschieht durch die Einübung in den Umgang mit Schrift. Und das ist der rote Faden dieser Selbstbiographie.
Damit sind wir bei der zweiten und dritten Vorlesung des Professors seiner selbst, wie Jean Paul die Abschnitte seiner Kindheitserinnerung zu nennen beliebt. Wir sind bei den Kapiteln über Joditz und Schwarzenbach. Die Liebe zu den Buchstaben steht am Anfang. »Noch erinnere ich mich der Winterabendlust, als ich aus der Stadt endlich das mit einem Griffel als Zeilenweiser versehene ABC-Buch in die Hand bekam, auf dessen Deckel schon mit wahren goldnen Buchstaben (und nicht ohne Recht) der Inhalt der ersten Seite geschrieben war, der aus wechselnden roten und schwarzen bestand; ein Spieler gewinnt bei Gold und rouge et noir weniger an Entzücken als ich bei dem Buche«. Damit beginnt die Schule, und damit beginnt eine Art Fetischismus der Schrift. Denn die Buchstaben bezeichnen nicht eigentlich die Welt draußen, sondern sind eine eigene, magisch-verheißungsvolle Welt. »Jeder neue Schreibbuchstabe vom Schulmeister erquickte mich wie andere ein Gemälde; und um das Aufsagen der Lektion beneidete ich andere, da ich gern wie die Seligkeit des Zusammensingens auch die des Zusammenbuchstabierens genossen hätte«. Ein Mitschüler, ein »langer Bauernsohn«, dessen Name sogar überliefert ist – Zäh heißt er –, schlägt Fritz während des Unterrichts mit einem Einlegmesser auf die Fingerknöchel. Darauf nimmt der Vater Fritz zusammen mit den Brüdern (Adam, geb. 1764, und Gottlieb, geb. 1768) im Zorn von der Schule und erteilt den Kindern von nun an Privatunterricht. Der Vater läßt sie auswendig lernen: fromme Sprüche, Katechismus, lateinische Wörter etc., ferner Deklinationsregeln des Lateinischen mit allen Ausnahmen und »zwei oder drei Seiten von Vokabeln desselben Buchstabens und ähnlichen Klanges«. Die zu den Zeichen gehörigen Sachen und deren Zusammenhang erschließen sich dabei nicht. Die Zeichen bleiben für sich. In einer lateinisch geschriebenen griechischen Grammatik studiert der Schüler »durstig und hungrig das Alphabet«, ohne daß es zur Übersetzung gekommen wäre und der Leib der Sprache, wie Jean Paul schreibt, Geist bekommen hätte. Mutmaßungen und Sehnsüchte müssen die verborgenen Inhalte ersetzen. Und so blüht ungewollt doch die Phantasie in dieser geistigen Saharawüste der Sinn-Austrocknung.
Dies Elend führt auch zu einem lechzenden Durst nach Büchern, die für das Kind zum ›frischen grünen Quellenplätzchen‹ des selbst Zusammengereimten werden. Der Orbis sensualium pictus des Johann Amos Comenius, die »sichtbare Welt« in »Vorbildung und Benahmung« (Pictura et Nomenclatura), ein damals weit verbreitetes multimediales Kinderbilderbuch, zuerst 1658 erschienen, war das erste dieser geistigen Quellplätzchen. Der kleine Fritz konnte darin zu den Buchstaben Bilder sehen und diese wiederum geordnet nach Elementen, Pflanzen, Tieren, nach den verschiedenen Tätigkeiten des Menschen, bis hin zum Jüngsten Gericht und Gott. Die Buchstaben erhalten nun Bedeutung, verlieren aber nicht mehr ihre magische Eigenwertigkeit. Zu diesen ersten Büchern gehörten auch David Faßmanns Gespräche in dem Reiche derer Todten, zwischen 1717 und 1740 in vielen Bänden erschienen. In diesen unterhalten sich berühmte Persönlichkeiten der Vergangenheit, also Tote – Kaiser, Päpste, Feldherren etc. – über ihr Leben, ihren »Todt«, ihre »Thaten« und »Fata«. Das suchende Kind wird also sogleich mit dem Tod und seiner literarischen Überwindung konfrontiert. Wie viel es daraus lernte, wissen wir nicht. Denn die Bibliothek des Vaters, die solche Schätze enthielt, war selten für Fritz zugänglich. Aber jedenfalls waren es in diesem »volkleeren Dorfe«, Joditz, die Bücher, die die Mitmenschen, Gäste, die sprechenden Menschen von draußen, repräsentierten.
Auch die Ereignisse dieser äußeren Welt gelangen an das Kind in Buchform. Es sind die Bayreuther Zeitungen, die die Patronatsherrin Plotho in Zedwitz dem Vater monatlich oder vierteljährlich – bandweise – zur Verfügung stellt. Nicht also die Neuigkeiten zählen, denn die berichteten Ereignisse sind längst vergangen, sondern das Überdauern des Schnellvergänglichen, so, wie es im Buche steht.
Und dann erzählt der erinnernde Jean Paul von einem der deutlichsten Anzeichen nachmaliger Autorschaft: »Den gegenwärtigen Schriftsteller zeigte schon im Kleinen eine Schachtel, in welcher er eine Etui-Bibliothek von lauter eigenen Sedezwerkchen aufstellte, die er aus den bandbreiten Papierschnitzeln von den Oktavpredigten seines Vaters zusammennähte und zurechtschnitt.« Der kleine Fritz macht also erste Bücher. »Der Inhalt«, so fährt sein Lebensbeschreiber fort, »war theologisch und protestantisch und bestand jedesmal aus einer aus Luthers Bibel abgeschriebenen Erklärnote unter einem Verse; den Vers selber ließ er im Büchelchen aus.« So bekommt es der werdende Autor auch schon mit der Theologie zu tun, wenn auch noch auf höchst eigenwillige Weise. Ferner wird berichtet, wie er »statt neuer Sprachen neue Buchstaben« erfand. Er nahm Kalenderzeichen oder geometrische oder chemische aus Büchern oder Zeichen aus seinem Kopf, »und setzte daraus ein ganz neues Alphabet zusammen.« Er war dann der erste und der einzige, der diese Buchstabenwelten beherrschte.
Gespensterfurcht und Geisterscheu wird den Kindern vom Vater, dem protestantischen Theologen, in der Annahme, damit den Glauben zu festigen, bei jeder Gelegenheit beigebracht. So wird der kleine Richter bei Leichenzügen allein in die düstere, leerstehende Kirche geschickt, um die Bibel des Vaters in die Sakristei zu tragen. Aber »wer von uns schildert sich die bebenden grausenden Fluchtsprünge vor der nachstürzenden Geisterwelt auf dem Nacken und das grausige Herausschießen aus dem Kirchentore?« Die Mutprobe, die sich wiederholt, endet jedesmal im still für sich behaltenen Entsetzen. Dies befestigt, wie sich herausstellen wird, nicht den Glauben, sondern trägt weiter zu einem kritischen, eigenwilligen späteren Umgang mit den Glaubensinhalten bei. Heterodoxie, Kritik an der orthodoxen protestantischen Lehre, wird bald das Ergebnis sein und gleichfalls zur wichtigen Voraussetzung eines eigenständig schöpferischen, keinen Vorgaben von anders woher vertrauenden Schriftstellerdaseins werden. Denn diese Autorschaft hat, wie noch zu sehen sein wird, nicht zuletzt, die im Glauben erweckten Ängste und die Angstbewältigung durch imaginatives Angstagieren zur Grundlage.
Auch die erste Liebe ereignet sich in Joditz; auch sie wird in der Darstellung Jean Pauls zum Modell für die künftige Transformation von Lebenserfahrung in Literatur. Es handelt sich um eine nicht erklärte Liebe, eine Fernliebe. Das Mädchen, Augusta, »ein blauaugiges Bauermädchen seines Alters, von schlanker Gestalt, eirundem Gesicht mit einigen Blatternarben«, ist Gegenstand eines Romans, der sich nur in Friedrich Richters Innerem abspielt. Er betrachtet sie von seinem Pfarrstuhl aus in ihrem Weiberstuhl und kann sich nicht sattsehen. Lediglich wenn sie abends die Weidekühe nach Hause treibt, klettert der Kleine, der von seinem Vater eingesperrt und von der Welt ferngehalten wird, auf die Hofmauer, um das Mädchen heranzuwinken; oder er klettert wieder herab, um ihr durch eine Spalte im Hoftor etwas Eßbares, eine Zuckermandel etwa, zu reichen. »[M]ehr vom Körper durfte nicht von den Kindern aus dem Hofe«, kommentiert der spätere Biograph seiner selbst diese Schlüsselszene. Distanzliebe ist denn auch später das Motto des Autors. Denn nur die ferne Geliebte erlaubt es, an sie oder über sie zu schreiben und damit das Flüchtige der großen Gefühle auf Dauer zu stellen. Erotik wird dem späteren Literaten vor allem zum Schriftverkehr.
In der Vorlesung über die Zeit in Schwarzenbach, also Jahre später, folgt dann aber doch der erste Kuß. In einem unbeobachteten Moment rennt der Pfarrsohn über die Saalebrücke, dringt in das Haus seiner neuen – aus der Ferne, versteht sich – Geliebten ein und drückt das lange geliebte Wesen, eine Katharina, nunmehr an Brust und Mund. Aber der Erzähler beeilt sich zu versichern, daß das nur »eine Einzigperle von Minute« gewesen sei, »das Feuerwerk des Lebens für einen Blick«. Und dann war es dahin; es bleibt in der Erinnerung, zur Erzählung geworden.
Schwarzenbach
Ansonsten herrschen auch in Schwarzenbach das abgeschlossene Schaltier- und Winkeldasein vor und darin die Buchstabenkramerei und das Büchermachen auf eigene Faust und ohne Rücksicht auf Verständnis und Verstehbarkeit. »Der jetzige Romanschreiber«, so Jean Paul, »verliebte sich ordentlich in das hebräische Sprach- und Analysier-Gerümpel und Kleinwesen […] und borgte aus allen schwarzenbachischen Winkeln hebräische Sprachlehren zusammen, um über die diakritischen Punkte, die Vokalen, die Akzente und dergleichen alles aufgehäuft zu besitzen, was bei jedem einzelnen Worte analysierend aufzutischen ist. Darauf nähte er sich ein Quartbuch und fing darin bei dem ersten Buche Mosis an und gab über das erste Wort, über seine sechs Buchstaben und seine Selblauter und das erste Dagesch und Schwa [Zeichen für Abschwächung oder Verdoppelung bzw. für einen unhörbaren E-Laut, H.P.] so reichliche Belehrungen aus allen entlehnten Grammatiken mehre Seiten hindurch, daß er bei dem ersten Worte ›anfangs‹ […] auch ein Ende machte«. Der angehende Schriftsteller schafft sich nun aus Buchstabenliebhaberei nicht mehr nur einfach Bücher und ganze Welten, die in ihnen stehen, sondern die Genesis der Dinge selbst.
Jean Paul weist ausdrücklich darauf hin, daß das auf seines späteren Helden Quintus Fixlein (1796) Treibjagd nach Buchstaben in einer hebräischen Foliobibel verweise. Das eingebildete Büchermachen findet sich in einer anderen Variante, des Selberschreibens tatsächlicher Bücher, die man aus dem Leipziger Meßkatalog kennt, auch im Schulmeisterlein Wutz, seiner ersten Idylle von 1790. Das Zusammenleimen und Zusammenschneiden von Büchern aus Papierschnitzeln kennt man, ebenso wie das Übertrumpfen der Bibel, aus jenem kleinen Roman Fibel von 1811. Literarische Erfindung und Lebensbeschreibung verschwimmen. Die Entstehung des Schriftstellers und die Imagination des Schriftstellers werden eins. Aber das Thema hat so viele Aspekte, daß es für ein ganzes in Schrift verwandeltes Leben reicht – für die Autobiographie des Autors ebenso wie für die vielen Biographien, die dieser schreibt.
Anmerkungen
Frühe Schriften. Schwarzenbach, Hof, Leipzig, 1776–1784
In der Schwarzenbacher Zeit, mit der Jean Pauls eigene Lebensbeschreibung endet, beginnt sein geistiges Leben kommunikativer zu werden. Er lernt Johann Samuel Völkel kennen, einen neologischen, einen gegenüber der lutherschen Orthodoxie kritischen evangelischen Geistlichen, der dem Vater unterstellt ist und mit dem der Sohn offen über Fragen der Religion diskutieren kann. Ab 1776 wächst dann auch die Bekanntschaft, später Freundschaft mit seinem wichtigsten geistigen Mentor der frühen Zeit, dem Pfarrer Erhard Friedrich Vogel aus dem nahegelegenen Rehau, später Dekan in Wunsiedel. Vogel, ein aufgeklärter und reformwilliger Geistlicher, stellt dem jungen Richter seine umfangreiche, mit dem ganzen Wissen und der Literatur der Zeit versehene Bibliothek zur Verfügung. Für ihn ist dieser freie Zugang zur intellektuellen Welt einer der wichtigsten Anstöße seiner frühen Jahre überhaupt. 1778 beginnt er, sich aus den Büchern und Zeitschriften, die er da vorfindet, Exzerpte zu fertigen. Die Sammlung der Exzerpte wächst schnell und wird bereits 1781 auf über 3000 Seiten angewachsen sein. Die Exzerpte geraten zu Jean Pauls wichtigstem Arbeitsinstrument Zeit seines Lebens. Er konsultiert sie immer wieder und schlachtet sie aus für seine Einfälle, Anekdoten und witzigen Bemerkungen. Am Ende seines Lebens wird das Konvolut weit über 12.000 Seiten umfassen und kann nur mehr über Register und Register der Register überschaubar gehalten werden.
Erhard Friedrich Vogel. Gemälde in der Friedhofskirche in Wunsiedel
Anfang 1779 kommt Richter nach Hof aufs Gymnasium. Ihm, dem Dorfjungen, dem schüchternen Neuling, wird von den Stadtkindern erst einmal ein Streich gespielt, um seine Unbeholfenheit bloßzustellen. Ein Mitschüler redet Fritz Richter ein, daß es an der Schule üblich sei, daß ein Neuankömmling vortrete und dem französischen Sprachlehrer die Hand küsse. Fritz tut dies – zur Verblüffung des Lehrers und zum Spott der Mitschüler. Der, der ihn da hereinlegte, war Johann Amandus Reinhart, der jüngere Bruder des später als Maler in Rom berühmt gewordenen Johann Christian Reinhart. Dieser hatte das Hofer Gymnasium gerade verlassen. Sein jüngerer Bruder wird später Pfarrer in Bayreuth werden und sollte einst, 1825, Jean Paul die Leichenpredigt halten.
Gymnasium in Hof
Friedrich Richter setzt sich aber aufgrund seiner überlegenen intellektuellen Fähigkeiten bald gegenüber den anderen durch. Er gelangt nach einer Prüfung sofort in die Prima. Nach zwei Jahren nur hat er die Schule absolviert.
Es ist die Zeit erster, nachhaltiger Freundschaften, die hier ihren Anfang nehmen – die mit Adam Lorenz von Oerthel aus dem Joditz benachbarten Töpen, etwas später die mit Johann Bernhard Hermann und dann die fast lebenslange mit Christian Georg Otto, später über Jahrzehnte Jean Pauls erster Leser und Kritiker.
Am 25. April 1779 stirbt Friedrich Richters Vater. Die zurückgelassene Familie gerät durch den Verlust seines Einkommens in immer tiefere materielle Not. Der junge Richter kompensiert dies durch stetig wachsende, schließlich exzessive Lese- und Schreibarbeit. Er hält Schulreden, verschlingt Bücher, schreibt Berge von Papier voll und entwickelt, um seine beginnende geistige Eigenständigkeit zu demonstrieren, sogar eine private Orthographie: Doppelkonsonanten werden im Auslaut und vor Konsonanten vereinfacht, das Dehnungs-h wird ausgelassen, Doppelvokale werden vereinfacht usw. Jean Paul wird diese Eigenheiten bis zu seinem 41. Geburtstag im Jahre 1804 beibehalten. Individualität ist ihm nicht zuletzt ein Ereignis des Schriftbilds.
Nach dem Abschluß des Gymnasiums beginnt die sog. »Muluszeit«, die Zeit, in der er weder Esel noch Pferd, weder Schüler noch Student, sondern etwas dazwischen, eben mulus, Maultier, ist. Diese Zeit reicht vom Oktober 1780 bis zum Beginn des Theologie-Studiums in Leipzig im Mai 1781. Philosophisch-theologische Abhandlungen werden verfaßt, die Übungen im Denken, später, 1781, die Rhapsodien, eine Sammlung kleiner theologisch-philosophischer Aufsätze. Es entsteht ein kleiner Briefroman, Abelard und Heloise, welcher bald wieder verworfen wird. Rastlosigkeit, immer weiterschreiben, revidieren, neu ansetzen, Schrift als Lebenshalt und Dauer-Garant, auch bei widrigsten Umständen in der Leipziger Studentenzeit – das ist die Signatur dieser Jahre und wird prägend sein auch für das Kommende. Zu diesen ersten eigenständigen Schriften, über die bald, als für Richter typisches Schreiben über das Schreiben, ein Tagebuch meiner Arbeiten geführt werden muß, treten ab Oktober 1780 auch die Briefe, ein weiteres, lebenslanges Medium der Selbstvergewisserung, des Selbstentwurfs und auch und vor allem der Anverwandlung, der Einverleibung von anderen und anderem, von anderen Personen und von externer Welt, als eigenwillig erschriebener Wirklichkeit.
Ende 1781, Anfang 1782 findet sich dann ein erstes Zeichen literarischer Gestaltungsversuche im Schreiben: Die Produktion satirischer Texte beginnt mit dem Lob der Dummheit. Dem folgt ab Juni 1782 die Niederschrift des ersten Teils der ersten Satiresammlung, der Grönländischen Prozesse. Das neue Wissen und die neuen metaphysischen Verunsicherungen, die sich der junge Richter durch sein Lesen und Exzerpieren einhandelt, finden, zunehmend radikalisiert, in einem poetischen Experimentalnihilismus ihren Ausdruck. Alles Seelische, Geistige wird aufs Materielle, Körperliche reduziert und dem Gelächter preisgegeben. Damit versucht Richter, sich literarisch zu eigen zu machen, was ihn umtreibt und was er im Medium des Gedankenexperiments nicht abschließend und auf eine ihm Ruhe stiftende Weise klären kann. Richter hat damit erstmals Erfolg. Anfang 1783 erscheint der erste Band dieser Grönländischen Prozesse als Buch. Der junge Mann ist Schriftsteller. Das Theologie-Studium hat er zugunsten der breit gestreuten Lektüren und der vielen Schreibaufgaben längst beendet – sehr zum Mißfallen seiner Mutter, die sich von ihrem Sohn als Pfarrer materielle Unterstützung für die Familie erhofft hatte.
Ende August 1783 beginnt die Arbeit an einer zweiten Satiren-Sammlung, der Auswahl aus des Teufels Papieren, die sich über Jahre hinziehen sollte. Im Oktober erscheint noch der zweite Band der Grönländischen Prozesse. Doch dann ist es mit den ersten schriftstellerischen Erfolgen vorbei. Nicht jedoch mit der Schriftstellerei. Damit endet zunächst der kurze Überblick über die ersten Schreib-Jahre des jungen Friedrich Richter.
Am Anfang wurde gefragt, was man denn von dem kleinen und jungen Richter wissen kann und woher man es weiß, und es wurde festgestellt, daß man sich in einer Art Zirkel bewegt: Fast alles, was man weiß, weiß man durch die rückblickende Stilisierung des jungen durch den alten Jean Paul. Was Wunder, daß da alles durchtränkt wird von dem, was für den alten Autor allein zählt – die Schriftstellerei. Das Kind, der Junge wird zur Präformation dieser Lebensobsession, die alles Leben in Papier, Tinte, in Druckerschwärze und Buch verwandelt. Nun, spätestens ab 1778, tritt man in ein neues Stadium, das der Quellen, die dieses Leben unmittelbar bezeugen. Aber auch sie besagen, daß es von Anfang an ein fast ausschließlich erschriebenes gewesen ist. Die Autobiographie als indirekte Quelle endet hier. Zwar gibt es noch eine Reihe von Nachlaßnotizen zu Schwarzenbach, zu Hof, zu Leipzig. Aber sie werden immer spärlicher. Zu seinem Vater heißt es da noch, er sei orthodoxer Lutheraner der ersten Jahrhunderthälfte gewesen, der sich mit den neuen Tendenzen zur Heterodoxie, also zur kritischen Auseinandersetzung mit den kirchlich überlieferten Dogmen auf der Grundlage des neuen, unter Empirisierungsdruck stehenden Wissens nicht anfreunden konnte. Er habe deshalb nur noch an sich gedacht und hielt seine Erziehungsaufgabe für abgeschlossen. Von unschönen Seiten der damaligen Existenz ist da auch die Rede, von Hunger, von Prügeln – Lebenserfahrungen, die in der rückblickenden Sicht auf den werdenden Schriftsteller keinen rechten Platz hatten, nur in der noch unstilisierten Materialsammlung, die für die nie geschriebene Fortsetzung angelegt wurde. Aber dann findet sich auch wieder Vertrautes: »Nur Selbschreiben stärkt«, »Der Leser ist empfangend, der Schreiber zeugend«; oder: Der Junge habe keine Liebe gesucht, er las den »Werther« und war mit Schreiben beschäftigt. Über Leipzig finden sich dann nur noch Einträge über seinen Lehrer Platner, seine Lektüre, vor allem die von Swift. Erste poetologische Reflexionen über den frühen Schriftsteller tauchen auf: »Ich dachte, ich mache zu wenig Bilder«. Ansonsten nur noch Gedankenblitze – über gute Satire, über Parodien von Biographien, über die Einwirkung des Biers beim Arbeiten – eine für Jean Paul in seiner Jugend noch nicht drängende Frage, später eine immer wiederkehrende.
Die Autobiographie endet. Jean Paul hatte genug davon, sein Leben in einzelnen aufeinanderfolgenden Ereignissen wie auf einer Perlenschnur aufzureihen – er, der das kontinuierliche Erzählen so sehr haßte und das Abschweifen und das witzige Herausspringen aus der Geschichte so sehr liebte. Dafür gibt es nun aber als Quellen für dieses Schreib-Leben Jean Pauls Schriften selbst. Sie wollen nun, nicht vollständig, aber exemplarisch, in ihrem Werden und ihrer inneren Verflochtenheit gesehen werden.
Im Leben Fibels, der Biographie des Alphabet-Erfinders für Analphabeten und seiner Biographen, schreibt sein Autor ironisch über das seit Plutarch geläufige biographische Verfahren, aus der Kindheit und Jugend oder »Zwiebelwurzel des Helden die ganze künftige Tulpe vorzuschälen«. Kein Zug, sei er auch noch so unscheinbar, komme dem Biographen elend genug vor, um nicht als Vorschein künftiger Größe gesehen zu werden. Ex ungue leonem. Man muß sich, wenn man eine Biographie über Jean Paul schreibt, über diesen Spott hinwegsetzen. Denn wie bei wenigen anderen Autoren präsentiert sich einem sein frühes Leben ausgerichtet auf seinen einzigen späteren Inhalt, das Schreiben, das endlose Werden des Schriftstellers. Seien die frühen Ergebnisse auch noch so vorläufig, von ihm selbst und seinem Leser in Zweifel gezogen und zu ziehen, sie enthalten die Grundmaterialien dieser Existenz. Sie zeugen nicht nur von der Besessenheit, die von Anfang an da ist, von der Rücksichtslosigkeit gegenüber allem, was einer solchen Existenz entgegensteht und der Entschlossenheit, es in Schrift zu verwandeln, sie enthalten auch das Experimentelle, nie Abschließbare, immer von einem Extrem ins andere Weitergehende, sie enthalten die satirische Bitterkeit und die empfindsamen Schwärmereien, wenn auch in rudimentärer Form. Sie zeigen auch, welche Rolle dabei zunehmend die Literatur spielt: Sie ist das Feld, auf dem Krisen inszeniert, gedanklich schwer lösbare Fragen agiert werden können. Kurz, diese Schriftmassen zeugen von Anfang an von einem einseitigen Lebensentwurf, einem radikal einseitigen – aber gerade in dieser Einseitigkeit großartigen. Er repräsentiert den beginnenden Schriftabsolutismus einer aus den Fremdbestimmungen entlassenen Literatur der Moderne, die Triumphe und Verzweiflungen der Autorschaft und das nie endende Sprechen darüber.
Exzerpte
Der Beginn von Jean Pauls Schreiben zeigt sich nicht in eigenen literarischen Erfindungen, er beruht nicht auf eigenen Erfahrungen, sondern ist ein exzessives Abschreiben. Aber eines, das sich so entwickelt, daß es nicht als unselbständiges vom späteren selbständigen Produzieren überholt wird, sondern zeitlebens Gerüst der schriftstellerischen Tätigkeit und damit des Lebens bleibt. Wie schon zu hören war: »Um meine Lebensgeschichte zu haben, brauch ich bloß die Bände der Exzerpte vor mir aufzuschlagen: an jedem extrahierten Buch hängt ein glimmendes Stück meiner Geschichte.«
Die ersten Exzerptbände, die in Faszikel Ia und Ib des handschriftlichen Nachlasses in der Berliner Staatsbibliothek aufbewahrt sind, betreffen zunächst vor allem theologische Schriften aus der Bibliothek des Pfarrers und väterlichen Freundes Vogel. Genauer gesagt, handelt es sich meist um Exzerpte aus Rezensionen von theologischen Schriften, also um Tertiärliteratur. Der junge Richter exzerpiert ausführlich, seitenlang, meist ohne eigenständigen Kommentar – ganz im Gegensatz zu später, ab 1782, wo er sich höchst eigenwillig nur Materialien für seinen Witz, seine Skurrilitäten, Anekdoten und dergleichen für die späteren Assoziationen und Digressionen herauspickt.
Der erste Exzerptband ist dem 15jährigen so wichtig, daß er einen Schreiber aus Schwarzenbach namens Wolfram beauftragt, den Titel Verschiedenes, aus den neuesten Schriften. Erster Band. Schwarzenbach an der Saale – 1778 in Schönschrift auf den Umschlag zu schreiben. So äußert sich nicht nur seine Buchstabenverliebtheit, von der sein alter ego als Biograph einst wird zu berichten wissen; der junge Richter schreibt sich auch, wie weiland das Schulmeisterlein Wutz, sein erstes Buch zusammen. Denn durch die fast druckreife Schrift sieht der Einband nun aus wie ein Buchdeckel.
Titelblatt von Verschiedenes, aus den neuesten Schriften, 1778
Das allererste Exzerpt ist aus dem Journal für Prediger von 1770 genommen und behandelt einen Artikel über »Die Ewigkeit der Höllenstrafen«. »negat« ist als Vermerk der Ablehnung und als einziger Kommentar hinzugefügt. In diesem Artikel findet sich ein vorsichtiges Abrücken von Glaubenssätzen der lutherischen Orthodoxie: Zwar sei von solchen Strafen in der Heiligen Schrift die Rede; jedoch könne man nicht annehmen, daß Gott ein vernünftiges Wesen geschaffen habe, dessen unaufhörliche Unglückseligkeit er vorausgesehen habe. Auch wolle Gott warnen und bessern, was nur Sinn ergebe, wenn er von jenem Grundsatz abweiche und grausame Strafen im Falle der Besserung abmildere.
Der junge Richter wurde von seinem Vater in einem Klima der Furcht vor Gott und der Angst vor Sünde und den unerbittlichen Strafen, die darauf stehen, erzogen. Sola fide – nur der bedingungslose Glaube, auch wenn er den Vernunftverzicht erfordert, kann in unserem sündigen Leben helfen. Sola scriptura – nur die Schrift gibt Auskunft über das, was wir zu glauben und zu erwarten haben. Friedrich Richter sucht also offenbar, sobald er auch nur im Ansatz selbständig zu denken lernt, diese Angst zu bearbeiten und sich gegenüber diesen Zumutungen ans Denken eigenwillige Positionen zu erkämpfen. Seine frühen Lehrer Völkel und Vogel, heterodoxe Theologen, Neologen, kritisch gegenüber der Überlieferung und den kirchlichen Dogmen, die einen Hauch von Aufklärung in die Düsternis des fränkischen Hinterlandes bringen wollen, sind ihm dabei behilflich.
»Von den Wirkungen des Teufels«, lautet der nächste Eintrag. Wieder handelt es sich um eine vorsichtige Kritik der Dogmen: Wenn der Teufel an allen Sünden schuld sei, müßte er allgegenwärtig sein, was aber nicht gedacht werden könne. Hier nun fügt Richter einen noch entschiedeneren Kommentar ein – lateinisch, wie er es anfangs liebte, um seine neu erworbene Gelehrsamkeit unter Beweis zu stellen. »Non credendum est diabolum existere, quod ego jam probabo«, schreibt er ins Exzerpt (es ist nicht glaubhaft, daß der Teufel existiert, was ich schon beweisen werde). Hinter der Gelehrtenmaske fühlt man aber auch die Erregung, die noch von den Erfahrungen des geängstigten Kindes her mitbebt. Jean Pauls Schreiben ist schon hier, in seinen allerersten Manifestationen, ein Um-Schreiben von Lebenserfahrungen, deren Erschütterungen festgehalten und zugleich bewältigt werden sollen. So wird es bleiben.
Bald sind zu den ausgedehnten Exzerpten Register nötig, in denen die verschiedenen behandelten Materien präsent gehalten werden. Zum Buchstaben A heißt es da: »Aberglaube – ist ausgebreiteter als man vermutet […] noch mer aber ist schon verloschen […] ist schädlicher als der Ateism«; oder: »Angst – zu große über Gottes Zorn ist unnötig«; zu D: »Dreieinigkeit – ist […] kanonisirtes Unding«. Zu E: »Erbsünde – die Schriftstellen, die eine beweisen wollen, handeln nicht davon«; zu H: »Höllenstrafen – sind nicht ewig«. Das sind nicht unbedingt Richters eigene Meinungen, jedoch Hinweise auf für ihn interessante heterodoxe Ansichten.
Aus der von Karl Friedrich Bahrdt herausgegebenen Allgemeinen theologischen Bibliothek exzerpiert Richter weit über einhundert Seiten. Dort findet sich von der Orthodoxie bis zum Deismus, der jeglichem Offenbarungsglauben abhold ist, alles. Richter interessiert sich unter anderem für Basedows Lehrbuch der natürlichen Religion von 1774. Dieser sieht den Grund für den Abfall von Gott und dem Glauben an Jesus Christus in der Kirche selbst, in ihrer Lehre, ihrer Liturgie und Kinderunterweisung, und empfiehlt als Heilmittel eine natürliche Religion, die allem Aberglauben und den Zwangsmitteln der väterlichen Meinungen abschwöre.
Ein anderer Theologe, der dem jungen Richter – wie aus dem Umfang seiner Exzerpte zu schließen ist – in dieser ersten Zeit sehr wichtig war, ist Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem. Dessen Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion von 1768 vertreten gemäßigt neologistische Positionen. Mit dem damals sehr erfolgreichen neuplatonistischen Instrumentarium wird von der Schöpfung als einer Stufenleiter der Vervollkommnung gesprochen, welche in der Nachfolge Jesu zu höheren Seinsgraden führe. Die Dogmen der Erbsünde und der Höllenstrafen werden damit entschärft. Von Jean Paul besonders hervorgehoben wird ein Gedanke, der ihn immer wieder umtreibt. Nehme man, wie Jerusalem an, daß der Mensch die Anlage zu unendlichen Fähigkeiten habe, so sei auch der Gedanke an seine völlige Vernichtung unmöglich. »mit einer Anlage zu unendlichen Fähigkeiten, um als Embryo zu sterben; ein Herr der Thiere, ein Herr der ganzen Natur, mit allen Schicksalen eines Insekts; ein todter Staub vol götlicher Kraft; ein denkendes Wesen, das sich über alle Himmel erhebt; und in dem Augenblik ein Fras der Würmer; mit dem strengsten Gesez gebohren, ohne Gesezgeber. Wie räthselhaft! wie finster!« Jerusalems Beschwörung, solches doch nicht denken zu müssen, macht sich sein junger Leser, wie nicht zuletzt die Anverwandlung an seine Orthographie zeigt, zu eigen. Immer wieder wird er von diesem Skandalon der Sterblichkeit und seinem Komplement, dem Postulat der Unsterblichkeit, handeln – theologisch, philosophisch und zunehmend auch in poetischen Figurationen.
Selbst der damals die Gemüter erhitzende sogenannte Fragmenten-Streit findet – etwas später (1781) – in Richters frühen Exzerpten seinen Niederschlag. Hier erreicht die kritische Auseinandersetzung mit der orthodoxen Theologie eine Extremposition. Hermann Samuel Reimarus, Gymnasialprofessor in Hamburg, hatte 1767/68 für den internen Gebrauch in verständigen Zirkeln eine Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes verfaßt, in welcher er gegen die Zumutungen des biblischen Glaubens mit seinem Festhalten an einer übernatürlichen Offenbarung und an Wundern wetterte. Nicht nur die angeblichen Wunder in der Bibel werden darin verhöhnt, sondern auch die Göttlichkeit und Auferstehung Jesu für einen Betrug seiner Jünger erklärt. Reimarus versuchte diese Attacken mit historisch fundierter Kritik zu rechtfertigen. Lessing veröffentlichte und verteidigte 1777 diese Fragmente eines Ungenannten. Eine Flut von empörten Gegenschriften war die Reaktion. Richter macht sich Auszüge aus dem zweiten Fragment mit dem Titel Unmöglichkeit einer Offenbarung, die alle Menschen auf eine gegründete Art glauben könten und aus dem fünften, das Über die Auferstehungsgeschichte betitelt ist und bei Richter unter der Überschrift Einwände gegen die Erzälung des Mattäus, daß Christi Grab sei versiegelt und von römischen Soldaten bewacht worden geführt wird. Richter liest und exzerpiert darüber hinaus auch Lessings Antwort auf die Einwände der Gegner, die Duplik von 1778, und weitere Streitschriften in diesem Zusammenhang. Der angehende Schriftsteller scheut, obwohl ihn dieses Mal sein Mentor, Pfarrer Vogel, davon abhalten und ihn davor bewahren wollte, keine Religionskritik mehr. Die gedankliche Inszenierung der Glaubenskrise ist ihm wichtiger als fragwürdige Glaubenszuversicht, wenngleich er sich damals noch erhofft haben dürfte, der Glaube möge aus derlei Auseinandersetzungen gestärkt hervorgehen.
Ab 1781 wendet sich Richters Interesse aber dann von den theologischen Fragen eher ab und verstärkt anderen zu: philosophischen und literarischen.
In dem Maße, in dem im 18. Jahrhundert die überlieferten Dogmen über die göttliche Schöpfungseinrichtung ins Wanken geraten, machen sich philosophische Spekulationen breit, die ihre Sinnhaftigkeit, ihre Vorherbestimmtheit und Kontinuität über die Brüche der Entwicklung hinweg mit Vernunftgründen statt dogmatisch oder unter bloßer Berufung auf die Offenbarung durch die Schrift plausibel machen sollen. Sie müssen sich dabei zunehmend dem Druck der empirischen Naturwissenschaften stellen, deren Argumente entweder widerlegen oder integrieren. Jean Paul registriert dies in seinen Exzerpten aufmerksam und immer vom Nervpunkt der persönlichen Betroffenheit her, nämlich im Horizont der Frage, wie weit sich individuelles Dasein ohne irrationale Dogmen denken lasse, aber auch ohne trostloser Kontingenz und den Gefahren des Nihilismus anheimzufallen. Immer, auch noch in den scheinbar entlegensten, uns heute abstrus erscheinenden Theorien, die er in diesen frühen Exzerpten rezipiert, geht es um dieses persönliche Ganze.
So zum Beispiel handelt ein Auszug aus dem Jahr 1780, anknüpfend an die »freundschaftliche Korrespondenz« des Thomas Abbt, eines Freundes von Friedrich Nicolai und Moses Mendelssohn, erschienen 1771, von den »Samenthierlein«. Sie haben den jungen Richter, nicht anders als seine Zeitgenossen, wieder und wieder beschäftigt. Nach damals sich langsam durchsetzenden biologischen Erkenntnissen waren sie für den Zeugungsakt maßgeblich und dafür verantwortlich, daß durch die Vereinigung von Ei- und Samenzelle ein neues Wesen entsteht. Was uns heute selbstverständlich erscheint, war damals metaphysisch höchst prekär. Denn damit wurde der herrschenden Präformationslehre widersprochen, die besagt, daß seit Anfang der Schöpfung aufgrund der göttlichen Urzeugung Keime vorfindlich seien, aus denen sich alles spätere Leben entwickle. Nichts prinzipiell Neues entsteht dabei und nichts geht verloren. Kontinuität als oberstes Schöpfungsprinzip ist gewährleistet und verbürgt daher auch jedem einzelnen, daß sein Leben nicht einer völligen Vernichtung und Ersetzung durch Neues ausgeliefert ist. In Konkurrenz zur Präformationslehre behauptet nun die sogenannte Epigenesis-Lehre, daß in der geschlechtlichen Zeugung jeweils Neues hervorgebracht werde. Die entstehende Biologie nimmt metaphysische Verunsicherungen in Kauf, um ihre neuen, durch Beobachtung gewonnenen Erkenntnisse durchzusetzen. Schon in einem früheren Exzerpt von 1779 bemerkt Richter irritiert, daß ein Freiherr von Gleichen-Rußwurm in einer Abhandlung über die Saamen- und Infusionsthiergen, und über ihre Erzeugung (Nürnberg 1778) gegen die Autoritäten Haller und Bonnet die Präexistenz im Ei leugne. Vielmehr seien die Bewegungen und Wirkungen eines neu eingedrungenen »Samenthiergens« für die Vorgänge der weiteren Brütung verantwortlich. In jenem oben genannten Exzerpt aus Thomas Abbt nun werden die Konsequenzen gezogen. Was, so heißt es, wenn dieses »Samenkörnlein« nicht zur Befruchtung kommt? Ist es dann, wie das Ei, das buchstäblich leer ausgeht, verloren? Oder muß man nicht auch in ihm noch eine Absicht seines Schöpfers vermuten, eine Bildung, die in ihm etwas Unverlierbares, nicht der Vernichtung Anheimgegebenes, erkennen läßt? So, wie die Säuglinge, die sogleich sterben, auch schon eine Fähigkeit der Seele ausgebildet haben.
Wie man sieht: Das strittige Phänomen der Samenzelle wird hier versuchsweise metaphysisch umgedeutet, um theologisch vereinnahmt werden zu können: Das Samentierchen ist keine Widerlegung der Theologie, sondern ihre Bestätigung. Das ist keine Forschung, sondern Spekulation, die an seelische Trostbedürfnisse appelliert und diese mit einer Kaskade rhetorischer Fragen aufruft. Jean Paul nimmt dazu nicht Stellung. Aber es treibt ihn sichtlich ebenfalls um. Und er wird auch nie als Wissenschaftler dazu Stellung nehmen können und wollen, sondern diese Beunruhigung und die daraus notwendig hervorgehenden bildlichen Vorstellungen in immer neuen gedanklichen Figurationen aktualisieren.
Man könnte dergleichen Diskussionen und Richters Interesse für sie auch an verwandten Phänomenen verfolgen – der Diskussion über den Armpolypen etwa, der nach damaligen neuesten empirischen Entdeckungen beliebig oft zerschnitten werden kann und sich in jedem Teil immer neu reproduziert. Folgt daraus eine Widerlegung der Präformationslehre, da man nicht annehmen könne, daß solche Zufälle der Neubildung am Anfang der Schöpfung vorgesehen waren? Oder heißt dies, daß jedes Teilchen dieses Tieres eben präformierte Keime besitze und so, wie unscheinbar immer, erst recht Kronzeuge der Schöpfungslehre sei?
Jean Paul versammelt derlei anstößige Denkmodelle. Er läßt sie sozusagen gegeneinander aufmarschieren. Entscheidungen treffen kann und will er nicht. Offenbar geht es ihm mehr um die Dramaturgie des Konflikts als um unumstößliche Wahrheiten, denen gegenüber er ja längst mißtrauisch geworden ist. Vielleicht lassen sich in diesen konstellativen Arrangements bereits erste, protoliterarische Gestaltungen erkennen. Später wird er dieselben Fragen in explizit poetischen Figuren personifizieren und durch sie in Szene setzen. Ein Beispiel dafür ist der Leibgeber des Siebenkäs-Romans und dessen »Kniestück […] als erster Menschenvater«, wo es wieder um Fragen der Präformation geht, nun aber ironisch-satirisch gebrochen und in der Schwebe zwischen Ernst und Unernst belassen.
Unverkennbar ist in dieser frühen Zeit aber auch, daß der junge Richter erst einmal und immer wieder auch Zuflucht sucht bei tröstlicheren, weniger riskanten Theorien. Leibniz ist damals noch verbindlich für ihn, dessen Theodizee göttlich garantierte Kontinuität gegen alle Sprünge und Zufälle verteidigt und eine Homogenität der Seinsstufen annimmt, die auch noch dem Geringfügigsten Teilhabe am vernünftigen Schöpfungsplan und eine Vervollkommnungsmöglichkeit in der Stufenfolge und Verkettung der Wesen in Aussicht stellt. In Jean Pauls Exzerpten schlägt sich das auch nieder im Rückgriff auf den häufig zitierten Leibniz-Nachfolger der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, den Schweizer Naturphilosophen Charles Bonnet. Dessen Betrachtungen über die Natur von 1766 spielen eine große Rolle, ebenso seine Philosophische Untersuchung der Beweise für’s Christenthum von 1769. Während im ersten Essay die Stufenfolge der Dinge propagiert wird, in der alles unverlierbar aufgehoben sei und der Armpolyp gegen die Zerstückelungstheoretiker in seiner ständig wieder auf seine ursprüngliche Einheit zurückgehenden Reproduktionskraft gefeiert wird, behandelt die zweite Schrift – nach Auskunft von Jean Pauls Exzerpten – insbesondere die Fortdauer der Tierseelen. Gegen materialistische Reduktionismen, die in allem nur die seelenlose Mechanik am Werk sehen wollen (La Mettrie), wird hier auch dem Tier eine Seele zugesprochen, und zwar eine fortdauernde. Denn nichts, was die Allmacht Gottes zu schaffen für würdig befunden habe, sei bloß materiell und damit vergänglich. Alles sei kraft göttlicher Vorsehung in seinem Wesen immateriell und seinem Wesen nach der Erhaltung würdig. Präexistenz aller Dinge »von Anfang her bis zu ihrer Erscheinung« und darüber hinaus sei daher das Motto der Schöpfung. So läßt sich aus dem jetzigen auch Gewißheit über das künftige Leben ableiten. Bonnet gibt unter anderem Auskunft über die Sprache, die wir dort sprechen werden. Richter notiert das kommentarlos.
Nun finden sich aber im selben Heft 9 des Faszikels Ia von 1780 auch sehr ausführliche Exzerpte zu David Hartley, einem englischen Assoziationspsychologen in der Nachfolge des Lockeschen und Humeschen Empirismus, Betrachtungen über den Menschen, seine Natur, Pflicht und Erwartungen. Sie zeigen, wie der junge Richter sich gleichzeitig auch mit ganz konträren, nämlich materialistisch beeinflußten Konzepten – hier nicht der Naturlehre und Metaphysik, sondern der Psychologie und Erkenntnistheorie – sehr ernsthaft auseinandersetzt. Dies mag, zusammen mit den wenig später gefertigten, ebenfalls sehr einläßlichen Helvétius-Auszügen, exemplarisch zeigen, wie der angehende Schriftsteller die Bastionen der Theodizee auch immer wieder verläßt, um sich unerschrocken in den Kampf mit riskantesten Denkexperimenten zu begeben.
Hartleys Observations on Man gehen vor allem der Frage nach, wie Empfindungen entstehen. Dabei interessiert ihn, wie sich äußere Reize zunächst in körperliche und dann in seelische Aktivitäten transformieren. »Hartlei«, wie er beim jungen Richter heißt, geht davon aus, daß externe Impulse zum Beispiel bei Gesichtseindrücken zu Schwingungen der Sehnerven führen, die wiederum analoge Schwingungen im Gehirnmark hervorrufen, welche alsdann Bilder und seelische Reaktionen darauf ergeben. Es wird also eine Isomorphie der einzelnen Bereiche angenommen; einer ist in den anderen transformierbar. Nun aber, so reflektieren Hartley und Richter im Anschluß an ihn, gibt es tausend verschiedene äußere Erscheinungen. Wie sind diese im Innern des Körpers und der Seele abbildbar? Müßte es nicht für jeden Reiz eine besondere Schwingung geben? Liegen die Unterschiede vielleicht in der Stärke der Schwingungen? Diese und ähnliche Fragen der Bewußtseinsgenese ergeben sich im 18. Jahrhundert immer wieder, wenn man sich mit der cartesianischen Lehre der Substanzentrennung nicht mehr zufrieden geben will. Die hatte res extensa (Materie) und res cogitans (Geist) kategorial geschieden, so daß die offenbar ja auch gegebene Einwirkung des einen auf das andere, die Frage der extern induzierten Empfindung als Wirkung auf die Seele, nicht mehr erklärt werden konnte. Die Frage des sog. commercium mentis et corporis, des Zusammenhangs von Leib und Seele, stellte sich, wie die verwandte, die des influxus, des Einflusses des einen Bereichs auf den andern. Hartleys Assoziationspsychologie, die so heißt, weil sie überdies die räumliche Nähe einzelner Empfindungseindrücke im Gehirn für die Verbindung der Ideen verantwortlich macht, versucht auf all diese Folgelasten der Philosophie und Erkenntnistheorie des 17. Jahrhunderts nun im Anschluß an die englische empiristische Philosophie vorsichtige Antworten zu geben. Hartley entgeht dabei dem Problem nicht, wie man den cartesianischen Dualismus soll kontern können, ohne in einen platten materialistischen Monismus als Alternative zu verfallen. Die Antwort, alles sei gleich und daher ineinander übertragbar, weil alles bloß mechanisches Funktionieren ist, möchte er vermeiden. Er thematisiert, was Richter aufmerksam registriert, die Schwierigkeiten, beharrt aber darauf, daß derlei Verbindungen des Verschiedenen gedacht werden können müssen, um die Vorgänge in der menschlichen Psyche – von der Wahrnehmung bis zu Assoziation, Gedächtnis, Imagination, Vergnügen und Schmerz – begreifen zu können. Richter konzediert ihm in kurzen Kommentaren, daß er seine Auffassungen sehr scharfsinnig verteidige und daß die »Art […] von Abhängung und Verbindung, die Hartlei angiebt«, eine von den möglichen sei und, so fügt er fast zögernd hinzu, auch eine der »wahrscheinlichen«.
Noch nie hatte der junge Richter sich so weit in den Bereich einer von der Vorsehung und ihren göttlichen Substanzen verlassenen, nur aus sich heraus funktionierenden Welt vorgewagt. Aber sofort zuckt er wieder zurück: »Mir scheint ferner die Beschaffenheit der Nerven mit keiner andern Materie verglichen werden zu können – iede ist eine eigne Art«, heißt es gleich darauf, das Gedankenexperiment wieder kassierend. Die Bereiche sind also doch zu verschieden, um als ineinandergreifend gedacht werden zu können. Und er rettet sich wieder zu Leibniz und dessen Annahme einer spirituellen Homogenität des Universums, welche allein die auftretenden Probleme lösbar mache. Wenn alles geistige Substanz im Stadium verschiedener Grade der Vervollkommnung sei, macht auch das Problem des Einflusses der einen auf die andere keine Sorge mehr. Es folgt denn unmittelbar auf die Hartley-Exzerpte auch ein Exzerpt aus der Leibnizschen Monadologie.
Ebenfalls noch im Jahr 1780 findet sich eine erste Spur der Lektüre des Helvétius. Es handelt sich hier um ein Exzerpt aus Nicolais Allgemeiner deutscher Bibliothek von 1775. Richter kritisiert den französischen Philosophen. Dieser behaupte, wir gewönnen unser Urteil über die Dinge durch den Vergleich der äußeren Eindrücke über sie. »Allein diese Meinung des Helvezius ist falsch«, fügt er dem Exzerpt kommentierend hinzu. In einer Seele, in welcher es nichts als die Sukzession der Empfindungen gebe, synthetisiere sich wie bei den Tieren nichts zum Begriff. Die Seele des Menschen müsse Folgerungen aus den Vergleichungen ziehen können, und das sei nur möglich, wenn sie über autonome Fähigkeiten verfüge. Wir sind also wieder bei der Frage des Einflusses auf die Seele bzw. die Geisteskräfte und die nach der Eigenständigkeit oder Abhängigkeit ihrer Verarbeitung. Was hier aber noch nach einer Abrechnung und Erledigung des Helvétius aussieht, erweist sich wenig später als Faszinosum. In einem seiner ersten Briefe an Pfarrer Vogel im April 1781 – noch aus Schwarzenbach, kurz vor der Abreise zum Theologie-Studium in Leipzig – berichtet er seinem Mentor, daß er das Vergnügen nicht beschreiben könne, welches er »bei der Durch[lesung] des Helvezius« empfangen habe: »Die wolklingende Sprache, die Beredsamkeit, die wizzigen Bemerkungen« seien hinreißend.
Wenig später wohl, in Leipzig, fertigt sich Richter »extraits« aus De l’esprit