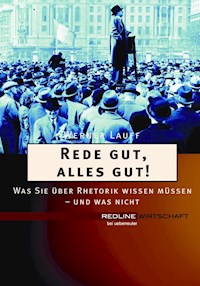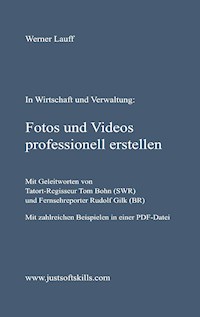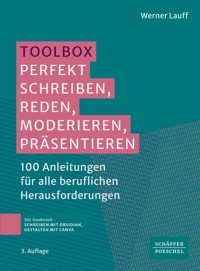Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Es gibt nur wenige journalistisch tätige Menschen, die im Laufe ihres Berufslebens alle Medien durchlaufen. Die meisten machen Karriere in einer Mediengattung und sind damit Spezialisten. Viele sind zudem entweder vor oder hinter der Kamera tätig, auf der Bühne oder backstage, als Akteure oder Manager. Selten erleben sie diese Perspektiven kumulativ. Und erst recht gibt es wenige Personen, die in Unternehmen tätig waren, für die sie selbst die Grundlagen legten. Der Weg von Werner Lauff durch die Medien war aber tatsächlich derart umfassend. Er ist einer der wenigen, der die gesamte Medienentwicklung begleitet hat: Die Breitbandverkabelung in den achtziger Jahren, den Start des privaten Fernsehens, die Einführung landesweiter und lokaler Hörfunksender, Videotext, Bildschirmtext und nicht zuletzt die Entwicklung des Internets. Wie kam dieser Weg durch alle Medien zustande? Welche Rollen hatte er dabei inne? Welche Entwicklungen konnte er dadurch beeinflussen? Seine Erzählung schildert ein Stück Mediengeschichte. Sie führt in den Deutschen Bundestag und zu RTL Television. Zu AOL Europa und zum Verband der Zeitungsverleger. Zur Bertelsmann Broadband Group und zum Landsbergblog. Zu Le Monde und Radio NRW. Zu Radio Essen und Europe 1. Zu Cityweb und zu D&D. Sie begleiten Werner Lauff als Kolumnist und Moderator, Geschäftsführer und Aufsichtsrat, Blogger und Kolumnist, Buchautor und Dozent sowie Redner und Lobbyist auf einem Pfad, der trotz dieser Vielfalt erstaunlich geradlinig war, weil es einen roten Faden gab: Journalismus mit Vision. Journalisten sind nicht nur Personen, die Inhalte für Medien erstellen. Auch wer ein Radio gründet, Portale etabliert oder einen Newsletter ins Leben ruft, ist journalistisch tätig. Deswegen sind Verleger, Senderchefs und Programmdirektoren auch Journalisten. Alle Journalisten, ob Bericht erstattend, kommentierend oder planend tätig, brauchen Visionen. Wie entwickelt sich ein Politikfeld, zum Beispiel Energie und Umwelt? Welche Zukunft hat die Autoindustrie? Welche Möglichkeiten bieten neue Technologien? Kommt das Flugtaxi? Aber auch: Wie nutzen wir morgen Medien? Journalismus mit Vision sollte daher eigentlich die Normalität darstellen. Aus dem Inhalt: Journalistische Nachwuchsförderung, Journalistenausbildung in Paris, Assistent im Deutschen Bundestag, Abteilungsleiter beim BDZV, Geschäftsführer des VRWZ, Geschäftsführer in der WAZ-Gruppe, Bei AOL und Bertelsmann, Freiberufler, Lokaljournalist
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Jugendzeitschrift Alternative
Truppenzeitschrift Heer
Journalistische Nachwuchsförderung
Journalistenausbildung in Paris
Assistent im Deutschen Bundestag
Abteilungsleiter beim BDZV
Geschäftsführer des VRWZ
Geschäftsführer in der WAZ-Gruppe
Bei AOL und Bertelsmann
Freiberufler
Bücher
Fachartikel
Reden
Moderationen
Seminare und Coachings
Lokaljournalist
landsbergblog
Kreisbote
Nachwort
Personen
VORWORT
Das Internet ist eigentlich
keine Technologie, sondern
ein Technologieträger.
Werner Lauff, 1993
Es gibt nur wenige journalistisch tätige Menschen, die im Laufe ihres Berufslebens alle Medien durchlaufen. Die meisten machen Karriere in einer Mediengattung und sind damit Spezialisten. Viele sind zudem entweder vor oder hinter der Kamera tätig, auf der Bühne oder backstage, als Akteure oder Manager. Selten erleben sie diese Perspektiven kumulativ. Und erst recht gibt es wenige Personen, die in Unternehmen tätig waren, für die sie selbst die Grundlagen legten. Mein Weg durch die Medien war aber tatsächlich derart umfassend.
Werner Lauff ist einer der wenigen, der die gesamte Entwicklung begleitet hat: Die Breitbandverkabelung in den achtziger Jahren, den Start des privaten Fernsehens, die Einführung landesweiter und lokaler Hörfunksender, Videotext, Bildschirmtext und nicht zuletzt die Entwicklung des Internets. Oft hat er an der Einführung neuer Medien aktiv mitgewirkt.
Förster, Vom Urknall zur Vielfalt, Berlin 2017
Wie kam dieser Weg durch alle Medien zustande? Welche Rollen hatte ich dabei inne? Welche Entwicklungen konnte ich dadurch beeinflussen?
Meine Erzählung schildert ein Stück Mediengeschichte. Sie führt in den Deutschen Bundestag und zu RTL Television. Zu AOL Europa und zum Verlegerverband. Zur Bertelsmann Broadband Group und zum landsbergblog. Zu Le Monde und radio NRW. Zu Radio Essen und Europe 1. Zu cityweb und zu D&D. Sie begleiten mich als Kolumnist und Moderator, Geschäftsführer und Aufsichtsrat, Blogger, Buchautor und Dozent sowie Redner und Lobbyist auf einem Pfad, der trotz dieser Vielfalt erstaunlich geradlinig war, weil es einen roten Faden gab: Journalismus mit Vision.
Journalisten sind nicht nur Personen, die Inhalte für Medien erstellen. Auch wer ein Radio gründet, Portale etabliert oder einen Newsletter ins Leben ruft, ist journalistisch tätig. Deswegen sind Verleger, Senderchefs und Programmdirektoren auch Journalisten. Alle Journalisten, ob Bericht erstattend, kommentierend oder planend tätig, brauchen Visionen. Wie entwickelt sich ein Politikfeld, zum Beispiel Energie und Umwelt? Welche Zukunft hat die Autoindustrie? Welche Möglichkeiten bieten neue Technologien? Kommt das Flugtaxi? Aber auch: Wie nutzen wir morgen Medien? Journalismus mit Vision sollte daher die Normalität darstellen.
Man hat oft über mich gesagt, dass ich anschaulich schreibe und rede.
Werner Lauff kann sich etwas vorstellen.
Werner Lauff kann man verstehen.
Prof. Dr. Norbert Schneider, 2008
Tatsächlich habe ich mich darum immer bemüht. Ich will das auch hier tun. Daher habe ich in dieses Buch auch Auszüge aus Texten und Reden aufgenommen; Sie sollen Ihnen authentisch verdeutlichen, in welchem Umfeld man sich damals bewegte, insbesondere was bereits erreicht war und was noch lange nicht.
Dieses Buch richtet sich an alle, denen ich in den vergangenen fast 50 Jahren begegnet bin. Sie sind ein Stück auf meinem Weg mitgegangen und ich bin ein Stück auf ihrem Weg mitgegangen. Unsere Wege haben sich gekreuzt und liefen eine Zeitlang parallel. Ebenso wie mich ihr ganzer Weg interessiert, könnte es sein, dass sie Lust haben, etwas über meinen Weg zu erfahren, der von woanders herkam und woandershin führte.
Werner Lauff, im Januar 2025
JUGENDZEITSCHRIFT ALTERNATIVE
Meine Kindheit war wesentlich von zwei Tatsachen geprägt. Zum einen davon, dass ich ein Einzelkind war. Meiner Geburt gingen zwei Fehlgeburten voraus. Als es endlich geklappt hatte, gaben meine Eltern weitere Zeugungsversuche auf. Zum anderen wuchs ich in Städten auf, teils sogar in einer Etagenwohnung am Dickswall, einer vielbefahrenen Straße in Mülheim an der Ruhr. Es war nicht daran zu denken, nachmittags einfach mal aus dem Haus zu gehen, um mit anderen Kindern zu spielen oder im Wald herumzutollen. Ein Eltern-Taxi gab es auch nicht. Mein Vater war oft unterwegs und meine Mutter hatte keinen Führerschein.
So verbrachte ich die Nachmittage nach dem Halbtags-Kindergarten einzeln in meinem Zimmer im dritten Stock. Das hatte auch Vorteile. Noch bevor ich in die Grundschule kam, konnte ich lesen. Es heißt, dass ich anderen Kindern im Hausflur etwas aus der Tageszeitung vorgelesen habe. Nach der Einschulung beschäftigte ich mich nachmittags oft mit den Experimentierkästen von Kosmos und dem Spielcomputer Logikus. Ich baute eine Telefonanlage sowie eine Lichtschranke und programmierte das Spiel mit dem Schäfer, dem Wolf, der Ziege und dem Kohlkopf. Ab und zu brachte ich versehentlich eine 4,5-Volt Flachbatterie von Daimon zum Dampfen, weil ich Kurzschlüsse produzierte.
Als wir später von Mülheim an der Ruhr nach Hameln an der Weser zogen, änderte sich nicht viel an dieser Splendid Isolation. Ich erinnere mich noch daran, dass der Bus der Linie P um 7:10 Uhr im Klüt-Viertel abfuhr. Nach einmal Umsteigen ging es dann zum Schiller-Gymnasium, in dem ich bis zur 9. Klasse blieb. Die Schule war um viertel nach eins aus und dann stand erneut ein relativ langer Schulweg auf dem Programm. Mittagessen gab es um halb drei, dann folgten Hausaufgaben. Und danach standen wieder Aktivitäten aus den Bereichen Forschung (Kosmos) sowie Bauen und Wohnen (Lego) an. Meine Freunde, zum Beispiel Ralf-Eckhard Binder (heute Arzt in Bad Oeynhausen), wohnten eine halbe Autostunde entfernt, auf der anderen Seite der Weser; das war zu weit.
Bei meiner Bautätigkeit war ich allerdings von einer gewissen Ungeduld geprägt. Während Klaus, der Sohn der Familien-Freunde Werner und Ulla Eckler aus Krefeld, Lego-Steine mit Akribie in Ordnungskästen aufbewahrte und architektonische Kunstwerke herstellte, befand sich mein Lego-Bestand unsortiert in einer Kiste, wodurch es schon mal vorkommen konnte, dass das einzige passende Teil im ersten Obergeschoss meiner Phantasievilla das war, auf dem aufgedruckt „Garage“ stand. Die Konsequenz aus all dem war später deutlich sichtbar: Während ich im Studium noch alle möglichen Lernsysteme ausprobierte und ohne Orientierung schaffenden Repetitor wohl kaum durchgekommen wäre, war Klaus Eckler schon Wissenschaftler beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Familienspiele gab es bei uns übrigens nicht. Ab und zu kam die nach Hameln nachgeholte Oma väterlicherseits zum Mensch-Ärgere-Dich-Nicht und ließ mich, wie ich mit kindlicher Intelligenz schnell feststellte, absichtlich gewinnen; mein diesbezügliches Wissen behielt ich aber für mich. Sie ging regelmäßig mit mir zum Spielplatz und führte dort die Aufsicht über die anderen Kinder, denen sie im Fall einer ungebührlichen Annäherung Schläge mit dem Regenschirm androhte. So konnte ich den ein oder anderen von ihnen ärgern, ohne eine körperliche Reaktion befürchten zu müssen.
Mein Vater war häuslich. Er las gerne Zeitung und schaute die Sportschau. Er war am glücklichsten, wenn ich dabei still neben ihm saß. Ein Mann ohne Eigenschaften. Besonders missfiel mir die skurrile Art meines Vaters, anstehende Aufgaben mit Bleistift auf immer neuen kleinen Zetteln zu notieren, sie in Klarsichthüllen zusammenzuführen und mit ihnen am Wochenende den Wohnzimmertisch zuzupflastern. Das führte nicht zur Erledigung, sondern nur zur Verwaltung dieser Aufgaben. Vielleicht, nein: Ganz sicher, ist das ein Grund dafür, dass ich heute versuche, alle anstehenden Aufgaben noch am gleichen Tag abzuarbeiten.
Über handwerkliches Geschick verfügte mein Vater nicht. Sollte er ein Bild aufhängen und war es auch noch so klein, rückte er mit Bohrmaschine und Dübeln an. Waren die Herausforderungen komplizierter, hoffte er darauf, zufällig einen Fachmann kennenzulernen, zum Beispiel wenn der Nachbar einen Maler in sein Haus bestellt hatte. Während die Familie durchaus Geld für gutes Porzellan und Urlaube ausgab, war mein Vater in Angelegenheiten, mit denen er sich nicht auskannte, unerträglich sparsam. Als es darum ging, den ersten Plattenspieler in unserem Leben zu kaufen, ging er mit mir in die Metro, um dort den Verkäufer mit der Maximalangabe „70 Mark“ dazu zu bringen, uns das älteste Modell mit reiner Mechanik zu verkaufen, das er zuvor aus dem Lager geholt hatte.
Meine Mutter konnte oder wollte dazu kein Gegengewicht setzen. Je älter ich war, desto mehr wuchs bei mir daher der Wunsch, keine freie Zeit mit meinen Eltern zu verbringen. In den letzten fünf Schuljahren, die nach unserem Umzug nach Wilhelmshaven an der Humboldtschule (dem heutigen Gymnasium am Mühlenweg) stattfanden, schlug die Alleinbeschäftigung in eine intensive Nachmittags- und Abendtätigkeit um. Ich trat erst in die Schüler-Union und dann in die Junge Union ein, wurde 1974 ihr Pressesprecher, übernahm die Schriftleitung der von ihr herausgegebenen Jugendzeitung „Alternative“ und wurde später ihr Vorsitzender. Ich verließ das Haus morgens um halb acht und kam um elf Uhr abends zurück. Ich fieberte dem Abitur entgegen und damit der Möglichkeit, aus der Stadt an der Jade wegzuziehen, egal wohin. Die Vakanz des Jobs des Pressesprechers der Jungen Union Wilhelmshaven lag übrigens daran, dass mein Vorgänger als Spion der DDR aufflog, im Zusammenhang mit Günter Guillaume, dem Kanzler-Spion. Er spionierte natürlich nicht die Junge Union aus, sondern die Bundesmarine.
Parallel zu meiner Tätigkeit für die Jugendzeitung schrieb ich bereits Artikel und ganze Titelseiten für das örtliche Anzeigenblatt „Jade-Kurier“ und vermarktete die Junge Union, die sich zweimal wöchentlich zu Themen allgemeinen Interesses äußerte und in der Wilhelmshavener Zeitung erstaunlicherweise unzensiert Gehör fand – ob Jugendbezug oder nicht. Natürlich war ich klug genug, mir nicht einzubilden, ich sei nun bereits Journalist. Ich hatte eher die Not der Medien erkannt, denen es oft an Inhalten mangelte.
Neben meinen schreibenden Aktivitäten führte ich zusammen mit Kapitän Günter Marten (später Bundestags-Abgeordneter und Honorar-Konsul von Ungarn) eine Seminarreihe zum Thema „Kommunalpolitik im Planspiel“ durch. Außerdem kandidierte ich in einem Dreier-Team für das Amt des Schülersprechers und gewann; damit begann, begrenzt auf ein Jahr, eine Management-Tätigkeit, bei der es hauptsächlich um die vorzeitige Einführung der neuen Sekundarstufe II ging. Ich war Journalist, Dozent, Manager und im Nebenberuf Schüler – so hätte man es damals ausdrücken können.
TRUPPENZEITSCHRIFT HEER
Trotz aller Nebentätigkeiten schaffte ich das Abitur mit der Note 1,7; die Schulleitung befreite mich von der mündlichen Prüfung. Allerdings kam nun der 15 Monate dauernde Wehrdienst, der im Sommer des heißesten Jahres seit langem in der Wüste rund um Augustdorf begann. Die anderen Anrückenden waren allesamt sportlich und kräftig, ich war das Gegenteil. Es war eine Tortur.
Allerdings war ich, was ich längst wieder vergessen hatte, bei der Musterung nach besonderen Qualifikationen gefragt worden und hatte geantwortet, ich sei journalistisch tätig. In irgendeinem Wehrbereichsverwaltungscomputer muss diese Information gespeichert worden sein, denn einen Monat vor Ende der dreimonatigen Grundausbildung kommandierte mich die Bundeswehr von heute auf morgen nach Oldenburg in Oldenburg ab: „Sie werden dort Presseoffizier.“
Das war zwar weit übertrieben. Presseoffizier war Urban Ingenerf. Ich wurde im Mannschaftsdienstgrad „Gefreiter“ schreibender Mitarbeiter der Pressestelle der 11. Panzergrenadierdivision, mehr nicht. Aber für mich war diese Versetzung in die Clausewitz-Kaserne in Oldenburg-Ohmstede ein Segen. Das Grundtalent, schreiben zu können, und die bisher gewonnene Erfahrung führten dazu, dass ich mit der anstehenden Arbeit keine Probleme hatte. Zusammen mit Reiner Wrede, heute Fotograf in Fürth, und Holger Hollemann (BILD-Zeitung, später dpa) fuhr ich mit dem Kübelwagen zu Truppenteilen und machte für die Truppenzeitschrift HEER, ab und zu auch für „Bundeswehr aktuell“, Reportagen. Beispiele aus HEER:
„Mit Schirm, Charme und Weißbuch“ – Reportage über Oberleutnant Ulrich Loch, den Jugendoffizier der 11. Panzergrenadierdivision
„Wir verbinden alles“ – Reportage über das Fernmeldebataillon 11
„Viele Köche bereiten den Brei“ – Reportage über die 40 Köche der Bundeswehr am Standort Oldenburg
„Räder, Kräder, Brummerscheine“ – Reportage über die Ausbildung von Bundeswehrsoldaten am Fünf-Tonner
„Zivilist und Reservist“ – Über den Reservistenverband der Bundeswehr
„Zuuu-gleich“ – Reportage über die Arbeit der Pioniere
„Schwimmen lernen – retten können“ – Reportage über den DLRG-Stützpunkt Bundeswehr Leer
Manchmal, je mutiger wir wurden: fast immer, mussten wir auch Bilder aus der Luft machen und forderten daher einen Hubschrauber an. Der Beobachtungshubschrauber Alouette war wie für uns gemacht.
Ab und zu musste ich als Redakteur zum Umbruch in die Pressestelle des Ersten Korps in Münster reisen. Die war genau neben der Uni; so entstand der Wunsch, später in Münster zu studieren. Einziger Wermutstropfen einer ansonsten wirklich guten Zeit in Oldenburg war die Tatsache, dass bei Manövern und Übungen nur wenige Journalisten gebraucht wurden und ich daher dabei die einfachsten Routineaufgaben erfüllen musste, zum Beispiel als Späher auf einem Hochsitz sitzen und melden, wenn der Feind kommt.
Einmal nutzte ich dabei, aus Langeweile, eines der beiden überlassenen Funkgeräte und stellte darin mit einem Schraubendreher die Frequenz auf den Feindfunk um. So wurde ich auch zum Horcher und hielt den Befehlsstab mit Neuigkeiten aus dem anderen Übungslager auf dem Laufenden. Später erhielt ich dafür einen Bestpreis des Inspekteurs des Herres, ein Buch mit Theaterstücken von Carl Zuckmayer.
In der Oldenburger Zeit bekam ich eine Aufforderung eines gewissen „Hauptmann Becker“, mich bei ihm zu melden. Es stellte sich heraus, dass Hauptmann Becker, der nur ein Gebäude weiter sein Büro hatte, Mitglied der CDU war und auf Bundesparteitagen der CDU als Ordner arbeitete. Wir waren uns sympathisch und reisten fortan zu zweit an die jeweiligen Tagungsstätten. Die Arbeit war gut bezahlt und relativ einfach; nur sehr selten versuchte jemand, Zugang zu erhalten, der dazu nicht befugt war. Durch diese Tätigkeit, die wir beibehielten, als ich studierte, waren wir ganz nah dran an Persönlichkeiten wie Margaret Thatcher, Leo Tindemans, Helmut Kohl, Norbert Blüm und vielen anderen.
Die Zeit bei der Bundeswehr brachte es mit sich, dass man sehr kurzfristig zum Dienst, auch am Wochenende, verpflichtet wurde. Da ich nach wie vor in Wilhelmshaven wohnte, das eine Autostunde von Oldenburg entfernt lag, wäre es in der anderen Zeit leicht möglich gewesen, nach Hause zu fahren. Ich hatte aber noch keinen Führerschein. Mein Vater hatte darauf bestanden, dass wir zunächst auf einem Firmengelände das Autofahren üben. Doch nachdem ich das dritte Mal den Motor abgewürgt hatte, was zu Tiraden führte, beschloss ich, auf diesen Privatunterricht zu verzichten. Ich habe den Führerschein später im Eilverfahren gemacht, aber erst mit 27.
JOURNALISTISCHE NACHWUCHSFÖRDERUNG
Auf zum Jura-Studium! Allerdings begann es mit einem Schock: Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen teilte mir einen Studienplatz in Saarbrücken zu, 650 Kilometer von zu Hause entfernt. In meinem Studienfach Rechtswissenschaften gab es allerdings die Möglichkeit, sich im Zweiten Nachrückverfahren auf nicht in Anspruch genommene Studienplätze zu bewerben. Dabei bekam ich gleich drei Angebote und glücklicherweise war Münster dabei.
Der Nachteil war, dass das Semester schon begonnen hatte. Trotzdem fand ich, heute wohl undenkbar, noch ein Apartment mit Balkon am Horstmarer Landweg, mitten unter Sportstudenten. Und ich hatte noch einmal Glück. Bei dem Versuch, mich in der Uni zurechtzufinden, stieß ich auf einen weiteren Newcomer, Dietrich Wüsteney, der heute Fachanwalt für Arbeitsrecht in Bremerhaven ist. Wüsteney hatte alle Einführungsveranstaltungen besucht und auch schon seinen Belegbogen abgegeben, so dass er mich bei mehreren Gläsern Altbierbowle bestens briefen konnte, wie ich mich verhalten musste.
Das Jurastudium machte mir Spaß, mit Ausnahme des extrem schweren Kurses zur Betriebswirtschaftslehre. Allerdings litt ich unter einem Phänomen, das ich in einem Artikel mit dem Titel „Vom Konkurrenzkampf der Kommilitonen“ für DIE WELT beschrieb:
(…) Trotz Aufsicht in Bibliotheken und Seminaren gelingt es immer wieder, Bücher mitgehen zu lassen. Ebenso häufig werden wichtige Werke innerhalb der Bibliothek versteckt. So ist es keine Seltenheit, wenn Strafrechts-Lehrbücher zwischen Dictatus Papae und der Goldenen Bulle auftauchen. Karl-Heinz Millgramm, Fachschaft-Vertreter an der Universität Bochum: „Das Seminar ist von den Studenten so missbraucht worden, dass es sich an der Grenze der Unbrauchbarkeit befindet.“ Dieser Egoismus einiger weniger greift zunehmend auf die Masse über. In München beobachtete ein Assistent, dass Dutzende von Kommilitonen an die 25 Bücher auf ihrem Platz stapeln und so der allgemeinen Verfügung entziehen. Hauptsache scheint zu sein, sich selbst die Informationen gesichert zu haben; andere können sehen, wo sie bleiben. Dass Seiten in Zeitschriftenbänden fehlen ist schon längst beklagenswerter Brauch; anstatt zu fotokopieren (die Seite zu 10 Pfennig) reißt man den Aufsatz heraus. (…)
Besonders spannend fand ich die Vorlesungen des Zivilrechtlers Helmut Kollhosser. Unvergessen sind seine ersten beiden Fallübungen, die er mit großem Genuss vortrug. In einem Fall ging es darum, dass ein Westfale in Köln einen Halven Hahn bestellt, aber kein Geflügel serviert bekommt. Im anderen Fall orderte ein Tourist sechs Flaschen Oppenheimer Krötenbrunnen (lieblich), erhielt aber in gleicher Menge Oppenheimer Sackträger (trocken).
Kollhosser war kurz darauf einer von mehreren Gutachtern, die mir den Weg für ein Stipendium bei der Konrad-Adenauer-Stiftung ebneten. Die anderen waren Professor Hartmut Schiedermair und Franz-Josef Nordlohne (CDU), der für den Ort Lohne im Deutschen Bundestag saß. Dieses Stipendium bekam ich pünktlich zum zweiten Semester.
Ich erinnere mich noch gut an die dreitägige Prüfung, die in der Akademie Schloss Eichholz bei Bonn stattfand. Ein Selbstläufer war das nicht; neben einem IQ-Test standen zahlreiche schriftliche Aufgaben, Diskussionen und eine mündliche Prüfung auf dem Programm. Dabei hatte ich ziemliches Glück. Ich war aus einer Gruppe von sechs Prüflingen der vierte oder fünfte. Diejenigen, die vor mir dran waren, kehrten alle mit besorgtem Gesicht in den Kreis zurück. Mir wäre es wohl ähnlich gegangen, denn im Prüfungszimmer im ersten Stock – dem Büro des damaligen Direktors des Instituts, Bernhard Gebauer – hingen Fotos von vier Persönlichkeiten aus dem Stiftungsleben oder aus der CDU oder aus dem Umfeld Adenauers, ich weiß es bis heute nicht. Wer denn das sei, lautete die erste Frage Gebauers.
Das war eine Katastrophe, denn ich kannte keinen der vier Männer. Doch ein zweiter Prüfer, Wolfgang von Geldern, MdB, schob nach: „Oder erzählt man unten, dass wir das fragen?“ Ich antwortete: „Ehrlich gesagt erzählt man das unten“. Daraufhin meinten die Prüfer, dann bräuchten sie die Frage ja nicht mehr zu stellen. Nicht auszudenken, wenn sie anders reagiert hätten. Dann wäre ich der Depp gewesen, der historisch unbewandert ist und, noch schlimmer, sich nicht mal eine halbe Stunde lang Namen merken kann.
Das Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung war auch insofern ein Glücksfall, als ich nach kurzer Zeit hörte, dass man dort ein Institut zur Förderung des journalistischen Nachwuchses gegründet hatte. Es gab also die Gesamtheit der Stipendiaten, die im Rahmen der „Begabtenförderung“ ein allgemeines Seminarprogramm angeboten bekamen, und eine Untergesamtheit journalistisch interessierter Stipendiaten, die ein spezielles Angebot erhielten. Ansprechpartner war Hartmut Hentschel, der später in Argentinien das Meinungsforschungsinstitut Demoskopia gründete. Ich kontaktierte ihn; er nahm mich sofort ohne Formalitäten als ersten Stipendiaten in die Journalistenförderung auf.
Hintergrund war der Eindruck der CDU/CSU, dass die Medien, besonders die öffentlich-rechtlichen Anstalten, sie bei der Berichterstattung und Kommentierung benachteiligen. Ein CDU-Medienreferent, Wolfgang Fischer (später Geschäftsführer von Studio Hamburg), hatte das in einem Papier zum Ausdruck gebracht und Gegenstrategien gefordert. Eine dieser Gegenstrategien war es, eigene Journalisten auszubilden. Das ist rückwirkend betrachtet mit der Journalistischen Nachwuchsförderung der Adenauer-Stiftung, die es bis heute gibt, auch gelungen. Fast alle Teilnehmer des Programms sind später in den Medien gelandet.
Die Ausbildung bei der Adenauer-Stiftung war umfassend und deckte auch die Medien Hörfunk und Fernsehen ab. Wir besuchten Seminare in den Sendern, sprachen mit Radio- und Fernsehmachern und bekamen so einiges vom Geschehen in den elektronischen Medien mit. Eines Tages lud mich die Stiftung sehr kurzfristig telefonisch zu einem einwöchigen Seminar nach Schloss Eichholz ein. „Da geht es darum, humorvolle Dinge zu schreiben, von der Glosse bis zum Liedtext. Das wäre doch was für Sie.“ Ich packte meinen Koffer und fuhr los. Zwei Tage später saßen zehn ausgewählte Stipendiaten der Journalistenförderung morgens um neun in einem Seminarraum. Die Tür ging auf. Herein kam der Direktor der Akademie zusammen mit Hans Rosenthal, Curth Flatow, Horst Pillau und Heinrich Riethmüller. Diese vier sollten uns eine ganze Woche lang begleiten, ihre Erfahrungen weitergeben und unsere Arbeiten begutachten. Wir konnten das nicht glauben. Es war ein Traum. Natürlich war dieses Seminar nirgendwo ausgeschrieben; es hätte Hunderte von Bewerbungen gegeben.
Wer Hans Rosenthal war, dürfte heute noch allgemein bekannt sein. Wer aber waren die anderen drei? Curth Flatow war Deutschlands erfolgreichster Komödien-Autor. Zu seinen größten Erfolgen zählten Das Fenster zum Flur (1960), Vater einer Tochter (1966) und Der Mann, der sich nicht traut (1973). Seine Boulevardkomödie Das Geld liegt auf der Bank (1968) brachte es am Berliner Hebbel-Theater auf über 500 Aufführungen. Neben seiner Theaterarbeit war er seit 1950 im Filmbereich und für Rundfunk und Fernsehen aktiv. Aus seinem Roman Ich heirate eine Familie entstand die gleichnamige Fernsehserie mit Thekla Carola Wied und Peter Weck im ZDF. Flatow verarbeitete darin autobiografische Elemente, da er selbst eine Mutter mit mehreren Kindern geheiratet hatte.
Horst Pillau war ein ebenso erfolgreicher Autor von Theaterstücken, Sketchen und Drehbüchern wie Theodor Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg und Simmels Es muss nicht immer Kaviar sein. Viele Stücke des Ohnsorg-Theaters sind von ihm. Auch fürs Fernsehen schrieb er häufig, beispielsweise für die Zirkus-Serie Salto Mortale.
Heinrich Riethmüller war seit vielen Jahren musikalischer Begleiter von Hans Rosenthal und trat live bei „Dali, Dalli“ auf. Auch die beiden Autoren waren mit Hans Rosenthal eng befreundet und lieferten oft Texte für „Dalli Dalli“ zu. Die Idee zu der außergewöhnlichen Journalistenförderung hatte wohl Rosenthal, der für seinen Arbeitgeber, den Sender RIAS, permanent auf Nachwuchssuche war.
Eine der Arbeiten, die ich in dieser Woche erstellte, war ein Couplet. Ich bin wahrscheinlich der einzige Stipendiat, der gelernt hat, etwas in dieser Stilform zu verfassen. Couplets sind meist gesellschaftskritisch; sie behandeln Themen mit spöttischer Distanz. Anders als beim Chanson, bei dem Erleben und Stimmungen im Vordergrund stehen, sind Couplets eher fröhlich und rhythmisch. Der Refrain hat das Zeug zum Gassenhauer. Mein Couplet hatte den Refrain „Wir ham durchgehend geöffnet, wir sind immer für Sie da.“ Das spielte auf das (West-) Berlin der damaligen Zeit an, das keine Sperrstunde kannte. Die Strophen erzählen allerdings Vorkommnisse, die nicht so erfreulich waren. Kurz zuvor hatte es dort viele Gefängnisausbrüche gegeben. Addieren Sie zu dieser Information den Refrain und Sie ahnen, wie ironisch das „durchgehend geöffnet“ in diesem Fall gemeint war.
Mein zweites Stück war ein fiktives satirisches Interview mit dem damaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Heinz Kühn. Er war dafür bekannt, dass er dauernd unterwegs war und man mit ihm allenfalls am Flughafen sprechen konnte. In dem Interview verwechselt Kühn afrikanische Staatsmänner mit deutschen Ministern und macht auch sonst den Eindruck, mit NRW nicht viel zu tun zu haben. Zu dieser Zeit ahnte man nicht, dass einen die (amerikanische) Realität in Sachen „wirrer Regierungschef“ einmal einholen würde.
Ich habe von diesem Seminar erheblich profitiert. Ab und zu konnte ich später Lerninhalte aus dem Genre Satire nutzen. Ein Beispiel aus dem Jahr 2015, in dem ich den damaligen Oberbürgermeister der Stadt Landsberg, Mathias Neuner, in einer Satire des landsbergblog so adressierte:
Erkenne die Möglichkeiten
Hej Mathias, dem Artikel "Kein neuer Schreibtisch für den OB" aus dem Landsberger Tagblatt haben wir entnommen, dass der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Stadtrats den Kauf neuer Möbel für dein Büro abgelehnt hat, um 12.000 Euro einzusparen. Nur du warst für die Anschaffung, alle anderen waren dagegen.
Wir in Schweden sagen bei solchen Vorkommnissen: Ryck upp dygg! Lass den Kopf nicht hängen, tiden läker alla sår - die Zeit heilt alle Wunden. Bei IKEA verkaufen wir dir Möbel zu Preisen, gegen die auch dein Finanzausschuss nichts einwenden kann. Komm einfach mal bei uns in Augsburg vorbei!
Besonders beliebt ist zum Beispiel unser höhenverstellbares Schreibtischsystem GALANT, aus dem du Schreib- und Konferenztische zusammenstellen kannst. Eine komplette Ausstattung für dein Büro kostet dich nur 397 Euro. Da reicht das Budget locker noch für den Aktenschrank HEIMNIS mit Nummernschloss zum Preis von 139 Euro und den drehbaren Bürostuhl VORSITZ für 199 Euro mit Zurücklehnfunktion.
Auf diese Möbel gewähren wir zehn Jahre Garantie. Wenn etwas kaputt geht, musst du also nicht wieder in den Ausschuss zurück. Auch wenn du mal auf den Tisch haust. Also, Mathias, entdecke die Möglichkeiten!
In der Markthalle, auf dem Weg zur Kasse (nur Barzahlung und EC-Karte) kannst Du dann noch jede Menge Kleinigkeiten mitnehmen, die Dein Büro noch schöner machen. Heb den Kaufbeleg gut auf und erzähle in der nächsten Sitzung des Finanzausschusses, wieviel du gespart hast. Denn som söker han finner, sagen wir bei IKEA, wer suchet, der findet. Dein IKEA Einrichtungshaus Augsburg
Nach dem Seminar in der Akademie Eichholz erschien in der WELT dieser Artikel vom späteren Chef der BUNTEN, Hans-Hermann Tiedje:
Rosenthal: dem Fernsehen fehlen Ideen
Wenn es private Rundfunkstationen gäbe, bekämen wir in der Bundesrepublik mehr Showmaster von Format. Diese Überzeugung äußerte Deutschlands populärster Showmaster Hans Rosenthal am Wochenende auf einer Tagung der Konrad Adenauer Stiftung in der Politischen Akademie Eichholz.
Rosenthal hält es nicht für einen Zufall, dass beispielsweise der Großteil des Moderatoren-Nachwuchses im deutschen Fernsehen sich seine Sporen bei Radio Luxemburg oder den populären Programmen der Europawelle Saar verdient hat. Moderatoren wie Helga Guitton, Frank Elstner, Jochen Pützenbacher, Rainer Holbe und Dieter Thomas Heck säßen täglich am Hörfunkmikrofon; im Umgang mit den elektronischen Medien erreichten sie so eine Sicherheit und Professionalität, die sie den Gelegenheits-Moderatoren der Television voraus hätten.
Bei der Tagung in Eichholz – sie wurde veranstaltet für Nachwuchsautoren – ging es um „Ziele und Methoden der Unterhaltung in Hörfunk und Fernsehen“. Außer Rosenthal referierten Heinrich Riethmüller, der meistgespielte deutsche Bühnenautor Curth Flatow und Horst Pillau, einer der meistbeschäftigten Fernsehautoren. Dabei war man sich schnell darüber einig, dass auf keinem Programmsektor leichter manipuliert werden könne als auf jenem der Unterhaltung.
Die politische Unterhaltung, so wurde festgestellt, sei derzeit von weit links angesiedelten Schreibern fest okkupiert. Eine kritische Unterhaltungssendung anderer Couleur fehle völlig. So konnte Hans Rosenthal fragen: „Wo ist denn der Satiriker, der am Beispiel des Krieges zwischen Kambodscha und Vietnam die sozialistische Utopie aufzeigt? Selbst wenn die ganze Welt sozialistisch wäre, es würde doch Kriege geben.“ Die Kriege würde es wohl geben. Den Satiriker gibt es nicht.
Rosenthal erinnerte in Eichholz auch an die Tatsache, dass auf dem westdeutschen Unterhaltungssektor, wenn Auseinandersetzung mit den Verhältnissen im Ostblock oder auch nur in Mitteldeutschland nicht stattfindet, dagegen verstehe die DDR ihren Unterhaltungssendungen wie selbstverständlich als massiven Transportriemen für Propaganda. Das geradezu groteske Ungleichgewicht habe den Programmen des Westdeutschen Werbefernsehens unbeabsichtigt zusätzliche Funktionen übertragen. Sie sind laut Rosenthal echte Politik, nämlich ein enormes Propagandamittel für die freiheitliche westliche Gesellschaftsform.
Der Showmaster sprach sich, wie auch Flatow und Pillau, für ein Kabarett der Mitte aus, dass eines Tages im deutschen Fernsehen wieder Platz haben müsse. Pillau: Wir hatten bis etwa 1975 eine Zeit, als vom Fernsehen fast durchweg sogenannte harte, kritische, relevante Fernsehspiel-Stoffe gefragt waren. Jetzt sind auch wieder romantische Stoffe möglich. Freilich benötige man dringend Autoren mit Ideen: „Ideen sind kostbar, Ideen sind gewerkschaftsfeindlich.“ Hans Rosenthal wurde noch deutlicher: „Wenn ein tüchtiger freier Mitarbeiter im Funk festangestellt ist, dann ist der praktisch schon alle Ideen los.“
Im gleichen Jahr entstand für mich neben dem Stipendium noch ein zweiter Zugang zu den Medien. 1978 etablierten ARD und ZDF mit den Tagesthemen und dem heute-journal eine damals neue Art der Berichterstattung. Bislang hatte es in Nachrichtensendungen vor allem Meldungen und O-Töne gegeben. Mit O-Tönen sind Zitate etwa aus einer Bundestagsdebatte gemeint, manchmal aber auch fürs Fernsehen aufgenommene Statements von Politikern, die dabei direkt in die Kamera schauten. Erstmals kommentierten beide Magazine Ereignisse auf Tagesbasis; bisher gab es Kommentare und Features nur einmal pro Woche in Report oder Panorama. Ziel war es, jeden Tag von Neuem Zusammenhänge herzustellen, Hintergründe zu erläutern und strategische Motive zu verdeutlichen. Das war so revolutionär, dass die ganze Republik auf die Wirkung dieser Innovation gespannt war.
Damals schrieb ich einen Brief an die Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn und bot ihr an, mit einer Gruppe der Jungen Union beide Sendungen eine Zeit lang regelmäßig anzusehen und anschließend unsere Meinung dazu auf der Medienseite der Zeitschrift „Das Parlament“ zu veröffentlichen. Ich wusste: Es war eines der Konzepte der Bundeszentrale, gesellschaftlich relevante Gruppen selbst sprechen zu lassen. Pluralität war für sie nicht Binnenpluralität (alle Meinungen kommen in einem Artikel vor), sondern Außenpluralität (jeder äußert seine Meinung und aus allen zusammen entsteht ein gesamtes Bild).
Ich bekam umgehend eine telefonische Rückmeldung. Zwar konnte die Bundeszentrale, vertreten durch Christian Longolius, Angelika Jaenicke und Heino Gröf, mit meinem Vorschlag nichts anfangen. Aber zufällig suchten sie die Basis einer gesellschaftlich-relevanten Gruppe, die zusammen mit Medienpädagogen die von der Gruppenorganisation (hier der CDU) entsandten Rundfunkräte in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten daraufhin überprüft, ob und wie sie die Interesse „ihrer“ Gruppe eigentlich vertreten. Der Verdacht war: Da findet gar keine Rückkopplung statt, von Vertretung kann keine Rede sein, die Herrschaften haben das Repräsentationsprinzip als Basis ihres Mandats längst vergessen.
Diese Aufgabe nahm ich gerne an und stellte aus der Jungen Union Wilhelmshaven heraus eine solche Gruppe zusammen. Dabei war übrigens auch Ulrich G. Stoll, der seit 2001 Reporter des ZDF-Magazins Frontal 21 ist. Zwei Medienpädagogen der Universität Hamburg, Professor Jörg Hennig und seine wissenschaftliche Mitarbeiterin Marita Tjarks-Sobhani, machten sich viele Male auf den Weg nach Wilhelmshaven, um uns zunächst in mühevollen Sitzungen ausarbeiten zu lassen, was denn überhaupt unsere Interessen sind, die die Fernsehräte vertreten sollen. Dabei ging es vor allem darum, nicht sprachlos zu sein, wenn die Befragten sich auf das Prinzip der Interessenvertretung einlassen würden.
Unsere Gesprächspartner waren dann Erik Bettermann (ZDF, Bundesjugendring), Bruno Brandes (NDR, MdL, CDU), Dr. Franz Cromme (NDR, CDU), Prof. Dr. Eberhard Dall’Asta (NDR, MdL, CDU), Jürgen Echternach (NDR, MdBü, CDU), Prof. Dr. Hans H. Klein (ZDF, MdB, CDU), Herrmann Kroll-Schlüter (ZDF, MdB, CDU), Annemarie Mevissen (RB, Frauenausschuss), Hans Schäfer (ZDF, Erziehung und Bildung), Dr. Christian Schwarz-Schilling (ZDF, MdB, CDU), Moritz Thape (RB, Senat), Dr. Horst Waffenschmidt (ZDF, Deutscher Städtebund) und Dieter Weirich (HR, CDU, MdL). Die erste Angabe sagt aus, in welchem Sender die jeweilige Person Gremienmitglied war. Die zweite Angabe kennzeichnet, aufgrund welcher Eigenschaft das Mandat bestand, zum Beispiel als Vertreter des Senats oder des Städtebundes. In vielen Fällen war die Entsendung als Vertreter von Parteien erfolgt. Dass wir Vertreter der CDU befragten, lag am Projektansatz: Wir waren Mitglieder der Jungen Union und wir wollten wissen, inwieweit unsere Mitglieder uns vertreten.
Tatsächlich akzeptierten die meisten, dem Gremium nicht losgelöst von der Basis anzugehören, sondern quasi „im Auftrag“. Allerdings hatte wohl noch niemand versucht, das geltend zu machen. Andere Gremienmitglieder lehnten die Fragestellung dagegen komplett ab. Sie glaubten, sie seien als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gewählt, wegen ihrer Kompetenz. So war es aber nicht.
Das Projekt „Rundfunkräte auf dem Prüfstand“, über das es auch ein Buch in der Schriftenreihe der Bundeszentrale gibt, hat sicher nicht viel bewirkt; soweit ersichtlich, ist es eher in die Fußnoten der Literatur zur Verfasstheit des öffentlichrechtlichen Rundfunks eingegangen. Es war aber eine spannende Zeit; sie führte uns ganz nach oben in die Anstalten, zu denen wir ein Stück Distanz abbauen konnten. Außerdem schoben die Medienpädagogen immer mal wieder Motivationseinheiten ein, etwa einen Besuch bei der Tagesschau.
Angenehm waren auch die Besuche bei der Bundeszentrale selbst. Dort gab es eine kleine Bücherei, in der man Werke aus dem Handel zu politischen Themen umsonst bekommen konnte. Fast jeder Besuch endete in diesem Raum. Ich erinnere mich daran, dass Heino Gröf mir einmal Buch für Buch anreichte, bis ich den Stapel kaum noch halten konnte. Das wäre noch so weitergegangen, wäre nicht plötzlich Franklin Schultheiß erschienen, der Direktor der Bundeszentrale für politische Bildung, der uns mit den Worten „Heino, bist Du verrückt geworden“ aus dem Zimmer wies. Glücklicherweise gelang es mir, den bis dato erbeuteten Stapel heraus zu balancieren, ohne die wertvolle Fracht fallen zu lassen. Dann wäre die Wut wohl noch größer gewesen.
Zu meinen Besuchen in Bonn gehörten auch Stippvisiten im Langen Eugen, wo ich unter anderem Norbert Sklorz besuchte, den wissenschaftlichen Mitarbeiter von Professor Hans Hugo Klein. Sklorz war mir bei der Organisation des Interviews mit seinem Chef im Rahmen des Projekts behilflich, das dann andere Mitglieder der Gruppe führten. Solche Besuche waren für mich hochinteressant, weil man als Journalist, vor allem als junger und angehender Journalist, gar nicht genug Atmosphäre tanken kann.
Zu Jörg Hennig und Marita Tjarks-Sobhani hatte ich im Jahr 2001 noch einmal Kontakt. Hennig bat mich, den Festvortrag zu seinem 60. Geburtstag zu halten. Das empfand ich als große Ehre. Dass Juristen Germanisten irgendetwas Brauchbares vortragen, ist aus Germanistensicht ja nicht selbstverständlich. Es gelang aber und wir hatten viel Spaß.
Verehrte Anwesende,
am Anfang stand ein raffinierter Plan. Vor mehr als 20 Jahren wollten Christian Longolius und Angelika Jaenicke von der Bundeszentrale für politische Bildung nachweisen, dass das Repräsentationsmodell, das den Gremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zugrunde liegt, nicht funktioniert. Sie waren überzeugt, dass die Vertreter der gesellschaftlichrelevanten Gruppen nicht die Interessen ihrer Mitglieder vertreten, sondern, wenn überhaupt welche, dann nur ihre eigenen.
Wie weist man als staatliche Behörde so etwas nach, ohne sich aus der Deckung der Beamtenbesoldung zu begeben? Nun, man finanziert ein Forschungsprojekt und ermutigt die Basis dieser gesellschaftlich-relevanten Organisationen, "ihre" Gremienmitglieder einfach mal überraschend aufzusuchen. Damit war der Eklat vorprogrammiert. Man stelle sich das einmal vor: Da kommen so ein paar Leute hereingeschneit und sagen: "Guten Tag. Sie sind unser Vertreter im ZDF-Fernsehrat, was tun Sie denn da für uns?" Sie können sich die Überraschung vorstellen: Das ist etwa so, als wenn plötzlich ein gänzlich unbekannter junger Mann vor Ihnen steht - und "Hallo Papa!" sagt.
Eine dieser Gruppen waren wir; das war die Junge Union Wilhelmshaven. Um unseren jugendlichen und stark auf Weltverbesserung ausgerichteten Eifer zu kanalisieren, schickte man uns die mit wissenschaftlicher Gründlichkeit gesegneten Pädagogen Jörg Hennig und Marita Tjarks. Die beiden pilgerten nun alle zwei Wochen ins Oldenburgische und verbrachten halbe Wochenenden mit uns im Jugendheim Kirchreihe zwischen Cola-Dosen und Dartbrettern.
Das Ergebnis - Sie können es in Jörg Hennigs Buch "Rundfunkräte auf dem Prüfstand" aus dem Jahr 1981 nachlesen - das Ergebnis war, wie erwartet, niederschmetternd. Die meisten Mitglieder der Rundfunkräte hatten längst vergessen, dass sie die Interessen ihrer Gruppen vertreten sollten. Sie fühlten sich als Honoratioren, als Geehrte, als im Wege der Belohnung mit einem Amt Bedachte. Und sie sonnten sich im Licht des Intendanten, genossen die Buffets am Lerchenberg und freuten sich über die kostenlos von der Anstalt ins Haus gebrachten Fernseher. Sie fühlten sich so frei und entspannt wie ein in die Südsee entsandter Botschafter, den man dort vergessen hat, weil seine Personalunterlagen im Auswärtigen Amt verloren gingen. (…)
JOURNALISTENAUSBILDUNG IN PARIS
Die Projektarbeit mit der Bundeszentrale fand in den ersten vier Semestern meines Studiums der Rechtswissenschaften an der Uni Münster statt. Das Studium selbst betrieb ich mit großem Eifer; nach vier Semestern hatte ich acht Scheine. In den Semesterferien zog es mich immer wieder nach Frankreich, unter anderem quer durchs Land mit dem SNCF-Bahnticket „France Vacances“. Für 283 DM konnten Deutsche damals 15 Tage lang alle Strecken kostenlos nutzen. Enthalten war auch ein siebentägiger Freifahrtschein für die Pariser Métro. Von einer solchen Reise liegt mir noch die Planung vor. Meine Stationen waren Marseille, Toulon, Cannes, Monaco, Arles, Aix-en-Provence, Barcelona, Toulouse, Biarritz, Bayonne, Bordeaux und Paris.
Apropos: Bei einem Paris-Aufenthalt kam ich zufällig im zweiten Arrondissement an der Adresse 33, Rue du Louvre, am CFPJ vorbei, dem „Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes“. Ich ging hinein und erkundigte mich nach den Lehrinhalten. Das CFPJ hatte ein Programm unter dem Titel „Journalistes en Europe“, bei dem acht angehende Journalisten aus mehreren Kontinenten gemeinsam Themen der französischen Politik und Wirtschaft betrachteten und daraus, in französischer Sprache, Artikel für eine vor allem in Medienkreisen verbreiteten Vierteljahreszeitschrift machten.
Das gefiel mir und ich machte gleich auf dem Rückweg in Sankt Augustin halt, dem Sitz der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hartmut Hentschel fand die Idee gut und sagte zu, die Kursgebühren im fünfstelligen DM-Bereich zu übernehmen; außerdem verdoppelte er das „Büchergeld“. So kam es, dass ich mein Apartment in Münster aufgab und für ein Jahr nach Paris wechselte. Hentschel hatte mir empfohlen, parallel einen Sprachkurs an der Sprachschule „Alliance Francaise“ zu machen, wo man auch Zimmer vermittele.
Das erwies sich bei Ankunft in der französischen Hauptstadt zwar als falsch. Allerdings sagte mir die Sekretärin, die meine Einschreibung entgegennahm, ihre Mutter hätte gerade ein Zimmer frei, Madame Metoyer, 11, Rue d’Assas. Tatsächlich wurde das für die nächsten zwölf Monate mein neues Domizil. Ich habe es als helles großes Zimmer in Erinnerung mit einer kleinen Kammer für alles, was man nicht sehen sollte. Die Waschgelegenheit war ein rudimentäres Cabinet Toilette; eine Dusche hatte die Wohnung nicht. Wäsche konnte man allenfalls auf dem Gasherd in der Küche waschen. Dafür war die Miete erschwinglich.
Der tägliche Unterricht an der Alliance Française war allerdings nicht zielführend, weil Schülerinnen und Schüler aus vielen Ländern in einer Gruppe waren und komplett unterschiedliche Vorbildungen hatten. Das betraf auch das Lernen selbst. Als am dritten Tag das Wort „porter“ zum vierten Mal konjugiert werden sollte und die Wortfolge bei „nous portons“ schon wieder stockte, verließ ich den Kurs und machte mich selbst sprachlich fit, indem ich eine Zeitung nach der anderen las, fast jeden Abend ins Kino ging (eine Karte kostete rund 3,30 DM) und jedes Schild, auf das ich stieß, übersetzte.
Man muss sich noch einmal in diese Zeit zurückversetzen. Außerhalb von Frankreich war es praktisch unmöglich, Aktuelles und Triviales in französischer Sprache zu sehen, zu hören oder zu lesen. Es gab noch kein Satellitenfernsehen, also auch kein nach außen gerichtetes Programm wie TV5 Monde. Im Radio konnte man allenfalls auf Kurzwelle Sendungen in französischer Sprache hören, mit Glück aus Frankreich, meist aus Algerien oder der Elfenbeinküste. Zeitungen brauchten lange und waren teuer, wenn sie in Deutschland ankamen. Und natürlich gab es noch kein Internet. Das führte dazu, dass ich beschloss, nach meinem Aufenthalt in Paris nach Saarbrücken weiterzuziehen, um an der Universität des Saarlandes (die ich zunächst verschmäht hatte) zu studieren und mich auf eine Tätigkeit als Korrespondent in Frankreich vorzubereiten. Dazu musste ich mir einen Omniband-Fernsehempfänger kaufen, der mir erlaubte, gleichzeitig deutsches und französisches Fernsehen über Antenne zu empfangen – in schwarzweiß übrigens.
Später habe ich den Berufswunsch „Korrespondent in Frankreich“ der besseren Verständlichkeit wegen zu „Nachfolger von Ulrich Wickert“ verdichtet. Wickert war allerdings damals noch gar nicht Frankreich-Korrespondent der ARD; das war Heiko Engelkes, der mir in meiner Pariser Zeit immer mal wieder über den Weg lief. Einem größeren Fernsehpublikum blieb Engelkes durch einen Wutausbruch im Gedächtnis. Am Abend, als Valéry Giscard d’Estaing abgewählt wurde, versäumte es die Tagesschau, rechtzeitig zur ersten Hochrechnung nach Paris umzuschalten. Obwohl er pausenlos „Hamburg, Hamburg“ in die Leitung rief, konnte er die Prognose und die Reaktionen darauf nur wutentbrannt nacherzählen. Heiko Engelkes war 17 Jahre lang Studioleiter in Paris und blieb auch nach seinem Ausscheiden dort. 1987 ernannte ihn der Staatspräsident zum Ritter der Ehrenlegion.
Die Tätigkeit der Auslandskorrespondenten bestand vor allem darin, die Abendnachrichten, die in Frankreich eine Institution waren und gefühlt eine Dreiviertelstunde dauerten, zu beobachten und daraus Themenvorschläge für die Heimatredaktion zu entwickeln. Am nächsten Morgen stellte man sich dann an irgendeine Straßenecke und machte einen Aufsager nach dem Muster: „Die Menschen in Frankreich sind besorgt.“ Nach einer Minute und 30 Sekunden war die Sache im Kasten und den Rest des Tages konnte man sich diversen kulturellen und politischen Einladungen widmen. Oder selbst jemanden zum Essen einladen, zu einem der vielen Hintergrundgespräche.
Dann startete das Programm „Journalistes en Europe“ des CFPJ. Den Kickoff gab es standesgemäß bei einer Bouillabaisse „Chez Fonfon“ am „Vallon des Auffes“ in Marseille. Unvergesslich! Jeder bekam ein paar Tage Zeit, sich ein Thema zu suchen. Ich entdeckte meines auf der eigentlich unbewohnten Insel Frioul, wo man Wohnungs-Investoren versprochen hatte, neben teuren Wohnungen, die sie bereits bezahlt hatten, Schulen, Kindergärten, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten zu errichten, aber insoweit nichts geschah. Einer der Wohnungsbesitzer war der deutsche Generalkonsul, Maitre (gleich Rechtsanwalt) Walter Pauly, den ich in seinem Büro aufsuchte.
Weitere Recherchen zeigten dann, dass die Stadtverwaltung daran eine Portion Mitschuld trug. Der Bürgermeister der Stadt, Gaston Defferre, Mitglied der Parti Socialiste (PS), war damals gleichzeitig Innenminister der Französischen Republik, was die Sache ein Stück brisanter machte. Als ich das „Go“ für die Geschichte bekam, war mir klar, dass sie gut werden musste, weil sie ansonsten keine Gnade vor den kritischen Augen der Institutsleitung finden würde. Tatsächlich machte man den Versuch, sie abzulehnen; die anderen Journalisten der Gruppe gaben aber dezent zu verstehen, dass das Blatt ohne meinen Beitrag keinen einzigen Artikel enthalten würde. So wurde ich Bestandteil einer Kontinent-umspannenden Solidaritätsaktion und die Geschichte erschien – unter dem Titel „Le Scandale de Frioul – Rien ne va plus“.
L’échec du projet de l’aménagement des iles du Frioul concerne à la fois la Mairie, les partis politiques et un promoteur marseillais. Après dix années d’euphorie, le « projet du siècle » est arrêté. Les pertes sont importantes, le site de l’archipel est atteint. Les habitants du Frioul s’estiment victimes du « jeu politique ».
Wir reisten aber nicht nur in Frankreich herum. Die Institutsleitung ordnete uns auch Pariser Journalisten zu. Bei mir hielt man die Tageszeitung „Le Monde“ für angemessen. Vielleicht lag es daran, dass ich jeden Tag ein Exemplar von Le Monde sichtbar unter den Arm geklemmt hatte. Das war, unter uns, eher ein Trick, um in Paris nicht bestohlen zu werden: „Me no tourist, me live here“. Aber natürlich schaute ich jeden Tag auch in die Zeitung hinein, die übrigens am Mittag erschien. Aber das meiste war dann doch für einen Ausländer schwer verständlich. Das liegt auch daran, dass die Franzosen gerne Aliasse verwenden, indem sie beispielsweise den Justizminister als Garde des Sceaux (Siegelbewahrer) bezeichnen oder das Kanzleramt als „Hotel Matignon“. Außerdem lieben Franzosen Abkürzungen wie S.M.I.C. (Mindestlohn) und Gesetzesbezeichnungen nach Namen wie „Loi Toubon“. Das ist alles überwindbar, erschwert die Sache aber. Man bräuchte ein Gebrauchslexikon der französischen Politik, das es soweit ersichtlich nicht gibt.
Der Insider-Blick, den mir das CFPJ in die Redaktionsräume von Le Monde gewährte, erklärte ein Stück, was da geschah: Hier schrieben Eingeweihte für Eingeweihte und man schrieb in Eingeweihten-Sprache. Zudem gab es enge Zuständigkeiten. Der Journalist, der mich betreuen sollte, befasste sich nur mit der inneren Organisation der Gewerkschaften CGT und CFDT. Wenn sich dort etwas tat, Wahlen zum Beispiel oder ein neues Programm, lief er zu Hochform auf und erhielt Platz im Blatt. Führte die CGT aber Verhandlungen über einen Tarifvertrag, war jemand anderes zuständig.
Da wunderte es nicht, dass mir „mein“ Journalist am ersten Tag einen ganzen Stapel von Kopien in die Hand drückte und mich aufforderte: „Lesen Sie das!“ Ich zeigte das Konvolut meinen Ausbildern des CFPJ, die die Unterlagen in den Papierkorb warfen, mich von Le Monde zurückholten und mir die Tür zum Radiosender Europe 1 öffneten.
Europe 1 war eigentlich ein französischsprachiger Piratensender für das Saarland, das ja mal französisch war. Er strahlte sein Programm mit kräftigen 1.000-Kilowatt-Anlagen auf der Langwelle aus, was für einen Empfang in ganz Europa ausreichte. An Stereo-Sound und Schallplatten-Qualität war bei dieser Übertragungsart nicht zu denken. Trotzdem war der Sender, der sein Studio von Anfang an in der französischen Hauptstadt hatte, auch bei Parisern enorm beliebt, vielleicht gerade, weil er sich mit vielen munteren Wortbeiträgen und anschaulichen Reportagen von anderen privaten Radiosendern wie RTL oder Radio Monte Carlo unterschied und erst recht von den langweiligen staatlichen Sendern.
Der Journalist, mit dem ich ein Tandem bilden sollte, war Michel Moineau. Er war jeden Tag von Montag bis Freitag auf Sendung, immer um die Mittagszeit herum. Er war der Börsenjournalist des Senders und berichtete über den Parketthandel, der pünktlich um 12:00 Uhr endete. Also fuhr er gegen 11:30 Uhr mit einem kleinen Übertragungswagen auf den Vorplatz der Börse. Er verließ das Auto kurz, studierte drinnen die große Anzeigetafel, befragte den ein oder anderen Händler, kehrte zu seinem Auto zurück und funkte von dort aus seinen etwa zweiminütigen Börsenbericht ins Studio live auf den Sender. Damit war sein Tagwerk im Grunde erledigt.
Ich fand es faszinierend, wie jemand ohne große Vorbereitung, mit nur ein paar Stichworten auf dem Zettel, zwei Minuten im Radio hochqualifiziert über ein komplexes Thema sprechen konnte. Für Michel, den Börsenexperten, war das aber eine leichte Übung. Ab und zu ging er in die Redaktionskonferenz, aus der Europe 1 das Mittagsmagazin sendete. Es war eine Art moderierte Talksendung, in der die Verantwortlichen für die Genres Politik, Kultur, Sport, Wirtschaft und Vermischtes ihren Beitrag verlasen und anschließend spontan über das eine oder andere Thema diskutierten, manchmal mit großem Gelächter. Gerade diese lebendige, unverkrampfte und unzensierte Art des Radios gefiel den Parisern besonders. Bei Europe 1 war immer etwas los. Ich schaute in den nächsten Monaten ab und zu im Sender vorbei. Dort lernte ich eines mittags Francois Mitterrand kennen, der zum Interview angetreten war - damals war er noch etwas scheu. Das änderte sich, als die Bürger ihn zwei Jahre später zum Staatspräsidenten der Französischen Republik wählten.
Nach zwei Wochen meinte Michel, ich könnte ja mal parallel zu ihm den Börsenbericht formulieren und wir könnten das Ergebnis dann vergleichen. Dies verdeutlichte mir schlagartig ein Dilemma. Mit meinen 22 Jahren verfügte ich zwar über eine gute, wenn auch ausbaufähige Formulierungskunst, eine Menge Neugier und die nicht bei Jedem ausgeprägte Gabe, zuzuhören ohne mitteilen zu wollen (was mir später noch sehr helfen sollte). Mir fehlte aber das gesamte inhaltliche Wissen. Ich hatte keine Ahnung von Fonds, Indizes, Hebelprodukten, Optionsscheinen oder Vorzugsaktien. Und so schnell ließ sich das auch nicht erlernen, erst recht nicht aus fremdsprachigen Büchern, die per se eine Herausforderung darstellten.
Ich gab Michel also einen Korb und entschied für den Rest meiner Zeit in Paris, mich in Form von Besuchen, Gesprächen und Recherchen in den inhaltlichen Gebieten fortzubilden, in denen ich später tätig werden wollte. Außerdem schrieb ich Artikel für deutsche Zeitschriften. Für die SONDE 1/1980, eine „Zeitschrift für neue christlich demokratische Politik“ verfasste ich einen Beitrag über „Jugendsekten – auf der Suche nach Werten und Sinn“.