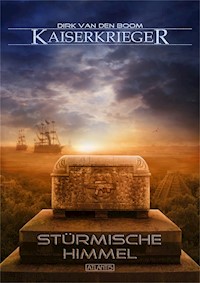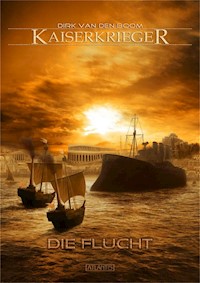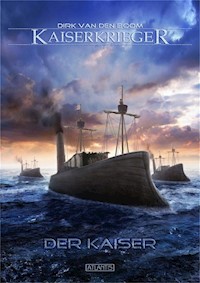Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Trunken von ihrem Triumph vor Adrianopel setzen die Goten zur Eroberung Ostroms an und bedrohen Thessaloniki. Während die Männer des Kleinen Kreuzers Saarbrücken noch versuchen, ihre Nützlichkeit für das Römische Reich unter Beweis zu stellen, formiert sich der Widerstand gegen die "Zeitenwanderer". Mächtige Kirchenfürsten intrigieren gegen den wachsenden Einfluss der Deutschen, auf der Saarbrücken selbst wird der Keim des Verrats gepflanzt... und nicht nur dort...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Personenverzeichnis
Endnoten
Dirk van den Boom
Kaiserkrieger: Der Verrat
1
Als sie in das große Feldlager kamen, das das westliche Heer beherbergte, bekam Rheinberg erstmals einen Eindruck von der Größe und Macht des Römischen Reiches. Gratian führte gut 25 000 Legionäre in den Kampf, verstärkt durch Hilfstruppen und einen kleinen Tross. Hier, im Feldlager, das der Kaiser vor nunmehr fast zwei Wochen aufgeschlagen hatte, bildete sich bereits so etwas wie eine kleine Stadt um die Palisadenzäune, die die Legionäre als Abgrenzung in den Boden gerammt hatten. Der Treck der deutschen Infanteristen, angeleitet durch den dröhnenden Lastwagen, wurde von den Massen der römischen Soldaten mit Schweigen begleitet. Die rund 160 Infanteristen wirkten wie eine sehr kleine, sehr verlorene Kolonne, die den breiten Weg bis zum gigantischen Zelt des Kaisers entlangmarschierte, jederzeit in der Gefahr, durch die überwältigende Anzahl der sie umgebenden römischen Soldaten zermalmt zu werden.
Rheinberg bekam bei diesem Gedanken fast schon klaustrophobische Ängste. Er schob sie mit Bedacht beiseite, konzentrierte sich darauf, neben Aurelius Africanus und den beiden Tribunen Rennas einigermaßen würdevoll auf seinem Pferd an der Spitze voranzureiten. Aus den Augenwinkeln verfolgte er die Blicke der römischen Soldaten. Er hoffte, dass sie von ihm kein allzu schlechtes Bild bekamen.
Als sie sich dem Zelt des Kaisers bis auf etwa zweihundert Meter genähert hatten, hielt die Kolonne an. Von hier an durften nur Africanus und Rheinberg weitergehen. Sie stiegen von den Pferden ab, die von Mitgliedern der Leibwache des Kaisers weggeführt wurden. Dann schritten sie auf das große leinene Vordach zu, vor dem vier Gardisten standen und sie unter ihren in der Sonne schimmernden Helmen misstrauisch musterten. Schließlich wurde ein Vorhang zur Seite geschlagen und ein alter, bärtiger Mann in voller Rüstung trat ins Freie. Africanus und Rheinberg blieben vor ihm stehen.
»Ich bin Arbogast, General des Kaisers«, stellte sich der muskulöse Mann mit dem wettergegerbten Gesicht knapp vor. »Mein Herr befahl mir, Euch zu ihm zu führen. Ihr seid Trierarch Africanus?«
Der Angesprochene bestätigte dies und überreichte ein Schreiben Rennas, das dieser ihm zur Beglaubigung mitgegeben hatte. Arbogast akzeptierte es, steckte das Papier aber achtlos in den Gürtel. Dann fixierte sein Blick Rheinberg.
»Und Ihr seid der Anführer der Fremden, über die so viel Wunderliches berichtet wird.«
Rheinberg versuchte ein Lächeln, das an dem alten Haudegen abperlte wie Wasser.
»Ich hoffe, dass es nur Wunderliches war, jedoch nichts Negatives.«
»Geredet wird viel«, entgegnete Arbogast. »Ich höre, Ihr seid Germane.«
Rheinberg zögerte. Arbogasts Name legte nahe, dass es sich bei ihm um einen der zahlreichen germanischen Offiziere in der römischen Armee handelte. Ein Vorgänger des legendären Stilicho, dessen große Zeit und großes Scheitern in nicht allzu ferner Zukunft lag.
»Ich komme zwar aus der Gegend, aber …«
Arbogast äußerte einen Satz in einer harten, völlig unverständlich klingenden Sprache. Rheinberg war sich sicher, dass es sich um einen der zahllosen germanischen Dialekte handelte. Von einer einheitlichen deutschen Sprache war man noch Jahrhunderte entfernt.
»Ich verstehe Euch nicht, General.«
»Ihr seid kein Germane«, stellte Arbogast fest.
»Ich werde es dem Kaiser erklären«, wich Rheinberg aus. Dem General schien dies zu genügen, denn er wandte sich abrupt um.
»So folgt mir.«
Der Innenraum des Zeltes ähnelte mehr einem Saal. Dicke Teppiche waren auf dem Boden ausgelegt und dämpften die Schritte. An den Zeltwänden standen Gardisten, die die Besucher mit aufmerksamen Augen beobachteten. Möbel standen verteilt, scheinbar wahllos, und ein hinterer Teil des großen Raumes war durch weitere Vorhänge abgetrennt, wahrscheinlich war es der Privatbereich des Kaisers. Aufgespannt zwischen zwei Stützpfosten des kaiserlichen Zeltes hing eine große, farbige und sehr kunstvolle Karte des Römischen Reiches. Davor stand ein mächtiger, marmorner Tisch, der mit Dokumenten, Karten und anderen Unterlagen völlig überladen war. Neben dem Tisch standen zwei Männer. Den einen erkannte Rheinberg sofort: Er war jung, kaum mehr als 20 Jahre alt, und er trug über einer reichhaltig bestickten Toga einen purpurnen Umhang. Es konnte sich dabei nur um Gratian, den Kaiser Westroms handeln. Der Blick aus den Augen des jungen Kaisers wirkte wach und neugierig, was Rheinberg als gutes Omen ansah. Der andere Mann war deutlich älter, ging sicher bereits auf die 50 zu und trug ebenso wie Arbogast eine vollständige Rüstung. Er musste ebenso wie der Germane ein hoher Militär sein.
Aus den Augenwinkeln sah Rheinberg, wie Africanus sich auf seine Knie niederließ. Er tat es ihm sofort nach. Kaum hatten ihre Knie den Boden berührt, als bereits die eher sanfte Stimme des Kaisers erklang.
»Erhebt Euch. Für Formalitäten haben wir später Zeit. Arbogast, dies sind unsere Gäste?«
»Es scheint so, mein Imperator.«
»Dann bietet ihnen Sitzplätze an.«
Aus dem Hintergrund erschienen Diener und schoben Sitzschemel heran. Wie aus dem Nichts standen dann Weinkaraffen und Schüsseln mit einfachen Speisen auf den eilends danebengestellten Tischlein. Arbogast, der von dem Ausmaß an Gastfreundlichkeit offenbar nicht vollends begeistert erschien, knurrte etwas und deutete eine einladende Handbewegung an, sobald sich Rheinberg und Africanus erhoben hatten.
»Ihr habt meinen getreuen General Arbogast bereits kennengelernt«, stellte der Kaiser ihn erneut vor, als sie sich alle gesetzt hatten. »Dies hier ist Malobaudes, König der Franken und ein weiterer höchst geschätzter Ratgeber in militärischen wie auch zivilen Fragen.«
Rheinberg deutete gegenüber dem älteren Mann mit dem gewichtigen Leibesumfang eine Verbeugung an, die dieser schweigend zur Kenntnis nahm. Der Kapitän fühlte sich denkbar unsicher. Er hatte einmal an einer Audienz bei Kaiser Wilhelm II. teilgenommen, zusammen mit 28 weiteren jungen Marineoffizieren. Es war eine nur sehr kurze Begegnung gewesen, doch das höfische Zeremoniell war vom Kaiser für seine Lieblingssoldaten auf das Allernotwendigste reduziert worden. Wilhelm hatte sich in Marineuniform gezeigt und versucht, seine Besucher mehr wie Kameraden und weniger wie Untertanen zu behandeln. Wenn Rheinberg sich richtig erinnerte, war ihm das alles wie eine schlechte Operette vorgekommen, obgleich das Schauspiel bei manchen seiner Kameraden die Wirkung nicht verfehlt hatte. Aber es gab einen Unterschied zwischen Wilhelm und Gratian: Wo der eine vom Krieg träumte und das Militärische mit seinen Zeremonien, seinen Pomp und seinen Glanz verehrte, führte der andere seit seiner Jugend einen endlosen Krieg um die Sicherheit seines Reiches, lebte mehr in Feldlagern als in kaiserlichen Residenzen und stand unter der beständigen Erwartung seines Volkes, selbst gegen jede Bedrohung von größerer Bedeutung vorzugehen. So sehr auch der Kaiserhof West- wie Ostroms in Friedenszeiten von höfischem Zeremoniell beinahe orientalischer Ausmaße dominiert wurde, so sehr waren römische Kaiser aber zugleich Pragmatiker und hatten es gelernt, auf diese Dinge zu verzichten, wenn es notwendig war. Marc Aurel, der berühmte Philosophenkaiser, hatte die letzten Jahre seiner Regentschaft nur auf Kriegszügen verbracht, und dies hatte nicht zuletzt zu seinen stoischen Überzeugungen beigetragen. So jung Gratian auch sein mochte, so sehr war er bereits durch das Leben als Feldherr geprägt worden.
Africanus übernahm es dann, sich selbst sowie Rheinberg vorzustellen. Sie hatten beide vereinbart, dass zu Beginn der Trierarch derjenige sein würde, der die bisherige Geschichte der Ankunft der Saarbrücken schildern würde, da der Imperator möglicherweise einem seiner Soldaten erst einmal mehr Glauben schenken würde. Africanus hielt seine Schilderung knapp, folgte streng den Fakten und verzichtete auf unnötige Ausschmückungen. Auch gab er kein Urteil über die charakterlichen Eigenschaften der Ankömmlinge ab, um gar nicht erst in den Verdacht zu kommen, den Kaiser und dessen Einschätzung ungebührlich beeinflussen zu wollen.
Gratian zeigte mit keiner Miene, wie der Vortrag bei ihm ankam. Sein Gesicht war ein Bild konzentrierter Aufmerksamkeit und es war ihm nicht anzusehen, ob er die Schilderungen des Trierarchen für glaubwürdig hielt. Arbogasts Züge hingegen verdunkelten sich mit jeder fortschreitenden Minute. Der Veteran schien von dieser Geschichte herzlich wenig zu halten, wenngleich Rheinberg nicht ersehen konnte, was er für einen Grund dafür hatte – entweder hielt er Africanus selbst für fragwürdig oder er meinte, er sei ungebührlich beeinflusst worden. Rheinberg musste sich immer wieder vor Augen halten, dass Magie und Zauberei in dieser Zeit für absolut real gehalten wurden und ein entsprechender Vorwurf sehr schnell einen Gerichtsprozess und ein tödliches Urteil nach sich ziehen konnte.
Als Africanus geendet hatte, gab es keine unmittelbare Reaktion des Kaisers. Arbogast schnaubte, äußerte seine Meinung jedoch nicht vor Gratian, der seinen Blick nun auf Rheinberg richtete.
»Es scheint, als könnt Ihr Wunder bewirken«, sagte der Imperator.
»Keine Wunder, Majestät. Ich verfüge über technische Mittel, die Euch unbekannt sind. Aber ich bin ein Mensch, sterblich, und würde von Eurem Feldherrn hier niedergestreckt werden, sollten wir mit dem Schwert gegeneinander antreten.«
Arbogasts Gesichtsausdruck ließ darauf schließen, dass der General diese Idee nicht für die übelste hielt.
»Wenn ich Africanus richtig verstanden habe, behauptet Ihr, durch die Zeit gereist zu sein.«
»Ja, Imperator. Aber nicht mit Absicht. Wir haben diese Macht nicht.«
»Also haben andere dafür gesorgt?«
»Andere oder anderes. Wir wissen es nicht.«
»Mit welcher Absicht?«
»Wir wissen es nicht.«
»Und was habt Ihr nun vor?«
Rheinberg holte tief Luft.
»Mein Imperator, wir sind Schiffbrüchige, wenn Ihr so wollt. Wir suchen eine Heimat.«
»Mein Reich?«
»Das wäre uns recht.«
»Was bietet Ihr uns an?«
»Unsere technischen Errungenschaften und unser Wissen.«
»Was verlangt Ihr dafür?«
»Sicherheit.«
Gratian runzelte die Stirn. »Sicherheit? Wer könnte sicherer sein als Ihr mit Eurem mächtigen Schiff?«
»Das gilt nur für kurze Zeit. Wie jede Maschine funktioniert auch die unsere nur, wenn sie instand gehalten wird. Dafür benötigen wir eine Basis, Rohstoffe, Arbeiter. Unsere Sicherheit würde in kurzer Zeit ohne all dies dahinschmelzen.«
»Warum also lasse ich Euch nicht dahinschmelzen und nehme mir nachher, was ich brauchen kann?«
Rheinberg nickte. »Das könnt Ihr. Wahrscheinlich würden wir zu entkommen versuchen und jemand anderen um Obhut fragen. Eure Schiffe können uns nicht aufhalten. Die Perser mögen eventuell größeres Interesse haben.«
Gratians Augen verengten sich, Arbogast wirkte ob dieser Worte alarmiert.
»Ihr droht uns?«
»Ich will überleben. Ich würde es sehr vorziehen, es in Eurem Reich zu tun. Ich kann Euch helfen, es zu retten.«
»Wovor zu retten?«
»Vor allem, was ihm und Euch persönlich bevorsteht. Es ist eine Menge. Eine wichtige historische Entwicklung hat begonnen, deren Vorboten die Goten sind. Das Reich steht vor dem Abgrund, vor allem der Westen, und Ihr selbst habt nicht mehr lange zu leben.«
Gratian wechselte einen Blick mit Arbogast.
»Ihr könnt in die Zukunft sehen, ja?«
»Ich kenne die Vergangenheit, da ich aus der Zukunft komme.«
»Und Ihr wollt Euer Wissen mit uns teilen?«
»Für Sicherheit und Aufnahme.«
Gratian lehnte sich zurück und schaute versonnen auf das Zeltdach. Arbogast konnte nun nicht mehr an sich halten.
»Wir brauchen einen Beweis Euren guten Willens«, knurrte er.
»Wir haben die Piraten zur Strecke gebracht«, erwiderte Rheinberg.
Der General machte eine abfällige Handbewegung. »Ihr habt ein paar Segelschiffe angegriffen und einen Verbrecher gefasst. Fein. Ich meine eine wirkliche Herausforderung.«
»An was denkt Ihr?«
»Ihr sagt, die Goten seien erst der Anfang?«
»Sie sind Vorboten.«
»Vorboten von was?«
»Zahlreichen weiteren Völkern, die gegen die Grenzen des Reiches strömen und den Westen letztendlich erdrücken werden, in nicht einmal einhundert Jahren«, erklärte Rheinberg.
»Und Ihr wisst, was wir dagegen tun können?«, fragte Arbogast.
»Ich ahne es.«
»Zeigt uns, was Ihr jetzt tun könnt. Ihr wisst, wie es im Osten aussieht?«
»Valens ist gefallen, die Goten ziehen plündernd durch das Reich, zwei Drittel des östlichen Heeres ist tot.«
Arbogast zögerte. »Zwei Drittel.«
»22 000 Tote«, bekräftigte Rheinberg. »Nur ein Heermeister hat überlebt.«
»Welcher?«
»Flavius Victor.«
»Sebastianus ist auch tot?«, hakte nun Gratian nach.
Rheinberg nickte nur. Er hatte alles noch einmal genau nachgelesen, ehe er hierher aufgebrochen war. Jede seiner »Vorhersagen« musste stimmen.
»Gut. Dann zeigt Eure Überlegenheit und die Macht Eures Wissens und tretet gegen die Goten an!«, forderte Arbogast.
»Das will ich tun.«
Verblüfftes Schweigen folgte Rheinbergs freimütiger und schneller Antwort.
»Mit Euren … wie vielen Männern?«
»160.«
»Die Goten aber zählen …«
»20 000. 30 000. Wer weiß.«
»Das ist absurd. Ihr seid ein Angeber.«
»Begleitet mich.«
Arbogast öffnete den Mund und verschloss ihn sogleich wieder. Als er ein amüsiertes Lächeln auf den Lippen Gratians sah, wirkte er mit einem Male eher verlegen als erbost.
»Ja, Arbogast. Begleitet ihn. Nehmt dazu eine Einheit von Legionären, aber führt auch Pferde und Karren mit Euch und dann geht es gen Osten. Ich wünsche, dass Ihr den Landweg nehmt, ich will kein großes Aufsehen durch dieses Wunderschiff provozieren. Außerdem sollten sich die Fremden an unsere Soldaten gewöhnen und umgekehrt. Vereint Euch mit Flavius Victor und vielleicht könnt Ihr dann absehen, ob etwas gegen die Goten zu erreichen ist.«
»Ihr macht mich zum Feldherrn des Ostens?«
»Nein, das soll Theodosius werden. Ich habe es gestern beschlossen. Der Sohn des alten Generals, ein Römer von hohem Blut. Ich habe bereits einen Boten nach Spanien geschickt. Er soll mich hier so schnell treffen, wie er kann.«
Gratians Aufmerksamkeit richtete sich wieder auf Rheinberg. Dieser war von den Befehlen des Kaisers angetan. Den Landweg zu wählen, sozusagen als verlängerte, vertrauensschaffende Maßnahme, war keine dumme Idee, um etwas gegen Misstrauen und Angst zu tun. Es kostete Zeit, aber richtig in Eile waren sie nicht. Theodosius hatte gegen die Goten zu seiner Zeit Jahre zugebracht, so lange würde es diesmal sicher nicht dauern.
»Theodosius gehört zu Eurer Vergangenheit?«, fragte Gratian.
»Er wird Kaiser des Ostens.«
Gratian wirkte nicht überrascht.
»Ein guter Kaiser?«
»Es gab schlechtere«, antwortete Rheinberg vorsichtig. »Aber es gab auch bessere.«
Der Imperator wartete auf eine Erklärung, doch Rheinberg beschloss, es vorerst dabei zu belassen.
»Aber ein guter Feldherr?«, fragte Gratian.
»Ein durchaus fähiger Anführer«, gestand Rheinberg ein. »Aber auch ihm gelang es nicht, die Goten zu besiegen.«
»Was ist das Ergebnis? Der Osten verloren?«
»Nein. Er wird die Goten zu Foederatii machen und ihren König im Amte belassen. Sie werden keine Untertanen des Reiches sein, aber im Reich siedeln dürfen, und sie werden keine Befehle der römischen Verwaltung entgegennehmen, sondern nur zu Beistand verpflichtet sein.«
Gratian wirkte über diese Antwort nicht sehr glücklich. »Das erscheint mir riskant«, murmelte er.
»Sehr riskant«, stimmte Rheinberg zu. »Und nur ein Präzedenzfall. Er wird zur Auflösung des Reiches, vor allem im Westen, führen, denn Eure Nachfolger werden die gleiche, einfache und bequeme Lösung suchen.«
Arbogast wirkte nachdenklich. Malobaudes, der noch kein Wort gesagt hatte, nickte. Als fränkischer König konnte er besonders gut ermessen, was für eine Veränderung die Föderationslösung mit sich brachte. Auch Gratian schien die Tragweite einer solchen Entwicklung nahezu intuitiv zu erkennen.
»Ihr werdet mir mehr dazu erzählen müssen, Rheinberg«, sagte Gratian schließlich.
»Ich stehe Euch zur Verfügung. Doch vielleicht wollt Ihr und der verehrte Arbogast eine Vorführung dessen, was wir den Goten zeigen wollen?«
Arbogasts Augen glitzerten. »Eine Vorführung? In der Tat.«
»Eine gute Idee«, meinte Gratian. »Was braucht Ihr?«
»Ziele. Und ein freies Feld.«
»Malobaudes …«
»Ich werde alles bereitstellen«, erwiderte der General sofort.
»Dann darf ich Euch alle einladen, einer kleinen Demonstration beizuwohnen!«, sagte Rheinberg zufrieden.
Die Männer erhoben sich.
Auf dem Weg hinaus erkundigte sich Malobaudes genauer nach Rheinbergs Wünschen und er trug ihm auf, was ihm Becker in der gemeinsamen Vorbereitung geschildert hatte. Der General wirkte anfangs etwas verwirrt, versprach aber, sogleich tätig zu werden. Als sie alle in der Sonne des späten Vormittags standen und nur der Franke davoneilte, um seinem Stab Aufträge zu erteilen, winkte Rheinberg Becker herbei. Auf ein Zeichen Gratians wurde er zu der kleinen Gruppe vorgelassen.
»Das ist Legat Becker, der Kommandant meiner kleinen Kohorte.«
Becker verbeugte sich tief.
»Er wird Euch die Macht seiner Waffen demonstrieren. Der Kaiser hat der Präsentation zugestimmt. Es wird alles vorbereitet.«
Becker lächelte und bat darum, sich zurückziehen zu dürfen, was ihm gewährt wurde. Kaum hatte er seine Männer erreicht, brüllte er Befehle und die Infanteristen sprangen auf, drei der Maschinengewehre vom Lastwagen abzuladen. Gratian und Arbogast betrachteten das Fahrzeug mit unverhohlenem Interesse.
»Ich lade Euch und Eure Gardisten ein, den Ort der Demonstration mit uns in unserem Wagen zu besuchen«, bot Rheinberg spontan an. »Ich will alleine fahren, Euren Gardisten ausgeliefert, sollte ich Unheilvolles planen. Nehmt es als weitere Präsentation unserer technischen Errungenschaften.«
Ehe Arbogast seinen Imperator von einer unüberlegten Entscheidung abbringen konnte, hatte Gratian bereits mit kaum verborgener Begeisterung seine Zustimmung gegeben. Dem General blieb nichts anderes übrig, als nach einem Zenturio zu brüllen, der sogleich mit zwei Dutzend Gardisten angetrabt kam.
»Dann wollen wir mal!« Rheinberg half sowohl Gratian als auch Arbogast in das Fahrerhaus, ehe er selbst hinter dem Steuer Platz nahm. Dann hörte er, wie die Gardisten hinter ihm auf die leer geräumte Ladefläche rumpelten, sich auf den schmalen Bänken niederließen und dem gesicherten, nun aber verwaisten MG auf dem Dach über ihrem Imperator misstrauische Blicke zuwarfen.
Rheinberg ließ den Motor an. Das Rütteln und Schütteln der schweren Dieselmaschine ließ den Wagen erzittern und Rheinberg bemerkte, wie sich die Finger des Kaisers unwillkürlich in die karge Polsterung der Sitzbank krallten. Er beschloss, sehr, sehr langsam zu fahren.
»Wohin, geehrter General?«
Arbogast starrte bleich aus der Windschutzscheibe und brauchte eine Weile, um Rheinberg schließlich den Weg zu weisen.
Rheinberg löste die Handbremse. Der Lastwagen rollte butterweich an. In einer sorgfältigen Kurve zog der Kapitän das Gefährt langsam herum, bis es über die unebene, nur gestampfte »Hauptstraße« des Feldlagers von dannen rumpelte. Aus den Augenwinkeln sah Rheinberg, dass ihnen ein Trupp Kavalleristen folgte. Auf diesem Terrain würde er ihnen mit dem Laster niemals davonfahren können und Rheinberg dachte nicht einmal im Traum daran, es auch nur zu versuchen.
Der Laster rumpelte durch das Haupttor, an dem die Wachen nicht wussten, ob sie ihren Kaiser im Führerhaus anglotzen oder sich eilig verbeugen sollten. Unter kargen Richtungsanweisungen Arbogasts erreichten sie ein Feld vor dem Lager, wo der Wagen zum Stillstand kam.
Rheinberg drehte den Motor ab und sah Gratian auffordernd an.
»Nun, Majestät?«
Der Kaiser wirkte etwas bleich um die Nase, aber ansonsten war er guter Dinge. Die Geschwindigkeit konnte ihn nicht beeindruckt haben, da konnte jedes Pferd mithalten. Die Tatsache, aber dass der Wagen sich ohne Zugtier in Bewegung gesetzt hatte …
»Und Ihr seid sicher, dass das keine Magie war?«, stellte Arbogast die bisher unausgesprochene Frage.
»Magie, die so laut ist und stinkt?«, erwiderte Rheinberg. »Kommt, ich zeige Euch etwas!«
Die Männer kletterten heraus und Rheinberg öffnete die Motorhaube. Gratian und Arbogast starrten verständnislos hinein.
»Das ist eine Maschine, wir nennen sie einen Motor. Sie treibt die Räder des Wagens an, indem sie Alkohol verbrennt.«
»Alkohol verbrennen?«
»Zumindest so ähnlich«, gab Rheinberg zu. »Keine Magie jedenfalls. Von Menschen erfunden, von Menschen konstruiert und es benötigt Menschenhand, um es zu reparieren und funktionsfähig zu halten.«
Gratian berührte einen der heißen Zylinder vorsichtig mit den Fingerspitzen.
»Können wir so etwas bauen? Ich meine, nehmen wir an, ich stelle Euch die besten Handwerker meines Reiches zur Verfügung, und gebe Euch alle Materialien, die Ihr begehrt – könnten meine Leute das bauen?«
»Nein.«
»Warum nicht?«, begehrte Gratian auf.
»Uns fehlen die Werkzeuge, um die richtigen Werkzeuge zu bauen, die notwendig sind, um den Motor zu entwickeln. Aber wir können eine vergleichbare, einfachere Maschine bauen, die ebenfalls einen Wagen antreiben kann, oder ein Schiff. Wir nennen diese eine Dampfmaschine.«
»In ihr verbrennt auch Alkohol?«
»Holz. Oder Kohle. Sie arbeitet mit Wasserdampf.«
»Dampf?«
Rheinberg nickte.
»Und das könnten meine Leute bauen?«
»Aus Bronze, ja. Wir könnten sie anleiten. Dann brauchen sie unsere Hilfe nicht mehr und sie können es alleine. Eure Galeeren würden unabhängig vom Wetter und mit höherer Geschwindigkeit die Meere beherrschen. Kein Pirat und kein Feind würde es wagen, Euch herauszufordern.«
»Das Mittelmeer gehört uns und wer will den Rest«, schnaubte Arbogast, immer noch voller Zweifel.
»Wenn die Vandalen Nordafrika erobern und Euch die Kornkammer nehmen, werdet Ihr anders urteilen.«
Der General und Gratian sahen sich kurz an. »Wann soll das geschehen?«, fragte der Kaiser schließlich.
»Es beginnt 429, es endet keine zehn Jahre später.«
Erneut wechselten die beiden Männer Blicke. Sie wussten, welche katastrophalen ökonomischen Konsequenzen ein solcher Schlag haben würde.
Arbogast räusperte sich.
»Eure Demonstration, Rheinberg.«
»Sicher, General.«
Die Legionäre aus dem Feldlager hatten sich mittlerweile ebenfalls den Schaulustigen angeschlossen. Männer hatten auf breiter Ebene Ziele aufgebaut, alte Holztonnen, Strohpuppen, Übungsmaschinen der Legionäre, Kisten und allerlei anderen Müll, mal niedrig, mal hoch aufgetürmt, und alles auf einer geraden Linie von vielleicht 200 Metern Länge. Becker hatte seine Männer im Lager gelassen, misstrauisch beäugt von Gardisten, und nur neun seiner Soldaten mitgebracht: drei pro Maschinengewehr. Sie nahmen nun nebeneinander Stellung, jeweils vielleicht zehn Meter voneinander entfernt, und stellten ihre mächtigen Schusswaffen auf Dreibeinen auf.
Becker gesellte sich zu Rheinberg.
»Da hinten stehen auch noch einige Bäume, in guter Reichweite.«
»Die holzen wir ab«, flüsterte Rheinberg. »Wir sparen heute nicht an Munition. Wir haben nur diese eine Chance. Es muss sehr, sehr beeindruckend wirken.«
»Beeindruckend, jawohl«, erwiderte Becker grinsend. Er gesellte sich wieder zu seinen Männern, die ihre Vorbereitungen abgeschlossen hatten. Rheinberg erwog für einen Moment, den Kaiser unvorbereitet mit dieser Demonstration zu konfrontieren, entschloss sich aber dann dagegen.
»Majestät, Ihr seht jetzt die Fähigkeiten der mächtigsten Schusswaffen, die wir mit uns führen. Sie werden innerhalb sehr kurzer Zeit die Reihe von Zielen vernichten, die Eure Männer dankenswerterweise errichtet haben. Darüber hinaus gedenken wir, jene kleine Gruppe von Bäumen dort drüben zu fällen.«
»Zu fällen?«, echote Arbogast.
»Es wird recht laut«, fuhr Rheinberg mit seinen Erläuterungen fort. »Erschreckt Euch nicht. Wir beginnen, wenn Ihr den Befehl gebt, Imperator!«
Gratian nickte gemessen, wusste aber ganz offensichtlich nicht, was ihn jetzt erwartete. Rheinberg konnte ihm dies kaum verübeln.
»Dann beginnt!«
Rheinberg gab Becker ein Zeichen. Der Hauptmann bellte einen Befehl.
Die MGs feuerten.
Das MG 08 mit seinem mehr als 70 cm langen Lauf war eine beeindruckende Waffe. Es hatte ein Kaliber von 8 mm und wurde durch einen Patronengurt gefüllt, der leicht ersetzt werden konnte. Ein Gurt fasste 250 Patronen, die das MG mit einer Kadenz von 500 oder 600 Schuss pro Minute abfeuern konnte. Mit einer effektiven Schussweite von fast zweieinhalb Kilometern gegen Bodenziele war der Hinweis auf das nahe Ende der Baumgruppe alles andere als Angeberei gewesen. Es war eine schwere Waffe und man benötigte eine Lafette, um sie aufzustellen und aufzurichten. Ideal, um von gesicherten, möglichst erhöhten Positionen ein ganzes Schlachtfeld zu bestreichen.
Rheinberg hatte exakt das im Sinn, wenn es an der Zeit war, den Goten entgegenzutreten.
Die MGs waren laut. Ihr plötzliches, unvermitteltes Rattern schallte über die Ebene und Gratian zuckte sichtlich zusammen. Fast zeitgleich begannen die Ziele, sich in zerschreddertes Holz aufzulösen, und das wie von Geisterhand. Späne flogen, Holzteile wirbelten durch die Luft, als die drei MGs methodisch von links nach rechts schwenkten. Es dauerte keine dreißig Sekunden, da war von den oft mannshohen Zielen nichts mehr zu sehen außer Trümmern und Fetzen. Für einen kleinen Moment legte sich Ruhe über das Feld, dann hatten die Schützen neu gezielt und wieder erschütterte das Stakkato der Salven Mark und Bein. Die gut einen Kilometer entfernte Baumgruppe bestand aus sechs niedrig gewachsenen Zedern. Eine unsichtbare Faust durchfuhr Äste und Stämme, und als die drei MGs ihr Feuer auf die Bäume vereinten, brachen die trockenen Gewächse unter dem Wirbelwind der Zerstörung zusammen.
Die MGs schwiegen. Alle starrten schweigend auf die Baumgruppe, von der nur noch Stümpfe und Trümmer zu sehen waren. Für einen Moment flogen noch Holzteilchen in der trägen Sommerluft umher, dann war der Blick frei auf die dahinter liegende Landschaft.
Rheinberg ließ das Bild noch einen Moment wirken, dann winkte er Becker herbei.
»Wer von den Männern kann das MG am schnellsten auseinanderbauen?«
»Der Gefreite Lehmann ist ungeschlagen.«
»Dann darf ich bitten.«
Becker drehte sich um und brüllte.
»Majestät, wenn Ihr einen Tisch bringen lasst, demonstriere ich Euch, dass auch in diesem Falle keine Magie im Spiel ist.«
Gratian und Arbogast wirkten blass und erschüttert. Malobaudes schüttelte unentwegt den Kopf. Schließlich nickte der Kaiser.
Eilfertige Diener brachten einen stabilen Holztisch aus dem Lager, bahnten sich einen Weg durch die starrenden Legionäre, unter denen sich ein ungläubiges, ergriffenes Gemurmel ausgebreitet hatte.
Lehmann war derweil mit seinem MG angelaufen gekommen und wuchtete es auf Geheiß Beckers auf den Tisch. Sie warteten noch eine kurze Zeit, um der erhitzten Waffe die Möglichkeit zu geben, etwas abzukühlen. Mit fliegenden Fingern begann er, den Mechanismus auseinanderzubauen. Nach drei Minuten war das MG in seine wesentlichen Einzelteile zerlegt und der Kaiser und seine beiden Generäle beugten sich darüber.
»Ihr seht, edle Herren, dass dies eine mechanische Konstruktion ist«, erklärte Rheinberg. »Sie ist sicher dem, was Eure Waffenhandwerker produzieren können, deutlich überlegen und dennoch ist es letztendlich nur eine konsequente Weiterentwicklung von Waffen, die Euch nicht unbekannt sind.«
Gratian fuhr mit den Fingern über die mittlerweile abgekühlten Metallteile und nickte.
»Es ist wahr«, murmelte er. »Dies ist kein Zauber, sondern höchste Handwerkskunst.«
Er sah auf. »Arbogast, ahnt Ihr, was wir mit diesen Waffen ausrichten können, auf einem von uns gewählten Schlachtfeld? Wisst Ihr, was da 20 000 Goten noch bedeuten, wenn wir drei gute Positionen haben, von denen das Feld beherrscht werden kann? Wir würden ein Blutbad anrichten, ohne einen unserer Männer in Gefahr bringen zu müssen!«
Der Heermeister mochte ein ungnädiger und misstrauischer Mann sein, doch diese Demonstration hatte ihre Wirkung auch auf ihn keinesfalls verfehlt.
»Ja, mein Imperator. Wir müssten unsere Legionen nur als Lockvögel einsetzen, um den Feind in die richtige Position zu bringen.«
»Dafür dürften die verbliebenen Truppen des Ostens genügen«, warf Rheinberg ein. Die Blicke Gratians und Arbogasts kreuzten sich in stummem Einverständnis. Der Kaiser reckte sich und schaute auf die zerschredderten Ziele.
»Trierarch Rheinberg, ich ziehe es vor, wenn Ihr die Freunde des Römischen Reiches werdet und nicht unsere Gegner.«
»Das entspricht meinen Wünschen.«
»Dann sollten wir wieder in mein Zelt gehen und die Details besprechen.«
Gratian wandte sich ab, stapfte auf das Feldlager zu, umging bewusst den Lastwagen. Seine Gardisten beeilten sich, ihm ein Pferd zu bringen. Becker, Rheinberg, Arbogast und Malobaudes schauten ihm nach.
»Nun gut«, knurrte der Germane. »Aber ich werde ein Auge auf Euch haben, das verspreche ich.«
»Ich freue mich auf Euren Ratschluss«, erwiderte Rheinberg mit einem Lächeln. Der General schnaubte und stapfte hinter seinem Herrn her.
»Verzeiht meinem Kameraden«, sagte nun Malobaudes und strich sich zufrieden über seinen Bauch. »Er wird Euch keine Unbill bereiten. Das einzige wirkliche Ziel, das er hat, ist, seinem Kaiser zu dienen.«
Rheinberg nickte versonnen. Wenn er den knurrigen Alten überzeugte, hatte er auch den Kaiser überzeugt, dessen war er sich nun sicher.
2
Der Mulio, der Maultiertreiber, hatte keine langen Fragen gestellt. Der Handel im Römischen Reich war karg genug, weil immer weniger produziert wurde und all jene, die Überschüsse hatten, sie zu horten trachteten. Der Profit für den weiten Handel quer durch das Reich wurde immer niedriger. Mehr und mehr Produzenten konzentrierten sich auf den eigenen Bedarf und verkauften nur noch an den Staat, der Waffen für seine Armee benötigte und Lebensmittel für den Unterhalt der städtischen Schichten, die ansonsten – vor allem in Rom selbst – große Unruhen hervorrufen würden. Und so wurde der Überlandhandel, einstmals eine der Lebensadern des Reiches, durch staatliche Regulierung und die Abschöpfung aller Überschüsse durch einen sich immer weiter ausbreitenden Beamtenapparat immer mehr ausgetrocknet. Die Karren des Kolonnenführers waren nur halb gefüllt. Als die junge Frau ihm zwei Goldstücke in die Hand gedrückt hatte, die offenbar nicht durch niedere Metalle gestreckt worden waren, hatte er bereitwillig Platz in einem der Wagen angeboten. Ihr Begleiter, ein junger Mann, der sich in seiner recht neuen und frisch ausgebesserten Tunika sichtlich unwohl fühlte, hatte nur schweigend danebengestanden. Beide jungen Leute trugen je ein großes Bündel mit sich herum und sie waren gekleidet wie für eine lange Reise, sahen ihm aber ein wenig zu gepflegt aus für einfache Wanderer. Die Fingernägel der jungen Frau waren sorgfältig manikürt gewesen, das war dem Mann sofort aufgefallen, und obgleich ihr Begleiter nicht so aussah, als sei ihm körperliche Arbeit völlig fremd, machte er auf ihn nicht den Eindruck eines Tagelöhners oder Handwerkers.
Aber zwei Goldmünzen waren zwei Goldmünzen, und solange sich die beiden ruhig verhielten und keine Scherereien machten, würde er sie nicht behelligen.
Die Kolonne der vier Eselskarren brach an einem frühen Morgen von Ravenna aus auf. Die Straßen waren gut, doch die Esel langsam und der Verkehr beeindruckend. Oberitalien war immer noch eines der ökonomischen und politischen Zentren des Reiches und das zeigte sich auch in der Dichte der Bevölkerung sowie dem Ausmaß des Verkehrs zwischen den vielen städtischen Siedlungen in dieser Region.
Gegen Mittag, als die Sonne hoch am Himmel stand, waren die Ausläufer Ravennas gerade aus ihrem Sichtfeld verschwunden. Ihre erste Etappe führte sie nach Mailand, einer weiteren bedeutenden Stadt. Von dort würden sie sich dann in Richtung Osten, die Küstenlinie entlangbewegen, in Sirmium Station machen und letztlich in Konstantinopel enden. Gerüchte in der Bevölkerung, die Goten würden das flache Land des Ostens beherrschen, hatte der Kolonnenführer als Angstmacherei abgetan. Ob das ernst gemeint war oder nur der Versuch, sich selbst etwas einzureden, hatten weder Julia noch Volkert erkennen können. Volkert wusste ungefähr, was sich im Osten des Reiches abspielte, aber er war sich sicher, dass sich die Lage beruhigt haben würde, sobald die langsamen Karren den beschwerlichen und langen Weg bis nach Sirmium zurückgelegt hatten.
Die Fahrt war langsam und monoton. Der Lenker des Karrens, auf dem Julia und Volkert Zuflucht hatten, war ein schweigsamer, alter Mann, der mit gekrümmten Rücken hinter den Eseln saß und außer einem gelegentlichen Schnalzen keinerlei Laut von sich gab. Bisweilen stieg er ab und ging neben den Tieren her, tätschelte ihre Schädel und schnalzte erneut. Die Esel schienen das als Bestätigung ihrer guten Dienste zu akzeptieren, jedenfalls machten sie die ganze Fahrt über keinerlei Ärger. Volkert hatte den Eindruck, hier ein eingespieltes Team vor sich zu haben.
So blieb ihm und Julia nur, hinten auf dem Karren zu sitzen und zu reden. Julia hatte es als ihre Aufgabe entdeckt, die doch eher bröckeligen Kenntnisse Volkerts in Latein und Griechisch aufzubessern, und sie ging mit Feuereifer ans Werk. Als Übungsmaterial hatten sie nicht mehr als nur ihr Leben und sie stellten sich gegenseitig Fragen und schilderten, was sie in ihren jeweiligen Zeitaltern erlebt hatten. Julia glaubte vieles nicht, was Volkert ihr schilderte und nahm mit großem Stirnrunzeln zur Kenntnis, dass sich die Stellung der Frau in der Gesellschaft auch viele Hundert Jahre in der Zukunft nicht grundsätzlich gebessert hatte. Wenig Interesse zeigte sie für seine Schilderungen technischer Errungenschaften, weitaus mehr jedoch an den medizinischen Fortschritten und interessanterweise an politischen Strukturen. Als Volkert ihr die Funktion des Reichstages zu erklären versuchte, hatte sie wenige Probleme, das zu verstehen – die römische Republik war durchaus noch stark im Geschichtsbewusstsein der Römer verankert und ihr Vater war schließlich Senator. Auch die Schilderungen der politischen Verhältnisse, des Aufkommens der Sozialdemokratie und ihrer Ablehnung der Monarchie, fanden bei ihr durchaus Verständnis, denn letztlich gab es eine historische Entsprechung im Widerstreit zwischen Plebejern und Aristokraten in der eigenen Geschichte, wenngleich sicher unter anderen Vorzeichen. Es schien sie zu enttäuschen, dass sich so viel im Grunde nicht geändert hatte. Offenbar hatte sie die Hoffnung genährt, dass die Menschen der Zukunft in vielen wichtigen Dingen weiter entwickelt waren als die ihrer Zeit, doch die Schilderungen der internationalen Spannungen und der Kriege erinnerten sie offenbar doch sehr stark an die Geschichte des Imperiums und an ihre eigene Gegenwart.
Nachdem sie den ganzen Vormittag über diese Dinge geredet hatten, begannen sie mit dem Mittagessen, über Persönliches zu sprechen. Volkert begann zu verstehen, wie gleichzeitig privilegiert und beengt Julias Leben als Senatorentochter gewesen war. Ein goldener Käfig, trotz zwei im Grunde liebevoller Eltern, die ihrer Tochter so einiges hatten durchgehen lassen. Für Julia war diese Reise mehr als nur eine Trotzreaktion auf die Ablehnung ihres Geliebten durch ihre Eltern, es war ein ganz grundsätzlicher Befreiungsschlag. Im Grunde, so bemerkte sie selbst einmal bitter, hätte sie als Mann geboren werden sollen, denn für eine Frau wie sie gab es in Rom keinen Weg, mehr aus sich zu machen. Beide sprachen lange über ihre Familien und die damit verbundene Erkenntnis Volkerts, dass er seine Eltern und Geschwister wahrscheinlich nie wieder sehen würde, machte ihn für einige Minuten traurig und schweigsam. Es sprach für Julia, dass sie das sofort erkannte und, anstatt in ihn zu dringen, den jungen Mann einfach in die Arme nahm, während dieser wehmütigen Erinnerungen nachhing.
Als der Abend anbrach, erreichten sie eine der zahlreichen Herbergen an der Hauptstraße. Es war ein weitläufiges, flaches Gebäude mit Stallungen. Es bestand aus einem großen Schankraum sowie einem angeschlossenen Gebäude mit Unterkünften verschiedener Preisklassen – Schlafsäle mit einfachen Strohsäcken als Liegestätten für die weniger Betuchten, Einzelzimmer mit richtigem Mobiliar für die wohlhabenderen Reisenden. Volkert und Julia hätten sich mit dem Gold, das die Senatorentochter mit sich führte, rein theoretisch eine etwas bessere Unterkunft leisten können, hatten aber beschlossen, möglichst nicht aufzufallen. Also schoben sie zwei Strohsäcke zusammen und ließen sich nach einem eher frugalen Abendmahl erschöpft auf ihre pieksige Schlafstatt nieder. Der Saal war nur zu einem Drittel gefüllt und die Reisenden hielten so weit Abstand voneinander, wie es nur ging. Das nächtliche Schnarchen, Schnäuzen und Husten war für Volkert, der Mannschaftssäle von der Marine her gut kannte, nichts Besonderes und er war schnell in einen tiefen Schlaf gefallen. Julia hingegen, durchaus an eine etwas luxuriösere und privatere Nachtruhe gewöhnt, schwankte zwischen Ekel, Angst und Nervosität hin und her. Schließlich schlang sie ihre Arme um Volkerts Körper und presste sich an ihn. Zugedeckt unter grob gewebten Decken, konnte man in der Dunkelheit kaum etwas von den Konturen ihrer Körper erahnen. Spielerisch ließ Julia ihre Hand den Oberkörper Volkerts hinabgleiten, huschte über die Bauchdecke hinunter bis …
Julia kicherte.
»Mentula tua iubet, amatur!«1, flüsterte sie in Volkerts Ohr. Dieser öffnete die Augen, und obgleich er nicht ganz verstanden hatte, was Julia gerade gesagt hatte, bedurften die massierenden Bewegungen, mit denen ihre Fingerspitzen um seine Eichel kreisten, keiner weiteren Erklärung. Er unterdrückte ein Aufstöhnen, da er keinen der anderen Gäste unnötig auf ihr Tun aufmerksam machen wollte, doch es fiel ihm schwer, und umso schwerer, desto intensiver Julias Massage wurde.
Ihr Mund drückte sich auf den seinen, fordernd, dominierend. Er drückte die junge Frau an sich, die ihn unten unablässig bearbeitete. Ein Seufzen aus ihrem Mund drang an sein Ohr, dann ein leises Flüstern: »Immanis mentula es!«
Was auch immer das bedeuten mochte – Volkert war nicht in der Lage, sich auf Vokabeln zu konzentrieren –, es hatte definitiv mit seinem harten Penis zu tun, der fast schmerzhaft gegen die nun viel zu enge Hose stieß. Seine eigenen Hände erforschten Julias Körper, drückten die festen, kleinen Brüste der jungen Frau, die ein ersticktes Stöhnen ausstieß und seine Liebkosungen wild erwiderte.
Dann, mit langsamen Bewegungen, schob Julia ihren Körper über den seinen. Immer noch eine Hand fest um seinen Schaft geklammert, nestelte sie ihn aus der Hose, und dann drückte sie seine Eichel fest gegen ihre Scham. Das raue Haar kratzte an der Spitze seines Penis, und dann umschloss ihn warme, feuchte Enge.
»Lente impelle«, flüsterte Julia heiser. Das hatte Volkert verstanden. Stoß langsam! Er ließ sich nicht zweimal auffordern, vergaß seine Umgebung. Es war ihm egal, wer was hörte oder sah, als ihn eine bisher nie gekannte Leidenschaft überkam, die köstliche Verbindung von Begehren und Liebe, wie er sie nie zuvor in seinem Leben kennengelernt hatte. Er fühlte, wie sein Penis tief in Julias Körper vorstieß und die sanft kreisenden, fordernden Bewegungen ihrer Hüfte ließen jede Selbstbeherrschung zu einer Illusion werden lassen. Mit einem nur schwach unterdrückten, heißen Aufbäumen ergoss er sich in die junge Frau, stieß ein erschreckend lautes Keuchen aus, fühlte die in seinen Nacken gekrallten Hände Julias und war für diese glücklichen Momente nicht auf dieser Welt.
Langsam klärte sich sein Blick und trotz der Dunkelheit erkannte er schemenhaft das lächelnde, schweißgebadete Gesicht Julias. Er wusste, dass er länger hätte aushalten sollen und müssen, doch sah er in den Augen seiner Geliebten keinen Vorwurf, sondern nur einen tiefen, zufriedenen Ausdruck geteilten Glücks.
Auf der benachbarten Schlafstatt ertönte ein dreckiges Kichern und eine Männerstimme sagte: »Filius salex, quod tu mulierorum diutuisto!«2
Volkert lief tiefrot an. Weniger, weil er verstanden hatte, sondern eher, weil Julia verlegen dreinblickte. Sie erklärte das eben Gesagte mit einigen Umschreibungen.
»Das hat er gesagt?«, vergewisserte sich Volkert. Julia nickte und lächelte. Der junge Mann beschloss, diese Frage nicht zu beantworten. Zu einer anderen Zeit würde er seiner Geliebten offenbaren, dass dies soeben das allererste Mal in seinem Leben gewesen war.
Julia löste sich von ihm. Ihre Schlafstatt war verklebt und verschwitzt, doch das kümmerte keinen von beiden. Und hatte die Senatorentochter noch eben unter Schlaflosigkeit gelitten, so dauerte es jetzt nicht mehr lange, ehe die Müdigkeit auch sie überwältigte. Ihr Schlaf war tief und nur lauter Lärm würde sie jetzt noch aufwecken.
Es war schon weit nach Mitternacht, als mehr als nur ungewohnte Laute sie aus ihrem Schlaf holten. Öllampen erhellten den Schlafsaal und laute Schimpfworte hallten durch den Raum.
»Cacator!«3, brüllte ein älterer Mann, als ein Fuß ihn anstieß und zwang, sich umzudrehen. Julia öffnete die Augen und drückte sich an Volkert, der sich schläfrig aufrichtete.
Vier Legionäre in voller Rüstung hatten den Schlafsaal betreten. Angeführt wurden sie von einem dicken Mann in ziviler Tunika, der einen schweren Sack um den Gürtel trug, aus dem mit jeder Bewegung ein klimperndes Geräusch erklang.
»Männer!«, hallte seine Stimme durch den Saal. Mittlerweile hatte er die ungeteilte Aufmerksamkeit aller Erwachten. In vielen Gesichtern erkannte Volkert Angst. Er hatte keine Ahnung, was hier vor sich ging.
»Männer Roms!«, erhob der Dicke erneut seine bemerkenswert durchdringende Stimme. »Der Kaiser ruft Euch zu sich! Das Reich sieht sich größten Bedrohungen ausgesetzt! Valens, unser göttlicher Kaiser des Ostens, ist den räuberischen Horden gotischer Barbaren zum Opfer gefallen! Eine Schande, Römer, die uns alle betrifft! Eine Schande, die nur durch das Blut der Barbaren auf unseren Schwertern ausgelöscht werden kann! Männer Roms! Ich gebe Euch nun die Gelegenheit, Eurem Imperator zur Hilfe zu eilen und Eure Pflicht für das Imperium zu erfüllen!«
Der Dicke hielt inne und sah sich um. Trotz der schwachen Beleuchtung wirkte es so, als fasse er jeden der Anwesenden genau in den Blick. Auch Volkert fühlte sich von ihm unangenehm berührt, vor allem, da er jetzt eine gute Idee davon hatte, was eigentlich vorging.
Der Dicke war hier, um neue Rekruten für die römischen Truppen anzuwerben. An seinem Gürtel hing ein Beutel voller Gold, um jedem Freiwilligen das Handgeld zu zahlen, das ganz sicher dazugehörte, wenn man dem Angebot des Mannes folgte. Volkert kannte diese Art von Männern, er hatte sie zur Genüge in Deutschland getroffen, gerade jetzt … gerade damals … Der Fähnrich versuchte, die verschiedenen Zeitebenen nicht durcheinanderzubekommen, scheiterte aber schließlich. Jedenfalls schienen sich die grundsätzlichen Fähigkeiten und Methoden der Anwerber über die Jahrhunderte nicht verändert zu haben.
»Gold für jeden, der sich meldet!«, dröhnte die Stimme nun. »Regelmäßiger Sold, Land und Gut nach Ende der Dienstzeit. Hier jemand dabei, der noch kein römisches Bürgerrecht hat? Das gibt es dazu, am Ende der Dienstzeit für Euch, schon während Eurer Dienstzeit für Eure Kinder. Ruhm und Ehre könnt Ihr erwerben und sicher so manche Reichtümer, wenn die gegnerische Armee geschlagen vor Euch liegt und ihre Schätze zur Verteilung anstehen. Wer gar mehr sein möchte als ein einfacher Soldat, dem stehen viele Wege offen. Doppelter Sold für gute Handwerker. Für einen Schmied gar dreifacher. Für alle, die sich bewähren, Aufstieg in den Rängen. Hat nicht einst unser göttlicher Diokletian sich vom einfachsten Rekruten zum Kaiser hochgedient? Höchste Ehrungen und Ämter für die Erfolgreichen! Kehrt geehrt in Eure Dörfer zurück, befreit von allen Steuern und Abgaben! Es gibt kein besseres Leben und es gibt kein größeres Abenteuer!«
Die Stimme des Mannes war ohne Zweifel ein gut gestimmtes Instrument. Sie verband Pathos mit Schlitzohrigkeit, wirkte überzeugend, amüsant, ernsthaft, ironisch, ehrlich, je nachdem, was gerade benötigt wurde. Der Mann beherrschte sein Geschäft und Volkert war sich sicher, dass er für jeden erfolgreich angeworbenen Rekruten eine entsprechende Summe Goldes für seine »Bemühungen« erhalten würde.
Niemand im Schlafsaal der Herberge wirkte beeindruckt. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie es der Dicke gerne gehabt hätte. Es blieb die Furcht in den Zügen der Gäste, wie sie schweigsam und den direkten Blickkontakt meidend auf ihren Lagern saßen und alles taten, um nur keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Der Dicke seufzte und gab den vier Legionären einen Wink. Volkert verkrampfte sich, doch die Soldaten taten nichts anderes, als den Mittelgang zwischen den Liegestätten entlangzumarschieren und die Ruhenden kurz zu mustern. Dann drehten sie sich um und stellten sich mit unbeteiligter Miene hinter den Dicken.
»Nun gut«, grunzte dieser schließlich. »Aber wenn die Barbaren vor Eurem Haus stehen, Eure Frauen und Töchter vergewaltigen, Euer Hab und Gut plündern, Euer Anwesen in Brand stecken und Euch in die Sklaverei verschleppen, fleht nicht den Imperator um Hilfe an, denn dann seid Ihr selber schuld, habt Ihr das Reich doch in seiner schweren Stunde im Stich gelassen.«
Erstaunlich behände drehte sich der Mann auf dem Absatz um und verließ den Saal. Die Soldaten folgten ihm. Mit ihnen gingen die Lampen. Dunkelheit kehrte in die Herberge zurück, erleichtertes Flüstern erfüllte den Raum für kurze Zeit, bis sich alle wieder niederlegten und das allgegenwärtige Schnarchen zurückkehrte.
Julia hatte sich eng an Volkert geschmiegt und starrte noch minutenlang mit aufgerissenen Augen ruhelos in die Dunkelheit. Dann fielen auch ihr die Lider zu und sie begann, wieder in einen unruhigen Schlaf zu fallen.
Sie schreckte wieder hoch, als grobe Hände sie packten und zur Seite schoben. Sie schrie unwillkürlich auf, drückte die dünne Decke an ihren Körper. Schreie, Rufe, Gebrüll erklangen im Saal, als eine Gruppe grimmig dreinblickender Legionäre durch den Raum stapfte, vereinzelt Männer hochrissen, sie kurz begutachteten und dann in der Mitte des Saales zusammentrieben.
»Verdammt!«, rief Volkert auf Deutsch, als ein Berg von einem Mann ihn packte und mit einer bestechenden Leichtigkeit auf die Beine stellte. Ohne auf seinen Protest zu achten, wurde er gegen die Gruppe von mittlerweile sieben oder acht Männern geschleudert, die von drei Legionären mit vorgehaltenen Speeren in Schach gehalten wurden. Mit aufgerissenen Augen verfolgte Julia das Schauspiel. Es konnte keinen Zweifel mehr daran geben, was sich hier abspielte. Nachdem der friedliche und freiwillige Rekrutierungsversuch gescheitert war, hatte man zu anderen Mitteln gegriffen. Die Männer hier, alle für den Kriegsdienst einigermaßen brauchbaren, wurden mit Gewalt eingezogen.
Julia hatte davon gehört, weit entfernt von der Realität ihres Daseins hatte sie die Geschichten als bedauerlich empfunden und gleichzeitig die Notwendigkeit betont, um die Streitkräfte mit dem nötigen Personal zu versehen. Jetzt aber durchflutete sie ein Chaos von Entsetzen, Bitterkeit, Hilflosigkeit und wachsender Verzweiflung. Sie versuchte, die Tränen zurückzuhalten, als sie Volkerts hilflose Blicke sah. Die Legionäre hatten die »Rekruten« mittlerweile grob gefesselt und begannen, die Stricke mit einem langen Seil aneinanderzubinden. Es gab keinerlei Aussicht auf Flucht.
»So!«, durchdrang die Stimme des Dicken den Saal. »Ich habe gute Nachrichten für Euch, Männer: Ihr dürft dem Reich und Eurem Imperator dienen. Möglicherweise nicht ganz freiwillig, wie es aussieht.«
Ein meckerndes Gelächter, das gar nichts mit der rhetorischen Brillanz seines ersten Auftritts zu tun hatte, untermalte den Seitenhieb.
»Nur, damit eines klar ist: Ob freiwillig oder nicht, Ihr seid fortan Soldaten des Kaisers. Das heißt 25 Dienstjahre und all die wunderbaren Annehmlichkeiten, die ich Euch versprochen habe. Und natürlich auch die Gesetze: Auf Desertion steht der Tod. Wer Deserteuren hilft, stirbt ebenfalls.«
Der bohrende Blick des Dicken schien jeden der Rekruten zu fixieren. »Das ist klar? Soll ich es wiederholen? Wer wegläuft, wird hingerichtet! Wer Euch versteckt oder hilft, stirbt ebenfalls! Nur, damit niemand auf dumme Gedanken kommt. Arrangiert Euch mit Eurem Schicksal und Ihr könnt was draus machen. Kämpft dagegen an und Ihr werdet Eures Lebens nicht mehr froh. Sobald die Ausbildung vorbei ist, dürft Ihr Briefe schreiben und mit Eurer Familie in Kontakt treten. Sobald Ihr eine gewisse Dienstzeit absolviert habt, dürft Ihr heiraten. Geht alles, kein Problem. Wer schon verheiratet ist, meldet das im Lager dem Dekurio, dann gibt es möglicherweise bei gutem Benehmen bald eine Besuchserlaubnis.«
Volkert warf Julia einen langen, intensiven Blick zu. In ihm lag eine stumme, aber sehr intensive Botschaft. Sie verstand sie sofort und nickte. Fast schien es, als würde der junge Mann jetzt lächeln.
Was auch immer gerade geschehen war, es war sicher einer der entsetzlichsten Heiratsanträge in der Menschheitsgeschichte.
»Und jetzt los!«
Ein Legionär zog am Seil und die Rekruten, immer noch halb betäubt von den überwältigenden Ereignissen, folgten mehr oder weniger willig. Der gelegentliche Tritt eines anderen Soldaten brachte die Kolonne schließlich auf Trab, und so schnell, wie der Spuk begonnen hatte, war er auch vorbei.
Zurück blieben das Chaos zerwühlter Strohsäcke und fassungslos dasitzende Reisenden sowie ein entsetzt wirkender Herbergswirt, der hilflos und händeringend umherlief und nicht wusste, was er sagen oder tun sollte.
Und eine leise weinende Julia.
3
»Rheinberg hatte recht.«
»Ich höre diesen Satz viel zu oft.«
Gratian warf Arbogast einen milde tadelnden Blick zu. Der knurrige General senkte den Kopf in scheinbarer Unterwürfigkeit, aber er konnte seinen Imperator damit nicht täuschen.
Richomer hielt sich mit jedem Kommentar bedeckt. Er war erst im Feldlager eingetroffen, als Rheinberg und Becker ihre Demonstration bereits beendet hatten, aber er hatte sich von vielen – vor allem seinen Kameraden, die dem Spektakel aus der Nähe beigewohnt hatten – darüber berichten lassen. Der Kaiser schien den seltsamen Trierarchen und den mindestens genauso seltsamen Tribun oder Legat in Gnade aufgenommen zu haben, und das genügte als Information. Arbogast jedoch hatte die Angewohnheit, gegen die Fremden zu stänkern, keine Minute abgelegt und hatte offenbar auch nicht die Absicht, dieses Verhalten zu ändern.
»Jedenfalls ist es wahr«, bestätigte Richomer. »22 000 Tote, 8 000 Überlebende, eine ganze Reihe davon verletzt. Von den 8 000 sind sicher 2 000 Offiziere und Unteroffiziere, weniger als 6 000 einfache Legionäre. Wir haben demnach acht Legionen, davon aber jede mit mehr als der nötigen Anzahl an Offizieren. Flavius Victor hat das Oberkommando übernommen und sammelt die Truppen derzeit noch bei Adrianopel. Das ist aber kein gutes Aufmarschgebiet, denn die Goten halten sich immer noch in der Gegend auf.«
Richomer beugte sich über die große Karte des östlichen Reiches, die auf dem mächtigen Marmortisch in Gratians Zelt ausgebreitet war. Auf ihr konnte man leichter strategische Symbole platzieren als auf der aufgespannten Version im Hintergrund des Zeltes. »Der Heermeister schlägt daher Thessaloniki als Sammelpunkt für eine neue Armee vor.«
»Die Idee wäre nicht schlecht, wenn wir in aller Ruhe abwarten wollten, um einem neuen Feldherrn die Möglichkeit zu geben, sich im Osten zu organisieren«, kommentierte Malobaudes. »Doch die Ankunft Rheinbergs hat die Situation geändert. Der Trierarch ist der Ansicht, dass für langes Warten und übertriebene Vorsicht kein Grund besteht. Er schlägt vor, den Tribun Becker sogleich mit seinen Männern nach Thessaloniki zu entsenden, sich dort mit den Überlebenden zu vereinigen und die verbliebenen Legionen als Köder zu nutzen.«
Richomer sah von Malobaudes zu Arbogast und zurück.
»Als was?«
»Als Köder. Sie sollen so tun, als würden sie die Schlacht suchen. Fritigern soll sich angelockt fühlen, denn wenn er gegen 30 000 erfolgreich war, wird er wohl auch 8 000 schlagen können.«
»Damit hat er absolut recht«, murmelte Arbogast.
»Tatsächlich sollen sich die Legionen in einem vorbereiteten Schlachtfeld scheinbar bereithalten, sich beim Angriff der Goten dann aber sofort zurückziehen, das Schlachtfeld räumen und den Wunderwaffen Beckers die Chance geben, den Barbaren eine Lektion zu erteilen, die diese niemals vergessen werden.«
Richomer blickte wieder auf die Karte, als wolle er versuchen, durch das Studium derselben zu begreifen, was Malobaudes ihm da gerade erklärt hatte.
»Ich habe das aber richtig verstanden – dieser Becker hat keine Kohorte bei sich, ja?«
»Er sagt, er braucht nicht einmal alle seine Männer. Er benötigt nicht mehr als eine gute Schussposition, um seine Schützen so auszurichten, dass sie freies Schussfeld haben, selbst aber in Deckung bleiben. Er rechnet nicht mit vielen Verlusten, will aber unsere Männer als Leibgarde seiner Schützen einsetzen, sollten doch einige verirrte Goten durchbrechen. Dafür sollten sie noch gut sein oder, Richomer?«
»Die Moral ist tief gesunken«, gab dieser zu bedenken. »Ich glaube aber, dass ich schlicht nicht richtig verstehe, was diese Männer mit ihren Waffen anrichten können. So Ihr diesen Angriff befehlt, mein Imperator, werde ich alles tun, um Becker zu helfen.«
»Gut«, sagte Gratian, der der Diskussion bisher schweigend gefolgt war. »Ich werde Arbogast mitschicken, er soll das Kommando von Flavius Victor übernehmen, der immer noch verletzt ist. Ein paar Legionäre kann ich entbehren, aber ich muss so bald wie möglich wieder nach Westen marschieren, denn die Grenzen sind nicht sicher, wenn ich mich dort nicht aufhalte.«
»Was ist mit Theodosius?«, fragte Arbogast. »Er ist doch immer noch als Feldherr des Ostens vorgesehen!«
»Das ist er. Er wird sich auf den Weg machen, sobald ihn die Boten erreicht haben. Wenn Becker scheitert, wird er seine zukünftige Aufgabe hoffentlich mit Nachdruck verfolgen. Ist Becker erfolgreich, müssen wir uns über sehr viele Dinge ganz neu Gedanken machen.«
»Das denke ich auch!«
Alle Köpfe drehten sich herum. Im Zelteingang stand eine Gestalt, gewandet in einfache Reisekleider. Er benötigte keine Vorstellung und keine Legitimation. Jeder von Rang kannte den Mann mit seinem schiefen Gesicht.
Gratian erhob sich. »Ambrosius!«
»Mein Imperator!«
»Welch eine Überraschung und Freude!«
»Ich bin willkommen?«