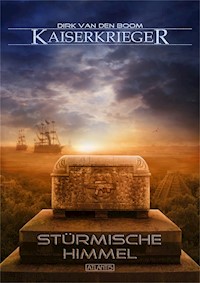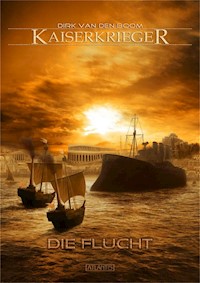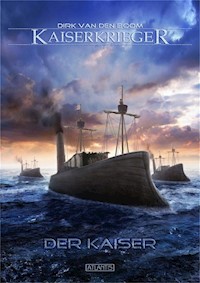Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Urlaub – diese neue Möglichkeit zu nutzen, ist Tribun Ackermann bisher nie in den Sinn gekommen. Aber als sich die Möglichkeit ergibt, zusammen mit seiner Verlobten Lucrecia einige schöne Tage bei Verwandten auf Capri zu verbringen, schlägt er diese nicht aus. Was wie ein entspannter Aufenthalt beginnt, wird schnell zu harter Arbeit, denn ein Mord erschüttert die Beschaulichkeit seiner Reise – und dieser versetzt die ganze Insel in helle Aufregung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Weitere Atlantis-Titel
Dirk van den Boom
Kaiserkrieger Vigiles: Urlaub auf Capri
1
»Das Konzept des Urlaubs ist mir fremd.«
Ackermann sah Lucrecia an. Er wunderte sich nicht. Ihm selbst war dieses Konzept nur oberflächlich vertraut. Er sah von der Dachterrasse ihres Lieblingsrestaurants hinunter auf das in der Abenddämmerung stinkende Rom und versuchte, das Bedürfnis, tief Luft zu holen, so weitgehend wie möglich zu unterdrücken. Egal was die Stadtbehörde an Umbauten und Modernisierungen durchführte, die Sache mit der Kanalisation funktionierte weiterhin nur bei den Reichen, die es sich leisten konnten, ihre Scheiße bei den Armen abzuladen. Wenn der Wind aus der falschen Richtung kam oder, wie jetzt, schlicht im Tal zwischen den sieben Hügeln hängen blieb, war es nur mit Mühe zu ertragen. Ackermann hatte sich daran gewöhnt, aber es blieb unangenehm, vor allem wenn man eigentlich ein schönes Abendessen genießen wollte.
»Es ist auch zu meiner Zeit neu gewesen«, sagte er in einem weiteren Versuch, sein Erlebnis als Zeitreisender in passende Grammatik zu kleiden.
Lucrecia sah ihn strafend an. »Dies ist deine Zeit.«
»Ich meine diejenige, aus der ich stamme. Für Beamte – also Staatsbedienstete – wurde er reichsweit erst 1908 eingeführt. Und viele haben ihn gar nicht in Anspruch genommen, weil es nicht gerade als karrierefördernd galt.«
»Das ist in etwa 1500 Jahren«, wies Lucrecia auf ihre Fähigkeiten im Kopfrechnen hin.
Ackermann nickte. »Wir sind unserer Zeit jetzt eben voraus. Das kaiserliche Edikt sieht vor, dass alle Staatsbeamten acht freie Tage im Jahr bekommen, ohne Einbußen beim Salär zu erhalten. Darüber hinaus können weitere sechs Tage unbezahlten Urlaub gewährt werden. Für Beerdigungen zum Beispiel. Oder Hochzeiten.« Ackermann warf einen bezeichnenden Blick auf seine Verlobte, die den Hinweis mit einem bezaubernden Lächeln zur Kenntnis nahm.
»Und wer gewährt?«
»Der Dienstvorgesetzte.«
»Und wer ist das bei euch?«
»Na – ich!«
Lucrecia nickte bedeutungsvoll. »Nun, wenn das so ist, kannst du dir selbst Urlaub genehmigen. Das ist ausgesprochen praktisch. Ich mag die Idee.«
»Vor allem kann ich ihn mir vorenthalten«, kommentierte Ackermann und nahm einen Schluck Wein. Wo Lucrecias Verwandter diesen Tropfen herbekam, war ein gut gehütetes Geheimnis der Familie und auch Ackermann war bisher immer nur darauf hingewiesen worden, dass er, um ihn zu trinken, eben hierherkommen musste. Einen Weinhändler in der weiteren Verwandtschaft zu haben, war nicht so hilfreich, wie Ackermann sich das ausgemalt hatte.
»Und damit bist du aufgefallen?«, fragte die Frau.
Der Mann zuckte mit den Schultern. »Irgendwann hatten alle ihren Urlaub genommen, nur ich nicht. Da kam ein Bote des Ministeriums vorbei. Ein Schreiben aus dem Konsistorium. Die freundliche Bitte, ich solle doch an meine Gesundheit denken und in allem meinen Leuten ein Vorbild sein. Auch in Bezug auf die Entspannung.« Ackermanns Gesicht war anzusehen, was er von dieser Idee hielt.
Lucrecia sah ihn zweifelnd an. »Aber du willst nicht?«
»Es gibt viel Arbeit.«
»Die gibt es immer.«
»Ich wüsste gar nicht, was ich tun sollte.«
»Wir könnten verreisen. Ich finde den Gedanken faszinierend. Ich könnte meinen Marktstand an Kusine Emilia übergeben, die hat das schon öfters gemacht und gibt sich mit einem Prozentsatz der Einnahmen zufrieden. Meist schickt sie eh ihre Tochter. Für ein paar Tage oder Wochen ginge das. Sie sind keine Diebe. Ja.« Lucrecias Gesicht bekam einen nahezu träumerischen Ausdruck. »Eine Reise. Ich habe noch nie eine richtige Reise gemacht, nur so aus … Spaß! Es wäre einen Gedanken wert. Es käme natürlich auf das Ziel an.«
Ackermann sah seine Geliebte stirnrunzelnd an. »Eine Lustreise? Ein gewagter Gedanke. So was machen Kaiser, wenn sie nicht gerade andere Länder besuchen, um sie zu erobern und auszuplündern.«
»Jeder sucht sich seinen eigenen Spaß.«
»Acht Tage reichen für eine Reise nicht – jedenfalls solange die Eisenbahn nicht fertiggestellt wurde. Wir könnten natürlich in irgendein Dorf in der Nähe von Rom. Immerhin würde es da nicht so stinken. Das wäre schon eine ziemliche Erholung. Ein Ort, wo man schnell hinkommt und …«
»… einen die Kollegen schnell erreichen, wenn etwas ist. Nein, nein, nein.« Lucrecia sagte es dreimal und dreimal kam es unmissverständlich bei Ackermann an.
»Wohin dann?«
»Capri.«
Ackermann lehnte sich zurück. Nur das eine Wort? Er wartete auf weitere Erläuterungen, doch Lucrecia ließ sich bitten.
»Was meinst du?«
»Capri. Nur vier Meilen vom Festland. Wir reisen nach Neapel und setzen dann über.«
»Wir beide also? Du würdest in jedem Fall mitkommen?«
»Du möchtest deinen Urlaub alleine verbringen?«
»Ähm … nein. Ich dachte, das Konzept sei dir fremd?«
Lucrecia lächelte. »Ich bin bereit zu lernen. Und Capri ist gut. Dahin würde ich dich begleiten, mein Liebster.«
Ackermann sah sie forschend an, dann seufzte er. »Acht Tage sind immer noch zu wenig, um nach Neapel …«
»Vierzehn. Du musst ja für die Reise nicht auch noch bezahlt werden, oder?«
»Aber …«
»Fehlt dir das Geld?«
Ackermann schüttelte den Kopf. Ihm fehlte es absolut nicht an Geld. Neben seinem ordentlichen Gehalt als hoher Staatsbeamter erhielt er noch die Apanage, die alle Zeitenwanderer ausbezahlt bekamen. Er hatte gar keine Zeit, das Geld auszugeben. Er lagerte es in einer Truhe in seinem Büro, dem sichersten Ort in Rom nach dem Kaiserpalast. In der Tat hatte sich mit der Zeit da so einiges angesammelt. Und er war nur in Bezug auf Lucrecia großzügig, die aber ihr eigenes Geld verdiente und ihm nicht auf der Tasche lag. Er wusste gar nicht, wohin mit all den Münzen, um ehrlich zu sein.
Sechs unbezahlte Urlaubstage würden kein großes Loch in sein Vermögen reißen.
»Nein«, sagte er also wahrheitsgemäß. Lucrecia anzulügen, war etwas, das er sich für besondere Momente aufbewahrte, nicht zuletzt deswegen, weil es für eine erfolgreiche Schwindelei erheblicher Anstrengung bedurfte. Sie kannte ihn mittlerweile zu gut, um sich allzu leicht an der Nase herumführen zu lassen.
Lucrecia war nun Feuer und Flamme und begann, Pläne zu machen, indem sie Ackermann ihre Entscheidungen mitteilte, die übliche Weise, in der sie ihn in diese Dinge mit einbezog. Da es um eine letztlich angenehme Sache ging, in Bezug auf die Ackermann auch nicht mehr wusste oder Präferenzen hatte als sie, war das absolut in Ordnung. Es war gut, einmal Verantwortung abgeben zu können.
»Vierzehn Tage. Es gibt eine gute Straße von hier nach Neapel und wir nehmen eine der neuen Schnellkutschen. Ich würde sagen, zwei Tage bis zum Hafen. Oder wir nehmen einen der Küstensegler. Dann setzen wir über, das geht schnell. Ich würde sagen, mit etwas Glück haben wir zehn Tage auf Capri. Wir werden uns schnell langweilen, darauf freue ich mich schon. Müßiggang. Wir werden es irgendwann hassen.«
Ackermann war sich da nicht so sicher.
»Warum Capri?«
»Es ist schön dort. Mildes Klima. Kaiser Tiberius mochte es.«
»Es heißt, er mochte vor allem die Abgeschiedenheit seiner Villa, um allerlei Ferkeleien anzustellen.«
Lucrecia sah Ackermann tadelnd an. »Sueton war ein Propagandist. Und er hatte zu viel Fantasie, wie alle alten Männer, die nicht mehr können, es aber nicht wahrhaben wollen.«
Ackermann beließ es dabei. Es war nicht wichtig.
»Ich habe Verwandte auf Capri«, kam Lucrecia nun zum Kern der Sache. »Es sind Fischer. Keine armen Leute. Sie haben ein Haus. Wir genießen dort Gastfreundschaft. Wenn wir ein paar Münzen mitbringen, sogar sehr viel Gastfreundschaft. Du wirst meinen Cousin Marcus mögen. Er redet kein Wort und tut im Regelfall, was ihm seine Frau sagt.«
Ackermann hatte zwar den Eindruck, dass Lucrecia Marcus vor allem aufgrund dieser Eigenschaften schätzte; die Tatsache allein, dass er auch dies nicht zu kommentieren wagte, zeigte ihm jedoch, wie ähnlich er und der Fischer von Capri sich bereits gekommen waren.
»Du hast dir ja richtig Gedanken gemacht«, sagte er anerkennend.
»Ist das so ungewöhnlich?«
Ackermann verbarg sein Gesicht im Weinglas. Das war eine Fangfrage und er war gut beraten, sich die Antwort erst einmal genau zu überlegen. Der Abend hatte so schön angefangen, er wollte ihn sich nicht unnötig verderben.
»Keinesfalls«, sagte er also, die beste Antwort unter diesen Umständen. »Capri also. Ich stelle es mir sehr entspannend vor.«
Für einen Moment warf ihm die Dame seines Herzens einen kritischen Blick zu, geradeso als müsse sie sich noch genau überlegen, wie sie diese Antwort zu verstehen hatte. Ackermann steckte sein Gesicht ein zweites Mal in den Weinkelch, um ihr keinen Anlass dafür zu geben, seinen Ausdruck genau bewerten zu können. Sie war eine gute Beobachterin.
Ein Kellner erschien und brachte zwei Teller, auf denen frische Muscheln angerichtet waren.
»Mit der Empfehlung des Hauses«, sagte der Mann und schaute Ackermann vielsagend lächelnd an. Der Tribun war Stammgast und er war bereits so etwas wie eine lokale Berühmtheit. Der Wirt war der Ansicht, es sei eine gute Idee, sich den Mann warmzuhalten, und nein, es gab noch keine Gesetze, die Ackermann die Annahme von kostenlosen Mahlzeiten verboten.
»Danke«, erwiderte dieser etwas einsilbig. Als Lucrecia ihn mit dem gleichen vielsagenden Lächeln anschaute, räusperte er sich.
»Ich weiß, was man Muscheln nachsagt«, erklärte er, um Würde bemüht.
»Es ist mehr als nur ein Gerücht.«
»Das bezweifle ich. Wie so viele Hausmittel, steht auch dieses durchaus unter Zweifel. Außerdem …«
Er unterbrach sich. Beinahe hätte er etwas Falsches gesagt.
»Außerdem?«, hakte Lucrecia nach, nahm eine Muschel, hielt sie waagerecht vor sich, spitzte die Lippen und sog das glibbrige Innenleben mit einem betont lauten Schlürfen in sich hinein. »Außerdem?«, wiederholte sie danach noch einmal, diesmal mit einem sehr unschuldigen Tonfall.
Ackermann wusste, dass er in der Falle steckte. Er war normalerweise nicht um Worte verlegen, aber diesmal suchte er vergeblich nach einer Ausrede.
»Außerdem«, sagte Lucrecia nun und beugte sich vor, um leise fortzufahren: »… bist du noch nicht in dem Alter, in dem du Hilfsmittel nötig hättest, richtig? Kein Sueton, der bitter über die Eskapaden anderer schreibt, weil er sie selbst nicht mehr genießen kann.«
Ackermann räusperte sich.
»Wenn du es sagst.«
»Du hast das sagen wollen.«
»Das streite ich ab.«
»Also benötigst du Hilfsmittel?« Lucrecia sah auffordernd auf die Muscheln, die noch unberührt vor Ackermann standen.
»Nein. Ich mag keine Muscheln.«
Das war gelogen, in dieser Situation aber der bestmögliche Ausweg aus einer unangenehmen Lage.
Lucrecia hob eine weitere zu ihrem Mund.
»Vielleicht hilft es ja bei mir«, sagte sie leise. »Ich fühle mich alt und wenig begehrenswert.«
Ackermann wurde bleich. Er musste darauf antworten, er kam aus der Sache nicht mehr raus.
Zwei Wochen Urlaub. Das konnte und würde nicht gut ausgehen.
2
»Urlaub?«
Iocers Lippen formten das Wort mehrmals stumm, ehe er es laut aussprach. Es war, als ob er sich erst zu vergewissern hatte, dass es tatsächlich existierte oder nicht explodieren würde, wenn er es aussprach. Eine schöne Show, ostentativ, allein um die tiefe Kritik des Untergebenen am verschwenderischen und faulen Lebensstil des Vorgesetzten zum Ausdruck zu bringen, ohne es in so viele Worte zu kleiden.
Ackermann sah ihn lächelnd an. Für viele Angestellte des Reiches war das Konzept neu und es war ja auch nicht so, dass ihnen besonders viele freie Tage zustanden. Aber Iocer war der Allererste gewesen, der einen Antrag gestellt hatte, als das Gesetz verkündet worden war. Er war darin ein leuchtendes Vorbild für seine Kollegen gewesen, die dem Beispiel gerne gefolgt waren. Seine Missbilligung verlor dadurch ein wenig an moralischer Berechtigung.
Für all jene, die nicht das Glück hatten, für den Staat zu arbeiten, war der Gedanke an Freizeit – bezahlte noch dazu! – relativ absurd. Es gab allerdings Ausnahmen. Das stetig wachsende Firmenimperium der Kompagnons Behrens und Köhler beispielsweise gab den eigenen Mitarbeitern nach zwei Jahren Bewährungszeit sechs Tage Urlaub im Jahr, und diese bezahlt. Darüber hinaus gab es eine Liste an möglichen Sonderurlauben, etwa bei sehr wichtigen familiären Ereignissen. Die Arbeiter in den Brennereien, Brauereien und Kafferöstereien schienen sich an dieses Konzept schnell gewöhnt zu haben. Jemand wie Iocer ebenfalls, der zwar durchaus pflichtbewusst war und sich auch zur Arbeit schleppte, wenn er krank war, der aber auch äußeren Einflüssen unterlag.
Es war nämlich keinesfalls so, dass seine Frau etwas gegen gemeinsam verbrachte Freizeit einzuwenden gehabt hätte. Als Lehrerin an einer der neu gegründeten staatlichen Schulen genoss Claudia eine noch großzügigere Regelung. Dass sie ihre freien Tage nicht alleine verbringen wollte, sondern die Gestaltung der Freizeit als gemeinsame Aufgabe sah, hatte Iocer bemerkenswert schnell eingesehen.
War Urlaub für viele also bereits ein schwer zu vermittelndes Konzept, eine Urlaubsreise war beinahe sicher nur unverständliches Gebrabbel. Solche Lustreisen waren etwas für Kaiser und Senatoren oder deren Angehörige, für die untätigen Gattinnen reicher Leute, für wohlhabende Tunichtgute. Aber ein Vigiles, jemand wie Ackermann? Iocer verreiste nicht. Er saß zu Hause und war froh, wenn man ihn in Ruhe ließ. Ackermann hingegen hatte seine hochfliegenden Pläne freimütig beschrieben. Das forderte die Konsternation des Kollegen am meisten heraus.
»Das ist doch Lucrecias Idee«, kommentierte er weitsichtig.
»Sie hat ohne Zweifel etwas damit zu tun«, gab Ackermann unumwunden zu.
»Sie manipuliert dich.«
»Sie ist eine Frau. Ebenso wie Claudia. Müssen wir das ausdiskutieren, mein Freund?«
Als ob damit alles gesagt wäre, ging Ackermann am Kollegen vorbei in Richtung seines Büros. Kurz bevor er die Tür hinter sich schloss, lugte er noch einmal hervor, sah Iocer an und sprach: »Wenn ich fort bin, bist du hier der Chef. Bereite mir keine Schande!«
Dann schloss er die Tür vollends. Ackermann gestattete sich ein feines Lächeln. Iocer war noch jung und er würde sich ändern. Er brauchte nur noch ein wenig Zeit. Dann stand auch seine erste »Lustreise« auf dem Programm.
Ackermann warf einen prüfenden Blick auf die Akten, die sein Büro füllten, als würden sie nur darauf warten, mit einem Mal über ihn herzufallen. Jede enthielt einen Fall, nicht nur aktuelle, sondern auch bereits abgeschlossene – und jene, die sie abschließen würden, ohne jemals zum Täter vorzudringen. Diese Akten behielt er dauerhaft im Auge, sie waren eine Mahnung, die ihn an die immer noch eklatanten Unzulänglichkeiten erinnerte, unter denen die Vigiles operierten.
Er hatte nicht viel Gelegenheit, sich mit den Akten zu befassen. Zum einen ließ ihn der Gedanke nicht los, dass ein Urlaub, zu dem er sich mehr hatte überreden lassen, als dass er von der Notwendigkeit überzeugt war, im Grunde genommen Verrat sei. Natürlich schalt er sich einen Narren, und das wiederholt. Andererseits war eine so lange Abwesenheit von seinem Arbeitsplatz auch das Eingeständnis einer Niederlage. Wenn er denn zurückkam und hier alles seinen gewohnten Gang gegangen war, bedeutete dies vor allem eines: dass er nicht halb so unentbehrlich war, wie er gerne annahm. Das würde eine nur schwer zu verkraftende Erkenntnis sein, sodass er beinahe darauf hoffte, dass irgendeine Katastrophe hereinbrach, die nur er hätte abwenden können. Ein böser Gedanke, für den er sich sogleich schämte.
Zum anderen beunruhigte ihn jetzt, und das mehr, als er sich eingestehen wollte, die Aussicht auf ungestörte Wochen in trauter Zweisamkeit mit Lucrecia. Seine Gefühle für sie waren sehr ernsthafter Natur und er zweifelte auch keinesfalls an ihren ehrlichen Absichten. Aber es war das eine, sich einige Stunden in der Woche zu sehen, sorgfältig arrangiert beim Essen, beim Theater oder beim Besuch bei Verwandten, die nach Ackermanns Schätzungen gut die Hälfte der stetig anwachsenden Bevölkerung Roms ausmachten. Es war jedoch ganz etwas anderes, tagelang und ohne große Ablenkung aufeinander zu sitzen. Man lernte sich dann auf eine Art und Weise kennen, die Unzulänglichkeiten und Kritikwürdiges auf deutliche Weise offenbar werden ließ, ein Vorgeschmack auf das, was Lucrecia bereits mehrmals vorsichtig angedeutet hatte: die Gründung eines gemeinsamen Hausstands in nicht allzu ferner Zukunft.
Das war nichts, was Ackermann mit großer Zuversicht erfüllte. Er war ein selbstkritischer Mann und manchmal ging er vielleicht sogar etwas zu hart mit sich selbst ins Gericht. Aber er wusste auch, dass er manche Wesenszüge an anderen Menschen nur schwer ertrug, und hegte die stille Angst, dass er eventuell einen solchen an Lucrecia entdecken würde. Oder, möglicherweise noch schlimmer, sie etwas an ihm, das ihr bisher entgangen war und ihren Enthusiasmus deutlich zu mindern imstande war.
Das wäre sicherlich gut geeignet, ihm den Urlaub zu verderben. Ein Gedanke, den er zu verdrängen suchte, so gut es ging, der sich aber hartnäckig wieder meldete, sobald er seinen Überlegungen zu wandern erlaubte. Beinahe bereute er es, Lucrecia so leichtfertig zugesagt zu haben. Vielleicht fand sich noch eine passende Ausrede. Ein dringender Fall. Kollegen, die krank geworden waren, ein plötzlicher Engpass. Ein Ruf in den Palast, eine delikate Angelegenheit. Sicher könnte er, ausreichend schauspielerisches Talent vorausgesetzt, eine überzeugende Ausrede präsentieren. Doch zum einen bestand die Gefahr, dass Lucrecia es herausfand – und sie wurde immer besser darin, je mehr von Ackermanns Kollegen sie kennenlernte –, und zum anderen würde er mit großer Wahrscheinlichkeit ein schlechtes Gewissen entwickeln, das an ihm nagen würde, bis er mit der Wahrheit herausplatzte. Die Konsequenzen wollte er sich gar nicht erst ausmalen.
Also blieb keine Wahl. Er hatte sich in die Sache hereinmanövriert und musste sie jetzt ausbaden.
Vielleicht, sagte er sich dann, wurde es ja sogar ganz nett. Es war ja nicht so, dass er keine Ruhe brauchen würde. Er war es nicht gewohnt, sicher, aber das hieß ja nicht, dass er es nicht lernen konnte. Auch Urlaub konnte man lernen. Bestimmt.
Er schaute hoch, als jemand an der Tür klopfte und eintrat, ohne dass er geantwortet hätte. Es war Iocer, der weitere Akten in der Hand hielt und dabei ein maliziöses Lächeln trug, das in Ackermann sogleich großes Misstrauen auslöste.
»Ich habe etwas für dich«, sagte der Ermittler und ließ die Dokumente mit einer feierlichen Geste vor seinem Chef auf den Schreibtisch gleiten. »Wegen des Urlaubs.«
Ackermann konnte nicht anders und griff zu. Es waren einige dünne Ordner mit Fällen – um das zu erkennen, musste er nicht einmal einen aufschlagen – und sie stammten offenbar nicht aus Rom.
»Was ist das?«
»Das Ergebnis des neuen Polizei- und Fallregisters, das auf Anweisung des weisen Tribuns Ackermann seit einigen Monaten alle Dienststellen der CVN miteinander verbindet.«
Ackermann schlug den ersten Deckel auf. Er überflog die ersten Zeilen, dann verdüsterte sich sein Gesicht. Er schlug den Ordner wieder zu, ohne auch nur ein weiteres Wort gelesen zu haben. »Du bist gehässig, Iocer«, sagte er dann. »Unbearbeitete Fälle der Kollegen aus Capri? Weißt du nicht, was passiert, wenn ich mich ernsthaft mit diesen Dingen befasse? Oder was Lucrecia mit mir macht, wenn sie das merkt?«
»Es gibt überall im Reich jetzt diese Dienststellen voller unerfahrener Vigiles, die außer Bränden nichts löschen können und die trotz aller langsam beginnenden Bildungsmaßnahmen dringend etwas Unterstützung beim Detektivspielen brauchen können. Zumindest bis auf Weiteres. Bis wir alle befördert werden und Leitungspositionen im Reich einnehmen und endlich Ordnung in die Sache bringen können.«
»Davon träumst du?«
Iocer verzog das Gesicht. »Es wird so kommen. Wir wissen beide, wie die Situation ist. Wenn es so weit ist: Claudia möchte gerne nach Griechenland, aber nicht Konstantinopel.«
Ackermann wollte etwas sagen, besann sich dann aber eines Besseren. Sein Kollege hatte ja recht. Der Aufbau der CVN im ganzen Reich lief nur sehr schleppend voran, was vor allem am Mangel an geeignetem Personal lag. Es war nur eine Frage der Zeit, dann würde man die römische Abteilung schlachten und die Leute in alle Winde verstreuen, damit sie entsprechende Dependancen aufbauen oder verstärken konnten. Ackermann machte sich da keine Illusionen: Seine Behörde in der Hauptstadt wurde nur deswegen in allem unterstützt, da sie als Durchlauferhitzer für das Leitungspersonal im restlichen Reich diente. Iocer durfte also tatsächlich auf Beförderung hoffen. Vielleicht wurde sogar etwas aus Griechenland.
Ackermann widmete sich wieder den Akten vor ihm. Die Tatsache, dass Iocer ihm diese mühevoll herausgesucht hatte, würde sich negativ auf dessen Beförderungschancen auswirken. Denn dies hier waren letztlich Hilferufe überforderter Vigiles, die irgendwie zuständig wurden, aber mit dieser Verantwortung rein gar nichts anzufangen wussten.
Und wenn sie erfuhren, dass der berühmte Tribun Ackermann sich auf ihrer Insel befand, dann war beinahe unvermeidlich, dass er höflichen Besuch bekommen würde, mit vielen, vielen höflichen Fragen und der Einladung, doch mal bei den CVN Capris vorbeizusehen, wenn er in der Nähe sei. Absolut unvermeidlich.
Ackermann warf Iocer einen vernichtenden Blick zu.
»Lucrecia wird mich töten«, murmelte er.
»Wer kommt auch auf die Idee, Urlaub zu machen?«, versetzte Iocer, drehte sich um und ging.
Töten, dachte Ackermann. Es würde interessant sein zu erfahren, wie die Vigiles mit ihrer neuen und ungewohnten Arbeit auf der Insel umgingen. Wie schade nur, dass er es dann nicht mehr beobachten konnte, weil er dann selbst zum Opfer eines Mordes geworden war.
Er legte die Akten beiseite. Er würde Iocer nicht auf den Leim gehen. Das alles ging ihn absolut nichts an.
3
Es war nicht so, dass die Reise nach Capri ereignislos gewesen wäre. Der Küstensegler, der die Insel regelmäßig ansteuerte, war ein Schiff, das neben allerlei Waren bis zu zehn Passagiere mit an Bord nehmen konnte. Nicht Ackermann hatte die Passage gebucht, sondern Lucrecia, die einige Händler kannte, von denen der eine oder andere ihr etwas schuldete oder mit ihr verwandt war oder beides. Jedenfalls waren sie sehr freundlich an Bord begrüßt worden und Ackermann fragte nicht nach, warum eigentlich.
Die Passagiere waren aus unterschiedlichen Gründen unterwegs. Es waren naturgemäß keine Urlauber dabei, da sich dieses Konzept noch nicht sehr weit durchgesetzt hatte, die meisten waren Geschäftsreisende oder Beamte auf dem Weg zu neuen Positionen im Staatsdienst. Bis auf Lucrecia waren sie alle Männer, reisende Frauen gehörten immer noch zu einem eher seltenen Anblick, obgleich an der Höflichkeit und Fürsorge der Schiffsbesatzung kein Mangel war. Immerhin waren sie zahlende Passagiere, bewohnten eine eigene, wenngleich düstere und enge Kabine unter Deck. Wie alle anderen bevorzugten sie es jedoch, die Tage im Freien zu verbringen. Waren sie nicht gerade damit beschäftigt, der Mannschaft im Weg zu sein, saßen sie unter einem Sonnenschutz, genossen die frische Seeluft und die Wärme, aßen und tranken – nicht alle von ihnen, da einige Opfer der Seekrankheit wurden – und verbrachten im Grunde die ersten Urlaubstage, denn von großartiger Anstrengung konnte nicht die Rede sein. Ackermann genoss die See. Er war kein Seemann wie viele andere auf der Saarbrücken, sondern ein Polizist und Infanterist, aber die Zeit auf dem Kreuzer hatte ihm das Wasser zumindest näher gebracht als vorher und er stellte mit Freude fest, dass er immer noch Seebeine hatte – auch wenn es mal etwas stärker zu schaukeln begann.
Zwei der Passagiere, Vitellus und Victor mit Namen, erwiesen sich als besonders gesprächsbereit. Es handelte sich um einfache Beamte der Inselverwaltung, die in Rom gewesen waren, um eine neue, faszinierende Facette der kaiserlichen Reformen zu erleben: die von Fortbildungen. Neue Gesetze und Regelungen erforderten Beamte, die in diesen versiert waren, niemand wusste das besser als Ackermann. Eine Akademie war zu diesem Zweck errichtet worden, eine zweite in Konstantinopel und eine dritte, im Aufbau befindliche, in Treveri. Dorthin wurden Beamte geschickt, die einer kleinen Auffrischung ihrer Kenntnisse bedurften. Es war nicht einmal notwendig, sie dazu zu zwingen: Da künftige Beförderungen im ebenfalls gründlich reformierten Beamtendienst, der nun klare Laufbahnen und Dienstränge kannte, von absolvierten Fortbildungen mit abhängig gemacht wurden, gab es genügend Bewerber auf die diversen Lehrgänge. Damit entstand auch eine ganz eigene, neue Reiseindustrie, abgestellt auf Staatsbedienstete, die zu Kursen und Lehrgängen unterwegs waren.
Vitellus und Victor hatten eine besondere Preziose unter diesen Exerzitien der Wissensvermittlung genossen: Sie waren nun geschult im öffentlichen Haushaltswesen. Es war nicht so, dass die Römer es in diesem Bereich schon vor der Ankunft der Zeitenwanderer nicht bereits zu höchster Perfektion gebracht hätten. Die Freuden der imperialen Budgetverwaltung waren durch die Einführung modernster Methoden unter Kaiser Thomasius aber noch einmal potenziert worden – ebenfalls eine Tatsache, die Ackermann als Leiter einer stetig wachsenden Behörde zu bezeugen in der Lage war.
Bereits Kaiser Augustus machte dem fiskalischen Lotterleben der Republik ein Ende, indem er ein rationarium, einen Haushaltsplan, sowie ein breviarium totius imperii, eine Reichsfinanzstatistik, zusammenstellen ließ. Damals aber gab es nur begrenzte Haushaltsposten, allen voran natürlich das Militär, davon abhängig die Veteranenversorgung, öffentliche Bauten sowie, sehr wichtig, Brot und Spiele für die Bürger der großen Metropolen Rom und Konstantinopel. In all diesen Bereichen und in einigen zusätzlichen waren durch die Reformen, die bereits unter Rheinbergs Anleitung zu Lebzeiten Kaiser Gratians initiiert worden waren, die Ausgabenpositionen mehr geworden und ebenso die darin enthaltenen Summen. Die technologische Revolution, die das Imperium nun in großem Umfang umwälzte, war nicht ohne Kosten zu bekommen. Beamte bis hinunter in einfachste Positionen waren daher angehalten, sparsam und effizient mit den Geldern umzugehen. Und was war besser dafür geeignet, als die neue Imperiale Römische Haushaltsordnung, wenn möglich, gleich auswendig zu können.
Zu den besonderen Feinheiten gehörte in diesem Kontext die Einführung der doppelten Buchführung auch für staatliche Ausgaben. Grundlage dafür war die Abhandlung eines ganz besonders eifrigen Beamten, der auf der Basis mancher Unterweisung durch den Zahlmeister der Saarbrücken ein Werk namens Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita verfasst hatte. Dem guten Mann war Ackermann vor nicht allzu langer Zeit begegnet, als es um Fragen der Budgetabrechnung der CVN gegangen war. Stephanus Naericus war an sich ein netter Kerl, soweit Ackermann das hatte beurteilen können. Er gehörte aber gerade im sich reformierenden öffentlichen Dienst des Reiches nicht unbedingt zu den beliebtesten Menschen. Vitellus und Victor schienen das neue Wissen allerdings mit einem gewissen Gleichmut zu akzeptieren, was sicherlich auch damit zusammenhing, dass man den gelehrigen Beamten Ausflüge in das römische Nachtleben gestattet hatte, was, wie Ackermann wusste, sicher die eine oder andere Vergnügung bereithielt, die auf Capri eher schwer und vor allem nicht ganz so anonym zu genießen war.
Es war beruhigend, dass es die Syphilis zu dieser Zeit noch nicht gab. Die beiden Beamten waren verheiratet und hatten das mit der Keuschheit jenseits des ehelichen Bettes ganz sicher nicht allzu ernst genommen. Anders ließ sich ihre enthusiastische Beschreibung ihres Lehrgangs und ihre eher zurückhaltende Begeisterung für die nahende Heimkehr nicht erklären.
Capri war kein armer Ort. Die Steuereinnahmen mussten nicht unerheblich sein. Auf den zahlreichen terrassenförmig angeordneten Ebenen wurden allerlei landwirtschaftliche Produkte angebaut, das gleichbleibend milde und durchweg freundliche Klima war der Landwirtschaft sehr zuträglich. Darüber hinaus wurden die zwölf Villen des Tiberius weiterhin von staatlicher Seite verwaltet, zu ihnen gehörten Land und Wirtschaftsbetriebe. Unter Thomasius hatte man damit begonnen, manche dieser staatlichen Besitzungen zu Geld zu machen, um durch den Verkauf des Tafelsilbers die belasteten öffentlichen Haushalte zu sanieren. So mancher Mann von Reichtum würde sich daher wohl in Bälde auf der Insel in einer der alten Villen niederlassen können. Ein reizvoller Gedanke, den Ackermann aber für sich behielt. Er verdiente nicht schlecht in seiner Position, aber er war leider so gar nicht korrupt, wodurch ihm die zentrale Einnahmequelle vieler Beamter verschlossen blieb. Eine Villa auf Capri jedenfalls würde er sich niemals leisten können. Das war aber auch nicht nötig.
Lucrecia hatte hier ja Verwandte. Sie kamen schon unter. Zumindest hatte sie das behauptet und es gab für Ackermann keinen Grund, es nicht zu glauben.
Als sie in den kleinen Hafen der Insel einliefen, nach einer nicht besonders langen Überfahrt, da ihr Ziel gerade fünf Kilometer vom Festland entfernt lag, bedauerte Ackermann beinahe, dass die Reise ein Ende gefunden hatte. Unterwegs zu sein, bedeutete zwar eine gewisse Anstrengung, aber sie enthob ihn aufgrund der begrenzten Möglichkeiten auch von jedem Freizeitstress. Nun aber, mit der Insel als Hinterhof und einer energischen Gefährtin an seiner Seite, war zu erwarten, dass er Dinge tun, betrachten oder sonst wie genießen sollte, und das mit einem gewissen Enthusiasmus, den aufzubringen er doch eher schwierig fand. Er machte jedoch gute Miene zum gar nicht einmal bösen, wahrscheinlich aber doch recht anstrengenden Spiel.
Lucrecias Verwandte erwarteten sie natürlich nicht am Hafen, da niemand genau wissen konnte, wann jemand eintraf. Zum Glück war die Hafenstadt eher ein Hafendorf und die Straßen so übersichtlich, dass sie mit zwei angeheuerten Trägern, die sich ihres Gepäcks bemächtigten, das Anwesen der Familie recht schnell fanden. Es war keine Villa, aber auch keine Bruchbude, und als Ackermann die schönen, frisch in Weiß getünchten Wände betrachtete, die netten Giebel und den gepflegten Innenhof, war er erstmals bereit, der Sache mit diesem Urlaub eine Chance zu geben.
»Lucrecia!«, rief ein wohlbeleibter Mann und breitete die Arme zu einem herzlichen Willkommen aus. Natürlich hatte sie ihren Cousin Marcus in den höchsten Tönen gelobt, vor allem seine außerordentliche Gastfreundschaft, um Ackermann die Idee eines Urlaubs schmackhaft zu machen. Der Mann mit dem speckigen Gesicht und den darin beinahe verschwindenden Äuglein machte einen sympathischen Eindruck, aber Ackermann hielt sich mit seiner Begeisterung erst einmal zurück. Das hing sicher auch damit zusammen, dass er eine herzliche Umarmung erdulden musste, die ihn kurzzeitig nach Atem ringen ließ.
Als dann aber Marcus’ Frau sowie weitere Verwandtschaft in den Innenhof strömten und begannen, Lucrecia zu herzen, war es notwendig, sich an dem Treiben zu beteiligen. Hilfreich war, dass mittlerweile die Runde gemacht hatte, welchen Beruf Ackermann ausübte, was zu einer gewissen respektvollen Zurückhaltung führte, ebenso natürlich wie sein Status als Zeitenwanderer. Nur zwei Jungs, beide bemerkenswert blond, starrten ihn unverhohlen an und schienen sich nicht klar darüber zu sein, ob er eine Respektsperson sei.
»Ihr müsst müde sein!«, rief Aelitia, die Ehefrau des Marcus, die ihm sowohl an Leibesfülle wie aufgeräumter Lebendigkeit gleichkam. »Und hungrig! Und durstig!«
Die beiden Jungs beendeten das Starren, kamen zu Ackermann, der größere sah ihn an und fragte: »Du bist Polizist?«
»In der Tat«, erwiderte Ackermann wahrheitsgemäß.
»Ich werde mal Bandit. Du kriegst mich nicht!«
Eine Hand legte sich auf die Schulter des zukünftigen Verbrechers und eine Frau zog die beiden Jungs mit um Entschuldigung heischendem Blick zur Seite.
»Meine Nachbarin Claudia und ihre Jungs Nicos und Felix. Sie sind genauso erfreut über den hohen Besuch aus Rom wie wir«, erklärte Aelitia, während sie mit rudernden Armbewegungen den Weg ins Haus wies. »Hungrig und durstig, oder?«
Von alledem waren sie ein wenig, aber nach dem zu urteilen, was kurz darauf aufgefahren wurde, hatten sie eine mehrmonatige Reise als Galeerenruderer hinter sich gebracht, mühsam ernährt mit Wasser und Brot. Ackermann schaute mit Entsetzen auf die Speisenfolge, vor allem da er nun feststellen musste, dass Lucrecias Fähigkeiten wie Leidenschaft für erlesene Süßspeisen von der weiteren Verwandtschaft geteilt wurden. Da bei jeder neu aufgetragenen Variation auffordernde wie auch erwartungsvolle Blicke auf ihm ruhten, begann er zu ahnen, dass Lucrecia gegenüber ihren Verwandten erwähnt hatte, dass ihre Liebe auf dem fruchtbaren Boden einer rein geschäftlichen Beziehung gewachsen war und dass diese wiederum sehr viel mit dem Erwerb von allerlei Honigkuchen zu tun gehabt hatte.
Manche Dinge erzählte man einfach nicht.
Das würde alles nicht gut ausgehen, vor allem nicht für seinen Bauch, der bereits jetzt auf eine Weise vorgewölbt war, die ihm zu denken gab. Lucrecia sah ihn an, tätschelte seinen Arm und lächelte ihr bezauberndes Lächeln. Ihm sollte es gut gehen, das allein war ihr Bestreben und er liebte sie dafür. Dennoch, es gab auch zu viel des Guten und es dauerte nicht lange, da hatte sein Magen einen Füllstand an Speise und Trank erreicht, der körperliche Abwehrreaktion unausweichlich machen würde, setzte er die Zufuhr von beidem fort. Obgleich die Verwandtschaft sich ob der daraufhin einsetzenden konsequenten Verweigerung etwas enttäuscht zeigte, nahm man ihm nichts übel. Das stets sonnige Gemüt des Hausherrn und seiner Fischersippe schien sich auf alle zu übertragen, und als man ihnen ein geräumiges und helles Schlafgemach zugeteilt hatte, war die Verwandtschaft mit einem Mal verschwunden und eine ungewohnte, aber nicht unangenehme Stille senkte sich auf sie hinab.
Ackermann setzte sich auf den Rand des Bettes und prüfte die mit Stroh gefüllte Matratze. Der Leinenstoff war dick gewoben und es würde kein Gepiekse geben. Alles war sehr sauber. Man hatte sich Mühe gegeben, richtig Mühe. Ein wenig Rührung ob dieser Fürsorge konnte auch Ackermann nicht verbergen. Er saß still da. Lucrecia begann, sehr methodisch und dabei eine leise Melodie summend, ihr Gepäck auf diverse Kommoden und Truhen zu verteilen – um genauer zu sein: fast nur jene Dinge, die sie mitführte, da er selbst sich sehr bescheiden gezeigt hatte. Sie war in diese Arbeit versunken und Ackermann sah ihr einfach dabei zu, ganz still. Er konnte sich ohnehin kaum bewegen und fragte sich, ob er jemals in der Lage sein würde, das zu verdauen, was er eben zu sich genommen hatte. Aber die ruhige Beobachtung seiner Gefährtin gab ihm einen Frieden, den er nur selten empfand, und die durchs geöffnete Fenster hineinscheinende Sonne verstärkte diesen Eindruck nur noch. Er wünschte sich, dieser Augenblick würde nie enden und er könnte ihn festhalten, einrahmen und für immer bei sich tragen.
Vielleicht sollte er Maler werden.
Vielleicht sollte er auch aufstoßen, aber ganz leise, wenn möglich. Lucrecia mochte es nicht, wenn man zu vulgär auftrat.
»Was machen wir morgen?«, fragte Lucrecia. Ackermann hütete sich, sofort oder gar spontan zu antworten, vor allem da seine Lieblingsantwort »Nichts!« gewesen wäre.
Denn das war eine gefährliche Frage. Sie drückte zum einen aus, das war der gute Teil, dass für heute von ihm keine Aktivitäten, aber vor allem keine Energie mehr erwartet wurde. Er hatte seinen Frieden und erhielt die Absolution, einfach nur so zu sitzen und aus dem Fenster zu gucken. Möglicherweise würde man ihm noch einmal etwas zu essen anbieten – er ging sogar mit Sicherheit davon aus – und möglicherweise würde er noch etwas zu sich nehmen. Ansonsten aber wurde für den Rest des Tages nicht mehr von ihm erwartet, als brav zu sein, freundlich und eine gewisse Würde zu bewahren.
Zum anderen enthielt die Frage aber eine mehrfache Drohung und das war es, was ihn wirklich beunruhigte. Morgen, das war jenes Kontinuum, in dem Dinge passieren mussten. Es galt, etwas zu erleben, etwas zu tun, und von ihm wurde nicht nur Beteiligung eingefordert, sondern auch noch eigene Ideen, Einfälle, die auf Zustimmung stießen oder auch nicht. Egal wozu man sich entschloss, seine volle Einsatzbereitschaft, ja sein Enthusiasmus war gefragt und es gab keine Möglichkeit, sich zu drücken. Möglicherweise würde man ihm gestatten, etwas später aufzustehen, und auch das Frühstück gehörte noch zu jener Schutzzone, die sie ihm zubilligen mochte. Danach aber war es an ihm, Farbe zu bekennen, einen Standpunkt zu vertreten, sich an was auch immer zu beteiligen.
»Ich weiß es nicht«, erwiderte er.
Das war selbstverständlich die falsche Antwort. Besser als »Nichts!«, aber nichtsdestoweniger falsch. Er sah es an ihrem Gesicht, den Schatten, der kurz darüber flog, sie aus der Konzentration des Wäscheauspackens riss. Sie sah kurz hoch, blickte ihn an, ein sanfter Tadel nur, aber er musste jetzt aufpassen und sich mit den nächsten Antworten etwas mehr Mühe geben.
»Wir könnten uns die Insel ansehen«, sagte sie. »Mein Cousin leiht uns seinen Karren und seine Esel. Wir packen uns ein Picknick ein. Oder machen, wenn das Wetter schön ist, eine kleine Segelfahrt.«
»Picknick klingt gut«, reagierte Ackermann auf das Wort, das ihm vom Gesagten am besten gefiel. »So machen wir es.«
Nein, so schnell ging das nicht. Die verschiedenen Vorschläge und Alternativen mussten sorgfältig abgewogen werden, bewertet und unter unterschiedlichen Gesichtspunkten diskutiert. Eine schnelle Entscheidung auf eine komplexe Frage, das war nicht geeignet, um Lucrecias Wohlwollen zurückzugewinnen, und Ackermanns offensichtlicher Unwillen, in einen längeren Diskussionsprozess einzusteigen, besserte ihre Laune nicht.
»Du nimmst das nicht ernst«, sagte sie.
»Wir machen Urlaub. Ich dachte, das wäre die Zeit, in der man nichts ernst nimmt.«
»Aber auch das bedarf einer gewissen Planung«, entgegnete sie. »Man darf die Tage nicht alle verschwenden.«
»Wir sind gerade erst angekommen.«
»Und bald reisen wir wieder ab.«
»Bald, aber nicht morgen. Morgen sollten wir etwas unternehmen. Picknick, das war doch eine gute Idee.«
Lucrecia, die ihn eben noch am Tische des Cousins zu maßloser Völlerei angehalten hatte, warf ihm einen kritischen Blick zu. »Du wirst zu fett. Du solltest mehr auf dich achten.«
Picknick, so verstand Ackermann, war nicht Option Nummer eins für morgen.
»Es gibt hier einen schönen Markt mit viel frischem Fisch«, sagte sie. Ackermann, der sich an exakt diesem gerade überfressen hatte, stieß ein sanftes Stöhnen aus, gerade an der Grenze zur Missbilligung, sodass Lucrecia es nicht als direkte Ablehnung ihres gut gemeinten Vorschlags interpretieren konnte. Dennoch kam die Nachricht an. Da Lucrecia gerade selbst die Verfettung ihres Liebsten beklagt hatte, musste sie einlenken.
»Wir könnten meinen Onkel Ignatius besuchen. Er ist ein alter Mann und lebt auf der anderen Seite der Insel. Er kennt viele interessante Geschichten und verfügt über einen wunderbaren Humor.« Lucrecia sah ihn zweifelnd an. »Obgleich ich nicht weiß, wie sehr du für solche Geschichten empfänglich bist.«
Ackermann war gerührt ob ihrer Empfindsamkeit. Aber die Tatsache, dass sie ihm eine weitere Option zur Auswahl gegeben hatte, wies darauf hin, dass sie zwar zu einem gewissen Entgegenkommen bereit war, dieses aber möglicherweise für noch eine Alternative fehlte. Ackermann vermutete darüber hinaus, dass sie den ersten Vorschlag bewusst gemacht hatte, um sein Missfallen herauszufordern und ihn damit in Bezug auf den letzten, tatsächlich ernst gemeinten in Zugzwang zu bringen. Sehr geschickt.
Perfidität dieser Art war der schönen Lucrecia nicht fremd. Und sollte das ihr Plan gewesen sein, so funktionierte er. Geschwächt von der Beharrlichkeit, mit der sein Magen ihm das Blut aus dem Gehirn sog, um die schwere Verdauungsarbeit in Gang zu halten, und ermüdet von den Strapazen der Ankunft, der beständigen Konversation und der bisweilen allzu lärmenden Gastfreundschaft seiner aufgeregten neuen Verwandtschaft, verfügte er weder über die Willenskraft noch sonstige Energie, um dieses Gespräch weiter fortzusetzen. Vor allem aber nicht, eine eigene Meinung zu formulieren. Das Problem lag auf der Hand: Wenn er den neuesten Vorschlag ablehnte, wurde von ihm die geistige Anstrengung zur Formulierung einer eigenen Alternative erwartet. Natürlich, um eine Ablehnung ihrerseits zu provozieren, was die Entscheidungsfindung in eine weitere, ermüdende Runde drängen musste. Dafür war Ackermann nicht bereit.
»Ich bin sehr humorvoll«, kam seine eher lahme Einleitung, die von Lucrecia mit einem Stirnrunzeln bedacht wurde. »Ich bin gespannt auf Onkel Ignatius. Die Weisheit des Alters ist nicht zu unterschätzen.«
Lucrecias Zweifel ob seiner Aufrichtigkeit waren ihr deutlich anzusehen. Dennoch, es war das, was sie eigentlich vorgehabt hatte, also galt es nun, den Sack zuzuziehen. Sie nickte versonnen und meinte: »Wir sollten eine Flasche Branntwein mitbringen. Vom guten. Der alte Mann wird sich freuen und ein Gastgeschenk wird seine Zunge lösen.«
Ackermann zweifelte nicht daran, dass vor allem dieses Gastgeschenk zungenlösend wirken würde. Dennoch gab es gegen diesen Vorschlag nichts einzuwenden. Er nickte langsam, mühte sich, seine zufallenden Augen offen zu halten. Im Ringen um Körperflüssigkeit hatte der Magen definitiv die Oberhand gewonnen und besiegelte seinen Triumph nun damit, Ackermann in ein Verdauungskoma zu senden, das ganz sicher in einem langen nächtlichen Schlaf münden würde.
So war es beschlossen.
In diesem Moment, wie durch göttliche Fügung, verschwand der letzte Sonnenstrahl, der eben noch durch das offene Fenster getanzt war. Der Tag neigte sich dem Ende zu. Es war noch nicht dunkel – der Lichtschein wurde nur durch die benachbarten Gebäude verdeckt –, aber Ackermann fand, dass der Herr ihm jetzt eine gute Gelegenheit gab, ein richtiges Nickerchen einzuleiten.
»Du solltest dich eine Stunde hinlegen«, kam Lucrecia ihm zuvor. Sie hatte ihr Gepäck in die Truhen und Schränke transferiert, zeigte keine Anzeichen von Müdigkeit, nur die sanfte Fürsorge einer Gefährtin, die heute in allem ihren Willen bekommen hatte und für den morgigen Tag das Gleiche in Aussicht gestellt bekam.
Ackermann war es egal. Er lächelte.
»Ja«, sagte er mit einem ganz leicht leidenden Unterton. »Das wäre sicher gut.«