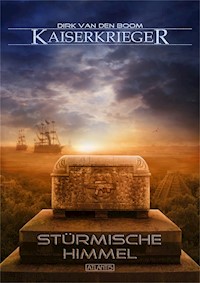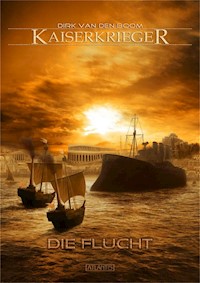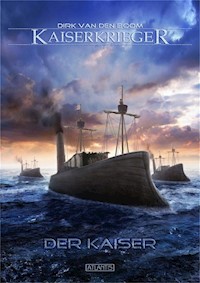Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Bürgerkrieg ist vorbei, die Zeitenwanderer waren siegreich. Unter der Regierung von Kaiser Thomasius I. beginnt eine Epoche der Reformen und Umwälzungen für das Römische Reich. Zu den neuen Institutionen des Imperiums gehören die Cohortes Vigilum Novi, die erste richtige Kriminalpolizei Roms. Kaum etabliert, steht die neue Behörde vor einer Herausforderung, die über ihr weiteres Schicksal im Reich bestimmen wird: Der Mord an einem Senator erschüttert das offizielle Rom und nicht jeder ist daran interessiert, dass die CVN mit ihrer Arbeit Erfolg haben ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Weitere Atlantis-Titel
Dirk van den Boom
Kaiserkrieger Vigiles: Tod im Senat
Prolog
Ackermann bekam gar nichts mehr mit.
Um ihn herum war hektische Aktivität ausgebrochen, aber er nahm sie nicht bewusst wahr. Er wusste, dass es den geschäftigen Tumult gab. Es gab ihn immer. Es war jedes Mal das Gleiche. Er hätte aus dem Gedächtnis aufzählen können, was jeder wann tat. Wachtmeister Schmidt würde mit wichtiger Miene vor der Wohnungstür stehen und jeden mit Argusaugen beobachten, der hineinkam. Schmidt war für wenig zu gebrauchen, aber er war imposant und von seiner eigenen Bedeutung dermaßen überzeugt, dass er sich gut als Türsteher machte. Sie hatten natürlich wieder Dr. Hansen gerufen, den sie in einem solchen Falle immer zurate zogen. Ein schüchterner Mann, leise, manchmal litt er an den Toten genauso wie die Verwandten und Freunde, sehr sympathisch und immer da, wenn man ihn rief. Zwei Männer waren sicher damit beschäftigt, den Gennat-Kasten zu öffnen und nach dem Vorbild des großen Berliner Kollegen den Tatort zu sichern.
Ackermann wusste das alles.
Es ging völlig an ihm vorbei.
Er stand über der Leiche und nahm jedes Detail in sich auf. Er merkte nicht, dass er dabei immer wieder die Hände zu Fäusten ballte und dann wieder entspannte. Die junge Frau starrte ihn aus leeren Augen anklagend an und Ackermann hörte ihre Worte. »Warum hast du es nicht verhindert? Ich bin doch nicht die Erste! Du jagst ihn seit über einem Jahr und du hast nichts erreicht! War dir der Tod deiner Schwester nicht Antrieb genug? Warum musste ich jetzt sterben – und warum auf diese Weise?«
Diese Weise.
Ackermann zwang sich, seine Augen von den ihren und den darin schlummernden Vorwürfen abzuwenden und den Rest ihres Körpers zu betrachten. Sie trug ein Schlafgewand, nichts Unübliches, es war sechs Uhr morgens und sie hätte eigentlich vor einer Stunde aufstehen müssen, um ihr Tagwerk im Haus der Familie Lehmann anzutreten, als Kindermädchen für die beiden Zwillinge, vier Jahre alt und der Stolz der alteingesessenen Reederfamilie. Sie war nicht aus ihrer bescheidenen Kammer heruntergekommen und man hatte nach ihr gesehen und dies vorgefunden.
Dies.
Das Nachtkleid war zerrissen und blutig. Der Mörder hatte ein großes Kreuz auf die Brust der jungen Frau geschnitzt, tief, mit einem Messer, immer der gleichen Art von Klinge, mit scharfen Zacken, die Fleisch und Knochen gleichermaßen durchtrennen konnte. Jemand mit großer Körperkraft und jemand mit einem sehr scharfen Messer. Ein Kreuz, senkrecht vom Halsansatz bis zum Zwerchfell und waagerecht unter den kleinen Brüsten quer über die Rippen, deren Splitter in der geöffneten Haut offen zutage traten. Überall war Blut.
»Das war ohne Zweifel wieder der Kreuzmörder. Der Dreckskerl.«
Kriminalsekretär Ernst Ahrens stand neben ihm, drei Jahre jünger, gerade erst auf diesen Posten versetzt. Dass er »wieder« sagen konnte, verstärkte die Anklage in den Augen der Toten nur noch und Ackermann strengte sich an, nicht wieder in diesen gebrochenen Blick zu starren. Der dritte Mord dieser Art binnen dreier Monate, der siebte in diesem Jahr. Das Gesicht des Kindermädchens vermischte sich mit dem Antlitz von Ackermanns Schwester Dorothea, die das zweite Opfer gewesen war, der erste Hinweis darauf, es mit einem Serienmörder zu tun zu haben. Immer junge Frauen, immer der eher zierliche Typ, immer Kindermädchen oder andere Hausangestellte meist gut situierter Familien, immer in einem der besseren Viertel Hamburgs, immer in der Nacht, immer völlig lautlos und unbeachtet und immer auf die gleiche Art und Weise. Eine Tat die Kopie der nächsten, eine Tote die Schwester der vorhergehenden, alle verwandt und verbunden durch eine Mordserie, der Ackermann hinterherlief.
Mit wachsendem Abstand.
Ohne Ziel vor Augen.
Ackermann zwang sich zu einem Nicken. Seit seiner Beförderung zum Kommissar vor wenigen Wochen fragte er sich, ob sein schneller Aufstieg eher ein Fluch denn ein Segen war. Sein erster großer Fall war bis jetzt sein Fluch. Er hatte sich dagegen gewehrt, dass man ihm die Ermittlungen entzog, als seine Schwester zu den Toten gehörte, und Direktor Moers hatte sich umstimmen lassen, nicht zuletzt deswegen, weil Ackermann wusste, was er tat, und dies mehrfach unter Beweis gestellt hatte. Mit seinen 33 Jahren war er ein Mann mit einiger Erfahrung und er hatte bereits vor Eintritt in den Polizeidienst Dinge gesehen, die mancher Frischling niemals zu Gesicht bekommen hatte.
Das hätte ihn härter machen sollen. Doch mit jedem weiteren toten jungen Ding spürte Ackermann die Härte in sich bröckeln wie Putz von den Wänden und es war niemand da, der neuen auftrug. Es würde nicht mehr lange dauern und die Mauer war offen und alle würden sehen können, wie es tatsächlich in ihm aussah.
Immer noch die Hände. Fäuste. Ausstrecken. Fäuste. Unentwegt und unbewusst. Er bemerkte nicht, dass Ahrens ihm einen forschenden Blick zuwarf. Er würde etwas sagen müssen, wollte er nicht vollständig als seltsam, als derangiert erscheinen. Doch es fielen ihm keine Worte ein.
Er blinzelte, versuchte, das Gesicht Dorotheas zu vertreiben. Es gelang ihm, sich wieder allein auf die anklagende Miene der Toten vor ihm zu konzentrieren, dann schaute er auf, suchte den Blick von Ahrens und zwang sich zu einem schwachen, traurigen Lächeln.
»Die Zeugen?«
»Alle sind unten im Wohnzimmer versammelt. Sie sind sehr aufgeregt, aber haben sich ganz gut im Griff.«
Natürlich. Eine hanseatische Familie mit Tradition. Allzu starke Emotionen zu zeigen und sich von plötzlichen Problemen aus dem Kurs bringen zu lassen, gehörte hier nicht zu den üblichen Verhaltensweisen. Man bewahrte Haltung. Ackermann holte tief Luft. Vielleicht sollte er sich ein Vorbild daran nehmen …
»Ich komme gleich herunter und rede mit ihnen«, sagte er leise und nickte Ahrens zu, der den Wink verstand und ging.
Ackermann blinzelte. Wie viele so grausam getöteter Frauen musste er noch ertragen, die ihm seine eigene Verzweiflung und Unfähigkeit so deutlich vor Augen führten? Sollte er darum bitten, von dem Fall entbunden zu werden?
Er ballte die Fäuste, diesmal nicht unbewusst, eine gezielte Geste, eine Nachricht an sich selbst.
Auf keinen Fall!
Ackermann wandte sich ab und trat hinaus auf den Gang, ging die Treppe hinunter in den ersten Stock, wo im geräumigen Wohnzimmer die anderen Bewohner des Hauses, die Lebenden, auf ihn warteten. Frau Lehmann hielt die beiden Kinder im Arm, eine mächtige Matrone unbestimmbaren mittleren Alters, deren verhärmte Gesichtszüge der scheinbaren Fürsorglichkeit widersprachen, mit der sie die Kinder festhielt. Ihr Mann, ein schmächtiger, aber hochgewachsener Herr in einem Hausanzug, stand am Fenster und starrte hinaus. Außerdem befand sich die Köchin im Zimmer, in eine weite, weiße Schürze gekleidet, schüchtern in einer Ecke sitzend. Alle sahen sie ihm entgegen, als er eintrat, erwartungsvoll, etwas verängstigt, aber voller Selbstbeherrschung.
Lehmann drehte sich um, das Gesicht eine Maske, doch Ackermann spürte den Unwillen des Reeders.
Der Kommissar setzte sich an den Tisch, bedeckt durch eine blütenweiße Damast-Tischdecke, in die das Wappen von Hamburg eingestickt war. Mit betont gemessenen Bewegungen holte er sein Notizbuch hervor, den Bleistift und sah dann das Ehepaar Lehmann an.
»Ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Können wir das gleich tun? Ich weiß, dass diese Situation für alle sehr schwierig ist. Es wird nicht lange dauern.«
»Stellen Sie Ihre Fragen«, sagte Lehmann mit erstaunlich tiefer Stimme und mit einer Autorität, der sich alle sogleich unterordneten. Ackermann verbarg ein Seufzen. In so einer Konstellation führte eine Befragung oft dazu, dass der Ehemann den anderen Familienmitgliedern seine Sicht der Realität aufzwang und wichtige Informationen verloren zu gehen drohten.
»Ich würde Sie gerne einzeln befragen«, sagte er also lächelnd. »Sie zuerst, Herr Lehmann?«
»Meine Frau und meine Dienstboten sprechen nur in meiner Gegenwart«, erklärte der Mann mit bestimmtem Tonfall. »Ich werde anwesend sein.«
Ackermann schüttelte langsam den Kopf, vermied alles, um provozierend oder anmaßend zu wirken. Lehmann war ein einflussreicher Geschäftsmann und in einer Stadt wie Hamburg war das von noch größerem Gewicht als anderswo.
»So gehen wir nicht vor, es tut mir leid«, sagte er. »Herr Lehmann, in Ihrem Haus geschah ein Mord. Er steht in einer Reihe ähnlicher Morde. Wir müssen diese Serie stoppen und dazu müssen wir mit größter Sorgfalt vorgehen. Wir müssen jeden einzeln befragen. Ich habe meine Vorschriften und diese haben sich bewährt. Ich mache das nicht, um jemandem zu schaden.«
Lehmann verzog das Gesicht.
»Das müssen Sie sicher«, erwiderte er ohne jedes Verständnis in der Stimme. »Aber bedenken Sie bitte, dass es nur um irgendwelche Kindermädchen geht, Frauen niederen Standes. Der Verlust ist sicher bedauerlich, er rechtfertigt aber wohl kaum, dass meine Autorität als Vorstand dieses Haushalts infrage gestellt wird.«
Eines der Kinder begann zu weinen. Der kleine Junge war offenbar nicht ganz der Meinung seines Vaters, für ihn musste der Verlust des Kindermädchens eine größere Bedeutung haben. Ackermann beobachtete, wie die Matrone den Jungen am Oberarm griff und zudrückte. Das Kind verstummte sofort. Wenn die Tote nur eine Spur menschlicher mit ihm umgegangen war, mit etwas mehr Wärme und Freundlichkeit, musste der Verlust für den Kleinen in der Tat schwer wiegen.
»Es gibt feste Vorgehensweisen, die wir bei einer solchen Ermittlung einhalten«, sagte Ackermann mit gleichbleibend verbindlicher Freundlichkeit. »Es sind bewährte Methoden, wie ich bereits sagte, Herr Lehmann. Ich will es so kurz halten wie möglich, aber ich muss darauf bestehen …«
Lehmann machte einen Schritt vorwärts. Seine Mundwinkel zitterten. Die blassblauen Augen waren starr auf Ackermann gerichtet. Da waren Risse in seiner Selbstbeherrschung und sie traten schnell auf.
»Sie bestehen in meinem Hause auf gar nichts!«, stieß der Mann hervor. Speichel flog Ackermann entgegen. »Dieses Aufhebens wegen einer besseren Magd! Überall Polizisten, als sei dieses Haus ein Hort des Verbrechens! Ihre Impertinenz setzt dem noch die Krone auf!«
Ackermann starrte den Mann an. Er fühlte, wie die Wut in ihm hochstieg.
»Herr Lehmann, Sie setzen sich jetzt bitte hin«, sagte er ruhig, etwas um Fassung bemüht. »Es ist unsere Aufgabe …«
»Es ist nicht Ihre Aufgabe, den Frieden und die Ordnung dieses Hauses zu stören!«
»Frieden und Ordnung wurden durch einen brutalen Serienmörder gestört, der seit einem Jahr …«
»Warum haben Sie ihn dann nicht längst geschnappt?«, brüllte Lehmann und erneut sprühte Speichel aus seinem Mund. Die beiden Kinder zuckten zusammen und zeigten alle Anzeichen von kontrollierter Angst, sie waren ganz sicher schon öfters Zeuge eines solchen Ausbruchs geworden. Auch die Köchin kauerte sich auf ihrem Stuhl zusammen und starrte nur zu Boden. Allein Lehmanns Ehefrau schaute Ackermann aus zusammengekniffenen Augen an, berechnend, wie ein Raubtier vor dem Angriff.
»Wir haben ihn noch nicht geschnappt«, bemühte sich Ackermann, »weil wir manchmal nicht alle notwendigen Informationen bekommen. Sie können uns nun helfen …«
»Wir sollen Ihnen helfen! Sie überdecken damit Ihre Inkompetenz! Hören Sie auf, andere Leute zu belästigen! Es war nur ein Kindermädchen! Davon gibt es junge Dinger wie Sand am Meer und ich bekomme ein Dutzend für eine! Schreiben Sie eine Akte, darin sind Sie doch bestimmt sehr gut, machen Sie ein Foto, schicken Sie einen bedauernden Brief an die Familie. Aber lassen Sie uns dieses Haus wieder in Ordnung bringen. Dieses Weib ist den ganzen Aufwand doch nicht wert!«
Irgendwas zerbrach bei Ackermann. Es musste das Bild eines anderen Mädchens vor seinen Augen sein, ebenfalls nichts wert, nur zufällig seine Schwester, die Tochter einer trauernden Mutter, eines verzweifelten Vaters. Nichts wert verdiente sie sich die Kosten ihres Studiums als Kindermädchen, nichts wert verfolgte sie große Pläne, wollte etwas aus sich machen. Nichts wert ging sie gerne tanzen und zog ihren Bruder für seine Eigenbrötlerei auf, nichts wert gelang es ihr wie kaum einem Menschen, ihn zum Lachen zu bringen und die Welt ein wenig anders, ein wenig freundlicher zu sehen, ein Blickwinkel, der ihm seit ihrem Tod abhandengekommen war.
Nichts wert.
Doch, da zerbrach jetzt was und Ackermann stand.
Er schrie Lehmann an. Es waren keine ausgesuchten Vokabeln, keine sorgsam gesetzten Worte der Beschwichtigung, keine höflichen Umschreibungen leichten Missfallens. Es war kein dezenter Hinweis auf seine Pflichten als Untertan des Kaisers, auf die Autorität seiner Behörde, auf die gesetzlichen Bestimmungen. Es war kein sanfter Rekurs auf die Tatsache, dass ein Serienmörder frei herumlief und die Bevölkerung der Stadt in Angst und Schrecken versetzte.
Nein, all dies war es nicht.
Ackermann kannte viele Schimpfwörter und Flüche, er war gut darin, Menschen zu beleidigen. Er bewegte sich in einem Umfeld, in dem er viele Leute kennenlernte, deren Wortschatz in dieser Hinsicht unerschöpflich schien. Er tauchte tief in den Fundus ein, der sich über die Jahre bei ihm angesammelt hatte, in seiner Zeit beim Militär, beim Anschreien von frischen Rekruten nach seiner Beförderung zum Feldwebel, in den Kneipen und Bars von Hamburg, bei Ganoven jeder Klasse. Er nahm all dies und fügte Weiteres hinzu, gab Lehmann, was ihm niemals ein Mensch zuvor gegeben hatte, und der Mann wurde erst rot, dann bleich, dann zitterten ihm die Hände und sein Kiefer klappte auf. Die Matrone hielt den interessiert zuhörenden Kindern die Ohren zu, ihr Gesicht verkniffen, ihr Antlitz aschfahl, jeder Muskel angespannt. Allein die Köchin, erst erschreckt, dann mit einem seltsam befriedigten Gesichtsausdruck, schien das Schauspiel zu genießen.
Irgendwann, Ackermann merkte es schon gar nicht mehr, kam Ahrens herein und zog seinen Vorgesetzten am Arm aus dem Wohnzimmer. Er stieß eine letzte Beleidigung aus, schärfer noch, verletzender als alle vorher, doch diese traf nur noch die eilends von Ahrens zugezogene Tür. Dann kehrte eine unnatürliche Stille ein und Ackermann spürte, dass ihm der Hals schmerzte und dass sich seine Finger schmerzhaft in die eigenen Handballen gruben.
»Herr Kommissar«, wisperte Ahrens. »Ich weiß ja … aber …«
»Schon gut«, sagte Ackermann, und als ob diese beiden resignierenden Worte einen Pfropfen lösten, ließ die ganze Wut und Aggression von ihm ab, verließ seinen Leib wie angehaltene Luft und er hatte das Gefühl, langsam in sich zusammenzufallen.
»Ahrens … Sie machen das«, murmelte er dann. »Sie führen die Gespräche. Und wenn sich jemand weigern sollte, dann wird die betreffende Person aufs Revier geladen. Lassen Sie sich in keine Diskussionen ein.«
Ahrens nickte nur. Er fragte nicht, was Ackermann jetzt vorhatte, und dieser drehte sich einfach nur um, ignorierte die ungläubigen, entsetzten und amüsierten Blicke der Polizisten, die draußen alles mitgehört haben mussten, und ging einfach.
»So funktioniert das nicht, Ackermann.«
Kriminaldirektor Moers war ein Mann, der in dem breiten Sessel beinahe verschwand, und obgleich ihn niemand jemals übersehen würde – sein stechender Blick wirkte wie der Lichtstrahl eines Leuchtturms –, hatte er die Angewohnheit, seinen Bariton auszureizen, so weit ihm seine Stimme zu Gebote stand. Im Kirchenchor, dem der Direktor seine karge Freizeit widmete, hatte er seine Stimmbänder zu einer gewissen Perfektion trainiert, was ihre Modulation, die Ausnutzung der Klangbreite und die Wiedergabe gefälliger Melodien anging. Im Gespräch mit seinen Untergebenen jedoch wurde die angenehme Singstimme zum Paukenschlag, unter deren Wucht so mancher zusammenzuckte. Er musste dafür nicht einmal laut werden.
Ackermann sagte nichts.
Er stand vor dem Schreibtisch seines Chefs und er hatte dieses Gespräch erwartet, ja befürchtet. Im Grunde noch am selben Abend, doch Moers hatte ihn schmoren lassen und den Mann erst am nächsten Morgen zu sich beordert. Vielsagende Blicke aus der ganzen Abteilung waren Ackermann auf seinem Gang nach Canossa gefolgt. Er hatte versucht, sie zu ignorieren, aber es war ihm schwergefallen.
»Herr Direktor …«
»Ich rede, Ackermann. Hinsetzen!«
Er folgte dem Befehl, zögerlich, denn er fand es angenehmer zu stehen. Nun, auf gleicher Augenhöhe, lag er direkt im Bereich des mächtigen Baritons und Moers sparte nun weder an Lautstärke noch an Modulation. Es war interessant, dass seine Mimik so unbeteiligt wirkte, wenn seine Stimme Gefühle wiedergab. Es war schwierig, Moers zuzuhören. Er war ein seltsamer Mensch.
»Ich habe einen Anruf bekommen, Ackermann. Syndicus Roeloffs. Sie kennen Roeloffs?«
Ackermann nickte. Jeder kannte Roeloffs. Er war einer der höchsten Beamten der Stadt, ein Vertrauter des Senats, und er arbeitete dem Ersten Polizeiherrn Harald Stevens zu. Stevens hatte Augen und Ohren aller Senatoren und des Ersten Bürgermeisters, und das schon seit gut fünfzehn Jahren.
»Wissen Sie, dass Lehmann zwei Verwandte und zwei alte Schulkameraden im Senat hat, Ackermann?«
»Nein, Herr Direktor. Ich weiß aber nicht …«
Moers hatte gar keine Antwort erwartet.
»Sie wissen vieles nicht! Sehr vieles! Lehmann hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt! Was haben Sie sich bei Ihrem Auftritt gestern eigentlich gedacht? Dass Sie einen der wichtigsten Kaufleute der Stadt so anpöbeln können? Erinnern Sie sich, wie Sie ihn genannt haben? Vor den Ohren seiner Frau, seiner Kinder, einer Köchin und einiger Polizeibeamter? Ich habe jedes Detail! Lehmann bestand darauf, dass ein Protokoll erstellt wird. Jedes verdammte Detail!«
»Er hat …«
»Das ist unwichtig!« Moers schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Es ist völlig egal, was er getan oder gesagt hat! Ich habe wirklich mehr von Ihnen erwartet, Ackermann! Wie konnten Sie dermaßen die Beherrschung verlieren?«
»Ich …«
Doch diesmal wurde er nicht unterbrochen. Ackermann brach selbst ab.
»Ja?« Moers lehnte sich zurück. »Ich höre.«
Ackermann suchte nach Worten, obgleich er sich diesen Morgen so manchen Satz zurechtgelegt hatte. Schließlich kam es eher stockend aus ihm heraus, nicht sehr elegant, nicht halb so laut wie der mächtige Bariton seines Chefs, aber sicher verständlich und nachvollziehbar.
Moers unterbrach ihn diesmal wirklich nicht, hielt die Augen geschlossen und legte die Hände in seinen Schoß, als würde er die Partitur eines Chorstücks memorieren, kurz vor einem wichtigen Konzert. Als Ackermann seine Schilderung beendet hatte, öffnete er die Augen wieder und sprach.
»Sie sind ein guter Polizist, Ackermann, und ich mag es nicht, wenn sich gute Männer so dumm benehmen.« Jetzt war die Singstimme sanft und behutsam wie bei einem verhaltenen Gotteslob. »Sie verspielen Ihre Karriere und alles, was Sie in diese investiert haben. Lehmann ist ein Kotzbrocken, jeder weiß das. Stevens weiß es, Roeloffs weiß es. Es gibt einen Grund, warum er zwar viele Freunde im Senat hat, aber noch nie in ihm sitzen durfte. Aber er ist mächtig, mächtig und wohlhabend, und viele Leute schulden ihm etwas. Sie mögen ihn nicht, sie verachten ihn, einige hassen ihn möglicherweise sogar, aber sie schulden ihm was, jeder auf seine Weise. Und er hat seit gestern Abend begonnen, Schulden einzutreiben, Ackermann. Meine Bemühungen, Sie zu beschützen, sind Grenzen unterworfen und der Sturm, der sich zusammenballt, ist so stark, dass er auch mich hinwegfegen wird, wenn ich mich zu sehr für Sie ins Zeug lege.« Er beugte sich nach vorne. »Was mir auch schwerfällt, weil Sie sich wirklich wie ein Idiot benommen haben, Ackermann. Ich verstehe Sie. Der Tod Ihrer Schwester. Der Serienmörder, der uns alle zur Verzweiflung bringt. Ich bin kein Stein, Ackermann. Ich verstehe. Aber Sie waren ein Idiot und Ihr Verhalten war unentschuldbar.«
Ackermann wollte Moers so gerne widersprechen. Aber da er wusste, dass er sich in der Tat unprofessionell benommen hatte, sagte er nichts. Außerdem war wohl nicht die Situation, Entschuldigungen vorzubringen, vor allem da Moers dafür letztendlich die falsche Adresse war.
Der Direktor nickte ihm zu.
»Ich weiß, dass diese Sache für Sie eine besondere Belastung darstellt«, sagte er nun, weiterhin mit erstaunlich viel Wärme in der Stimme. »Ich will das gerne noch einmal betonen. Aber Sie haben leider eine Grenze überschritten und ich kann Sie nicht mehr so schützen, wie ich es gerne wollte.« Er machte eine Kunstpause, um das Folgende wirken zu lassen, und Ackermann fühlte, wie ihm kalt wurde.
»Der Erste Polizeiherr hat mich angerufen, direkt nach Roeloffs. Ich sagte ja, die Sache macht die Runde.«
Ackermann nickte langsam. Der Erste Polizeiherr war das Senatsmitglied, das für die polizeiliche Struktur der Stadt Verantwortung trug. Er war Moers’ höchster Vorgesetzter.
»Ich soll Sie rauswerfen, mit Bausch und Bogen. Ein Exempel statuieren. Ich habe mit ihm argumentiert, Ihre Situation geschildert. Hat ihn etwas besänftigt. Er ist kein Freund Lehmanns, aber er steht unter Druck. Ich muss Sie loswerden, hat er gesagt, daran gibt es nichts zu ändern. Wenn ich es diskret schaffe, wird er mich decken. Wenn Sie dabei eine Chance bekommen, woanders weiterzumachen, will er es gar nicht wissen. Er hat mir eine Woche gegeben.«
Ackermann saß da und fühlte, wie das Blut aus seinem Gesicht wich. So eine harte Reaktion hatte er nicht vorhergesehen. Er schluckte trocken, suchte nach passenden Worten, nach einem Vorschlag, durch den er sich retten konnte, doch die Leere, die sich in ihm ausbreitete, wirkte lähmend.
»Es gibt einen Weg, wie Sie aus der Sache herauskommen. Eine Alternative. Ich weiß allerdings nicht, ob sie Ihnen sonderlich schmecken wird.«
Ackermann sah zu, wie Moers aus seiner Schublade die Kognakgläser holte und die bauchige Flasche ohne Etikett, die er im Büro aufbewahrte, wahrscheinlich auch für Situationen wie diese. Er goss großzügige zwei Fingerbreit ein, sich selbst weniger, und reichte Ackermann sein Glas, das dieser dankbar annahm.
»Trinken Sie!«
Das war ein Befehl und Ackermann gehorchte. Der Kognak war gut. Er wärmte ihn und belebte seine Sinne. Er trank das Glas leer, schneller, als es der gute Tropfen verdient hatte. Moers goss ihm nach, doch jetzt ließ Ackermann die Flüssigkeit stehen, rollte sie nur sanft im Schwenker umher.
»Ich habe jemanden angerufen«, eröffnete Moers ihm dann. »In Berlin. Einen alten Kameraden aus meiner Armeezeit.« Er stoppte und sah Ackermann forschend an. »Sie waren auch länger bei der Truppe, oder?«
Sein Gegenüber nickte langsam. »Infanterie, habe es bis zum Feldwebel geschafft.«
Moers nickte zufrieden. »Das sind gute Voraussetzungen.«
»Wofür, Herr Direktor?«
Moers lehnte sich zurück, sein Sessel knarrte dabei.
»Haben Sie schon einmal von der Geheimen Feldpolizei gehört, Ackermann?«
Der Angesprochene furchte die Stirn. »Es ist mir mal untergekommen, ja. In Preußen …«
»Nicht nur dort. Die Geheime Feldpolizei ist eine kleine Einheit. Ich vermute, dass sie im Kriegsfalle direkt dem Oberkommando unterstellt wird. Ihre Aufgabe ist es, Straftaten in der Truppe zu ahnden und Sabotage und Spionage zu bekämpfen. Ausgebildete Polizisten mit militärischer Erfahrung werden immer gesucht, Ackermann. Wie gesagt, ich habe telefoniert. Mein alter Freund hat sich bereit erklärt, mir zu helfen.« Moers beugte sich wieder nach vorne, sah Ackermann eindringlich an. »Ihnen zu helfen.«
»Wie?«, brachte dieser schwach hervor. Aber er ahnte es bereits.
»Ich kann Ihnen eine neue Dienststellung verschaffen. Damit ziehe ich Sie aus der Schusslinie. Man möchte eine GFP-Dienststelle in Kamerun einrichten, damit auch in den Kolonien, falls es zum Kriege kommt, feindliche Spione bekämpft werden können. Die Rede ist von einem Kommissar und fünf Schutzmännern in jeder Kolonie, Kamerun macht den Anfang. Es ist keine offene Stationierung, Ackermann. Die Idee ist, die GFP-Männer inkognito in die Truppe einzuschleusen, damit sie nicht auffallen, nicht zum Ziel werden. Sie sind Feldwebel der Reserve. Sie sind relativ jung und gesund. Man kann Sie reaktivieren, ohne großes Aufsehen zu erregen.«
Ackermann schüttelte den Kopf, vielleicht weniger aus Ablehnung, sondern eher, um die auf ihn hereinprasselnden Informationen auf die Reihe zu bekommen. Sein Leben, das fühlte er, stand vor massiven Veränderungen in ausgesprochen kurzer Zeit und er fühlte sich für einen Moment etwas überwältigt.
»Kamerun …«, brachte er schwach heraus und führte das Kognakglas zum Munde. Moers nickte verständnisvoll.
»Alles ein bisschen viel auf einmal, ich weiß«, sagte er. »Aber ja: Kamerun. Mein Freund sucht noch eine qualifizierte Person mit perfektem Leumund für die Stellung des Feldpolizeikommissars. Sie bekämen dann in den kommenden Jahren noch die Schutzleute zugewiesen. Sie selbst sind, wenn man so will, die Vorhut und sollen erst einmal nichts anderes tun, als normal in der Truppe zu agieren, die Augen und Ohren offen halten und regelmäßig berichten. Sollte es zum Krieg kommen, werden Sie entsprechend mit Männern verstärkt und können Ihre Tarnung aufgeben. Eine verantwortungsvolle Position, Ackermann. Eine etwas andere Tätigkeit als die, die Sie gewöhnt sind, aber eine gute Gelegenheit, sich zu bewähren und die Vergangenheit abzustreifen.«
Moers sah Ackermann intensiv an.
»Und abstreifen müssen Sie die Vergangenheit. Ihr Fanatismus macht Ihre Schwester nicht wieder lebendig. Ich verspreche Ihnen, dass wir hier der Sache auf der Spur bleiben. Einmal wird dieser Irre einen Fehler machen und wir bekommen ihn. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entkommen, das verspreche ich Ihnen. Mein Wort drauf. Aber es ist gut für Sie, wenn Sie Abstand gewinnen, Ackermann. Eine neue Aufgabe. Eine fremde Gegend. Sie werden es mögen und daran wachsen. Und bald erinnert sich kein Popanz wie Lehmann mehr an Sie und Sie verschwenden keinen Gedanken mehr an ihn. Eine Dienstzeit in Kamerun – vielleicht sechs oder acht Jahre – und Sie können jederzeit in den normalen Polizeidienst zurückkehren, in Hamburg oder anderswo. Zeichnen Sie sich aus. Verdienen Sie sich einen Orden. Das ist in den Kolonien kein Kunststück, da fällt jeder Mann mit Talent und Engagement sofort auf. Etwas ordentliches Metall auf der Brust und auch die Lehmänner dieser Welt werden nichts dagegen tun können, dass man Ihnen den verdienten Respekt erweist.«
Moers winkte und Ackermann gab ihm das erneut entleerte Kognakglas zurück. Der Alkohol verfehlte seine Wirkung nicht – er und die Worte seines Direktors, die echte Anteilnahme ausdrückten und die aufrichtige Hoffnung, dass sein Untergebener die goldene Brücke betreten würde, die dieser ihm mit einigem Aufwand errichtet hatte.
Ackermann fühlte die Entscheidung in sich reifen. Was blieb ihm auch für eine Wahl? Den Kampf gegen jemanden wie Lehmann konnte er nur verlieren, und mit diesem Makel eine Dienststellung im übrigen Reich zu finden, würde nicht leicht sein. Und wenn er sich weiter in Deutschland aufhielt, das war ebenso klar, würde ihn die Sache mit dem Kreuzmörder nicht loslassen. Er sah sich bereits immer wieder privat hierher reisen, um die Ermittlungen auf eigene Faust fortzusetzen. Das konnte nur im Unglück für ihn enden.
Ackermann holte tief Luft und begegnete Moers’ Blick, der ihm Zeit gegeben hatte, seine Überlegungen abzuschließen. Eine Mischung aus Dank und Scham erfüllte Ackermann. Moers hatte den Kopf herausgestreckt, weiter als erwartet, und das auf der Basis von Erwartungen, die Ackermann enttäuscht hatte, die er aber immer noch zu bewahren schien. Es war bemerkenswert, dass der Direktor immer noch mehr von seinem Untergebenen hielt als dieser von sich selbst. Ein Geschenk, das man nicht leichtfertig verspielte. Eine Gnade, der sich Ackermann für würdig erweisen musste.
»Ich akzeptiere das Angebot«, sagte er, etwas heiser vielleicht, also räusperte er sich und wiederholte mit mehr Festigkeit: »Ich akzeptiere es und danke Ihnen sehr. Ich verspreche Ihnen auch etwas: Ein zweites Mal werde ich Sie nicht enttäuschen.«
Moers lächelte und nickte.
»Ich rechne fest damit, Ackermann. Ich stelle Sie sofort frei und gebe Ihnen die Anschrift der Dienststelle, bei der Sie sich Anfang kommender Woche zu melden haben. Sie haben nicht viel Zeit. Wie ich gehört habe, werden Sie an Bord des Kleinen Kreuzers Saarbrücken aufbrechen, und das bereits im kommenden Monat. Bereiten Sie sich gut vor. Tun Sie Ihre Pflicht. Ich halte Sie über alles hier auf dem Laufenden. Es ist die richtige Entscheidung.«
»Herr Feldpolizeikommissar«, sagte Ackermann lächelnd und Moers grinste.
»Herr Feldpolizeikommissar«, wiederholte der Direktor dann und erhob sich, streckte die Hand aus und schüttelte Ackermanns Rechte. »Alles Gute für Sie.«
Und so verließ Arthur Ackermann Hamburg.
Für immer.
1
»Hier entlang, Tribun.«
Iocer führte ihn direkt in das Arbeitszimmer des Ermordeten. Zwei Wachsoldaten der Cohortes Vigilum Novi standen vor der Eingangstür und nickten Ackermann zu. Seine Leute, sie kannten ihn und würden niemanden einlassen, der ihnen unbekannt war.
Da lag er, hingestreckt auf einem Sofa, genau so, wie man ihn gefunden hatte. Sein Gesicht war blau angelaufen und der Schaum um seinen Mund längst getrocknet, wenngleich es um seine Lippen immer noch feucht schimmerte. Der Tod war erst vor einer halben Stunde eingetreten und man wusste es so genau, weil es mehrere Zeugen gab, die dem Todeskampf beigewohnt hatten. Senator Aemilius musste um sein Leben gerungen haben, soweit man den ersten Berichten Vertrauen schenken konnte. Jetzt wirkte er seltsam entspannt, beinahe wollte man auf seinen Lippen ein Lächeln erahnen.
Marcia erhob sich. Sie hatte sich über den Körper des Toten gebeugt, um ihn eingehend zu untersuchen. Die Frau in mittleren Jahren, mehr dürr als schlank, schaute Ackermann entgegen, als er neben sie trat. Ihre scharfen braunen Augen musterten ihn ganz genau, geradezu als wolle sie ihn mit ihren Blicken sezieren, ein Eindruck, den man ständig von ihr hatte. Auch ihre Stimme wirkte jederzeit scharf wie eine Klinge, selbst dann, wenn sie die nettesten Dinge sagte.
Was relativ selten vorkam.
»Tribun, du bist dick geworden.«
Das sagte sie immer, zum einen, weil es der Wahrheit entsprach, zum anderen, weil sie ihm damit einen wertvollen Hinweis in Bezug auf seine Ernährung geben wollte. Gleichfalls wie immer nickte er nur, tätschelte seinen Bauch, der sich unter der uniformähnlich geschnittenen Tunika zumindest erkennbar abzeichnete, und deutete auf den toten Senator.
»Sag mir was, Marcia.«
Die Frau lächelte freudlos. Sie war Ärztin und hatte darüber hinaus Kenntnisse, die ihr zu einer anderen Zeit und Gelegenheit die Bezeichnung »Kräuterhexe« eingebracht hätten. Eine Absolventin der gallischen Medizinerschulen, hatte sie das Jahr, bevor sie zu den CVN stieß, in der neuen Akademie von Doktor Neumann in Ravenna ihre medizinischen Kenntnisse … aktualisiert. Sie gehörte zu den ersten Absolventen des dafür eingerichteten Studiengangs und hätte eine Menge Geld damit verdienen können, alten Männern die Beschwerden fortschreitender Jahre zu lindern. Dass sie sich stattdessen bei den CVN gemeldet und von Ackermann mit großer Freude akzeptiert worden war, sagte viel über sie aus, und nicht nur Gutes.
Marcia hatte ein schon beinahe unnatürliches Interesse für Morde gezeigt und sie untersuchte Leichen mit einer Hingabe, die Ackermann manchmal zu denken gab. Sie war eine klassische Seiteneinsteigerin bei den CVN wie so viele bei einer neuen und vormals nicht dagewesenen Behörde und er war sich nicht immer sicher, ob er wirklich so viel über Marcias Vergangenheit wusste, wie er sich einbildete.
»Gift, Tribun«, wies sie auf das Offensichtliche hin. »Ich sprach mit Medicus Satius. Er wurde gerufen, als die ersten Symptome deutlich wurden.« Sie zeigte auf den Herrn mittleren Alters, der mit einer weiteren Gruppe älterer Herren in einer Ecke stand und sich leise unterhielt. »Er begleitet seinen Herrn stetig, war der Leibarzt des Senators, der ganzen Familie. Er kommt auch aus den gallischen Schulen, hatte aber noch nicht das Vergnügen des Zeitenwanderer-Auffrischungskurses. Doch er ist kein Narr. Er hat sogar das Gift erkannt und ich bin geneigt, seiner Theorie zuzustimmen.«
»Welches?«
»Schierling. Erst wurde ihm schlecht und alle dachten, er hätte sich nur den Magen verdorben. Er wurde dann in ein Nebenzimmer gebracht und vom Arzt der Familie behandelt. Dann hat er sich erbrochen, bekam Lähmungserscheinungen und starb an Atemnot. Ich vermute, dass er vor dem Tode einen Infarkt bekam, aber das ist nur eine Theorie. In jedem Falle war sein Tod die direkte Folge der Zugabe des Giftes. Es brauchte relativ lange, um zu wirken. Ich gehe nicht davon aus, dass ihm die effektivste Dosis verabreicht wurde. Er musste sie aufgebaut haben, im Verlauf des Abends. Das macht die Sache nicht leichter.«
Ackermann runzelte die Stirn.
»Also jemand, der sich nicht auskannte?«
»Oder jemand, der es hinauszögern wollte.«
Ackermann nickte in Richtung des Medicus. »Was hat er versucht?«
Marcia stieß ein Schnauben aus, in das sie eine gehörige Portion Verachtung legte.
»Was alle versuchen. Er hat Theriak verabreicht. Wie zu erwarten war, hat es nicht gewirkt.«
»Er hatte es vorrätig?«
Marcia schüttelte den Kopf, keine Verneinung, sondern ein Kommentar über die Sinnhaftigkeit dieser Frage. »Senator Aemilius war ein reicher und mächtiger Mann. Er hatte viele Feinde. Natürlich hatte er Theriak vorrätig. Er wird es vermutlich sogar regelmäßig zur Prophylaxe eingenommen haben. Neumann hat relativ deutlich gemacht, dass das Mittel keinen großen Schaden anrichtet, aber auch nichts nützt. Gegen eine Schierlingsvergiftung schon gar nicht. Tatsächlich wüsste ich nicht, was man bei einer akuten Vergiftung noch tun könnte. Aemilius war tot, als er die erste Dosis zu sich nahm.«
»Die erste? Erzähl mir mehr.«
Marcia ergriff Ackermann beim Arm und führte ihm vom Leichnam weg zu einem Tisch, auf dem ein Kelch und eine Karaffe standen. In der Karaffe war Wein erkennbar, der Kelch war leer.
»Er hat Wein getrunken, wohl mehr als einen Becher«, sagte sie. »Den genauen Ablauf werden die Verhöre erbringen. Meine derzeitige Theorie ist wie gesagt, dass er sich das Gift nach und nach zugeführt hat, mit jedem Becher etwas mehr, bis die Reaktion eintrat. Wäre ich zu einer Untersuchung in der Lage, wie sie in deiner Zeit möglich ist, Tribun, würde ich vermutlich herausfinden, dass extrem verdünnter Schierlingsextrakt in diesem Wein enthalten ist. Soll ich einen Sklaven rufen lassen zum Testen?«
Ackermann sah sich um.
Zum Glück hatte niemand sonst sie gehört.
Er sah sie scharf an und hob warnend einen Finger, was die Ärztin mit einem Achselzucken zur Kenntnis nahm.
So war sie, die gute Marcia, und es passte irgendwie zu ihrer Begeisterung für gewaltsame Tode und ihre Folgen. Ackermann musste manchmal wirklich an sich halten. Die Frau hatte zahllose Vorzüge und Kenntnisse und war normalerweise sehr umgänglich, von ihrer Begeisterung für Tote einmal abgesehen, die sich aber im Regelfalle über ihre Aufmerksamkeiten nicht mehr beschwerten. Nur ihre Haltung in Bezug auf die Sklaverei, die nun unter Kaiser Thomasius schrittweise abgeschafft wurde, konnte man nur als archaisch, weniger freundlich als menschenverachtend bezeichnen. Der Vorschlag, die angenommene Giftmischung an einem Sklaven auszuprobieren, war absolut ernst gemeint. Natürlich wusste sie, Ackermann würde einer solchen Vorgehensweise niemals zustimmen. Sie genoss es, ihren Vorgesetzten zu provozieren, vorzugsweise vor Publikum.
Hätte er aber eingewilligt, wäre sie ohne Skrupel zu Werke gegangen.
Ackermann nahm sich vor, zu gegebener Zeit ein ernstes Wort mit ihr zu reden. Wie immer würde er nicht dazu kommen.
Iocer trat auf ihn zu. Er hielt ein Pergament in der Hand, eine Liste, sein Markenzeichen. Es gab nichts, was er nicht aufzeichnete und für das bis jetzt noch relativ klägliche Kriminalarchiv der CVN dokumentierte. Das war eine seiner Stärken, für die Ackermann ihn brauchte. Jahrelang hatte Iocer vor den Gerichten Roms als Anwalt gearbeitet und er war dafür bekannt gewesen, seine mangelnde Rechtskenntnis durch endlose Elogen zu kaschieren, die Prätoren wie Streitparteien gleichermaßen in tiefen Schlaf zu versetzen in der Lage waren. Seine Erfolge waren daher bescheiden gewesen und nur seiner Beharrlichkeit war es zu verdanken gewesen, dass er weiter seinem Beruf nachgehen konnte. Wie Ackermann erfahren hatte, besserte der Anwalt damals seine kargen Einkommen durch allerlei Nebentätigkeiten auf. Er vermittelte exotische persische Tanztheateraufführungen an reiche Honoratioren, die eine Abwechslung für ihre Festivitäten haben wollten. Und er hatte sich gleichermaßen als Theaterkritiker einen Namen gemacht, wo seine ausschweifenden Monologe tatsächlich goutiert wurden und so mancher fahrender Künstler ihn engagierte, um ihn zu lobpreisen und damit die Aufführungen mit Leichtgläubigen zu füllen. Iocer kannte sich ein wenig im Recht aus, aber vor allem wusste er sich unter den Reichen und Schönen zu bewegen, kannte gleichermaßen die Artisten, Schauspieler und Rezitatoren, hatte ein besonderes Faible für schlechte Schriftsteller, die ganze künstlerische Szene der Stadt. Die Tatsache, dass seine Frau Claudia als Lehrerin arbeitete und damit wahrscheinlich mehr zum Einkommen der Familie beigetragen hatte als er, musste ihn gewurmt haben, jedenfalls genug, um sich zu bewerben, als die CVN nach Mitarbeitern suchte. Ackermann war sich anfangs nicht sicher gewesen, ob er den Mann akzeptieren sollte. Aber seine fast schon manische Akribie im Führen von Akten, Aufzeichnungen jeder Art, Aufstellungen, Listen und Protokollen war ein Segen. Wenn es jemanden gab, der seine beruflichen Misserfolge genaustens dokumentiert hatte, dann war es Iocer. So jemanden benötigte man. Ackermann hatte sehr genaue Vorstellungen von der Notwendigkeit eines Kriminalarchivs, auf das der wachsende Dienst würde zurückgreifen können. Iocer war der Mann, der den Nukleus dafür erarbeiten würde, und er würde es gut tun.
Und wer wusste, vielleicht wurde sogar noch ein ordentlicher Ermittler aus ihm.
Er bemühte sich jedenfalls redlich.
»Wir haben alle, die sich zum Zeitpunkt des Mordes im Haus befanden, im Atrium versammelt«, sagte Iocer und deutete mit dem ausgestreckten Daumen über seine rechte Schulter nach hinten. Auch die Gesprächsrunde hatte sich aufgelöst und dorthin begeben.
»Wer ist es alles?«
»Vier Senatoren und drei Sklaven und ein Schreiber, der für Aemilius gearbeitet hat. Die ehrenwerten Herren Modestus Arminius Ancilla, Lucius Petronius Dacer, Marcus Leviticus Africanus und der noch um einiges ehrenwertere Marcus Probius Cato. Dazu die drei Sklaven, einer davon der Majordomus dieser Villa, ein Koch und der Diener, der die Speisen und Getränke servierte. Der Schreiber ist für mich ein guter Kandidat für die Ermittlungen. Nach der ersten Befragung zu urteilen, hat er den Wein aus dem Keller geholt, als der Diener gerade nicht zugegen war. Eine hervorragende Gelegenheit, um ihn zu vergiften.«
»Wir wollen nicht zu voreilig sein«, murmelte Ackermann. »Du hast von allen die Details aufgenommen?«
»Das habe ich.« Iocer hob das Pergament. »Wollen wir sie festnehmen?«
Ackermann lachte auf.
»Vier Senatoren festnehmen – nur so zum Spaß? Der politische Skandal würde uns arbeitsunfähig machen. Nein, wir teilen den Herren jetzt in aller Freundlichkeit mit, dass sie nach Hause gehen können, wir sie aber alle noch einmal zu befragen gedenken. Der Sommer hat begonnen und nichts ist für diese edlen Würdenträger schlimmer als die Aussicht, nicht aufs Land fahren zu dürfen, also müssen wir versuchen, sie hierzuhalten. Das wird sie daran erinnern, dass sie nun Teil einer Untersuchung sind. Ich möchte, dass jeder der Männer beobachtet wird, setze Beamte auf sie an. Ich möchte über ihre Bewegungen informiert sein.«
»Alles klar, Tribun. Sonst noch etwas?«
Ackermann seufzte.
»Ein Senator ist ermordet worden. Und nicht irgendeiner. Was glaubst du, was nun passiert? Ich muss mit Politikern reden. Das ist jetzt eine diffizile Sache.«
Marcia gesellte sich zu ihnen. Sie hielt ihre Tasche fest, wirkte fast gelangweilt, da sie mit der Leiche durch war.
»Ich bin hier fertig, Tribun.«
»Dann darf der Leichnam abtransportiert werden. Ich sehe mich noch ein wenig um, dann gebe ich den Tatort frei.«
»Es wäre gut …«
Ackermann hob eine Hand. »Die Diskussion führt zu nichts. Dies ist die Villa eines Senators. Wir können sie nicht auf ewig versiegeln. Ich schaue mich um, dann geben wir sie frei. Wir sind auf das Wohlwollen aller Beteiligten angewiesen. Was ist mit der Familie des Toten?«
»Bereits in der Sommerfrische auf dem Landgut«, erwiderte Iocer. »Ich habe einen Boten entsenden lassen.«
Ackermann nickte anerkennend. In diesen Dingen dachte der Mann mit, denn er wusste, dass es keine gute Idee war, wenn die Witwe vom Tode ihres Mannes aus der Gerüchteküche hörte. Dies waren Kreise, in denen Iocer sich bewegt hatte, und seine Erfahrung sprach für ihn.
Er begann, durch das Haus zu wandern. Marcia meinte immer, er mache das, um mit den Geistern der Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Vielleicht hatte sie damit sogar recht. Ackermann glaubte nicht an spiritistische Sitzungen zur Lösung von Mordfällen, aber er war der Überzeugung, dass neben der rationalen Aufzählung der Fakten auch immer der emotionale Eindruck eines Tatorts dazugehörte, vor allem wenn man der Intuition eine gewisse Rolle im Ermittlungsprozess einräumen wollte. Ackermann fehlte hier vieles von dem, worauf er sich sonst gerne stützte. Das Kriminaltechnische Labor war erst seit gut drei Monaten existent und konnte zwar im Bereich der Spurensicherung einiges erreichen – sie hatten begonnen, eine Fingerabdruckkartei zu erstellen, in der sich bereits zwei Dutzend Kleinkrimineller befanden –, aber sonst waren ihre Hilfsmittel eher begrenzt. Es blieb meist nicht viel mehr als der Einsatz von Verstand und Intuition – und immer das notwendige Quäntchen Glück.
Ackermann hatte das auch nicht anders erwartet, als er vor einem Jahr die CVN ins Leben gerufen hatte – oder vielmehr damit beauftragt worden war, etwas in dieser Richtung zu tun. Mit voller Unterstützung des neuen Kaisers, Thomasius, der nun seit zwei Jahren Rom regierte. Er hatte die Ewige Stadt wieder zum Zentrum des Reiches gemacht und Ackermanns Arbeit hatte sich dadurch nicht erleichtert. Denn neben dem ständigen Anwachsen der über Jahrzehnte vernachlässigten Metropole führte dies auch zur steigenden Kriminalitätsrate, der seine kleine Truppe niemals Herr werden konnte.
Aber der Tod eines mächtigen Senators – das war eine andere Qualität.
Ackermann merkte, dass ihn seine Schritte in das Atrium geführt hatten. Er sah einige der Hausgäste, wie sie von seinen Kollegen befragt wurden, und die Sklaven, die stumm in einer Ecke standen. Sie waren natürlich als Letzte dran, denn die hohen Herren aufzuhalten, war weitaus schwieriger, als die Verfügbarkeit lebender Gegenstände zu gewährleisten. Ein Grund mehr, sich die Zeit zu nehmen, die Bediensteten des Hauses näher anzuschauen. Er würde sie nicht hier verhören, in Gegenwart ihres Herrn. Das Hauptquartier der CVN war ein besser geeigneter Ort dafür.
Er sah sie sich also an: Der Majordomus war an seiner vergleichsweise guten Kleidung, seinem fortgeschrittenen Alter und seiner würdigen Haltung zu erkennen. Wahrscheinlich in Sklaverei geboren, war er in diesem Haushalt aufgestiegen und hatte nun eine Position inne, in der es ihm besser ging als manchem freien Bürger. Er wirkte sehr selbstbeherrscht, das faltige Gesicht unbeweglich, die hagere Gestalt mit durchgedrücktem Rücken. Er sagte nichts, stand da wie eine Statue. Ein Mord in seinem Haus, an seinem Herrn. Was würde aus ihm werden? Wie würde die Herrin des Hauses mit ihm umgehen? Für einen Sklaven hatte der Tod eines Besitzers unabsehbare Konsequenzen.
Der Koch war jünger, plumper im Körperbau, mit einer befleckten Tunika bekleidet. Er stand da mit gesenktem Kopf. Er war sicher nicht nur für die Zubereitung der Speisen, sondern auch für die Auswahl des Weins und das Umfüllen von der Amphore in die Karaffe verantwortlich gewesen. Seine ergebene und deprimierte Körperhaltung ließ entweder den Schluss auf Schuldbewusstsein zu oder auf die Erkenntnis, dass er zumindest der Hauptverdächtige sein musste – und im Zweifel ein gut geeigneter Sündenbock.
Und Ackermann wusste, dass der Mann recht hatte. Ein Grund mehr, nicht zu voreiligen Schlussfolgerungen zu kommen.
Der dritte Mann, ein normaler Hausdiener, machte keinen besseren Eindruck. Er war noch jünger, nicht einmal zwanzig Jahre alt, dessen war sich Ackermann sicher. Er stand da mit ineinander verkrampften Händen. Als der Diener, der den Wein brachte, stand er gleichfalls ganz oben auf der Liste möglicher Täter. Und wer war schon daran interessiert, einem Sklaven möglichst ehrlich Gerechtigkeit widerfahren zu lassen? Vor allem dann, wenn man dadurch die edlen Senatoren aus der Schusslinie nehmen konnte, ganz egal, ob es nun einer von ihnen war oder nicht?
Ackermann schüttelte den Kopf.
Nicht mit ihm. Dafür waren die CVN nicht gegründet worden. So würde die Arbeit der allerersten Kriminalpolizei des Römischen Reiches nicht beginnen.
So nicht.
Ackermann hatte vor, ein Vorbild zu sein, solange er das noch konnte.