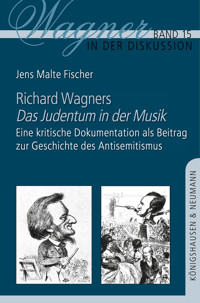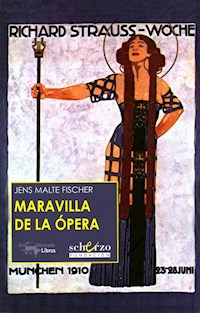Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
„Vieles von dem, was Kraus schrieb, trifft unsere Zeit noch genauer als seine eigene.“ (Jonathan Franzen) Jens Malte Fischer holt Karl Kraus mit einer großen Biografie zurück in die Gegenwart. Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Buchpreis 2020 Im Alter von 25 Jahren gründet er "Die Fackel", die er von 1911 bis 1936 alleine schreibt, die "Letzten Tage der Menschheit" werden zur radikalen Abrechnung mit dem Weltkrieg, die "Dritte Walpurgisnacht" nimmt es auf mit der Hitlerei. Karl Kraus: Das sei der größte und strengste Mann, der heute in Wien lebe, heißt es bei Elias Canetti. Kraus, geboren 1874 im böhmischen Jicin, gestorben 1936 in Wien: Für die einen war er Gott, für andere der leibhaftige Gottseibeiuns. Sein Name ist legendär geblieben, doch wofür er stand, das verblasst mehr und mehr. Jens Malte Fischer holt ihn jetzt mit einer großen Biografie in die Gegenwart. Persönlichkeit und Werk, Freund- und Feindschaften, Sprüche und Widersprüche zeigen einen der größten Schriftsteller in seiner Zeit und darüber hinaus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1902
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»Vieles von dem, was Kraus schrieb, trifft unsere Zeit noch genauer als seine eigene.« (Jonathan Franzen) Jens Malte Fischer holt Karl Kraus mit einer großen Biografie zurück in die Gegenwart. Im Alter von 25 Jahren gründet er »Die Fackel«, die er von 1911 bis 1936 alleine schreibt, die »Letzten Tage der Menschheit« werden zur radikalen Abrechnung mit dem Weltkrieg, die »Dritte Walpurgisnacht« nimmt es auf mit der Hitlerei. Karl Kraus: Das sei der größte und strengste Mann, der heute in Wien lebe, heißt es bei Elias Canetti. Kraus, geboren 1874 im böhmischen Jicin, gestorben 1936 in Wien: Für die einen war er Gott, für andere der leibhaftige Gottseibeiuns. Sein Name ist legendär geblieben, doch wofür er stand, das verblasst mehr und mehr. Jens Malte Fischer holt ihn jetzt mit einer großen Biografie in die Gegenwart. Persönlichkeit und Werk, Freund- und Feindschaften, Sprüche und Widersprüche zeigen einen der größten Schriftsteller in seiner Zeit und darüber hinaus.
Jens Malte Fischer
Karl Kraus
Der Widersprecher
Biografie
Paul Zsolnay Verlag
Meiner Frau
Und wenn ihr nach Biographien verlangt, dann nicht nach jenen mit dem Refrain »Herr So und So und seine Zeit«, sondern nach solchen, auf deren Titelblatte es heissen müsste »ein Kämpfer gegen seine Zeit«.
Friedrich Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (erschienen 1874, im Geburtsjahr von Karl Kraus)
I Karl Kraus wohnt
Am 12. Februar 1912 zog Karl Kraus hier ein und blieb dort bis zu seinem Tod 1936: Lothringerstraße 6, im 1. Bezirk. Er hatte, auch als er schon als Schriftsteller etabliert war, relativ lange bei seinen Eltern gewohnt, zunächst in der Maximilianstraße 13 im 1. Bezirk (ab 1919 hieß sie Mahlerstraße, nach 1938 Meistersingerstraße und dann wieder ab 1946 bis heute Mahlerstraße; eine kleine österreichische Geschichte in Straßennamen), dann in der Elisabethstraße 4. Seine erste eigene Wohnung befand sich ganz in der Nähe in der Elisabethstraße, eine weitere in der Dominikanerbastei 22. Die Lothringerstraße führt vom Karlsplatz zum Stadtpark. An ihrem Anfang stehen Häuser, die nahezu Ringstraßencharakter haben und heute als ziemlich prunkvoller »Altbau« bezeichnet werden. Leopold Liegler nennt die Nummer 6 das »vielleicht geschmackloseste Haus dieser Gegend, über und über mit gipsernen Ornamenten bedeckt«.1 In der Tat war es kein Haus, das Adolf Loos, dem Kämpfer gegen das Ornament, gefallen hätte, aber das scheint Kraus gleichgültig gewesen zu sein, ganz im Sinne seines Aphorismus: »Ich verlange von einer Stadt, in der ich leben soll: Asphalt, Straßenspülung, Haustorschlüssel, Luftheizung, Warmwasserleitung. Gemütlich bin ich selbst.«2 Als Kraus einzog, war es faktisch ein Neubau, 1904 fertiggestellt. Der Architekt war Julius Goldschlager. Gegen die Straße war das Haus anders als heute durch Portalpfeiler und einen schmiedeeisernen Zaun abgetrennt. Im Hochparterre war und ist die Wohnung, keineswegs groß, wenn auch für eine alleinstehende Person ausreichend. Es war das eine Zweieinhalbzimmerwohnung: ein großes Arbeitszimmer, ein relativ kleines Schlafzimmer, ein Bad und ein Vorraum als Diele. An der Eingangstür zum Vorzimmer war ein geräumiger Briefkasten angebracht, sehr groß, weil die Umschläge mit den Korrekturen der aktuellen Fackel aus der Druckerei hineinpassen mussten. Diese wurden gegen acht Uhr in der Früh von einem Boten gebracht, der einen Schlüssel zur Wohnung hatte, damit Kraus, der sich dann erst vor Kurzem zum Schlafen niedergelegt hatte, nicht gestört wurde. Vom Vorzimmer ging rechts das Badezimmer ab, in das Kraus einen kleinen Gaskocher gestellt hatte — mehr war nicht nötig, denn er nahm seine Mahlzeiten grundsätzlich außer Haus ein. Die eigentliche Küche, als solche nicht benötigt, im Souterrain (wie damals nicht unüblich), war durch eine Wendeltreppe vom Badezimmer aus zu erreichen und in eine Mischung aus Archiv, Registratur und Poststelle umfunktioniert worden. Links vom Vorzimmer aus ging es ins sehr große Arbeitszimmer mit einem angemessen großen Fenster.
Der Freund Karl Jaray ließ sehr bald nach dem Tod von Kraus die Wohnung (mit Ausnahme der Küche und des Bades) vom Fotografen J. Scherb im letzten Zustand (Juli 1936) fotografieren. Sie macht auf den Fotos den Eindruck, Kraus habe sich nur eben auf ein Nachtmahl wegbegeben. Das Bett soll in dem Zustand abgebildet sein, in dem der Bewohner darin starb. So ist ein ungewöhnlicher Blick in die sogenannte Privatsphäre möglich — einen ähnlichen Eindruck vermitteln ja die Fotos, die Edmund Engelmann in der Wohnung Sigmund Freuds aufgenommen hat, unmittelbar vor dessen letzter Reise in die Londoner Emigration. Kraus hielt ansonsten seine häuslichen Verhältnisse vor der Öffentlichkeit (wie sein privates Leben überhaupt) streng verborgen. Dass er etwa einen jungen Mann, den er gerade erst kennengelernt hatte, wie den Verleger Kurt Wolff, mit zu sich nach Hause nahm, nachdem man sich in einem Café getroffen hatte, war eine Ausnahme und ein ganz außergewöhnlicher Sympathiebeweis.
Zunächst fallen die vielen Bilder auf, in der Mehrzahl Fotos, an den Wänden, nicht nur im Wohn- und Arbeitszimmer, sondern auch im Schlafzimmer und in der Diele — die Wohnung wirkt geradezu gepflastert mit Bildern. Die Räume hinterlassen ingesamt einen abgewohnten Eindruck. Das wird zunächst nicht verwundern, denn es ist nicht überliefert, dass Kraus sich mit Verschönerungen beschäftigt hat. Es verwundert aber dann doch, denn ebenjener Jaray hatte die Wohnung im Herbst 1934, als Kraus seinen letzten größeren Urlaub an der Adria machte, renovieren lassen, aber das mögen in der Kürze der Zeit nur Schönheitsreparaturen gewesen sein (mit Ausnahme des Einbaus einer modernen Heizung), keine Grundrenovierung, für die die Zimmer hätten ausgeräumt werden müssen, was Kraus nicht zugelassen und Jaray sich auch nicht getraut hätte. Es mag aber sein, dass eher die Möbel verschlissen wirken und dieser Eindruck auf die Wände abstrahlt.
Stellen wir uns vor, in die Wohnung einzutreten, und sehen uns im Korridor um. Neben der Eingangstür steht links eine Kommode, auf der zwei Reisekoffer liegen. Über der Tür ein gerahmtes Bild, in dem zehn Postkarten mit Porträts von Schauspielerinnen eingefasst sind. Um wen es sich handelt, ist nicht zu erkennen, weil die Aufnahme nicht präzise genug ist, aber es ist zu vermuten, dass es sich neben anderen um seine Lieblinge Charlotte Wolter, Josefine Gallmeyer und Marie Geistinger handelt. Über der Kommode mit den Koffern symmetrisch angeordnet sind zwölf weitere Bilder zu sehen, jedes für sich gerahmt. Dominierend ist die berühmte Abbildung, die Johann Nestroy in einer seiner Glanzrollen (außerhalb der eigenen Stücke) zeigt, als Sansquartier nämlich in der Posse Sieben Mädchen in Uniform von Louis Angely, trotz seines französischen Namens ein Berliner Vaudeville- und Possenautor vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Links davon zwei der berühmten Theaterpublikumskarikaturen Honoré Daumiers, darunter Aubrey Beardsleys Zeichnung eines versunkenen Wagner-Publikums The Wagnerites. Unter dem Nestroy ein kleines Bild des alten Burgtheaters am Michaelerplatz, dessen endgültige Schließung Kraus als junger Mann miterlebt und immer bedauert hat. Darunter wiederum drei weitere Fotografien Nestroys in verschiedenen Rollen. Rechts daneben wieder drei Daumier-Karikaturen und darunter nochmals Nestroy in einer anderen großen Rolle, nämlich als Jupiter in OffenbachsOrpheus in der Unterwelt, und zwar als Jupiter, der sich auf amourösen Wegen in eine goldene Fliege verwandelt hat. Schon der Korridor ist also ein Kraus-Raum: Theater, Theater, alles Theater.
Betreten wir jetzt das Arbeitszimmer. Vor dem Fenster, das mit schweren Portieren zugezogen werden konnte, ein kleinerer Tisch mit zwei Stühlen. Rechts vom Fenster an der einen Längswand des Zimmers ein großes Bücherregal, das einzige größere in der ganzen Wohnung. Es besteht aus drei nebeneinanderliegenden Fächern verschiedener Breite, ist außerdem in fünf Ebenen übereinander geschichtet. Direkt anschließend rechts ein weiteres Regal. Links noch eines, das offensichtlich mit Fackel-Material vollgestopft ist, in Papier notdürftig eingewickelte Korrekturen, Fahnen etc. Auf der obersten Reihe die Fackel in Quartalsbänden, außerdem Buchausgaben der Werke von Kraus, darunter die Kraus’sche Bibliothek, die alle Besucher durch ihre Kompaktheit, um nicht zu sagen: Beschränktheit überraschte. Alle quer liegenden Bände eingerechnet werden hier, grob geschätzt, rund neunhundert Bücher versammelt sein. Kraus hatte hier immer noch so viel Platz zu verschenken, dass auf der obersten Reihe ein Viertel des Bretts noch mit Bildern verstellt ist. Er war kein Bibliophiler und kein Bibliomane. Er ließ sich Bücher aus Bibliotheken besorgen, wenn er sie brauchte, oder lieh sie sich bei Freunden aus. Bekam er Bücher zugeschickt, die ihm nicht wichtig wurden, verschenkte er sie oder ließ sie zum Antiquar bringen. Die vorhandenen Bücher sind teils schöne und kostbar wirkende Ausgaben der Klassiker: Goethe, Schiller, Shakespeare und Jean Paul. Dann aber auch Widmungsexemplare (wie belegt ist) von Frank Wedekind, Gerhart Hauptmann, Detlev von Liliencron und anderen wenigen Zeitgenossen, die er schätzte. Auf der anderen Längsseite neben einer Art Kommode mit matten Glasfenstern, einem »Kasten«, wie das damals hieß, steht noch ein kleines offenes Regal, in dem sich ebenfalls Arbeitsmaterialien stapeln.
Das Wohn- und Arbeitszimmer, Lothringerstraße, Wien, aufgenommen nach dem Tod von Kraus.
Vor das große Regal schräg herangestellt ist der durch die immer aufgeklappten Seitenteile enorm breite, wenn auch nicht sehr tiefe Schreibtisch, über und über bedeckt mit Büchern und Papieren. Dieser Schreibtisch war von Adolf Loos entworfen worden — die ganze Wohnung ist in ihren ersten Jahren teilweise zumindest nach Vorschlägen von Loos eingerichtet worden; neben dem Schreibtisch gab es auch einzelne Möbel und die Vorhänge, die auf seine Anregungen zurückgehen. In der Mitte des Schreibtischs befindet sich der eigentliche, relativ kleine Arbeitsbezirk, gekennzeichnet durch ein schon damals altmodisches Schreibzeug, bestehend aus einem Tintenfass und einer Schreibfeder mit Holzstiel, wie sie Kraus sein Leben lang benutzte, von der Volksschule an bis zur letzten Nummer der Fackel. Hinter dem Arbeitsbereich eine große, eher altmodische Tischlampe mit Messingschaft und einem breiten, sicher dunkelgrünen Lampenschirm, der drehbar war. Und dann musste noch ein Aschenbecher von erheblichem Format untergebracht werden, der beim ebenso erheblichen Zigarren- und Zigarettenraucher Kraus immer gut gefüllt war. Vor dem Schreibtisch ein bequemer, formschöner Schreibtischstuhl mit zwei U-förmigen Armlehnen, auf der Sitzfläche zwei Kissen, die der nicht groß gewachsene Kraus offensichtlich benötigte. Neben dem Schreibtisch stand ein beträchtlicher Papierkorb, daneben eine recht raumgreifende Ottomane, die wohl als Zwischen-Ruhelager bei der nächtlichen Arbeit benutzt wurde. Weitere kleine Beistelltischchen sind zu sehen; am Fenster steht ein großer Ledersessel. In der Ecke neben der Tür zum Schlafzimmer ein Kachelofen, rechts neben der Tür ein nach Rokoko schielender Tisch, darüber ein großer Spiegel.
Und auch hier, wie schon in der Diele: Bilder über Bilder, über alle Wände wuchernd, auf den Regalen, auf dem Schreibtisch, auf Beistelltischchen. Sie lassen sich in drei Gruppen aufteilen: Es sind zum einen Fotos des Bewohners in verschiedenen Lebensaltern, dann auch neben der Kommode die beiden berühmten Kraus-Porträts von Oskar Kokoschka, das Litho von 1912 und die Zeichnung, die im Sturm im Mai 1910 erschien. Unter der Lithografie Kokoschkas hängt ein Foto seines Druckers Georg Jahoda. Auf Familienfotos sind auch die Eltern und einige der Geschwister zu sehen. Die Geburtsstadt Jičín ist mit einer Ansicht vertreten. Zum anderen sind es Fotos und Bilder jener Größen der Vergangenheit, zu denen Kraus eine besondere Beziehung hatte. Wie schon in der Diele ist Nestroy mehrfach dabei, mit Rollen- wie auch mit Privatfotos, außerdem Jean Paul, Schopenhauer und Matthias Claudius, sowie geschätzte Schauspielerinnen.
In der Mehrzahl sind es Fotos der Freunde und Freundinnen, der Anhänger und Adepten, die ihm nahestanden: Arnold Schönberg in seinem berühmten Selbstporträt von 1919; Franz Janowitz und Franz Grüner, die im Ersten Weltkrieg gefallenen jungen Anhänger; Frank Wedekind als Totenmaske und als Fotografie; Adolf Loos, in einer fotografischen Reproduktion des Kokoschka-Porträts; Peter Altenberg. Vor allem aber die Frauen seines Lebens: Auf dem Schreibtisch steht das Bild Annie Kalmars, über dem Buchregal ebenfalls Annie Kalmar und nochmals Annie Kalmar als Gipsrelief auf einem Sockel in der Zimmerecke zwischen Kommodenwand und Fenster. Es ist das Gipsmodell des Hamburger Grabmals. Für alle späteren Frauen muss es schwierig gewesen sein, dass die früh verstorbene, aber doch unsterbliche Geliebte seiner Jugend von Kraus so mächtig präsent gehalten wurde. Neben diesem Gipsrelief hing in der Zeit, in der Leopold Liegler die Wohnung kennenlernte, das barocke Holzkruzifix, das Kraus, als er sich katholisch taufen ließ, von seinem Paten Adolf Loos erhalten hatte. Irgendwann hat Kraus das Kruzifix in das Vorzimmer verbannt, wahrscheinlich, nachdem er wieder aus der katholischen Kirche ausgetreten war. Nach seinem Tod nahm Helene Kann das Kruzifix an sich und hängte es ebenfalls bei sich im Vorzimmer auf. Als sie Besuch von Leopold Liegler bekam, merkte sie sein Interesse an diesem Kreuz und schenkte es ihm. Daneben sind auch Adele Sandrock und natürlich Sidonie Nádherný von Borutin zu entdecken, aber auch noch eine Dankurkunde des Wiener Tierschutzvereins (wohl der Dank für eine größere Spende). Auf der dem Fenster gegenüberliegenden Wand hängt ein großer venezianischer Spiegel, auf der Konsole darunter war lange ein blauer tropischer Schmetterling unter Glas zu sehen; er ist auf den Fotos nicht zu erkennen.
Das Schlafzimmer, ziemlich schmal, wird durch das große quer stehende Bett fast völlig ausgefüllt. Auffallend sind die drei erheblichen Kissen, die auf dem Bett übereinandergeschichtet sind: Kraus scheint nicht sehr flach geschlafen zu haben, falls die Kissen nicht nur dem Lesen dienten. Ans Bett herangerückt ein großer Sessel mit Plaids und Decken, neben dem Bett ein kleines Taburett mit einem kleinen Koffer, der wie ein Notkoffer wirkt, den man bei Feueralarm schnell an sich nehmen kann — er mag bei den ersten Ordnungsarbeiten nach dem Tod dorthin gekommen sein. Auf der anderen Seite ein kleiner Tisch mit Kaffeegeschirr. Über dem Bett ein Gipsrelief, diesmal vom jungen Kraus, daneben wiederum Frauenporträts, unter anderem ein großes Bild Sidonies neben Charlotte Wolter. Ein großer Kleiderschrank und ein sogenannter stummer Diener zum Aufhängen von Sakkos und Hosen. Außerdem Bilder von Annie Kalmar und anderen Frauen, sowie ein schmaler Tisch mit weiteren Papieren und Päckchen.
Der Gesamteindruck ist befremdend und bedeutend zugleich. Es ist die Wohnung eines Junggesellen, eine hermetische Klause, nicht nur für Familien ungeeignet, sondern auch für häufige Besuche von Freunden oder Freundinnen, keine Anatol-Wohnung also, sondern eine Wohnung, die ganz auf die Bedürfnisse eines ständig und herkulisch geistig arbeitenden Menschen zugeschnitten ist. Kraus’ Wohnung war eine Arbeits-, Gedenk- und Bilderhöhle besonderer Art.
Wie heißt es in Kraus’ Gedicht Alle Vögel sind schon da:
Und rechts und links in meinem Zimmer
hängt was gewesen an der Wand,
ein toter Freund reicht seine Hand
und was gewesen ist, bleibt immer.
Es schweigt mich an wie eine Sage,
jedes Ding von seinem Ort.
Die heimgegangne Göttin dort
Ruf des Geschlechtes heilige Klage.3
II Kindheit, Familie, Jugend
Herkunft
»Wo soll / Der fürstliche Leichnam seine Ruhstatt finden? / In der Kartause, die er selbst gestiftet, / Zu Gitschin ruht die Gräfin Wallenstein, / An ihrer Seite, die sein erstes Glück / gegründet, wünscht’ er dankbar, einst zu schlummern. / O lassen Sie ihn dort begraben sein!« So fleht die Gräfin Terzky am Schluss von SchillersWallenstein Octavio Piccolomini an, das Schicksal der Leiche des ermordeten Herzogs von Friedland, Albrecht Wallenstein, bedenkend. In Gitschin in Ostböhmen, tschechisch Jičín, heute auf Deutsch Jitschin geschrieben, rund neunzig Kilometer nordöstlich von Prag gelegen, wurde Karl Kraus am 28. April 1874 geboren. Heute hat das Städtchen rund 20.000 Einwohner, zur Zeit von Kraus’ Geburt rund achttausend, meist tschechischer Denomination, war es die Hauptstadt der gleichnamigen Bezirkshauptmannschaft, lag sie an der österreichischen Nordwestbahn und war Garnison des 3. Bataillons des 74. Infanterieregiments »Freiherr von Bouvard«. »Es ist ein sauberer Ort, der seine landschaftlichen und kulturellen Reize hat, ehrwürdig als Stätte blutiger Ereignisse und durch die Fülle bedeutender historischer Bauten«1, so Kraus rückblickend und etwas nüchtern 1925. Die blutigen Ereignisse haben mit Bismarck und dem deutsch-österreichischen Krieg zu tun, die historischen Bauten eher und vor allem mit Wallenstein.
Am 29. Juni 1866 trafen hier die preußischen und österreichischen Kräfte aufeinander. Die 5. preußische Division hatte Befehl erhalten, sich in den Besitz von Jičín zu setzen. General von Tümpling teilte seine Kräfte in drei Kolonnen: Die mittlere nahm Podulsch, scheiterte aber an Brada, während die rechte Kolonne den Österreichern (1. Armeekorps, Graf Clam-Gallas) ein siegreiches Waldgefecht lieferte und die linke ihnen die Ortschaften Zamez und Diletz entriss. Der Kampf schloss mit der Erstürmung der Stellung am Priwysin nach acht Uhr abends durch die Sturmkompanien des Generals von Tümpling. Es folgte noch ein Nachtgefecht, an dem die inzwischen eingetroffene 3. Divison (von Werder) teilnahm und das die Gefangennahme von drei österreichischen Bataillonen in zwei getrennten Straßengefechten in Jičín zur Folge hatte. Die Sachsen und Österreicher verloren über fünftausend Mann, darunter zweitausend Gefangene, die Preußen 1500 Mann. Das Treffen bei Jičín ermöglichte die Vereinigung der Ersten und Zweiten preußischen Armee und dadurch den Sieg bei Königgrätz (das wiederum rund vierzig Kilometer südöstlich von Jičín liegt). Dort fand wenige Tage später (am 3. Juli) jene Schlacht statt, die die Entscheidung des Krieges zugunsten der Preußen brachte. Bismarck nächtigte am Vorabend der Schlacht von Jičín im stattlichen Haus des »Handelsmannes, Kaufmanns und Hausbesitzers« Jacob Kraus und seiner Frau Ernestine, das sich hinter der Nordwestecke des Hauptplatzes befindet (die Adresse war Altstadt Nr. 43/44), also in repräsentativer Lage, in ebenjenem Haus, in dem Karl Kraus geboren wurde, angeblich war es sogar das spätere Geburtszimmer, in dem Bismarck sein Haupt zur Ruhe bettete. Man wird nicht ausschließen können, dass Kraus’ langanhaltende Begeisterung für Bismarck (»als Mensch ein Genie, als Staatsdiener nur ein Talent«, wie seine wiederkehrende Formel lautete), dessen Gedanken und Erinnerungen er für ein sprachlich großartiges Buch hielt, aus dem er immer wieder zitierte, gelegentlich auch vorlas, mit dieser frühkindlichen Hauslegende der Familie Kraus zusammenhängt.
Die Fülle bedeutender historischer Bauten hat aber mit Bismarck nichts zu tun, sondern mit einem anderen Condottiere früherer Zeiten, mit Wallenstein, Albrecht Eusebius Wenzel, Herzog von Friedland und Mecklenburg, Fürst von Sagan. Dessen Geburtstort Heřmanice (Hermanitz) liegt ebenfalls in Ostböhmen — das war Wallensteins Landschaft, und dort, eben in Jičín, beschloss er nach einigem Hin und Her, seinen Palast zu bauen, den Ruhesitz fürs Alter, das er nicht mehr erlebte, die Residenz. Golo Mann schreibt: »Gitschin hatte keine 200 Häuser, als er die Herrschaft antritt, es hat 500, als der Mord den blutigen Strich durch alle Pläne macht. Von einer Bauern- und Pfahlbürgersiedlung, in der man die Misthaufen vor den Häusern aus eigenem vermehrt, ist es zu einer blanken Residenzstadt, Handels- und Handwerkstadt geworden.«2 Die Hauptbauzeit des Palasts war 1623 bis 1630, die Ermordung Wallensteins in Eger vier Jahre später ließ den Palast unvollendet, aber bewohnbar. Das Schloss wurde verändert, es gehörte zur Zeit der Familie Jacob Kraus dem Fürsten Trauttmansdorff. Der für die kleine Stadt gewaltig dimensionierte Schlossplatz allerdings sah zu Kraus’ und sieht auch zu heutigen Zeiten so aus wie bei Wallenstein: ein Quadrat von Giebelhäusern im Stil der Spätrenaissance. Zwischen der etwas außerhalb gelegenen Kartause Walditz und der Stadt führte eine Lindenallee, die angeblich von tausenden von Soldaten in zehn Minuten gepflanzt worden ist.
Gräfin Terzkys von Schiller überlieferter Wunsch wurde nicht sofort erfüllt. Mehr als zwei Jahre lang lag der Sarg im Minoritenkloster in Mies. Erst dann wurde er in die Kartause geschafft, wo die Mönche zu ihrer Verwunderung den Leichnam noch unverwest und intakt fanden. Als das Kloster aufgelassen wurde, die Kartäuser ihre Heimstatt verlassen mussten, wurde die Kartause zu einem Gefängnis. Ende des 18. Jahrhunderts wurde einem Spross der Familie erlaubt, den Sarg Wallensteins in das Schloss Münchengrätz zu überführen, wo er heute noch liegt.
Eine ungewöhnlich reichhaltige Stadtgeschichte also und die entsprechenden Bauten, eindrucksvoll und gewaltig, gemessen an der Größe des Fleckens. Zusammen mit der idyllischen, bewaldeten und flussdurchzogenen Gegend werden sie für das kleine Kind Karl jene Empfänglichkeit für Landschaften und Ensembles gefördert haben, das den Erwachsenen auszeichnete. Die Erinnerungen an Jičín können nicht allzu intensiv gewesen sein, denn als Kraus drei Jahre alt war, siedelte die Familie bereits nach Wien um. Von Vater Jacob Kraus gibt es zwei Fotografien: Die erste zeigt ihn etwa 1870 mit seiner Tochter Malvine auf dem Schoß, ein schmaler, zierlicher Mann mit Backenbart und Oberlippenschnurrbart; die zweite von 1900, seinem Todesjahr, einen alten Mann (er war 1833 geboren), dessen Gesichtsausdruck einer gewissen zufriedenen Pfiffigkeit sich aber nicht geändert hat.
Das Geburtshaus in Jíčin, Altstadt, Stare mesto, Haus Nr. 43/44.
Jacob Kraus stammte aus dem ebenfalls böhmischen Unterkralowitz, wo sein Vater Isak (über die Mutter Jacobs ist nichts bekannt) bereits Handelsmann gewesen war, und kam 1860 nach Jičín; ein Jahr zuvor hatte er Ernestine Kantor geheiratet, die Tochter des in Jičín hochangesehenen Arztes Ignatz Kantor und von dessen Frau Anna. Beide Eltern Kraus stammten aus jüdischen Familien. Jacob Kraus war eine Zeitlang Gemeindevorsteher der jüdischen Gemeinde in Jičín und gründete in dieser Zeit eine Talmud-Thora-Schule. Das Judentum, das Kraus später solche Schmerzen bereitete, war also in der Familie keineswegs nur äußerlicher, routiniert beibehaltener Zierrat. Über die Mutter von Kraus, Ernestine, wissen wir wenig. Ein einziges Foto zeigt, dass der Sohn die entscheidenden Gesichtsmerkmale von ihr hat: die Augenpartie, den schmalen Mund. Es war also eine Hinaufheirat für einen aufstrebenden Handelsmann, wenn er die Arzttochter heiratete. Seine eigene Karriere wird die Erwartungen der Schwiegereltern aufs Schönste bestätigt haben.
Jacob Kraus war ein geschäftlich weitblickender Mann. Er erkannte, dass etwa die Lebensmittelindustrie, in diesem Falle also vor allem Mühlenbesitzer und Bäcker, für geklebte Papiersäcke einen steigenden Bedarf hatte. Also ließ er, speziell im Gefängnis in der Kartause von Jičín, in der Wallenstein so lange geruht hatte, solche Verpackungen von Gefangenen produzieren, Zwangsarbeit gewissermaßen, aber es waren keine Zwangsarbeiter, sondern Sträflinge, die sie herstellten. Das ist von Kraus-Gegnern später dem Sohn vorgehalten worden (es kursierte das Schmähwort vom »Sackel-Kraus«, eine Variante vom geläufigeren »Fackel-Kraus«), aber Arbeit von Gefangenen in Gefängnissen und Zuchthäusern ist bis heute nichts Unübliches und auch nichts Ehrenrühriges, da ja ein Teil des Erlöses den Gefangenen zugutekommt. Frühzeitig erkannte er auch den steigenden Farbenbedarf. Waschblau zum Beispiel, eine Unterspezies des Ultramarinblau, diente, mit Stärke versetzt und häufig in Kugelform, dem Nachspülen von Wäsche, um Gelbstich zu verhindern. Seit etwa 1830 wurde Ultramarin künstlich hergestellt aus einem Gemenge von Ton, Soda, Kohle und Schwefel. Ultramarin trat seinen Siegeszug an, weil ihm nach damaligen Erkenntnissen alle giftigen Stoffe fehlten. Es diente zum Mal- und Wasserfarbenverbrauch, zum Bedrucken von Tapeten, fand Verwendung in der Buchdruckerei und der Lithografie. Die deutschen Ultramarinfabriken erreichten gegen Ende des 19. Jahrhunderts einen Umsatz von fünf Millionen Reichsmark. Durch die billigeren und säurebeständigen Anilinfarben ging der Verbrauch an Ultramarin zwar in diesem Zeitraum zurück, aber er war immer noch lohnend genug, weil Jacob Kraus die Ultramarinproduktion Österreichs seit Anfang der achtziger Jahre in seiner Hand hatte und mit den deutschen Konkurrenten das Monopol für den Orient verabredete. Außerdem sicherten ihm seine Papiersäcke ein zweites »Standbein«. Seit 1895 hatte Vater Kraus auch eine Papierfabrik in Franzensthal im Böhmerwald, in der Nähe des Grenzübergangs Waldhaus. Jacob Kraus starb 1900, aber die Brüder von Karl Kraus, an ihrer Spitze der älteste, Richard, führten die Geschäfte erfolgreich weiter. 1911/12 wurden die Vereinigten Papier- und Ultramarinfabriken mit Sitz in Wien und Prag gegründet. Die Firma in Wien existierte bis zum »Anschluss« 1938, allerdings mit wechselnden Teilhaberschaften.
Kraus hatte neun Geschwister, er selbst war der Zweitjüngste von ihnen. Die älteste Schwester Emma wurde als über Achtzigjährige in Treblinka ermordet, in Auschwitz der Bruder Rudolf mit seiner Frau. Ein Schicksal, dem Kraus durch seinen Tod 1936 entging. Der älteste Bruder Richard, dem Kraus besonders nahestand, starb bereits 1909 in Wien. Seine Lieblingsschwester Marie, ein Jahr jünger als er, später verheiratetete Turnovsky, starb 1933.
Jacob Kraus mit Tochter Malwine, zirka 1869.
Der geschäftliche Erfolg des Vaters und der Brüder war für das Leben von Karl Kraus von erheblicher Bedeutung. Er gehörte zu einer ganzen Kohorte von Söhnen erfolgreicher Gründerzeitkaufleute und Geldmenschen, die es sich in »rentengeschützter Innerlichkeit« erlauben konnten, auskömmlich zu leben, ohne auf normalen Berufserfolg angewiesen zu sein. Sehr früh stand fest, dass er auf keinen Fall kaufmännisch tätig sein würde. Also wurde Anfang Januar 1900 vereinbart, kurz vor dem Tod des Vaters, dass aus der aus dem Erbteil stammenden Summe von 30.000 Kronen eine sechsprozentige Verzinsung monatlich oder vierteljährlich an ihn auszuzahlen sei, das waren 1800 Kronen jährlich. Vom Sommer 1906 an erhöhte sich die Summe auf zweitausend Kronen jährlich. Außerdem bezog er zusätzlich eine sechsprozentige Rente von einem Kapital von 80.000 Kronen, das heißt also 4800 Kronen jährlich. Diese Summe, so scheint es, wurde ab 1912, seit einer Teilhaberveränderung in der Firma und vor allem ab 1925 wegen der Inflation, geringer. Zweitausend Kronen war eine auskömmliche, wenn auch nicht stattliche Summe. Ein mittlerer Staatsbeamter verdiente vor dem Ersten Weltkrieg rund 125 Kronen im Monat, also rund 1500 Kronen im Jahr. 6800 Kronen war also eine durchaus ordentliche Summe, umgerechnet rund 40.000 Euro, die Kraus lange Zeit eine sorgenfreie Lebenshaltung ermöglichte. Seine Wohnung in der Lothringerstraße war zwar nicht groß, aber wohl nicht ganz billig in der Miete, weil sie sich in einem repräsentativen Haus in bester Lage befand. Persönlichen Luxus, mit Ausnahme der späteren Autokäufe, betrieb Kraus nicht. Die Einkünfte aus dem Verkauf der Fackel und aus den so lange erfolgreichen Vorlesungen verteilte er zu großen Teilen, meist über entsprechende Instituionen, unter bedürftige Menschen. Als sich die Einkünfte wegen der Inflation und auch wegen der deutlich sinkenden Erlöse der Fackel in den späten zwanziger Jahren deutlich, ja dramatisch verringerten, was durch die Einkünfte aus Lesungen und durch Theater- und Rundfunkhonorare zeitweilig ausgeglichen werden konnte, sah das bereits anders und deutlich schlechter aus. Man wird sagen können, dass sich Kraus am Ende seines Lebens dem finanziellen Notstand näherte, wenn auch ihn nicht noch erleben musste.
Ernestine Kraus, zirka 1869.
Kraus war ein körperlich eher schwaches Kind. Das ist bei den beiden zierlichen, schmalen und offensichtlich relativ kleinen Eltern nicht anders zu erwarten — auch seine Geschwister dürften in dieser Hinsicht ein ähnliches Erbteil mitbekommen haben. Was bei Kraus hinzukam, war eine Schiefstellung der rechten Schulter, in der Kraus-Literatur gemeinhin als Wirbelsäulenverkrümmung bezeichnet. Was es damit bei näherem Zusehen auf sich hat, darüber wird am Ende des Buches Auskunft gegeben werden. Sie war so schwach ausgeprägt, dass man auf keiner Fotografie etwas davon merkt, allerdings fiel sie allen, die mit Kraus in nähere Berührung kamen, sei es auch nur als Zuhörer seiner Vorlesungen, auf. Von einem Buckel, wie gelegentlich, meistens missgünstig, behauptet wurde, kann keine Rede sein, aber natürlich wird diese Abweichung vom Normalen auf das Selbstbewusstsein und Selbstgefühl des jungen Kraus keinen positiven Einfluss genommen haben. »Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein, und bei meiner Ehre! Ich will sie geltend machen. Warum bin ich nicht der erste aus Mutterleib gekrochen? Warum nicht der einzige? Warum mußte sie mir diese Bürde von Häßlichkeit aufladen? Gerade mir? Nicht anders, als ob sie bei meiner Geburt einen Rest gesetzt hätte.« Dass Kraus bei seinem ersten und letzten Versuch, auf einer Bühne als Schauspieler zu reüssieren (der Kurzauftritt als Prinz Kungu Poti in der von ihm organisierten Wiener Aufführung der Wedekind’schen Büchse der Pandora ist etwas anderes), ausgerechnet den Schiller’schen Franz Moor spielte, von dem diese Sätze stammen, und spektakulär scheiterte, ist schon merkwürdig. Der Befund hatte das Gute, dass er ihn vor der Einberufung im Weltkrieg bewahrte, vielleicht ihm also das Leben rettete. Wie weit er ihn psychisch beschwerte, ist nicht auszumachen. Auffallend ist, dass er einmal auf eine antisemitisch gefärbte Karikatur, die ihn mit tief zwischen den krummen Schultern sitzendem Kopf zeigte, äußerst gereizt reagierte, aber das kann auch mit dem antisemitischen Ton der Karikatur zu tun haben. Andererseits hat sie ihn bei einer seiner Lieblingsaktivitäten, dem Schwimmen, in dem er es zu einiger Meisterschaft brachte (immerhin hat er schwimmend Mechtilde Lichnowsky das Leben gerettet), offensichtlich nicht behindert. Es fiel ihm erst schwer, als die zunehmende Herzschwäche ihn am Ende seines Lebens lähmte.
Eines der ersten Fotos, das wir von Kraus besitzen, zeigt ihn als etwa Vierjährigen nach dem Umzug der Familie nach Wien, der 1877 stattfand. Auffallend ist ein Detail: Die Hände sind geradezu preziös gefaltet und mit der rechten Hand greift das Kind, wie sich selbst den Puls fühlend, über die linke. Das wäre für sich vielleicht gar nicht auffällig, wenn die notorisch beschworene Eitelkeit von Kraus nicht zumindest in einem Punkt bildlich nachweisbar ist. In den Fotografien, die von professionellen Fotografen später gemacht wurden, sind die in der Tat auffallend schönen, schmalen, aristokratischen Hände oft als Blickfang postiert. Unter den berühmten Fotos, die Trude Fleischmann von Kraus in den zwanziger Jahren aufgenommen hat, befindet sich eines, das nahezu exakt die kindliche Haltung der Hände nachbildet, nur seitenverkehrt. Der Händekult bei Kraus gipfelt in einem Foto, das sich nur auf die Hände konzentriert und daneben nur ein Viertel des Gesichts zeigt.3
Karl Kraus, zirka 1878.
Ernestine Kraus starb mit 52 Jahren 1891 in Wien, Kraus war siebzehn Jahre alt. In seinem grandiosen Jugend-Beschwörungs- und Verklärungsgedicht heißt es:
Heuer geht’s früh aufs Land,
auf blasser Wange
fühle ich deine Hand.
Fort bist du lange.
Fern als ein Leierklang
klingt’s in das Leben,
will’s einem Leid entlang
spielen und schweben.4
Kraus bewahrte zeit seines Lebens eine Haarlocke seiner Mutter auf, einen Brief von ihrer Hand und ein Blatt von einem Baum, der bei ihrem Grab stand.5 Die Bindung zur Mutter scheint also eng, sehr eng gewesen zu sein. Kein Wunder, da der Vater, wie alle erfolgreichen Väter der Gründergeneration, familiär wenig in Erscheinung trat, und wenn, dann, ebenfalls typisch, mit autoritärem Auftreten seinen Mangel an Präsenz wettzumachen suchte. Als cholerisch und aufbrausend wird er in den wenigen erhaltenen Andeutungen geschildert.
1877 zog die Familie von Jičín nach Wien. Das war mit dem erfolgreichen Aufstieg des Vaters und seiner Geschäfte unumgänglich geworden. Man konnte solche Geschäfte nicht mehr von einem böhmischen Provinzstädtchen aus führen. Von Karl heißt es, dass er den Wechsel schlecht verkraftete, der allerdings auch krass war. Immer wieder wird die von Germaine Goblot überlieferte Tatsache zitiert, dass sich der Vierjährige beim täglichen Spaziergang im Stadtpark in Begleitung eines Kindermädchens an sein Marionettentheater geklammert habe. Für den späteren Theatromanen ist das natürlich eine bezeichnende Episode, nur hat sich noch niemand darüber Gedanken gemacht, dass ein Vierjähriger sich kein Marionettentheater unter den Arm klemmen und damit spazieren gehen kann. Es wird sich also um einzelne Figuren, wahrscheinlich jeweils nur eine, dieses Marionettentheaters oder auch Puppentheaters gehandelt haben.
Ungetrübtes Glück verspürte Kraus nicht in der Weltstadt mit ihrem immensen Verkehr (im Vergleich mit Jičín zumindest), ihren Steinpalästen und gewaltigen Ringstraßenabschnitten, sondern im Wienerwald, wo die Familie im Sommer »aufs Land« ging, in Weidlingau oder in Hinterhainbach, ganz in der Nähe von Weidlingau. Auch in Bad Ischl hatte die Familie Kraus ein Feriendomizil. Die Wiesen und Wälder des Wienerwalds werden ihn deutlich an die Umgebung von Jičín erinnert haben. »Als ich zehn Jahre alt war, verkehrte ich auf den Wiesen bei Weidlingau ausschließlich mit Admiralen. Ich kann sagen, dass es der stolzeste Umgang meines Lebens war.«6 Im Gedicht Jugend heißt es:
Ja dort in Weidlingau,
in jenem Alter,
war mir der Himmel blau,
rot war der Falter.7
Schmetterlinge, wie eben die Admirale, hat Kraus immer besonders geliebt. Ein anderes Kind, achtzehn Jahre jünger, aus gleichermaßen großzügig ausgestattetem bürgerlichen und jüdischen Hause stammend, hat in Berlin und im damals noch ländlichen Potsdam ähnliche Erfahrungen gemacht: Walter Benjamin. »Und darum liegt das Postdam meiner Kindheit in so blauer Luft, als wären seine Trauermäntel oder Admirale, Tagpfauenaugen und Aurorafalter über eine der schimmernden Emaillen von Limoges verstreut, auf denen die Zinnen und Mauern Jerusalems vom dunkelblauen Grund sich abheben.«8
In Bad Ischl genoss Kraus später das Sommertheater mit seinen Komödien und Operettenaufführungen. Hier lernte er die Werke Jacques Offenbachs und anderer französischer Operettenkomponisten wie Edmond Audran kennen:
Dann in der Bildung Frohn,
bessrer Berater,
spielt mir der Lebenston
Sommertheater.
Da ward mir frei und froh
vor bunter Szene.
Liebte Madame Angot,
schöne Helene.
Blaubarts Boulotte und,
nicht zu vergessen,
Gerolstein, Trapezunt, alle Prinzessen.9
»Das Wort Familienbande hat einen Beigeschmack von Wahrheit.« Einer der berühmtesten Aphorismen von Kraus, oft zitiert von allen in dieser Hinsicht Geplagten, und das dürfte der größere Teil der Menschheit sein. Man könnte vermuten, dass das Verhältnis von Kraus zu seiner Familie tief gestört war. Das ergibt ein falsches Bild. Der älteste Bruder, Richard, der mit weiteren Brüdern die Firma des Vaters nach dessen Tod erfolgreich weiterführte, war so etwas wie ein Ersatzvater für den jüngsten Bruder (der Altersunterschied betrug immerhin vierzehn Jahre). Richard Kraus setzte den väterlichen Kurs der Strenge gegenüber den Kindern so lange gegenüber Karl fort, bis der sich nichts mehr sagen ließ, verband ihn aber mit durchaus brüderlicher Zuneigung. Die jüngere Schwester Marie, verheiratete Turnovsky, starb drei Jahre vor Kraus und war sein Leben lang seine Lieblingsschwester, auch wenn der Kontakt nicht allzu kontinuierlich gewesen zu sein scheint.
Die Liebe der Mutter zu Karl und die Liebe des Kindes zu der äußerlich schwach erscheinenden, der patriarchalischen Regierungsart des Vaters offenbar schutzlos ausgesetzten Frau war intensiv. Es erweckt den Anschein, als hätten sich hier die zwei oder auch die drei (die jüngste Schwester mitgerechnet) Schwächsten der Familie zusammengefunden, um in einer immerhin zwölfköpfigen Gemeinschaft eine kleinere Einheit zu bilden, die sich gegen die Übermacht der Erfolgreichen und Robusten zur Wehr setzten, soweit das möglich war. Ein Brief, den Kraus im Jahr 1897 an seinen Bruder Richard schrieb und in dem es vor allem um den Vater und die jüngste Schwester Marie geht, zeigt dies.10
Er vermittelt einen tiefen, wenn auch punktuellen Einblick in die Struktur der Familie Kraus. Er zeigt vor allem, dass das immer wieder festgestellte Auftreten von tiefgreifenden Konflikten in der Beziehung zwischen Kraus und seinem Vater, wie sie eigentlich so bezeichnend waren für das Verhältnis der Gründerzeit-Väter zu ihren materiell gut ausgestatteten, aber anderen Sphären der Kultur und der Kreativität sich zuwendenden Söhnen, doch auch abgeschwächt für die Familie Kraus zutrifft.11 Der Brief an den Bruder über den Vater ist nicht zufällig am Geburtstag des Vaters geschrieben und er trägt nicht zufällig zu Beginn ein Zitat aus dem Munde des Vaters, das von Kraus ausdrücklich als »Motto« gekennzeichnet ist: »Der Vater sagt: ich will keinen gebildeten Sohn.« Es geht im ganzen Brief um den Mangel an Herzlichkeit, der Karl von Richard (in diesem wie in andern Fällen sicher das Sprachrohr des Vaters) vorgeworfen wird, dieser aber gibt den Vorwurf ins Vielfache vergrößert zurück, und das vor allem in Richtung des Vaters. Es ergibt sich das Bild eines in der Tat autoritären Vaters, der seinen Kindern, wenn er auf Geschäftsreisen ging oder von solchen zurückkam, die Hand zum Kusse reichte. Eine solche Geste war in den großbürgerlichen Familien am Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich nicht mehr das Übliche; sie deutet auf das Provinzielle der Familienherkunft hin und war wohl ein Siegel der Aufsteigermentalität des Vaters. Der pflegte außerdem seine Kinder nicht mit dem Vornamen anzureden, sondern mit Brumm- und Zischlauten auf sich aufmerksam zu machen und sprach eher über sie in der dritten Person, als sie direkt anzureden. Überhaupt scheint die Ehrerbietung des Grußes und seine korrekte Ausführung in dieser Familie eine gewaltige Rolle gespielt zu haben, denn ein Konflikt, auf den im Brief angespielt wird, ergab sich aus einer Abschiedssituation mit mehreren Menschen, die nicht zur Familie gehörten, wobei der erwartete Abschiedsgruß des Sohnes dem Vater gegenüber versäumt wurde. Unter anderem daraus wurde der Vorwurf des herzlosen Sohnes geboren. Grundsätzlich betont Kraus hier (er ist mit 23 Jahren noch jung, aber nicht mehr kindlich), dass es eine Kluft zwischen der Familiensphäre und seinen Bestrebungen gebe. Es ist in der Tat schwer vorstellbar, dass Jacob Kraus tiefes Verständnis für die literarischen Ambitionen seines Sohnes hatte. Dies zeigt eine Korrespondenzkarte des Vaters an den Sohn: »Lieber Sohn Karl! D. l. Carte, sowie Zeitungsaussschnit unter Couvert heute erhalten, freue ich mich, daß Du wieder bald herkommst, & diene Dir das für Dich gar nichts gekommen, sonst hätte es Dir gleich nach Wien geschickt, danke Dir noch & H. frisch für den I. Band & sei herzl. geküsst von D. tr. Vater Kraus pp.« Wer so schreibt, hat den Übergang vom Analphabeten zum Alphabeten nur partiell geschafft. Das ist ohne Vorwurf gesagt, denn ein Mann, der sich aus kleinen Verhältnissen sehr weit nach oben gearbeitet hat, brauchte keine flüssige Feder und keinen literarischen Ausdruck; er hatte frühzeitig Sekretäre, die für ihn arbeiteten. Aber wie soll ein solcher Vater mit Freude beobachten, wenn sein jüngster Sohn literarisch-künstlerische Neigungen auszubilden scheint?
Es wurde erzählt, dass die Mutter einmal für die Töchter für einen Ball mehrere kostbare Fächer gekauft hatte. Der Vater sah bei der Abfahrt diese Luxusgüter und geriet in Wut. »Nur immer weiter so! Spielt auf, Musikanten! Man wird ja sehen, wohin das treibt!« Kein Wunder, dass Vater Kraus diesen Sohn und seine Ambitionen mit erheblicher Skepsis, ja mit Misstrauen betrachtete. In diesem Sinne wird die Laufbahn seiner älteren Söhne eher seinen Vorstellungen entsprochen haben. Dass Vater Kraus ein traditioneller Patriarch war, deutet auch der letzte Teil des Briefes an, in dem sich Kraus für seine jüngere Schwester ins Zeug legt und der gesamten Familie (die Mutter war ja einige Jahre zuvor gestorben) vorwirft, die »Complicität einer Mädchenseele« nicht zu verstehen. In dem weiteren Vorwurf, dass es in seiner Familie nur darum gehe, »Papier und Tochter« an den Mann zu bringen, klingen bereits jene Vorwürfe an, die im Umkreis von Sittlichkeit und Kriminalität dann vorherrschend werden. In der umgekehrten Perspektive bestimmt dieses zunächst familiäre Motiv eine Glosse wie Die Nebensache, in der Kraus eine Berliner Annonce zitiert, die beginnt: »Ich suche einen Schwiegervater der sich mit mir in Konfektion etabliert.« Kraus kommentiert: »Cherchez la femme, kann man da wohl nicht mehr sagen: Suchs Frauerl! Wo ist sie? Er sagt nicht: Einheirat, denn auch der Schwiegervater ist noch nicht etabliert. Sonst sagten sie wenigstens, dass sie das Geschäft finden wollen und darum die Frau suchen. Sie brauchten doch einen lebendigen Vorwand. Das fällt jetzt weg; der Schwiergervater ist das Rudiment einer überwundenen Entwicklung, die noch Sentimentalitäten kannte und die Frau beim Warenbestand berücksichtigte. Das ist vorbei. […] Zwei Haderlumpen werden sich in dieser großen Zeit über dem toten Leben eines Mädchens die Hand reichen.«12
Leo A. Lensing weist zu Recht auf die verblüffenden Parallelen zu KafkasBrief an den Vater hin: die gleichen autoritären Zurechtweisungen in der dritten Person, kurioserweise die gleichen Probleme, wenn das Brot bei Tisch nicht gerade geschnitten war. Bei Kraus allerdings fehlt das krisenschürende Moment der jüdischen Identität in der familiären Konstellation, zumindest in diesem Kontext. Das heißt nicht, dass der Vaterkonflikt bei Karl Kraus nicht auch Elemente antijüdischer Kritik enthält (von manchen später als jüdischer Selbsthass gedeutet), die ebenfalls zu schwerwiegenden Konflikten geführt haben. Kraus’ problematische Stellung zum eigenen und fremden Judentum ist weithin bekannt. Dass zu den innerfamiliären Quellen dieses Konflikts im Gegensatz zum Fall Kafka keine Zeugnisse vorliegen, heißt nicht, dass solche Konfliktquellen nicht vorhanden waren. Wenn ein junger Mann vor dem Tod seines Vaters, der ein aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde seiner Herkunftsstadt Jičín gewesen war, aus der israelitischen Gemeinde austritt, dann kann das nicht ohne Konflikte abgelaufen sein — leider wissen wir nicht, ob der Vater von diesem Schritt erfahren hat und wie er aufgenommen wurde. Es ist auffallend, wie viele Intellektuelle der Generation von Kraus aus jüdischen Familien stammten, in denen der Haupterwerb des Vaters oder Großvaters der Kaufmanns- und Unternehmerstand war. Der Aufstieg solcher Familien war nahezu überall von antisemitischen Widerständen begleitet. Die antisemitischen Vorurteile veranlassten viele dieser Söhne zur Flucht aus den Geldberufen der Väter. Es gab Phänomene dieser Distanzierung vereinzelt bereits früher, so etwa Heinrich Heine und Ludwig Börne, aber jetzt werden sie endemisch. Die Verquickung des Zieles totaler Assimilation, das Kraus in seiner Krone für Zion vertritt (die ein Jahr nach dem Brief über den Vater erscheint), mit dem Generationskonflikt führt zu jener prekären Zwischenstellung.
Dass der Brief an Richard über den Vater in großer Aufwühlung geschrieben wurde, bezeugen nicht nur die zahlreichen Unter- und die Durchstreichungen, sondern mehr als alles das Ende: »Und zum Schlusse eine Mittheilung, die Dir grotesk, wahnwitzig oder zum Mindesten ›überspannt‹ klingen mag [der Begriff »überspannt« war wahrscheinlich ein Hauptepitheton für Karl in der Familie]. Du sprichst von ›Lebensabendverschönern‹. Nun denn, ach ich sehe zu, das für mich zu thun, Ist das nicht sonderbar? Mach Dich gefaßt — erschrick nicht, wenn du gewahr wirst, daß die Tage, die mein 23. Jahr beendeten, mein ›Lebensabend‹ waren. Karl.«
Was heißt das? Leo A. Lensing lässt in der Schwebe, ob es sich um eine eher histrionische Geste der Überspanntheit oder um den ungeschminkten Verweis auf Selbstmordgedanken handle, wofür einiges spricht. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Da von einer Suizidgefährdung von Kraus nichts bekannt ist, scheint dies ein einmaliger Ausrutscher gewesen zu sein, der letzte Ausläufer einer allgemeinen Familienatmosphäre, die durch einen »Qualm von Unbehaglichkeit und Langeweile« gekennzeichnet war, der seinerseits vor allem auf der »morosen« (also mürrischen) Grundeinstellung des Vaters beruhte, wie sich Kraus in einem etwas früheren Brief an den damals noch guten Bekannten Felix Salten ausdrückte.13
Es sieht so aus, als habe sich Kraus nach diesem Ausbruch auf eine Art Versöhnung mit dem Vater eingelassen, vielleicht auf die Beibehaltung eines fragilen Status quo, was aber dazu führte, dass Jacob Kraus die Gründung der Fackel mit einem gewichtigen Kredit unterstützte. Welche Rolle Richard dabei spielte, kann nur vermutet werden, es wird eine vermittelnde gewesen sein. Dass Vater Kraus auch andere Seiten zeigen konnte, beweist eine kleine Episode. Als Kraus Anfang Oktober 1893 in München die Hauptmann’schenWeber vorlas, hatte er auch seinen Vater eingeladen. Der sagte ab, sparte aber nicht mit fürsorglichen Ratschlägen: »Trachte nur daß Du Dir nicht den Magen verdirbst u gib auf alles Acht. Trinke kein Wasser in der Fremde. Du mußt darauf sehen, daß Du Deine Wäsche u Kleider alle rein hast, damit Du ordentlich auftreten kannst, es wird Dich jedenfalls sehr anstrengen. Du mußt Dir beim Vortragen Mineralwasser bereithalten. Also ›Glück Auf‹ Lebewohl es küsst Dich D. t V Kraus Alle grüßen Dich!«14
Der Schüler Carl
Sechsjährig, wie üblich, kam Kraus in die Volksschule in der Schellinggasse 11, die Schlussprüfung legte er allerdings in der Volksschule in Weidlingau ab, wo die Familie im Sommer die Ferien verbrachte, wenn sie nicht nach Ischl fuhr. Zum Schuljahresbeginn 1884 kam er an das k. k. Franz-Joseph-Gymnasium. Wir können uns ein Bild des Schülers machen. Erhalten haben sich zwei Berichte. Der Anwalt Albert Weingarten, der im Hause Kraus verkehrte und später Karls ältere Schwester Malvine heiratete, scheint gelegentlich Nachhilfelehrerfunktionen ausgeübt zu haben und notierte in seinem Tagebuch: »Von den männlichen Mitgliedern der Familie gefällt mir am besten Carl; sein Charakter hat Kern. Er ist wild, trotzig, unbändig — aber er ist ein klarer offener Kopf. Es freut mich, daß er mir zugetan ist. Ich habe den Burschen gern und habe oft Not, nicht bezüglich seiner den anderen vis-a-vis parteiisch zu sein.«15 Ein ausführlicheres Zeugnis haben wir von einem Schulkameraden auf dem Gymnasium, Karl Rosner mit Namen. Er machte sich später als Journalist einen Namen, war Redakteur bei der Gartenlaube und dann zwischen den Kriegen der Berliner Leiter der Filiale des Cotta-Verlags, außerdem auch Verfasser historischer Romane. Rosner war ein Jahr älter als Kraus, aber sie waren in der gleichen Klasse. 1948 erschienen seine Jugenderinnerungen Unter dem Titel »Damals ---«. Bilderbuch einer Jugend. Nur wenige Leser werden »damals« darauf geachtet haben, dass es in diesem Buch ein Porträt des Franz-Joseph-Gymnasiums gab, eine strenge, »mit Zielrichtung auf klassisches Wissen und allgemeine Durchbildung geleitete Anstalt«, daneben aber ein Porträt eines Mitschülers, dessen weiteren Werdegang Rosner durchaus verfolgt hat, ein »farblos blasser, kränklich wirkender Bub«, eben Karl Kraus.16 Rosner beschreibt, wie gerade die gänzlich amusische Atmosphäre des Kraus’schen und die literarisch-theatralische des eigenen Elternhauses die Freundschaft zwischen den beiden Gymnasiasten befeuerte, wobei das Interesse sicher mehr auf der Seite von Kraus lag als auf der des anderen Karl. Außerdem war der alles leicht und sicher erfassende Stubenhocker Karl Kraus fast stets der Beste der Klasse, was Karl Rosner von sich nicht sagen konnte. Dafür war dieser den täglichen Fährnissen des Schulalltags besser gewachsen. Rosner, körperlich robust, prügelte sich für den schwachen Freund und Brillenträger im Stadtpark bei allfälligen Auseinandersetzungen und tauschte auch manche Glanzstücke seiner Steine- und Mineraliensammlung gegen Lösungen mathematischer Probleme (ein Fach, in dem Kraus glänzte). Und wenn Rosner mal wieder ins Klassenbuch eingetragen werden sollte, konnte sich der dafür zuständige Primus durch Gefälligkeiten schon erweichen lassen, den Eintrag zu unterlassen.
Rosners wichtigste Erinnerung ist sicherlich die an das imitatorische Talent des Klassenbesten. Der konnte offensichtlich die Lehrer so imitieren, dass sich die Klasse vor Lachen bog. Diese besondere Kunst lässt den späteren Wunsch, Schauspieler zu werden, verständlich erscheinen, seine Theaterleidenschaft insgesamt. Später hat Kraus diese Fähigkeiten nur noch privat genutzt, aber das in stupender Virtuosität, wie mehrfach bezeugt ist. Kraus hatte an seine Schulzeit die besten Erinnerungen. Der schulische Erfolg wird dazu beigetragen haben, aber es waren vor allem die Leseerlebnisse, die das ersetzten, was die häusliche Anregung offensichtlich nicht bot. Mit seiner enormen Kraft des Evozierens lang zurückliegender Eindrücke hat er immer wieder seine Freunde erstaunt. Noch gegen Ende seines Lebens konnte er die Namenslisten verschiedener Klassen wiedergeben. Einer seiner schönsten Aphorismen, besser gesagt Kurzprosastücke, lautet: »Es sollte verlockend sein, das Vorstellungsleben eines Tages der Kindheit wiederherzustellen. Der Pfirsichbaum im Hofe, der damals noch ganz groß war, ist jetzt schon sehr klein geworden, der Laudonhügel [eine Erhebung, die benannt war nach einem berühmten und beliebten Feldmarschall der Kaiserin Maria Theresia, der korrekt geschrieben Loudon hieß] war ein Chimborasso. Nun müßte man sich diese Dimensionen der Kindheit wieder verschaffen können. In einem Augenblick vor dem Einschlafen gelingt das der Phantasie manchmal. Plötzlich ist alles wieder da. Ein Fuchsfell als Bettvorleger wirkt ganz schreckhaft, der Hund in der Nachbarsvilla bellt, eine Erinnerungswelle aus dem Schulzimmer trägt einen Duft von Graphit heran und einen Klang des Liedes ›Jung Siegfried wa-a-ar ein tapferer Held‹, der Lehrer streicht die Fiedel, als ob er der leibhaftige Volker wäre, das alte Herzklopfen, weil man ›drankommen‹ könnte, im Garten blüht Rittersporn, kuhwarme Milch, erste Gleichung mit einer Unbekannten, erste Begegnung mit einer Unbekannten, das Temporufen des Schwimmeisters, Cholera in Ägypten und die Scheu in der Zeitung die Namen der Städte Damiette und Rosette (mit täglich zweihundert Toten) zu lesen, weil sie ansteckend wirken könnten, der Geruch eines ausgestopften Eichhörnchens und in der Ferne ein Leierkasten, der die Novität ›Nur für Natur‹ oder ›Er soll dein Herr sein‹ spielt. Alles das in einer halben Minute. Wer nicht imstande ist, es herbeizurufen, wenn er will, kann sich sein Schulgeld zurückgeben lassen. Ein gutes Gehirn muß kapabel sein, jedes Fieber der Kindheit so mit allen Erscheinungen sich vorzustellen, daß erhöhte Temperatur eintritt.«17 Es ist ein Text, dessen Evokationskraft sich durchaus mit der Berliner Kindheit um Neunzehnhundert Walter Benjamins messen kann. Es wäre lohnend, den Gemeinsamkeiten von Kraus und Benjamin, was Herkunft und Kindheit betrifft, weiter nachzugehen: das wohlhabende Elternhaus, der vergleichbar autoritäre Vater, die trostreiche, liebevoll zugewandte Mutter, die körperliche Schwäche des Kindes, die reiche Fantasiewelt, die sich schützend und kompensierend zwischen den schwachen Knaben und die raue Welt schob. Leider hat Kraus nur kürzeren und versprengten Texten die Erinnerungsfetzen seiner Kindheit anvertraut, dies aber mit der gleichen Kraft der Heraufbeschwörung, die Benjamin seinem Text mitgegeben hat. Dass Benjamin den tiefgründigsten Essay über Kraus geschrieben hat, ist kein Zufall. Er war ein begeisterter Leser der Fackel und tauschte sich mit seinem Freund Gershom Scholem immer wieder über seine Lektüre aus. Er traf sich auch mit Brecht in seiner Ehrerbietung gegenüber dem Wiener Einzelkämpfer, bis es dann (wie bei Brecht) zu jener kritischeren Haltung Benjamins gegenüber Kraus kam, als dieser den Wert des großen Kraus-Essays von Benjamin völlig verkannte, und erst recht, als er sich für Dollfuß engagierte.
Karl Kraus nach der Matura in Bad Ischl, vermutlich Sommer 1892.
Ein Lehrer war es besonders, der dem Schüler Carl, wie er sich damals schrieb, Eindruck machte, eine Art Mentor wurde: Dr. Heinrich Sedlmayer. Auch Rosner erinnert sich an ihn: »Ein reicher, gütiger Mensch, der hilflos war, wenn er auf allzu große Unaufmerksamkeit oder Faulheit stieß, der dann in verzweifelnder Bedrängnis die Hände rang, die blauen Augen in dem stillen Christuskopf gegen die kalkweiße Decke des Klassenzimmers hob« und dann bitter darüber klagte, dass die Buben nicht verstünden, dass alle Aufmerksamkeit, die der Lehrer an sie wandte, doch für sie aufgebracht werde, nicht für den Lehrer, der das doch alles bereits wisse. Dieser Sedlmayer war offensichtlich Altphilologe und Germanist — er hatte einen Ovid-Text ediert, unterrichtete aber in Kraus’ Klasse Deutsch. Er hat später die Kuriosität erzählt, dass der Tertianer Kraus eines Tages bei ihm zu Hause klingelte und darüber klagte, dass er mit dem Fach Deutsch solche Schwierigkeiten habe. Ein anderer Mitschüler hat ebenfalls berichtet, dass Kraus, später einer der größten Stilisten deutscher Sprache, als Schüler Schwierigkeiten im deutschen Aufsatz hatte. Alles Poetische und Blumige, das damals im deutschen und österreichischen Gymnasium als Zeichen eines »guten Stils« gefordert wurde, wollte ihm nicht gelingen, und noch war er nicht in der Lage, zu begreifen, dass dies ein Vorzug war. Auf einer Glatze Locken zu drehen, was später für ihn den Feuilletonismus kennzeichnete, lag ihm nicht, aber noch sah er das als Manko und fragte seinen verehrten Deutschlehrer, aus welchem Buch er denn »Stil« lernen könne. Sedlmayer versuchte vergeblich, dem kleinen Kraus klarzumachen, dass man so etwas wie Stil nicht aus einem Buch erlernen könne, und verwies dann, als sich der Schüler nicht überzeugt zeigte, auf ein beliebiges Buch über den deutschen Aufsatz.18
Dass Kraus mit dem damals üblichen Gymnasialunterricht in Deutsch nicht zurechtkam, verwundert nicht. Er selbst hat es mit aller Klarheit formuliert: »Ich bin noch heute nicht imstande, eine Ferienwanderung oder eine Herbstwanderung zu beschreiben, tröste mich mit dem Bewußtsein, daß Goethe selbst nicht in der Lage gewesen wäre, aus seinem Zitat ›Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind‹ einen Aufsatz zu machen […] Warum Lessings Minna von Barnhelm ein echt deutsches Lustspiel ist, eine Frage, die wie ein Alp seit Kindheitsträumen auf mir lastet, und von der ich das unbestimmte Gefühl habe, daß sie bis heute nicht endgültig beantwortet ist, weder von dummen Jungen noch von älteren Literarhistorikern.«19
Sedlmayer hat Kraus enorm beeindruckt. Der übernahm die Vaterrolle, die der prosaische Geschäftsmann Jacob Kraus nicht ausfüllen konnte. Die Fotografie des alten Sedlmayer zeigt ein sensibles Intellektuellengesicht. Welcher Lehrer eines Gymnasiums kann schon von sich sagen, dass ihm ein später berühmt gewordener Schüler eine dreizehnstrophige Ode gewidmet hat? An einen alten Lehrer heißt sie, mit dem Unteritel »Henricus Stephanus Sedlmayer«, und entscheidende Strophen lauten:
[…]
Von strenger Milde war dieser Unterricht.
Du guter Lehrer hattest den Schüler gern.
Doch näher deinem reinen Herzen
Lag wohl das Wohl eines armen Wortes.
Latein und Deutsch: du hast sie mir beigebracht.
Doch dank ich Deutsch dir, weil ich Latein gelernt.
Wie wurde deutsch mir, als ich deinen
Lieben Ovidius lesen konnte!
Denn jenes wahrlich machte mir Schwierigkeit.
Mir fehlten Worte, und es gelang mir nicht,
Den Frühling, den ich erst erlebte,
In einem Aufsatz auch zu beschreiben.
[…]
So kam ich durch und besserte später mich,
Weil ich es fühlte, dass ich dir schuldig war,
Im deutschen Aufsatz nach der Schule
Deinen Erwartungen zu entsprechen.
[…]20
Als Kraus sich 1912 über eine dümmliche Initiative des Kultusministeriums zur Hebung des Fremdenverkehrs mittels Lesestücken für die Volksschule aufregte, hat er seine Erinnerungskraft bemüht: »Die wir heute unter dem Fluch, im Zeichen des Fremdenverkehrs zu stehen, vorzeitig altern, können uns manchmal noch vor der Wichtigkeit des Hotelportiers in ein Logis der Erinnerung retten. Dann dringt nicht greifbarer als ein Sonnenstrahl im Staub, ein Tanz von Stimmen, Farben und Gerüchen ein, ein toter Tag schlägt seine Augen auf, und wir ertappen uns beim Einsagen, beim Zuspätkommen, beim Nachsitzen. Wir memorieren Lesestücke, sie waren von Pfeffel, Hölty, Kopisch und vor allem von Hey, und ferne klingt es wie: Bei einem Wirte wundermild, und: Hinaus in die Ferne … Und dennoch, es galt nicht dem Fremdenverkehr.«21 Kraus war ein Epigone des Lesebuchs — das hat keiner so klar erkannt wie eben Benjamin, der dem deutschen Lesebuch um 1900 Ähnliches verdankte: »›Des deutschen Knaben Tischgebet‹, ›Siegfrieds Schwert‹, ›Das Grab am Busento‹, ›Wie Kaiser Karl Schulvisitation hielt‹ — die waren seine Vorbilder, die haben in diesem aufmerksamen Schüler, der sie lernte, sich umgedichtet. So ist aus den ›Rossen von Gravelotte‹ das Gedicht ›Zum ewigen Frieden‹ geworden und noch die glühendsten seiner Haßgedichte sind an Höltys ›Feuer im Walde‹ entzündet, das die Lesebücher unserer Schulzeit durchstrahlte.«22
Der jugendliche Theatromane und das alte Burgtheater
»Ich bin auf der vierten Galerie geboren. Dort erblickte ich zum erstenmal das Licht der Bühne. Dort wurde ich genährt (für 40 Kr. altösterreichischer Währung pro Abend) mit den reichen Kunstmitteln des Kaiserlich-Königlichen Instituts, und dort sangen an meiner Wiege die berühmten Schauspieler jener Zeit ihre klassischen Sprecharien. Ich könnte ihre wunderbaren Tonfälle noch heute aus dem Gedächtnis aufzeichnen, wenn es für die Melodie des Sprechens allgemein gültige Notenzeichen gäbe. […] Es waren gar nicht die großen Tiraden, sondern ganz einfache Sätze, in denen die stärksten Melodien lagen. […] Wir kannten nicht nur den Text, wir kannten die Schauspieler auswendig.«23
Kein Bekenntnis kann die Faszination des Schülers Karl Kraus durch das alte Burgtheater am Michaelerplatz besser formulieren als diese Erinnerung: die Faszination durch die Klassiker, vor allem aber durch die großen Schauspieler jener Epoche, deren Stimmklang und Tonfall mehr noch als ihr Schreiten und ihre Gebärden den Schüler Kraus so tief beeindruckten, dass er sie noch Jahrzehnte später täuschend echt zu Gehör und Gestalt bringen konnte. Nur dass dieser schöne Evokationstext nicht von Kraus, sondern von Max Reinhardt stammt, zu dem Kraus nach anfänglichen Gemeinsamkeiten in schärfsten Kontrast geriet. Reinhardt, in Baden bei Wien geboren, nur wenige Monate älter als Kraus und auf den Rängen des alten Burgtheaters ebenso zu Hause, hat Kraus wahrscheinlich dort kennengelernt.
Das alte ehemalige Ballhaus war ein kleines Theater im Vergleich zum neuen Burgtheater. Zuverlässige Zeitgenossen schildern es als eines der kostbarsten Theater der Welt: ein langer, schmaler Saal, vier schmucklose Ränge, altes unbequemes Gestühl, altmodische Gasluster. Vor allem aber gab es eine Akustik, die schon damals mit der des Bayreuther Festspielhauses verglichen wurde und in der die geflüsterten und gehauchten Laute ebenso wirksam wurden wie der berühmte Schrei der Charlotte Wolter. Für Kraus blieb der Geist des alten Burgtheaters und seiner Schauspieler zeit seines Lebens der entscheidende Gradmesser dafür, was erfüllte Theatralität bedeutete. Das hieß nicht rückwärtsgewandter Konservativismus, denn ein solcher hätte es nicht zugelassen, dass sein Verkünder sich für Bert Brecht begeistern konnte, aber es hieß, dass sich die Verbindung von Sprach- und Sprechkunst in einem weit gefächerten Repertoire und einem über lange Zeit gewachsenen Ensemble als gültiger Maßstab erwies. Den Theaterregisseur im moderen Sinne, den für das Sprechtheater doch Reinhardt, für die Oper (ohne den Begriff zu reklamieren) Gustav Mahler erfunden hat, gab es damals noch nicht. Kraus vermisste ihn auch nicht, und als Reinhardt zu seinem geliebtesten Feind in der Theaterwelt wurde, hat er das »Regietheater« mit größter Skepsis beobachtet. Der Reinhardt’sche Begriff der »Spracharien« gibt zu Missverständissen Anlass. Keineswegs hat Kraus das selbstverliebte Virtuosentum von Schauspielern geschätzt, die auf Gastspielreisen wie Startenöre ihre Arien ablieferten und bereits ein Typus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren. Exponenten dieses Typus, zumindest hielt Kraus sie dafür, wie Josef Kainz und Alexander Moissi, waren ihm äußerst suspekt. Voraussetzungen für großes Theater waren ihm vor allem das Ensembletheater, wie es im alten Burgtheater mit seinen über Jahrzehnte führenden Zugehörigkeiten gegeben war, wo ein junger Schauspieler auffiel, integriert wurde, auf den Höhepunkt seiner Kunst aufstieg und dann wieder im Alter in die entsprechenden Rollen der zweiten Reihe zurücktrat. Der Wohlklang der gesprochenen Dichtersprache war Kraus durchaus Vorbedingung, die gedankliche Tiefe der Dramensprache der Klassiker musste dem Ohr des Zuschauers und Zuhörers in vom Rhythmus der Verse bestimmter musikalischer Weise eingeträufelt werden. Obwohl Kraus keine Noten lesen konnte und sich für Musik kaum interessierte, beweisen seine erhaltenen Schallplattenaufnahmen, dass er selbst zu einer rhythmisch gegliederten, vom Flüstern bis zum Schrei reichenden Vortragssprache fähig war — ohne diese Fähigkeit, die er an seinen Lieblingsschauspielern gelernt hatte, hätte er nicht 700 Vorlesungen mit teilweise frenetischem Erfolg halten können. Seine ebenfalls teilweise akustisch erhaltenen Gesangseinlagen bei Ferdinand Raimund und vor allem Jacques Offenbach beweisen überdies seine naturgegebene Musikalität: Hier singt einer perfekt ohne ausgebildete Gesangsstimme und ohne Notenkenntnis.
Wichtig aber ist vor allem, wie diese Dokumente zeigen, dass für Kraus das Charakteristische wichtiger war als das bloße Oberflächenschöne. Reinen Sprachbelcanto mochte er bei Schauspielern nicht, wie man an seiner späteren Ablehnung Moissis sehen kann, der für seine dem Gesang sich nahezu unziemlich nähernde sprachliche Darstellungsweise ebenso viel hysterische Verehrung wie auch Ablehnung erfuhr und nicht von ungefähr zu einem der bevorzugten Reinhardt-Schauspieler wurde. In den großen Mimen des alten Burgtheaters aber sah Kraus mehr als Sprechkunst im Sinne eines Außenreizes: Sprechkunst im Dienst des Sprachkunstwerks und Darstellungskunst des Einzelnen im Dienst der Ensembleleistung als Zusammenwirken von Menschenverkörperern. Seine mehrfach geäußerte Ansicht, dass der Effektschauspieler vom Defektschauspieler verdrängt worden sei, zeigt, wo seine Präfenzen lagen: lieber Effekt als Defekt, aber Effekt ohne Effekthascherei.
Es gab keinen spezifischen Burgtheaterstil, so wie es in Berlin einen naturalistischen Otto-Brahm-Stil gab und dann den weltweit erfolgreichen Reinhardt-Stil. Das Burgtheater spielte im Rahmen des Zensursystems eine erstaunliche Breite an Repertoire. Franz von Dingelstedt als Burgtheaterdirektor hatte mit einem großen Shakespeare-Zyklus Erfolg, ihm folgte 1881 Adolf Wilbrandt, selbst Schriftsteller, Dramatiker und geschickter Bearbeiter klassischer Stücke, der es als Erster wagte, die beiden Teile des Faust an drei Abenden hintereinander aufzuführen, die drei Teile des Wallenstein an zwei Abenden, daneben natürlich den österreichischen Klassiker Grillparzer, die griechischen Klassiker Euripides und Sophokles, sowie aus dem 19. Jahrhundert Bjørnson, Gogol, Turgenjew. Damit allein konnte ein Spielplan eines solchen Theaters nicht gefüllt werden: Unterhaltungsware auf einem einigermaßen gehobenen Niveau war ebenso nötig. Lustspiele von Blumenthal, Fulda und Lindau, Erhebendes von Wildenbruch und Gemessenes von Bauernfeld, Gesellschaftsdramatik von Sardou aus Frankreich wie Schwänke von Schönthan und Kadelburg gehörten ebenso dazu. Weil den Vorstadttheatern zugedacht, erschienen Raimund und vor allem Nestroy nur ausnahmsweise auf dem Spielplan — Kraus hat später, als sich das neue Burgtheater populistisch Nestroys annahm, dies mit scharfer Kritik verfolgt.
Vor allem aber war der beste Spielplan auf die Schauspieler angewiesen. »Burgschauspieler«, das war eine besondere Existenzform: »Am Burgtheater waren die besten Schauspieler, die es gab, lebenslänglich engagiert und zu einem wunderbaren Ensemble vereinigt. Heute kann man kaum mehr begreifen, was das war, ein ›Burgschauspieler‹. Er hatte die größten Vorrechte und die größten Ehren.«24 Die Begeisterung für den Schauspieler war die Konstante in der Beziehung zwischen Publikum und Burgtheater. Mochten die Direktionen wechseln, mochte mal mehr Shakespeare, mal mehr Schiller oder Blumenthal und Sardou im Vordergrund stehen — das Publikum dieses Theaters machte (das mag man kritisieren) keinen allzu großen Unterschied zwischen Schiller und Blumenthal (Kraus schon), wenn nur zwei, drei Lieblingsschauspieler gleichzeitig auf der Bühne standen und den edlen Schwung Schiller’scher Blankverse mit derselben Intensität interpretierten wie das Geplauder eines Salonstücks. Und weil man als Burgtheaterschauspieler praktisch unkündbar war und wenig Anlass hatte, aus einer Stadt, in der man so vergöttert wurde, in eine andere Stadt, an ein anderes Theater zu wechseln, wuchs und verwelkte man synchron mit seinem Publikum. Und wenn die alt gewordenen Lieblinge sich dann statuarisch am Souffleurkasten postierten, weil sie sich die Texte nicht mehr merken konnten — es wurde ihnen nachgesehen, weil man ja die großen und lebendigen Erinnerungen hatte. Wen die Wiener liebten, den ließen sie nicht mehr von der Bühne, wer bei ihnen nicht ankam, welche Meriten er sich auch andernorts erworben hatte, der zog besser bald weiter. Es waren Schauspieler, nochmals sei es betont, die nicht bloß als reine Verse-Sänger ihren Kollegen von der Oper hohl tönende Konkurrenz machten, sondern die durch die Macht der Persönlichkeit wie durch die der Stimme und der Sprechkunst zu wirken verstanden. Es sind einige wenige kostbare Tondokumente erhalten, die die Stimmen einiger dieser Schauspieler bewahren, unter anderm von Josef Lewinsky. Sie zeigen durchaus Pathos, aber kein überdimensioniertes, aber dann auch eine Nüchternheit, gegenüber der etwa der viel spätere modernere Moissi manieriert wirkt, ungeachtet der Faszination, die von ihm akustisch auszugehen vermag.25
Und was waren das für Schauspieler! Charlotte Wolter, ursprünglich Tänzerin, fast vierzig Jahre am Burgtheater, eine Darstellerin der großen Geste, die prunkhaftes Pathos verkörpern konnte ebenso wie die Dämonie der Lady Macbeth und die Verletzungsintensität der Hebbel’schen Kriemhild. Josef Lewinsky, der so viele Schurken spielte (Franz Moor war eine seiner Glanzrollen), der im persönlichen Umgang ein liebenswürdig-feiner Mensch war mit einer starken bibliophilen Neigung und einer berühmten Privatbibliothek. Dann der Mecklenburger Ludwig Gabillon (die meisten Stars waren keine Wiener, oft nicht einmal Österreicher), der in den tragischen Rollen des Repertoires, den Gestalten über dem Durchschnitt ebenso seinen Mann stand wie in Salonstücken. Seine Frau Zerline Gabillon, auf der Bühne eine Dame mit mehr Verstand als Geist, wie sie charakterisiert wurde, überlegen, scharf, auch kratzbürstig, ideal für die entsprechenden jungen Frauen bei Shakespeare, die allen gefallen, ohne sich etwas gefallen zu lassen. Friedrich Mitterwurzer