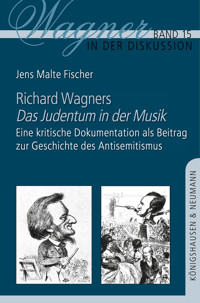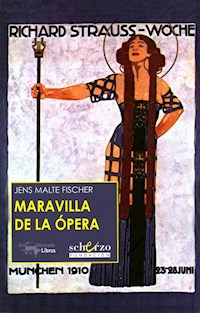Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Richard Wagner kommt nicht zur Ruhe. Noch immer ist nicht klar, welche Rolle seine Nachkommen auf dem Hügel in Bayreuth spielen sollen, noch immer ist man sich in Israel uneinig über die Frage, ob seine Musik dort aufgeführt werden darf oder nicht. Richard Wagners Wirkung: Darunter fällt etwa die Frage, wie man seinem Anspruch auf Erneuerung der Oper in der Gegenwart gerecht wird, darunter fällt aber auch die Frage, wie man die Begeisterung für Wagners Werk mit dessen Antisemitismus in Einklang bringt. Zum 200. Geburtstag am 22. Mai 2013 legt der Wagner-Kenner Jens Malte Fischer einen Band vor, der Wagners Wirkung auf unterschiedlichen Ebenen bis heute nachverfolgt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Richard Wagner kommt nicht zur Ruhe. Noch immer ist nicht klar, welche Rolle seine Nachkommen auf dem Hügel in Bayreuth spielen sollen, noch immer ist man sich in Israel uneinig über die Frage, ob seine Musik dort aufgeführt werden darf oder nicht. Richard Wagners Wirkung: Darunter fällt etwa die Frage, wie man seinem Anspruch auf Erneuerung der Oper in der Gegenwart gerecht wird, darunter fällt aber auch die Frage, wie man die Begeisterung für Wagners Werk mit dessen Antisemitismus in Einklang bringt. Zum 200. Geburtstag am 22. Mai 2013 legt der Wagner-Kenner Jens Malte Fischer einen Band vor, der Wagners Wirkung auf unterschiedlichen Ebenen bis heute nachverfolgt.
Jens Malte Fischer
Richard Wagner und seine Wirkung
Paul Zsolnay Verlag
Für Sebastian
Inhalt
Wagners Wirkung bedenkend
Aufführungspraxis
Der erste Nibelungen-Ring – Bayreuth 1876
Die Meistersänger – Zur Geschichte des Wagner-Gesangs
Antisemitismus
Richard Wagners Das Judentum in der Musik
Entstehung – Kontext – Wirkung
Das Judentum in der Musik
Kontinuität einer Debatte
Ausstrahlung
Der Alt-Revoluzzer und der Dulderkönig
Richard Wagner und Ludwig II.
Ein Märchen ohne gute Fee
Sympathie mit dem Tode
Tristan und Isolde und die literarischen Folgen
»Los von Wagner«? Probleme und Perspektiven der Oper zwischen 1890 und 1930
Wagner-Interpretation im »Dritten Reich«
Musik und Szene zwischen Politisierung und Kunstanspruch
Ausklang
Richard Wagner und Gustav Mahler
Ein Gespräch
Anhang
Nachweise
Anmerkungen
Wagners Wirkung bedenkend
Während diese Zeilen geschrieben werden, ist gerade wieder einmal der periodisch aufflammende Streit um die Musik Wagners in Israel zu einem sehr vorläufigen Ende gekommen. Der Streit schwelt nicht etwa erst seit Ende des Zweiten Weltkriegs, sondern bereits seit dem 12.11.1938, also drei Tage nach dem in Deutschland stattfindenden Pogrom vom 9. November 1938, der sogenannten »Reichskristallnacht«, als das Palestine Symphony Orchestra, das unter der Leitung Arturo Toscaninis ein Konzert mit dem Meistersinger-Vorspiel angesetzt hatte, dies wieder absetzte und durch Webers Oberon-Ouvertüre ersetzte, ausdrücklich als Reaktion auf den deutschen Pogrom. Ganz radikal war diese Maßnahme jedoch nicht, denn noch im Februar 1939 spielte das gleiche Orchester bei einem Gastspiel in Kairo und Alexandria Orchesterstücke Wagners. Nach dem Ende des Krieges wurden Richard Strauss und Franz Lehár in den Boykott miteinbezogen, dann auch Carl Orff, Strauss wegen seiner willfährigen und opportunistischen Haltung im »Dritten Reich«, Carl Orff aus den gleichen Gründen, wie auch Lehár, letzterer auch wegen der unbezweifelbaren Tatsache, daß Hitler neben Werken Wagners vor allem die Lustige Witwe schätzte. Im April 1953 setzte der große Geiger Jascha Heifetz es durch, daß er in Israel die frühe Violinsonate von Richard Strauss spielen konnte, wurde aber deswegen körperlich attackiert. Als erster Dirigent hat dann Zubin Mehta, Ehrendirigent des Israel Philharmonic Orchestra (Nachfolger des Palestine Symphony Orchestra), mehrfach versucht, zunächst Strauss und dann auch Wagner auf die Programme zu setzen. Schließlich gelang ihm dies auch im Oktober 1981 mit Vorspiel und Liebestod aus Tristan und Isolde – wenn immer wieder behauptet wird, der Boykott sei nie durchbrochen worden, so stimmt das seit diesem Datum nicht mehr. Allerdings wurde dieses als Zugabe gespielte Orchesterstück von heftigen Protesten begleitet. Mehta hatte den Vor- und Nachteil zugleich, kein Jude und kein Staatsbürger Israels zu sein; Daniel Barenboim ist beides, war aber dennoch oder deswegen immer wieder heftiger Kritik ausgesetzt, wenn er (zuerst 1991) Wagner aufs Programm setzte oder als Zugabe ankündigte, mit dem Hinweis, jeder, der das nicht hören wolle, könne den Saal ja verlassen. Und gerade jetzt ist ein neuer Versuch des 2010 vom Rechtsanwalt Jonathan Livny gegründeten ersten israelischen Wagner-Verbandes gescheitert, in Tel Aviv ein Konzert durchzuführen, das (dies wäre eine Neuerung gewesen) ausschließlich Werken Wagners gewidmet sein sollte.
Der Boykott von Strauss, Lehár und Orff ist quasi stillschweigend seit etwa zwanzig Jahren aufgehoben, der gegen Wagner gilt nach wie vor; die aktuelle Auseinandersetzung hat gezeigt, wie virulent die Angelegenheit, die dann immer auch international heftig diskutiert wird, nach wie vor ist.
Es fällt leicht, auf die Inkongruenzen der Sache hinzuweisen. Das Argument, solange Opfer der Shoah noch lebten, dürfe man Wagner nicht spielen, ist doch recht verquer. Sollen die zuständigen Stellen Buch darüber führen, wann der letzte Shoahüberlebende das Zeitliche segnet, und dann anregen, eine Wagner-Festwoche zu veranstalten? Wenn das Argument standhält, dann ist es mit diesem Datum nicht obsolet geworden, sondern müßte von den Kindern der Überlebenden übernommen werden. Jedoch ist klar: Niemand wird in Israel gezwungen, Wagner zu hören. Wer ein Werk des Komponisten auf dem Programm findet, muß das Konzert nicht besuchen, wer erst im Konzert hört, daß es als Zugabe gespielt wird, kann, siehe Barenboim, den Saal verlassen. Aber darum geht es den Protestierenden nicht: Sie bleiben im Saal und protestieren so laut, daß eine Aufführung Wagners schwierig wird. Von einer gewissen Unlogik zeugt auch, daß Werke Wagners in Israel über private TV-Kanäle in Opernaufführungen gesehen werden können, daß DVDs und CDs mit Wagners Musik gekauft werden können.
Ebenso kann das Argument nicht ausgehebelt werden, daß in Israel Autos der Marken VW, Mercedes-Benz und BMW sich erheblicher Beliebtheit erfreuen, alles Autohersteller, die auf enge Weise mit dem »Dritten Reich« verbunden waren, von ihm (beziehungsweise von Zwangsarbeitern) profitiert haben. Selten wird darauf hingewiesen, daß die Marke Ford ebenfalls tabu sein müßte, denn von Henry Ford stammt ein berüchtigtes antisemitisches Pamphlet The International Jew, immerhin in vier Bänden (basierend auf einer Reihe von Zeitungsartikeln) in den zwanziger Jahren publiziert, und wenn auch die Texte wohl nicht von ihm persönlich verfaßt wurden, erschienen sie unter seinem Namen, ganz davon abgesehen, daß auch Ford vor dem Krieg für das »Dritte Reich« LKWs und Kettenfahrzeuge produzierte, was Henry Ford mit einem NS-Orden vergolten wurde. Es gibt also genug Anlaß für einen israelischen Staatsbürger, sich auch beim Autokauf vorzusehen.
Aber das alles entlastet Richard Wagner nicht und auch nicht die Tatsache, daß seine Musik in den Lagern eher selten gespielt wurde, daß Beethoven und Bruckner im »Dritten Reich« bei offiziellen Anlässen und im Rundfunk viel häufiger ertönten als Wagner und daß der einzige wirkliche fanatische Wagnerianer in der Führungsclique der Nazis Adolf Hitler war, während andere ein nur laues Verhältnis zu Wagner hatten, manchmal sogar eher ein ablehnendes (wie Alfred Rosenberg).
Es ist wahrlich zu verstehen, wenn Juden in aller Welt, speziell israelische Staatsbürger, die Musik Wagners nicht hören wollen (bis weit ins 20. Jahrhundert gehörte das jüdische Bildungsbürgertum in Mitteleuropa zu den begeistertsten Anhängern Wagners). Ein Boykott, eine Tabuisierung ist jedoch nicht der richtige Weg, sich damit auseinanderzusetzen, ist vor allem bei einem Welt-Komponisten dieser Berühmtheit ridikül. Man sollte Wagner spielen, aufführen, ansehen, hören, wenn man denn will, sich aber dabei bewußt bleiben, welcher Ideologie dieser große Komponist Wort und Stimme geliehen hat.
Wagner war ein in der Wolle gefärbter Antisemit, das wird heute nicht mehr bestritten. Strittig ist nach wie vor, erstens, wie gewichtig der Wagnersche Antisemitismus war, und zweitens, ob Spuren davon im musikdramatischen Werk selbst zu finden sind. Die erstere Frage beantworten inzwischen die meisten seriösen Experten mit der Erkenntnis, daß der Wagnersche Antisemitismus über das um die Mitte des 19. Jahrhunderts »Übliche« deutlich hinausging und sich in den folgenden Jahrzehnten von Wagners Leben eher noch verschärfte. Die neuerdings immer wieder aufgewärmte These, daß Cosima Wagner die eigentliche Antisemitin war und den schwachen Gatten bei diesem Thema am Nasenring herumführte, kann in das Reich der Fabeln und Entlastungsstrategien verwiesen werden. Der Autor kann sich allerdings durchaus noch an Zeiten erinnern, in denen der Wagnersche Antisemitismus und seine tiefgreifende Wirkung heruntergespielt und deutlich verharmlost wurde, wenn er denn überhaupt ein Thema war. Seit Hartmut Zelinskys epochaler Dokumentation Richard Wagner – ein deutsches Thema ist das nicht mehr möglich.1 Der Autor selbst hat sich ausführlich mit Wagners in diesem Zusammenhang zentraler Schrift Das Judentum in der Musik beschäftigt.2 Aus guten Gründen spielt daher das Thema auch in diesem Buch eine wichtige Rolle.
Der zweite Punkt ist der sehr viel heiklere. Mit der festen und unumstößlichen Ansicht, daß Spuren der zentralen ideologischen Besessenheit Wagners auch in seinen Werken aufzuspüren sind, befindet sich der Autor, wie er immer wieder merkt, in einer Minderheitsposition, aber keineswegs allein. Die Angelegenheit ist dermaßen kompliziert, daß die folgenden Bemerkungen notgedrungen fragmentarisch bleiben, ja unzulänglich wirken müssen. Die einzige ausführliche monographische Untersuchung dazu ist bisher die des amerikanischen Germanisten Marc A. Weiner.3 Weiners Buch wurde heftig kritisiert, dennoch ist der Autor der Meinung, daß Weiner weitgehend recht hat, auch wenn er in einigen Punkten zu Übertreibungen neigt, unnötige Zuspitzungen bevorzugt, auch über sein Ziel hinausschießt. Nicht zu bestreiten bleibt, daß er beträchtlichen Scharfsinn aufgewandt hat, um Licht in ein Gestrüpp von Halb- und Ganzwahrheiten, vor allem aber von Leugnungen und Verharmlosungen zu bringen. Das Problem ist, daß Wagner-Interpreten, Regisseure wie Dirigenten vor allem, Wissenschaftler, aber auch »simple« Wagner-Liebhaber es zwar aushalten, zur Kenntnis zu nehmen, daß ihr Heros antisemitische Ansichten von einiger Radikalität geäußert hat. Sie wollen aber nicht anerkennen, daß diese seine Ansichten Spuren in seinem Bühnen- und kompositorischen Werk hinterlassen haben, weil sie dann ja vor der Alternative stünden, entweder ihrer Liebe zu diesem Werk abzusagen oder diese aufrechtzuerhalten in vollem Bewußtsein dieses Sachverhaltes (Marc A. Weiner gehört übrigens zu dieser letzteren Gruppe).
Auch der Autor ist der Meinung, daß es diese Spuren gibt. Das Problem, diese Spuren heute kenntlich zu machen, auf sie hinzuweisen, besteht darin, daß der antisemitische Code der Zeit Richard Wagners heute in dieser Konsistenz nicht mehr zur Verfügung steht, jedenfalls nicht in zivilisierten Gesellschaften – dazu haben die Ereignisse des 20. Jahrhunderts geführt. Wagner selbst konnte noch damit rechnen, daß versteckte, augenzwinkernde Anspielungen musikalischer wie szenischer Art von seinen Zeitgenossen, Juden wie Antisemiten wie auch »Neutralen«, sehr wohl verstanden wurden. Ein schlagendes Beispiel ist die Gestalt des Mime im Ring des Nibelungen. Und hier genügt, ganz abgesehen von den Charaktereigenschaften dieses unerfreulichen Zeitgenossen, seiner äußeren Gestalt, wie Wagner sie umreißt, ein Höreindruck von dem keckernden, kreischenden, sich stimmlich überschlagenden, keifenden Charaktertenor, der hier gefordert wird. Wenn man diesen Eindruck hat und daneben hält, daß (nicht zuletzt in Wagners Judentum in der Musik) das greinende, keifende, buffonesk-tenorale Klangbild als ein typisch jüdisches Merkmal des Sprechens von Juden, aber auch des Singens in der Synagoge angesehen wurde, dann wird man etwa die Auseinandersetzung zwischen Mime und Alberich im 2. Akt des Siegfried als einen nur schwer zu widerlegenden Beweis für die jüdische Konnotierung zumindest Mimes (die Gestalt Alberichs ist ein schwierigerer Fall) ansehen können. Wem das nicht einleuchtet, der sei zu einem Vergleich ermuntert. Man höre diese Szene und lege dann vergleichend zwei andere Musikstücke auf: erstens den Abschnitt »Der reiche und der arme Jude – Samuel Goldenberg und Schmuyle« aus den Bildern einer Ausstellung von Modest Mussorgsky (die spätere Orchesterfassung von Maurice Ravel macht es noch deutlicher als die originale Klavierfassung) und man wird staunen über die Musik, die Schmuyle zugeordnet wird, was ihre Ähnlichkeit mit Mimes Musik und Singweise betrifft. Zweitens wäre noch das sogenannte Judenquintett aus Richard Strauss’ Salome heranzuziehen. Was und wie dort die Juden singen, erfüllt alle Kriterien einer antisemitischen oder, vorsichtiger gesagt, einer antisemitisch auslegbaren Karikatur auf musikalisch-szenischem Gebiet und paßt sich nahtlos in den skizzierten Kontext ein.
Zuschauer und Zuhörer von heute haben Schwierigkeiten, solche Bedeutungen zu erkennen, man kann ja sagen, glücklicherweise. Das bedeutet aber nicht, daß sie nicht da sind, nicht so gemeint sind. Man müßte weiterhin über die Figur des Beckmesser in den Meistersingern sprechen, natürlich auch über Kundry und Klingsor im Parsifal – alle diese Fälle sind nicht über einen Leisten zu schlagen, aber sie gehören in diesen Zusammenhang.
Zumindest was die Gestalt des Mime betrifft, so gibt es einen Beleg, der eigentlich weitere Diskussionen erübrigen würde, nähme man ihn zur Kenntnis und dann auch ernst. Gustav Mahler, dem Antisemitismus seiner Zeit bekanntlich intensiv ausgesetzt und auch nach seinem Tode davon verfolgt, war ebenso bekanntlich ein glühender Wagner-Verehrer (das letzte Kapitel des Buches widmet dieser Tatsache eine vom Übrigen etwas abweichende Betrachtung). Natürlich wußte Mahler um Wagners Antisemitismus – dem konnte man nicht entgehen, wenn man in der Generation Mahlers Wagner-Anhänger oder auch -Gegner war. Merkwürdigerweise gibt es von Mahler keine schriftliche Äußerung dazu, wie er sich überhaupt gegenüber dem Antisemitismus seiner Zeit stark abwehrend in der Form der weitgehenden Ignorierung (bei gleichzeitiger völliger Klarheit über die Tatsache) verhielt. Es gibt aber eine Äußerung mündlicher Art, die so gediegen überliefert ist, daß an ihrem Wahrheitsgehalt nicht zu zweifeln ist. Natalie Bauer-Lechner, eine befreundete Geigerin, die bis zur Heirat mit Alma seine engste Vertraute in musikalischen und geistigen Dingen war, mehr noch als seine Schwester Justine, und die eckermannmäßig alles sofort aufzeichnete, was Mahler ihr in Gesprächen in seiner Wohnung, auf Spaziergängen oder im Urlaub mitteilte (ihre Erinnerungen an Mahler gelten als außerordentlich wertvolle und zuverlässige Quelle), hat folgendes aufbewahrt: Im September 1898 dirigierte Mahler an der Wiener Hofoper, deren Leiter er war, eine Vorstellung des Siegfried. Hinterher sagte er in kleinem Kreis über den Sänger des Mime, einen Julius Spielmann: »Er ist schon sehr durch den Theaterschlendrian verdorben. Das Ärgste an ihm ist das Mauscheln. Obwohl ich überzeugt bin, daß diese Gestalt die leibhaftige, von Wagner gewollte Persiflage eines Juden ist (in allen Zügen, mit denen er sie ausstattete: der kleinlichen Gescheitheit, Habsucht und dem ganzen musikalisch wie textlich vortrefflichen Jargon), so darf das hier um Gottes willen nicht übertrieben und so dick aufgetragen werden, wie Spielmann es tat.«4 Das heißt im Klartext: Um 1900 und auch schon zuvor hat jeder, der sich mit dem Werk Wagners einigermaßen auskannte, völlig diskussionslos die Gestalt Mimes als eine Judenpersiflage interpretiert. Unterschiede gab es dann nur noch in der Frage, wie diese offenkundige Tatsache zu bewerten sei. Wenn ein Wagnerianer wie Mahler, der selbst jüdischer Herkunft war, zu einer solchen Diagnose kommt, dann sollte man das doch zur Kenntnis nehmen, anerkennen, sich dazu verhalten. Dem Autor, der dieses Zitat immer wieder in allfälligen Diskussionen herauszieht und präsentiert, geht es damit aber immer eigenartig, so zuletzt noch in einer Berliner Diskussion in der dortigen Staatsoper mit einem berühmten jüdischen Wagner-Dirigenten und bekannten Wagner-Forschern auf dem Podium und einem berühmten Wagner-Regisseur im Publikum: Niemand traut sich zu sagen, daß Mahler hier Unsinn rede, aber dieser Beleg wird, weil unerwünscht, einfach umgangen, indem man in der Diskussion fortfährt, als ob er nicht existiere, und darauf beharrt, daß Wagners Werk von diesen unschönen Dingen absolut unberührt sei, und so weiter und so fort – der Autor wird nicht aufhören, sich über diese Taktik zu wundern.
Wie angedeutet: Dieses außerordentlich schwierige, aber auch dankbare und notwendige Thema muß über Weiner und einige wenige andere Autoren hinaus noch einmal gründlich und grundsätzlich aufgegriffen werden – »wer schüfe die Tat«? Hier muß es bei diesen beiläufigen Bemerkungen bleiben.
Richard Wagner und seine Wirkung – der Problemkomplex des Antisemitismus spielt, wie hier angedeutet und im Buch weiter ausgeführt, dabei eine erhebliche Rolle. Man mag das bedauern, und viele Wagner-Anhänger reagieren schon seit längerer Zeit mit einer Mischung aus Gereiztheit und Überdruß – aber das nützt nicht sehr viel, und vor allem: Wagner hat es sich selbst zuzuschreiben, da er selbst dafür gesorgt hat, daß wir darum nicht herumkommen.
Dennoch: Wagners Wirkung auf allein dieses Feld zuzuspitzen, wäre wahrlich engstirnig. Dieses Buch selbst ist in seinen verschiedenen Facetten der Beweis dafür, daß eine solche Vereinseitigung kaum hilfreich und sinnvoll wäre. Ein wichtiger Aspekt der Wagnerschen Wirkungsgeschichte konzentriert sich in dem Begriff des Gesamtkunstwerks. Da dieser in den folgenden Kapiteln nur am Rande eine Rolle spielt, sei er hier zu Beginn zumindest andeutungsweise entfaltet.
Richard Wagner mochte in einer späteren Phase seines Schaffens den Ausdruck »Gesamtkunstwerk« gar nicht mehr so sehr und benutzte ihn auch nicht mehr. Um 1850 jedoch, im Kontext der sogenannten Zürcher Kunstschriften, spielte er eine entscheidende Rolle. In Die Kunst und die Revolution, der Schrift, die noch Ende Juli 1849 in Leipzig entstanden war, entwirft Wagner ein Bild der griechischen Tragödie, das wesentlich vom Öffentlichkeitscharakter dieser Kunstform geprägt ist. Als sich gegenüber dem Gemeinschaftsgeist der attischen Tragödie und des entsprechenden Gemeinwesens die partikularen Egoismen durchgesetzt hätten, sei auch das »große Gesamtkunstwerk der Tragödie« in die einzelnen Kunstbestandteile zersplittert. Rhetorik, Bildhauerei, Malerei und Musik und so weiter hätten den Reigen verlassen, in dem sie sich vereint bewegten, und daraus sei das Nebeneinander von Oper, Ballett und Schauspiel in der bürgerlichen Gesellschaft entstanden. Von dem, was er die »große Menschheitsrevolution« nannte, erwartete Wagner sowohl die Überwindung der gesellschaftlichen Verhältnisse wie auch die Wiedergeburt des Gesamtkunstwerks. So wie die Menschheit sich künftig wiederzuvereinigen habe in brüderlicher Liebe, so müßten folgerichtig auch die Künste sich wiedervereinigen.5 In der erheblich umfangreicheren zweiten Zürcher Kunstschrift (sie wurde im November 1849 abgeschlossen) Das Kunstwerk der Zukunft führt Wagner das, was er zuvor nur knapp skizziert hatte, erheblich breiter und ausführlicher aus. Das große Gesamkunstwerk habe alle Gattungen der Kunst zu umfassen, um zur unmittelbaren Darstellung der vollendeten menschlichen Natur zu gelangen – die Vereinzelung der Künste entspreche dem gesellschaftlichen Partikularismus und Egoismus. Gegenüber dem Dreiermodell der früheren Schrift entwickelt Wagner jetzt ein Sechsermodell der Kunstarten. Da sind zunächst die drei rein menschlichen Kunstarten: Tanzkunst, Tonkunst und Dichtkunst. Wer glaube, in der Oper der letzten 250 Jahre eine Vereinigung dieser Künste zu erblicken, täusche sich, denn sie sei nicht mehr als ein gemeinsamer Vertrag (eine von Wagner im Ring deutlich verachtete Kategorie) des Egoismus der drei Künste. Hinzu treten die drei bildenden Künste: Baukunst, Bildhauerkunst und Malerkunst. Das musikalische Drama sei das Kunstwerk der Zukunft, amalgamiert aus den genannten Elementen, der Künstler der Zukunft sei die freie Genossenschaft aller Künstler, das heißt das Volk, denn in einer befreiten Menschheit gebe es keine Trennung von Kunst und Leben und keine Trennung von Kunstproduzieren und Kunstrezipieren – die Utopie des Meistersinger-Schlusses hat hier ihre Wurzeln.6 Unter »Gesamtkunstwerk« ist also keineswegs nur das aufzuführende und zu schaffende Werk selbst zu verstehen, sondern auch der Raum, in dem die Realisierung abläuft; essentiell ist weiterhin die Teilnahme der Zuschauer, die auch Künstler sind und in diesem Sinn Produzenten und Rezipienten von Kunst. Das Konzept des Gesamtkunstwerks ist eine durch und durch politische Idee, ein Gegenmodell zu einer differenzierten und institutionell verfaßten Politik, die Rücknahme der Politik in die ästhetische Erfahrung.7 Ob der Totalitätsanspruch dieser Konzeption mit totalitärem Anspruch gar nichts zu tun hat, ist allerdings eine Frage, die nicht so kategorisch verneint werden sollte.
Am deutlichsten wird man die unmittelbare szenische Umsetzung einiger Teilaspekte der Gesamtkunstwerk-Vorstellung in der Reform der Operninszenierung durch Gustav Mahler und Alfred Roller an der Wiener Hofoper im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erblicken können.8 Die Ära Mahler/Roller dauerte nur vier Jahre, vom Februar 1903, als Tristan und Isolde Premiere hatte, bis zum März 1907, als mit Glucks Iphigenie in Aulis die letzte Zusammenarbeit des Dirigenten und Hofoperndirektors Mahler und des Malers und Bühnenbildners Roller in Wien stattfand, aber diese kurze Zeit reichte, um die Art, in der Oper auf der Bühne realisiert wurde, erheblich zu verändern. Roller ist der erste Bühnenbildner, dem es gelang, die Vorstellungen des Schweizer Theatertheoretikers Adolphe Appia (die er sehr gut kannte) in eine praktikable Bühnenwirklichkeit umzusetzen, amalgamiert mit seinem eigenen sehr farbigen und dekorativen, von der Wiener Sezession geprägten Stil. Zu seinen Bühnenbildern und Kostümen kam Gustav Mahlers Inszenierung hinzu. Mahler war der Regisseur dieser Musteraufführungen, auch wenn er nicht als solcher auf den Besetzungszetteln stand (dies war damals nicht üblich, wie auch der Dirigent nicht genannt wurde), aber alle Berichte von seiner Probenarbeit beweisen, daß Mahler als der Begründer der modernen Opernregie zu gelten hat, wie zeitgleich in Berlin Max Reinhardt als der Begründer der Schauspielregie (Mahler und Reinhardt kannten sich und sind auf einem berühmten Photo zusammen mit Hans Pfitzner und dem Schwiegervater Mahlers Carl Moll zu sehen). Es mutet uns heute merkwürdig an, aber wenn ein Opernleiter auf dem Zusammenhang von Bühne und Orchestergraben beharrte, war das damals revolutionär.
In der Theaterreformbewegung der Jahrhundertwende, die an die Arbeiten von Appia und Edward Gordon Craig anschließt9, wirkt der Geist des Gesamtkunstwerks in unübersehbarer Weise. Die Berufungen auf Wagner, dessen Wirkungsmächtigkeit um 1900 auf einem ersten Höhepunkt steht, sind Legion. Theaterreform und Lebensreform greifen ineinander. Ein zentrales Beispiel dafür ist die Schrift von Peter Behrens Feste des Lebens, die exakt 1900 erschien und seine Vision einer Stilbühne erläutert, Stil verstanden als »Symbol des Gesamtempfindens, der ganzen Lebensauffassung einer Zeit«.10
Die Aufhebung der Trennung von Bühne und Publikum war, wie angedeutet, schon ein zentraler Gedanke Wagners gewesen. Sein Volksbegriff führte um die Jahrhundertwende in Kombination mit der Heimatkunstbewegung zu bedenklichen Ausweitungen. Wenn man heute in die Berliner Volksbühne geht, wird man sicher nicht direkt daran erinnert werden, daß der Volksbühnenbewegung reaktionär-völkische Elemente ebenso innewohnten wie eine manifeste Beeinflussung durch Wagnersche Gedanken. Studiert man die Schriften Ernst Wachlers, der 1900 die Zeitschrift Deutsche Volksbühne. Blätter für deutsche Bühnenspiele gründete, dann wird man diese Tendenzen deutlich erkennen können. Das, was die NS-Theaterpolitik dann »Thingspiel« nannte, hat seine entscheidenden Wurzeln bei Wachler und auch bei Wagner. Die Thingbewegung ist die einzige eigenständige Theaterreform und -form, die das »Dritte Reich« zustande gebracht hat, auch wenn sie sich auf die Jahre zwischen 1933 und 1935 beschränkte und dann durch mangelndes Zuschauerinteresse, mangelnde Qualität der neuen Stücke und den Modernismus des Propagandaministeriums die Gunst der Mächtigen, vor allem von Goebbels, verlor. Auf dem Thingplatz sollte sich die Volksgemeinschaft an festlichen Tagen zusammenfinden, um zunächst durch Sprechchöre, Bewegungschöre und Aufmärsche ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen, das durch den Einsatz von Licht, Musik, Feuer, Pantomime und Volkstanz in seiner Ausdrucksqualität gesteigert werden sollte und schließlich in einer Aufführung eines Thingspiels durch geschulte Laien gipfeln sollte. Die amphitheatralische Form sollte die Gemeinschaft von Bühne und Zuschauern erhöhen. Die Thingspielbewegung verdämmerte sehr rasch, die Elemente dieser Bewegung jedoch fanden sich wieder in den parteipropagandistischen Großveranstaltungen wie jener traditionellen Parteitagseröffnung in Nürnberg, die der amerikanische Journalist William L. Shirer im September 1934 in Nürnberg beobachtete: »Ich glaube, daß ich einige der Gründe für Hitlers erstaunlichen Erfolg zu verstehen beginne. Indem er Riten der katholischen Kirche transformiert, bringt er Prunk, Farbe und Mystizismus in das monotone Leben der Deutschen des 20. Jahrhunderts zurück. Die Eröffnungssitzung heute morgen in der Luitpoldhalle am Stadtrand von Nürnberg war mehr als eine glänzende Schauveranstaltung; sie atmete auch etwas von dem Mystizismus und religiösen Eifer einer Oster- oder Weihnachtsmesse in einer großen gotischen Kathedrale. Die Halle war ein Meer von grellfarbigen Fahnen. Selbst Hitlers Auftritt wurde dramatisch arrangiert. Die Kapelle hörte plötzlich auf zu spielen. Die dreißigtausend Menschen in der Halle verstummten. Dann intonierten die Musiker den Badenweiler Marsch, eine sehr eingängige Melodie, die – wie man mir sagte – nur bei Hitlers großen Auftritten erklingt. Hitler erschien im Rücken des Auditoriums, begleitet von seinen Gehilfen Göring, Goebbels, Heß, Himmler und anderen, schritt er langsam den breiten Mittelgang entlang nach vorn, während sich dreißigtausend Hände zum Gruß erhoben. Das ist sein Ritual, sagen die Kenner der Szene, welches immer so abläuft. Dann spielte ein großes Sinfonieorchester Beethovens ›Egmont‹-Ouvertüre. Riesige Scheinwerfer strahlten die Bühne an, auf der Hitler saß, umgeben von etwa einhundert Parteifunktionären sowie Armee- und Marineoffizieren.«11 Shirer hat sicher recht, wenn er das, was da an pseudoreligiöser Weihestimmung abläuft, mit dem Ritual der Kirche vergleicht. Er vergißt aber den viel näherliegenden Vergleich mit einer Theateraufführung: die Bühne, die andächtige Zuschauermasse, der Auftritt des Helden, spektakulär und »dramatisch arrangiert«, wie Shirer selbst sagt, also inszeniert (man denkt nicht zufällig an Lohengrins Auftritt im 1. Akt von Wagners Oper), dann natürlich die Musik zum Einmarsch und die Musik nach dem Einmarsch, die Lichtwirkungen und die unio mystica zwischen einem fanatisierten Publikum und dem »Star« auf der Bühne. Das ist nicht das Kunstwerk der Zukunft, aber es ist die Propaganda der damaligen Gegenwart mit Mitteln der Gesamtkunstwerks-Vorstellung, konzentriert auf den enthusiastischen Wagnerianer Adolf Hitler – Leni Riefenstahl hat in ihrem Film Triumph des Willens diese und andere Veranstaltungen des Jahres 1934 wirkungsvoll »dokumentiert«.
Der Wagnerschen Gesamtkunstwerk-Idee eignet neben dem revolutionären Impetus auch das Megalomanische und Selbstbezügliche, das ihrem Schöpfer (der sich auf Anregungen etwa bei Sulzer, Novalis und Schelling berufen konnte) anhaftete. Die »Maniera grande« des großen Stils, der alle Grenzen verschwimmen läßt, hat etwas Totalitäres im Totalen. Wagners Entwurf des Kunstwerks der Zukunft bindet sich um 1850 immer sorgsam zurück an die vorausgesetzte Revolution: die Gesamtrevolution als Bedingung für das Gesamtkunstwerk. Keineswegs aber wollte Wagner, als die Revolution nicht kam, auf die Gesamtkunstwerk-Idee verzichten. Wie Hofmannsthals Elektra mußte das Gesamtkunstwerk auf die Chrysothemis der Revolution verzichten und sich aufbäumend sagen: »Nun denn allein« – dies dürfte der Hauptgrund dafür sein, daß Wagner den Begriff »Gesamtkunstwerk« später eskamotierte. Trotzig ignorierte Wagner die Tatsache, daß die gesellschaftlichen Voraussetzungen für das Gesamtkunstwerk fehlten, und versuchte, es ohne diese zu realisieren. An seinen eigenen Vorbedingungen und Vorstellungen gemessen, war dieser Versuch jedoch zum Scheitern verurteilt. Adorno hatte den analytischen Blick dafür: »Musik, Szene, Wort werden integriert einzig, indem der Autor – das Wort Dichterkomponist bezeichnet nicht übel das Monströse seiner Position – sie behandelt, als konvergierten sie alle in demselben. Damit aber tut er ihnen Gewalt an und verunstaltet das Ganze. Es wird zur Tautologie, zur permanenten Überbestimmung. (…) Im Gesamtkunstwerk ist der Rausch unumgänglich als principium stilisationis: ein Augenblick der Selbstbesinnung des Kunstwerks würde genügen, den Schein seiner ideellen Einheit zu zersprengen.«12 Der Rausch als Rezeptionsbedingung – das deutet auf die Konsequenz, mit der totalitäre Bestrebungen sich Wirkungsmechanismen des Totalen in der Vision des Gesamtkunstwerks anverwandelten – was nichts darüber besagt, ob darin selbst totalitäre Ideologie transportiert wird.
Die Nichtrealisierung der Gesamtkunstwerk-Vorstellung auf der Bühne bis heute bestätigt die Skepsis Adornos. Auch als der Film als gewissermaßen siebte Kunstform hinzutrat, der von Meyerhold und Piscator so begeistert begrüßt und auf die Theaterbühne gehievt wurde, den der kinobegeisterte Alban Berg in seiner Lulu in die Partitur integrierte, und der heute in der Form von Videokunst speziell auf der Opernbühne zum leidvollen Regie-Alltag gehört, ohne daß eine überzeugende Amalgamierung von technischem Bild und Bühnenrealität je erreicht worden ist, rückte das Gesamtkunstwerk dadurch nicht näher. Gelegentlich hört man die Meinung, der Film, das Kino seien die wahrhafte Erfüllung aller Gesamtkunstwerk-Träume. Davon kann keine Rede sein. Ein auch nur flüchtiger Blick auf Wagners Vision zeigt schon, daß das Kino weiter davon entfernt ist als jede Laienaufführung in einem Hinterhoftheater. Es fehlt vor allem die Ko-Erlebnisfähigkeit von Darstellern und Publikum. Wie soll das Publikum verschmelzen mit Darstellern, die ein Jahr zuvor 6000 Kilometer entfernt vor technischem Gerät agierten und jetzt zweidimensional auf eine Kunststoffleinwand geworfen werden? Es mag sein, daß die sogenannte Cyber-Kunst hier eine Wende schafft – Skepsis ist angebracht. Es gibt im Kino also keine Aufhebung der Grenze zwischen Zuschauer und Darsteller, es gibt keine Plastik der Darstellung, sondern ein Relief, es gibt keine Gleichberechtigung der Musik mit der Sprache und der Malerei, denn Filmmusik ist, auch wenn sie sich oft bei den Modellen Wagners, Puccinis und Strauss’ bedient, im besten Falle Geschmacksverstärker, durchaus auch bis zum Halluzinogenen, nie jedoch gleichberechtigtes Mitglied im Ensemble der Künste.
Daß die überzeugendsten Beispiele für eine Annäherung an die Vorstellung eines Gesamtkunstwerks ausgerechnet im Bereich des Theaterbaus zu finden sind, der keineswegs im Zentrum des Wagnerschen Interesses stand (man könnte Rudolf Steiners Theaterraum im ersten Goetheanum in Dornach als faszinierendes Beispiel anführen, auch Gropius’ Entwurf für ein Totaltheater in Dessau von 1927), zeigt doch sehr deutlich, wie sehr diese Idee gescheitert ist, denn der Theaterbau ist zwar eine wichtige Vorbedingung für das Entstehen und Funktionieren des Gesamtkunstwerks, aber kann nicht isoliert von den anderen Künsten existieren. Ein dekoratives Schrei- und Schreittheater, wie es Max Reinhardt letztlich im Berliner Großen Schauspielhaus gewiß auf hohem Niveau realisieren konnte, mit kornfeldartig wogenden Statistenmassen, die 1919/20 preiswert zu bekommen waren (wovon auch die monumentalen Filme von Fritz Lang profitierten), hatte mit dem Gesamtkunstwerk nur sehr wenig zu tun.
Im Musiktheater der Gegenwart lassen sich die Spuren der Wagnerschen Vorstellungen am deutlichsten bei Karlheinz Stockhausen finden. Stockhausen selbst negierte den Zusammenhang mit Wagner, aber der Zyklus Licht, an dem er über zwanzig Jahre arbeitete und der aus sieben »Tagen« bestehen soll, also eine Heptalogie anstelle einer Tetralogie des Ring des Nibelungen, ist in seiner Mischung aus zum Teil elektronischer Musik, virtuosem (Chor-)Gesang, großangelegter szenischer Ebene in technizistisch geplanten Raumaktionen und der zugrundeliegenden Privatmythologie von Heil und Erlösung der deutlichste Versuch, an Wagner anzuknüpfen. Wieder aber stellt sich heraus, daß die Ko-Kreativität des Publikums die unüberwindliche Hürde bleibt, denn sie bezieht auch Stockhausen nicht ein, kann sie nicht einbeziehen, ohne die hochkomplizierte Fügung seines Werks sofort zu zerstören.
Es stellt sich abschließend die Frage, in welcher Erscheinung der Kulturgeschichte der Gesamtkunstwerk-Gedanke am überzeugendsten verkörpert ist. Bezeichnenderweise muß dazu ein Beispiel gewählt werden, das kein Theaterereignis ist, allerdings ein inszeniertes, theatralisches Ereignis: Gabriele d’Annunzios Anwesen oberhalb von Gardone am Gardasee, »Il Vittoriale degli Italiani«. D’Annunzio kaufte die damalige Villa Cargnacco, die bis 1915 der Kunstkritiker Henry Thode, ein Schwiegersohn Richard Wagners (was man nicht als Zufall betrachten kann), bewohnt hatte, im Jahr 1921 und bewohnte sie bis zu seinem Tod im März 1938, wobei die Villa und das sie umgebende weiträumige Gelände einer ständigen Veränderung und Überarbeitung unterzogen wurden. Bereits 1923 machte er die Villa und alles Übrige dem italienischen Vaterland zum Geschenk.13 Für manche mag das nur eine Anhäufung von Kitschgegenständen sein, in Wirklichkeit ist es der Versuch, ein Gesamtkunstwerk aus Landschaft, Gartenkultur, Architektur, technischen Denkmälern, Bildern, Raumgestaltung und Musikausübung zu realisieren, und das alles als eine Selbstfeier des größten Décadence-Autors Italiens und gleichzeitig als ein nationales Siegesmal für die von Mussolini durchgesetzte und von d’Annunzio ideologisch begleitete Intervention Italiens im Ersten Weltkrieg und die ebenfalls von d’Annunzio angeführte gewaltsame Einnahme von Fiume im September 1919, die eindeutig gegen den Versailler Vertrag verstieß und dann auch bald wieder beendet war. Es ist eine kultische Inszenierung von Kunstobjekten und militanten Devotionalien, die auf Überwältigung zielt. Der Zuschauer dieser Inszenierung sitzt nicht im Sessel, sondern bewegt sich flanierend auf der »Bühne«, durchschreitet verschiedene Stile, Zeiten, Kulturräume und Militärereignisse – »Ich schreite kaum, doch wähn’ ich mich schon weit«. Das Renaissance-Landhaus wird zum Schauplatz von Kriegspropaganda, gleichzeitig auch zur narzißtischen Selbstfeier des Frauen- und Kriegshelden, dem es gleichgültig scheint, wer ihm zu Füßen liegt: Fiume oder Eleonora Duse. Erobern, beherrschen, benutzen, verlassen – so ging es mit Fiume und so mit der Duse und anderen Frauen. Sexualität und Gewalt werden im Kulturtheater d’Annunzios virtuos zelebriert, der Totenkult bis hin zu einem kleinen Hundefriedhof (auch hier schloß sich der Wagnerianer d’Annunzio an seinen Meister an, denn im Garten der Villa Wahnfried ruht Wagners letzter Hund Russ neben seinem Herrn) ist überall aufdringlich vorherrschend. Das Gelände wird gewissermaßen choreographisch und szenographisch inszeniert, die mit ständig wechselnden Eindrücken bombardierten Besucher sind die eigentlichen Protagonisten der Aufführung, denn der maître de plaisir d’Annunzio hatte sich bereits zu seinen Lebzeiten von der Bühne an das Regiepult zurückgezogen. Der Besucher, von dem er annahm, daß er sowohl patriotisch gestimmt wie aufnahmefähig für die dekadente Stimmung sein müsse, wird somit zum eigentlichen Darsteller, der sich in wechselnden Spiegelungen und Positionen in diesem Gesamtkunstwerk bewegt und so ein Teil davon wird – eine überzeugendere Aufhebung der Trennung zwischen Darsteller und Zuschauer ist nicht realisiert worden. Und damit, daß er noch zu Lebzeiten diese Anlage dem italienischen Volke vermachte, hat er die Volksgemeinschaft herbeigezaubert, die Wagner vorschwebte, allerdings in einer Beleuchtung, die durchaus faschistische Züge trägt. Die flammende Rhetorik des italienischen Faschismus ist hier Stein und Weg geworden, im Inneren herrscht säkularisiertes Christentum vor. Opfer, Reliquie, Altar und Erlösung sind die wesentlichen Ingredienzien. Die Natur, die im Park bereits nur domestiziert und militarisiert zurechtgerückt vorkommt, wird in das Innere der Villa nicht vorgelassen. Selbst natürliches Licht ist verboten, es dringt nur gefiltert durch bunte Glasfenster wie in einen Dom der Dekadenz hinein, wie ihn Huysmans und Péladan entworfen hatten. Gelänge es, den Parsifal im Vittoriale zu inszenieren, wäre das erreicht, was Wagner vorschwebte.
Als Paul Bekker 1924 sein Wagner-Buch (heute kaum noch gelesen, aber eines der wichtigsten in der unübersehbaren Fülle der Wagner-Literatur) publizierte14, waren gerade mal elf Jahre seit dem von weit hallendem Glockenklang begleiteten Wagnerjahr 1913, hundert Jahre nach seiner Geburt, vergangen. Allerdings hatte sich die Welt zwischen 1913 und 1924 entscheidend verändert. Bekker war der wichtigste deutsche Musikkritiker und Musikschriftsteller vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg. Von der Qualität seiner kritischen Texte wie auch seiner großen Bücher über Beethoven, Wagner und Mahler kann man auch heute nur in bewundernden Tönen sprechen. So ist er der erste, der das Jüdische an bestimmten Gestalten Wagners in diesem Buch thematisiert hat, und Adorno, der ihm darin folgte, hat von Bekker viel gelernt. Bekker beginnt sein Buch mit folgenden Worten: »Die Gestalt und das Leben Richard Wagners sind für die heutige Zeit bereits zum Mythos geworden, seine Kunst aber beherrscht nach wie vor die Bühne und zwingt zur Auseinandersetzung. Sie hat die bisherige Wagner-Literatur zu einer Kampfliteratur der Wagnerianer und der Anti-Wagnerianer gemacht, zur mehr oder minder sachlich geführten Polemik gegensätzlicher Auffassungen. Beide Methoden der Betrachtung, die panegyrische wie die vorsätzlich oppositionelle, sind für die Wesenserkenntnis seiner großen Kunst unergiebig. Vielleicht aber war es aus Gründen tieferer Art bisher nicht möglich, zu einer Einstellung jenseits von Bejahung oder Verneinung zu gelangen. Vielleicht mußte erst das schöpferische Gegenbeispiel einer neuen Kunst erstehen, ehe die Kunst Wagners in ihrer Bedingtheit und Größe zugleich erkannt werden konnte.« Und Bekker fährt fort: »Die Entstehung dieses Buches verdanke ich der heutigen zeitgenössischen Musik.«15
Das war 1924 und so viel weiter sind wir heute auch wieder nicht. Wer heute im Jahr des 200. Geburtstages ein Wagner-Buch von Umfang und Bedeutung des Bekkerschen veröffentlichen will, schreibt dennoch unter gänzlich anderen Bedingungen, nicht nur, was den Einfluß der zeitgenössischen Musik betrifft. Dieses Buch hat bescheidenere Ziele: Es will Facetten und Aspekte von Wagners Wirkungsgeschichte möglichst vielfarbig umreißen und prononciert zuspitzen.
Wagners Wirkung bedenkend kommt man nicht um die Feststellung herum, daß kein Komponist der Musikgeschichte, keine schöpferische Potenz der Operngeschichte und des Musiktheaters bis heute eine solche sengende Strahlung (im Positiven wie im Negativen) aussendet wie Richard Wagner. Die oft narkotische, überwältigende Macht seiner Musik verbündet sich mit teilweise überzeugenden, teilweise aber auch sinistren, dumpfen Vorstellungen von der Welt und ihren Menschen, wie sie sind und wie sie sein sollten. Wagner ist der einzige Ideologe und Weltverbesserer, der sich zu seinen Vorstellungen die Begleitmusik selbst schreiben konnte, aber gleichzeitig gelingen ihm auch Passagen und ganze Werkteile, bei denen man das alles vergessen kann und soll. Der 3. Akt des Tristan ist ein Wunderwerk der einsamen Klage wie der herzzerreißenden Verzweiflung. Wer das je mit einem großen Dirigenten und einem bedeutenden Sänger erlebt hat, weiß, daß die markerschütternde Wirkung dieses Aktes höher ist als alle Vernunft, nicht zuletzt, weil sie frei ist von allen ideologischen Unter- und Nebentönen. Wagner ist immer wieder ein schwieriger, anziehender und abstoßender Fall, wie Thomas Mann in seinem Tagebuch vermerkte (19.6.1948).
Was ist ein Wagnerianer? Eigenartig ist, daß alle Menschen heutzutage, die der gesunde Menschenverstand so bezeichnen würde, vehement leugnen, ebendies zu sein. Wenn man als Wagnerianer nur jene dingfest macht, die außer Wagner keine Musik, kein Musiktheater gelten lassen, jene Frauen, die, wenn der Gatte im Nebenzimmer sich die Nase putzt, ausrufen: »War das sein Horn?«, außerdem jene, die Wagner nicht nur für den größten Komponisten aller Zeiten halten, sondern außerdem für den größten aller Denker, der zur Reichseinigung wie zur Vivisektion, zu den Jesuiten wie zu den Juden, zur Revolution wie zur Reaktion, zu Christus wie zu Jahwe und Buddha das jeweils abschließende Diktum geliefert hat, dann gibt es heute allerdings nur noch wenige Wagnerianer. Dafür aber gibt es Wagner-Enthusiasten und engagierte Wagner-Gegner in aller Welt, und das zuhauf. Und Wagners Bild leuchtet nach wie vor in allen Facetten und kaleidoskopischen Farb- und Formspielen auf: der Radikaldemokrat wie der schleimige Hofkünstler Ludwigs II. mit seinen Machtspielchen, der Tierschützer und Vegetarier wie der haßerfüllte Antisemit, der Nietzsche-Verleumder wie der treusorgende Gefährte, Freund und Familienmensch – gäbe es Medaillen, die mehr als zwei Seiten haben, so wäre Wagner der erste Anwärter, der mit ihnen verglichen würde. Aber es ist zu allen Zeiten und auf allen Seiten »Richard Wagner« auf ihnen geprägt. Als Grundsubstanz der Wagnerschen Persönlichkeit ist eine grenzenlose Egozentrik und aggressive Charakterstruktur zu erkennen, die eben auch seinen Antisemitismus kennzeichnen. Wäre Wagner eine weichere Persönlichkeit gewesen, wie es Mendelssohn war, oder hätte er seinen Leidensausdruck nach innen gewendet wie Brahms – seine Opern und Musikdramen sähen anders aus und wären vielleicht nicht von so umwerfender Wirkung. Zu der Wirkungsmacht eines solchen Genies, zu seiner Gewalt der Überwältigung gehört ein Gran Gewalttätigkeit. Bei Verdi finden wir es, bei Berlioz, bei Mahler – bei Wagner ist es mehr als ein Gran, es ist Granit. Die folgenden Studien versuchen, in den monumentalen Schatten, den dieser Granitfelsen wirft, einige aufhellende Lichtschneisen zu schlagen.
Aufführungspraxis
Der erste Nibelungen-Ring – Bayreuth 1876
Vorbereitungen und Proben
»Wenn das Bayreuther Theater auf Commando Wagners, lediglich für seine Werke, durch Privatsammlungen bestritten, wirklich zustande kommt, wie es allen Anschein hat, so bildet diese Thatsache allein eines der merkwürdigsten Ereignisse in der gesamten Kunstgeschichte und nebenbei den größten Erfolg, den ein Componist jemals träumen konnte.« So schloß der Wiener Musikkritiker Eduard Hanslick, der durchaus ernstzunehmende, intelligenteste und kenntnisreichste zeitgenössische Gegner der Wagnerschen Kunstbestrebungen (bis heute von den Wagnerianern völlig zu Unrecht verteufelt), einen Aufsatz über Rheingold, Jahre bevor er selbst bei den Bayreuther Premieren des Jahres 1876 dieses Wunder bestaunen und kritisch kommentieren konnte, nicht ohne sich seiner eigenen Äußerung zu erinnern. Die Uraufführungen von Rheingold und Walküre hatte es, völlig gegen den Willen Wagners, aber auf Drängen Ludwigs II., 1869 und 1870 in München gegeben. Siegfried und Götterdämmerung waren zuvor noch nie erklungen, der Ring als Ganzes wurde der Öffentlichkeit erst im August 1876 in Bayreuth vorgeführt. Das zur längst vertrauten und selbstverständlichen Institution gewordene Wunder der Bayreuther Festspiele soll hier nicht untersucht werden, auch nicht die Entstehungsgeschichte des Rings, noch seine tiefere Bedeutung; aus den zeitgenössischen Quellen soll vielmehr ein Bild jener ersten Aufführungen entstehen, die kein Videoband, kein Live-Mitschnitt dokumentieren konnte.
Die Daten, die auf dieses »merkwürdigste Ereignis« hinführen, sind schnell rekapituliert. Schon im Jahr 1866 spukt in Wagners Kopf die Idee, einen Pavillon des Bayreuther Schlosses als Ruhesitz zu beziehen, Nürnberg in der Nähe und Deutschland um ihn herum, wie er sagt (Bayreuth hatte der 22jährige zum ersten Mal besucht). Im März 1870 liest er einen Artikel über Bayreuth in einem Konversationslexikon und ist vor allem durch die Angaben über das Markgräfliche Opernhaus gefesselt. Sein junger musikalischer Adlatus Hans Richter hatte ihn nämlich schon darauf hingewiesen, daß dieses Theater eine für die Entstehungszeit ungewöhnlich große Bühne besitze. In das Jahr 1871 fallen die ersten brieflichen Andeutungen über eine zyklische Gesamtaufführung in einem eigens dafür bestimmten Haus, allerdings noch ohne Nennung des Namens Bayreuth. Ein Besuch in der Stadt im April des Jahres zeigt, daß das Markgräfliche Opernhaus zwar schön, aber für die Pläne Wagners ungeeignet ist; aber es erscheint ihm durchaus möglich, die alten Semper-Pläne für ein Festspielhaus, ursprünglich für München bestimmt, auf diese verschlafene fränkische Kleinstadt zu übertragen.
Im Mai 1871 fällt ihr Name zum ersten Mal in diesem Zusammenhang, im Februar 1872 wird der Bauplatz unterhalb der Bürgerreuth erworben, im Mai der Grundstein gelegt; die ersten Festspiele werden auf 1874 projektiert. Im August 1873 wird Richtfest gefeiert, ein Vertrag vom Februar 1874 (die Festspiele sind inzwischen auf 1875 verschoben) bringt die dringend benötigte Garantie des bayerischen Königs über 100.000 Taler — daß ohne Ludwig II. Festspielhaus, Festspiele und, nicht zu vergessen, die im Mai 1874 bezogene Villa Wahnfried nicht hätten finanziert werden können, ist oft genug betont worden. Nochmals gibt es eine Verschiebung, weil der Maschinenmeister Carl Brandt aus Darmstadt die technische Einrichtung für 1875 nicht mehr garantieren kann. Aber beim Termin 1876 sollte es dann bleiben (es hatte Carl Brandt offensichtlich nicht geschadet, daß er die von Wagner boykottierten Rheingold- und Walküre-Aufführungen in München betreut hatte; er galt nach diesen Aufführungen als der beste Mann in seinem Fach, und das war Wagner allemal wichtiger als sonstige Empfindlichkeiten).
Der Sommer 1874 kann als Vor-Vorproben-Sommer bezeichnet werden, in dem vor allem die technischen Voraussetzungen für die musikalische Exekutierung des Ring dergestalt geschaffen wurden, daß ein treues Häuflein junger Musiker die Noten kopierte. Angeblich war aus einer Weigerung des Schott-Verlags heraus, die Noten rechtzeitig stechen zu lassen, zwischen Wagner und Hans Richter die Idee geboren worden, die Noten von Hand kopieren zu lassen und so gleichzeitig mit dem Werk vertraute musikalische Assistenten heranzuzüchten, die später (da war Wagner wie immer Stratege) dirigentische Vermittler dieses Werkes in aller Welt werden konnten. Diese Rechnung ging voll auf. Mitglieder der berühmt gewordenen Nibelungen-Kanzlei, die über der Wirtschaft »Das weiße Lamm«residierte, waren der Sänger Adolf Wallnöfer, Hermann Zumpe, Anton Seidl, der in den neunziger Jahren dann der Wagner-Dirigent der New Yorker Metropolitan Opera wurde, Felix Mottl und Franz Fischer, später beide in führenden Positionen an der Münchner Hofoper. Für Franz Fischer (der nebenher auch ein Bayreuther Dilettanten-Orchester leitete) hat Wagner im Februar 1876 ein launiges Dankes-Gedicht geschrieben, eine Form, in der er Meister war:
Zumpe-Seidlscher Fehler-Verwischer,
Cello kühn mit Klavier-Vermischer,
schlechter Musik unerbittlicher Zischer,
Zukunfts-Musik-Kapellmeister Fischer,
Dilettanten-Orchesterspiels-Auffrischer!
Gische das Bier dir immer gischer,
decke der Tisch sich dir immer tischer!
Wer reimte wohl künstlicher, verschlagner,
als Ihr ergebner Freund
Richard Wagner?
Die Nibelungen-Kanzlei führte Hans Richter an, damals gerade neu ernannter Direktor des Ungarischen Nationaltheaters in Pest, dann der einzige Dirigent der ersten Festspiele, später in Wien und London tätig. Der junge Pianist Joseph Rubinstein war der unermüdliche Klavierbegleiter und Partiturspieler aller Proben für diesmal und die folgenden zwei Jahre. Es trafen auch die ersten Sänger ein, die Wagner für die Ausführung des neuen und schwierigen Werkes ausersehen hatte und deren Auswahl und Training ihn und seine Mitarbeiter noch lange und strapaziös beschäftigten sollten. So kam etwa der bedeutende Bassist Emil Scaria, der für den Hagen vorgesehen war; er schockierte den erlesenen Bayreuther Kreis dadurch, daß er zugab, die 8.Symphonie Beethovens nicht zu kennen. Noch schlimmer war allerdings, daß er es bisher nicht für nötig befunden hatte, sich mit der Dichtung des Ring zu beschäftigen. So viel Nonchalance konnte nicht gutgehen, und wirklich hat Scaria dann den Hagen auch nicht gesungen, angeblich weil er zu hohe Honorarforderungen gestellt habe. Bei der Bayreuther Uraufführung des Parsifal war Scaria dann allerdings wieder als vielgelobter Gurnemanz dabei.
Aus Berlin kam der Bariton Franz Betz, von Wagner für die zentrale Partie des Wotan auserkoren. Wagner kannte Betz seit sechs Jahren, als er mit ihm die Partie des Hans Sachs erarbeitet hatte. Bei den Münchner Aufführungen der ersten beiden Abende der Tetralogie hatte Betz die Rolle des Wotan aus Solidarität mit Wagner zurückgegeben und sich dadurch die Wertschätzung Bayreuths erworben. Betz war ein ausgesprochen schwieriger Mann, empfindlich und mit Skrupeln behaftet. So fürchtete er, für den Wotan nicht das rechte Maß an Dämonie zu besitzen und für die tiefen Noten der Partie nicht die nötige Stimmkraft aufbieten zu können. Wagner gelang es, diese und andere Bedenken zu zerstreuen, wie überhaupt die Details der Vorbereitungszeit zeigen, mit welch psychologischer Meisterschaft er auf der Gefühls-Klaviatur all seiner männlichen und weiblichen Neurosen-Kavaliere zu spielen verstand. Dies war nicht seine geringste Leistung bei der Vorbereitung der Festspiele, und er übertraf darin seine Gattin Cosima beträchtlich. Mit Betz sollte es dennoch immer wieder Schwierigkeiten geben.
Schwierigkeiten ganz anderer Art gab es mit der Besetzung der nicht minder wichtigen Partie der beiden Siegfriede. Für den Siegmund in der Walküre war man sich der Mitwirkung Albert Niemanns sicher, auch das ein Beispiel dafür, daß Wagner über alte Wunden souverän hinweggehen konnte, denn Niemann war es gewesen, der als Titelheld beim legendären Pariser Tannhäuser-Skandal von 1861 durch seine Allüren und Mätzchen die Sache noch verschlimmert hatte. An seiner Souveränität und Kompetenz als singender Darsteller (er hatte als Schauspieler debütiert) bestand jedoch kein Zweifel, so daß Wagner glücklich war, ihn für den Siegmund zu haben. Niemann sollte diese Erwartungen nicht enttäuschen. Damit war jedoch das Problem der Siegfriede nicht gelöst. Joseph Tichatschek, der Uraufführungs-Rienzi und -Tannhäuser, wäre zum Zeitpunkt der ersten Festspiele 69 Jahre alt gewesen und fiel damit aus (er nahm allerdings, von Wagner eingeladen, als gerührter Zuschauer teil). Wagner bedauerte dies tief, denn Tichatscheks Stimme war für ihn nach wie vor das Ideal einer durch die italienische Stimmschulung gegangenen, aber dadurch für den deutschen dramatischen Gesang nicht verdorbenen, ermüdungsfrei strahlenden Tenorstimme, auch wenn ihm die tieferen Dimensionen der Menschendarstellung unzugänglich blieben.
Ludwig Schnorr von Carolsfeld, der Tristan der Uraufführung, besaß den Zugang zu diesen tieferen Dimensionen, war aber bereits jung und überraschend verstorben, seit neun Jahren tot. Es sollte Wagners offene Wunde bleiben, daß er Tenöre wie Tichatschek und Schnorr für seine Werke nie mehr zur Verfügung haben sollte – dieses Problem überschattete auch den ersten Ring. Der Wiener Tenor Diener galt zunächst als Hoffnung für den Siegfried, enttäuschte aber bereits im Vorfeld gründlich. Hans Richter brachte daraufhin aus Budapest einen Dr. jur. Franz Glatz mit, ein Bild von einem Mann, aber gesanglich noch unfertig. Es ist erstaunlich zu sehen, welchen Wert Wagner auf das athletische, virile Aussehen seines Siegfried legte, mehr als auf die stimmlichen Voraussetzungen. Diese Einstellung sollte der endgültigen Besetzung der Partie nicht zum Segen gereichen. Der Mannheimer Tenor Georg Unger, der dann schließlich den Siegfried sang, war zunächst für den Loge vorgesehen. Erst im Herbst 1875 erhielt er die Partie des Siegfried endgültig zugesprochen, nachdem sich herausgestellt hatte, daß Glatz die Anforderungen nicht erfüllen würde, und ein Braunschweiger Ersatz ebenfalls nicht in Frage kam.
Sehr viel glücklicher konnte Wagner allerdings über die Wiener Sopranistin Amalie (Friedrich-)Materna sein, die ihm durch Scaria empfohlen worden war. Wagner hatte sie noch nie gehört. Als sie im Sommer 1874 nach Bayreuth kam, wußte er aber nach dem ersten Vorsingen, daß er seine Brünnhilde gefunden hatte. Amalie Materna kam, erstaunlich genug, von der Operette, was Wagner durchaus als Vorteil ansah, denn dort hatte sie darstellerische Beweglichkeit und deutliche Sprachbehandlung gelernt, die ihm so wichtig waren. Für die Vor-Vorproben des Jahres 1874 gilt, daß hier die Grundlagen des Bayreuther Stils gelegt wurden, oder, wie es der Wagner-Biograph Glasenapp im hagiographischen Bayreuther Ton sagt: »So lernte man vom Meister, so befestigte sich das Wissen vom Stil, so ward die Bayreuther Aussaat gestreut, damit ihre Zeugen und Empfänger dereinst in alle Welt hinausziehen könnten, um zu lernen, was ihnen gelehrt ward, und es allen Heiden zu predigen, als das Evangelium wahrer Kunst.«
Im Sommer 1875 fanden dann die Vorproben statt, diesmal auch schon mit Orchester. Am 1. Juli begannen die Soloproben, am 1. August die Orchesterproben. Für die Vorbereitung der Sänger versicherte sich Wagner der Mitarbeit des bedeutendsten Gesangspädagogen seiner Zeit, Julius Hey aus München, der über diese Zusammenarbeit interessante Erinnerungen hinterlassen hat und später in seinem Deutschen Gesangs-Unterricht seine Erfahrungen kodifiziert hat. Die Soloproben fanden in der Halle von Wahnfried statt; der Klavierfabrikant Bösendorfer aus Wien hatte zwei prachtvolle Flügel zur Verfügung gestellt. Die Intendanten der zwei bedeutendsten Opernbühnen des deutschen Sprachraums, von Hülsen (Berlin) und Jauner (Wien), spielten bei den Proben Zaungast. Wie angespannt die Nerven aller Beteiligten waren, zeigt eine merkwürdige, um nicht zu sagen groteske Begebenheit, die in der offiziellen Bayreuther Geschichtsschreibung nur verschleiert wiedergegeben wird, nämlich die Umstände der plötzlichen verärgerten Abreise Albert Niemanns, der auch noch wütend seine Partie zurückschickte (im nächsten Jahr war er allerdings wieder voller Enthusiasmus dabei).
Was vorgefallen war, berichten andere Beteiligte, so die Sopranistin Lilli Lehmann in ihren Erinnerungen: Fast jeden Abend gab es nach den Proben eine fröhliche Zusammenkunft der Künstler im Haus Wahnfried – zu fröhlich für den Geschmack der Hausherrin Cosima, die für die Launen des Künstlervölkchens wenig übrighatte und sich unter aristokratischen Gästen wohler fühlte (wie weit das Trauma ihrer eigenen illegitimen Geburt als Sproß einer Gräfin, deren Mädchennamen sie zunächst tragen mußte, und eines reisenden Virtuosen, Franz Liszt mit Namen, der sie erst legitimierte, als sie sieben Jahre alt war, dabei eine Rolle spielte, sei dahingestellt). Bei einem solchen Fest stand Niemann neben der Altistin Louise Jaide, die Erda und Waltraute singen sollte, und scherzte mit ihr. Das ging so weit, daß Frau Jaide den Kollegen von ihrem Teller fütterte. Die Hausherrin beobachtete das und stellte die beiden Sünder zur Rede, worauf Niemann (man möchte sagen zu Recht) empört abreiste.
Mit den Orchesterproben begannen auch die ersten Proben im Festspielhaus selbst, das noch ohne Bestuhlung war, weshalb die Zuhörer (soweit zugelassen) es sich auf den Stufen bequem machten. Als Wagner am ersten Tag der Orchesterproben mit Cosima und Schwiegervater Liszt das Festspielhaus betrat, spielte das Orchester das Walhall-Motiv, und Wotan-Betz sang »Vollendet das ewige Werk, auf Bergesgipfeln die Götterburg« – Wotans Begrüßung Walhalls aus dem Rheingold. Wagner dankte kurz und bewegt und begab sich dann auf seinen Platz, ein kleines Tischchen auf der Bühne, über einen Holzsteg erreichbar, dicht am Rand des versenkten Orchesters, auf dem die Partitur an einer Kiste lehnte, auf der eine Petroleumlampe stand. Ein Jahr später hat Adolph von Menzel Wagner so bei den Proben in einer berühmt gewordenen Skizze festgehalten.