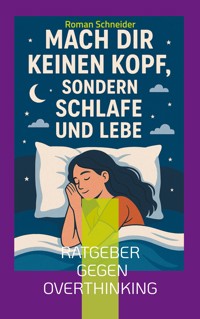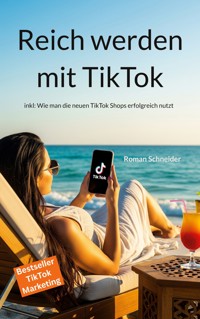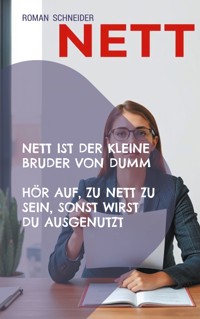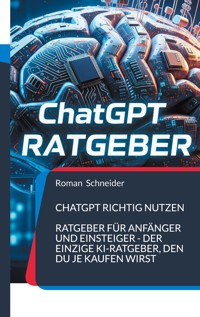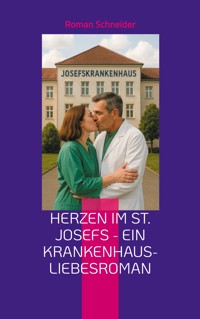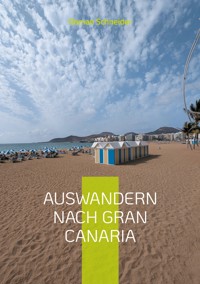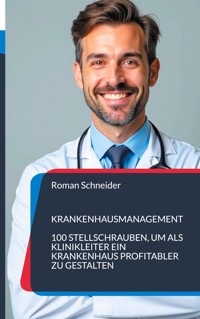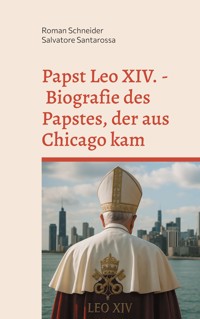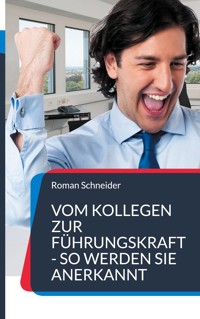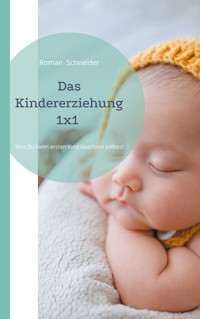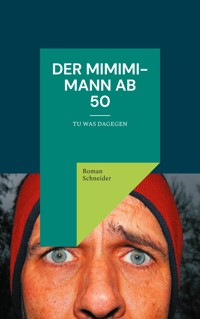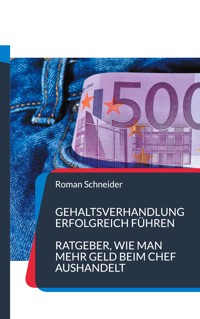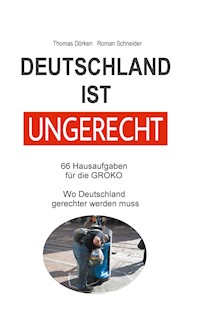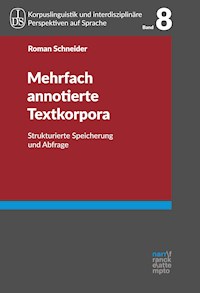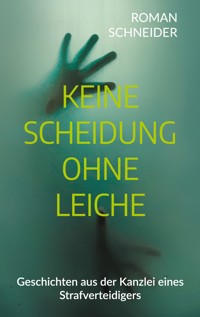
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Keine Scheidung ohne Leiche" schildert der Autor aus Sicht eines Strafverteidigers 30 Fälle, in denen im Rahmen einer Scheidung oder Trennung einer von den beiden Partnern zum Mörder wurde. Das Buch zeigt auf, dass oft ganz normale Menschen wie Du und ich zum Mörder werden können. Durch einen Moment, eine Überlegung, durch verletzte Eitelkeit oder den Weggang eines geliebten Menschens, der auf einmal Gefühle nicht mehr erwidert. Oft bricht dann in ehemaligen Partnern eine Welt zusammen und in einer Art Tunnelblick sieht man nur noch eine Lösung. Eine Lösung, die grausam ist. Was Menschen dazu bewegt, so zu handeln, wie sie gehandelt haben, darüber erzählt das Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Der Goldfisch
2. Die Uhr
3. Das Kochbuch
4. Der Briefkasten
5. Das Fotoalbum
6. Das Skalpell
7. Die Akte
8. Der Nachtdienst
9. Die Narkose
10. Die Sprechstunde
11.Das Münster
12. Die Bächle
13. Der Schlossberg
14. Der Seepark
15. Das Vauban
16. Die Kuckucksuhr
17. Der Schwarzwaldhof
18. Das Sägewerk
19. Das Gasthaus
20. Die Holzschnitzerei
21. Das Rathaus
22. Die Grenze
23. Der Bodensee
24. Die Therme
25. Die Brücke
26. Die Quadrate
27. Die Universität
28. Das Gericht
29. Die Zeitung
30. Das Casino
Epilog
Vorwort
Ein Freund erzählte mir diese Geschichten. Er ist Strafverteidiger, arbeitet seit dreißig Jahren in diesem Beruf. Wir kennen uns seit dem Gymnasium, haben damals gemeinsam die Schulbank gedrückt, gemeinsam geglaubt, das Recht sei gerecht.
Er glaubt das nicht mehr.
„Schreib du sie auf", sagte er mir. „Ich kann das nicht."
Wir saßen in seinem Büro in Freiburg. Es war spät am Abend, die Akten stapelten sich auf seinem Schreibtisch. Draußen regnete es. „Warum nicht?", fragte ich.
„Weil ich sie kenne. Weil ich sie verteidigt habe. Weil ich ihre Tränen gesehen habe."
Er erzählte mir von seinen Mandanten. Von Menschen, die töten mussten, um zu überleben. Von Ehepartnern, die sich so sehr liebten, dass sie sich umbrachten. Von der Liebe, die zum Hass wird, wenn sie stirbt.
„Das sind keine Kriminalgeschichten", sagte er. „Das sind Liebesgeschichten."
Die schlimmsten, die er kenne.
Ich fragte ihn, ob er diese Geschichten erfunden habe. Er schüttelte den Kopf. „Das Leben erfindet grausamere Geschichten, als ich sie mir ausdenken könnte."
Er hatte recht. Die Realität übertrifft jede Fiktion. Menschen sind zu allem fähig. Unter den richtigen Umständen. Im falschen Moment. Mit der falschen Liebe.
Oder der richtigen.
„Aber schreiben sollst du sie trotzdem", sagte ich.
„Nein. Du schreibst sie. Du kannst das."
„Warum ich?"
„Weil du Abstand hast. Weil du sie nicht kennst. Weil du urteilen kannst."
Ich kann nicht urteilen. Niemand kann das. Wir können nur erzählen.
Diese dreißig Geschichten stammen aus seiner Praxis. Manche sind genauso passiert, andere sind Variationen eines Themas. Ich habe Namen geändert, Orte verfremdet, Details verändert. Aber der Kern bleibt: Menschen töten aus Liebe.
Das ist die Wahrheit, die mein Freund nicht ertragen kann. Die Wahrheit, die ihn nachts wachhält. Die Wahrheit, die aus einem idealistischen Juristen einen zynischen Menschenkenner gemacht hat.
„Weißt du, was das Schlimmste ist?", fragte er mich, als ich ging.
„Nein."
„Dass ich sie verstehe. Alle. Jeden Einzelnen."
Das ist sein Fluch. Und sein Beruf.
Ich habe diese Geschichten aufgeschrieben, weil sie erzählt werden müssen. Weil sie zeigen, wer wir wirklich sind. Denn sie warnen vor der Liebe, die tötet.
Mein Freund wird sie nie lesen. Er kennt sie auswendig. Sie sind Teil seines Lebens geworden, Teil seiner Erinnerung, Teil seiner Schuld.
Er verteidigt sie, die Mörder aus Liebe. Er kennt ihre Motive, ihre Ängste, ihre Verzweiflung. Er weiß, dass sie keine Monster sind. Er weiß, dass sie Menschen sind.
Menschen wie wir alle.
Das ist das Erschreckende an diesen Geschichten. Nicht, dass sie passiert sind. Sondern dass sie uns allen passieren könnten.
Unter den richtigen Umständen.
Im falschen Moment.
Mit der falschen Liebe.
1. Der Goldfisch
Dr. Müller war Kinderarzt. Seine Hände waren weich, seine Stimme sanft. Vierzig Jahre lang hatte er Kinder behandelt, ihre Tränen getrocknet, ihre Ängste vertrieben. Niemand hätte gedacht, dass diese Hände töten könnten.
Seine Frau verließ ihn an einem Dienstag im März. Sie hatte einen anderen gefunden, einen Architekten, der jünger war und keine Kinder wollte. "Ich erstick in diesem Leben", sagte sie. "Mit dir, mit deiner Selbstgefälligkeit, mit deinem ewigen Gerede über andere Menschen."
Dr. Müller stand in der Küche und starrte auf das Aquarium. Der Goldfisch schwamm seine Kreise, tagein, tagaus dieselben Bahnen. Wie er selbst. Vierzig Jahre dieselben Runden.
Die Scheidung sollte am Donnerstag verhandelt werden. Seine Frau wollte die Hälfte seiner Praxis, das Haus, den Porsche. "Du bekommst den Goldfisch", hatte sie gesagt und gelacht.
Am Mittwochabend kam sie noch einmal. Sie wollte ihre Bücher holen. Er machte ihr einen Tee, Kamille, wie früher. Sie saß am Küchentisch und erzählte von ihrem neuen Leben. Von Reisen, von Spontaneität, von Leidenschaft.
"Weißt du, was dein Problem ist?", sagte sie. "Du lebst nicht. Du funktionierst nur."
Er nickte und dachte an den Goldfisch. Dann nahm er das Messer aus der Schublade, das große, mit dem sie früher das Fleisch geschnitten hatten. Ein Schnitt reichte.
Das Blut lief über den Küchentisch, tropfte auf den Boden. Der Goldfisch schwamm weiter seine Kreise.
Als die Polizei kam, saß Dr. Müller noch immer am Tisch. Er hatte das Aquarium geöffnet und seinen Finger ins Wasser gehalten. "Ich wollte nur wissen, wie es sich anfühlt", sagte er. "Eingesperrt zu sein."
Vor Gericht sprach er von vierzig Jahren Ehe, von Routine, von der Angst vor dem Alleinsein. Die Richterin verurteilte ihn zu zwölf Jahren Haft wegen Totschlags. Die Staatsanwältin hatte Mord gefordert, aber das Gericht sah keine Heimtücke. Nur Verzweiflung.
Dr. Müller nickte, als das Urteil verkündet wurde. "Kann ich den Goldfisch mitnehmen?", fragte er. "Ins Gefängnis?"
Die Richterin sah ihn lange an. Dann schüttelte sie den Kopf.
Der Goldfisch schwamm weiter seine Kreise. Allein.
2. Die Uhr
Klaus Bergmann war Uhrmacher. In seinem kleinen Laden in der Altstadt tickte die Zeit in hunderten von Rhythmen. Er kannte jeden Mechanismus, jedes Zahnrad, jede Feder. Uhren waren verlässlich. Menschen nicht.
Seine Frau Petra hatte ihn nach zwanzig Jahren verlassen. Für einen Investmentbanker, der Rolex trug und über Präzision sprach, aber nie pünktlich war. "Du lebst in der Vergangenheit", hatte sie gesagt. "Immer nur diese alten Uhren, diese toten Dinge."
Die Scheidung war bitter. Petra wollte den Laden, den sie gemeinsam aufgebaut hatten. "Du kannst ja Uhren reparieren", sagte sie. "Mach das halt für andere."
Klaus arbeitete die ganze Nacht vor der Verhandlung. Er reparierte eine Taschenuhr aus dem 18. Jahrhundert, die ein Kunde gebracht hatte. Winzige Zahnräder, dünner als Haare. Stunden vergingen, während er über das Werk gebeugt saß.
Um drei Uhr morgens hörte er den Schlüssel im Schloss. Petra kam herein, wie so oft in den letzten Monaten. Sie wollte etwas holen, sagte sie. Immer gab es etwas.
"Ich hab dir was mitgebracht", sagte sie und legte eine Rolex auf den Tresen. "Von Marcus. Er meint, du könntest sie begutachten. Für den Versicherungsfall."
Klaus nahm die Uhr. Sie war schwer, kalt. Ein Investment, kein Zeitmesser. "Gestohlen", sagte er nach einer Weile.
"Was?"
"Die Uhr. Die Seriennummer ist abgeschliffen. Schlecht gemacht. Sieht man sofort."
Petra wurde blass. "Das ist nicht... Marcus würde nie..."
"Doch. Würde er. Wie er dich stehlen würde. Wie er alles stiehlt."
Sie standen sich gegenüber im Laden. Die Uhren tickten, jede in ihrem eigenen Rhythmus. Petra griff nach der Rolex, aber Klaus hielt sie fest.
"Du zerstörst alles", sagte er. "Zwanzig Jahre. Alles kaputt."
"Lass mich los!"
Aber Klaus ließ nicht los. Er drückte zu, immer fester. Petra schrie, aber das Ticken der Uhren übertönte alles. Als sie still wurde, war es 3:17 Uhr.
Klaus setzte sich an seinen Arbeitsplatz und nahm die Taschenuhr zur Hand. Die Zeit war stehen geblieben. Das Hauptzahnrad war gebrochen.
Die Polizei fand ihn am Morgen. Er hatte alle Uhren im Laden aufgezogen. Sie tickten im Gleichklang, zum ersten und letzten Mal.
"Warum?", fragte der Kommissar.
Klaus sah auf die Taschenuhr in seinen Händen. "Die Zeit", sagte er. "Sie war abgelaufen."
Vor Gericht behauptete er, es sei ein Unfall gewesen. Aber die Rechtsmedizin bewies: Petra war erwürgt worden. Langsam, mit Bedacht.
Fünfzehn Jahre Haft. Klaus nickte, als das Urteil verkündet wurde. "Kann ich meine Uhren mitnehmen?", fragte er.
"Nein", sagte die Richterin. "Die Zeit müssen Sie anders verbringen."
In seiner Zelle ist es still. Keine Uhren, nur die Erinnerung an das Ticken. Klaus liegt auf dem Bett und zählt die Sekunden. Ein Leben lang.
3. Das Kochbuch
Maria Santorini führte das beste italienische Restaurant der Stadt. Ihre Küche war ihr Heiligtum, ihre Rezepte waren Familiengeheimnisse. Sie kochte mit Liebe, sagten die Gäste. Das stimmte. Bis zu dem Tag, als die Liebe starb.
Roberto war ihr Mann und ihr Sous-Chef. Vierzehn Jahre hatten sie zusammen gekocht, gelacht, geträumt. Das Restaurant war ihr gemeinsames Kind, das einzige, das sie hatten.
An einem Donnerstag im Juni kam Roberto nicht zur Arbeit. Maria fand ihn im Büro, über den Büchern. Er weinte.
"Ich kann nicht mehr", sagte er. "Ich liebe jemand anderen."
Die andere war eine Köchin aus München. Jung, ambitioniert, mit eigenen Träumen. "Sie will ein Restaurant eröffnen", sagte Roberto. "Ich gehe mit ihr."
Maria stand da, das Kochbuch ihrer Großmutter in den Händen. Hundert Jahre alte Rezepte, von Generation zu Generation weitergegeben. "Und ich?", fragte sie.
"Du bekommst das Restaurant. Ich will nur meine Sachen und... das Kochbuch."
"Das Kochbuch?"
"Es gehört mir auch. Ich hab all die Jahre mitgekocht. Ohne mich wäre es nichts wert."
Maria starrte ihn an. Das Kochbuch war mehr als Rezepte. Es war ihre Geschichte, ihre Identität. "Nein", sagte sie.
"Doch. Mein Anwalt sagt, ich hab Anspruch darauf. Geistiges Eigentum."
In dieser Nacht blieb Maria in der Küche. Sie kochte wie eine Besessene. Pasta, Risotto, Ossobuco. All die Gerichte, die Roberto geliebt hatte. Um Mitternacht kam er in die Küche.
"Riecht gut", sagte er und lächelte. Wie früher.
"Probiere mal", sagte Maria und reichte ihm einen Löffel Sauce. "Neues Rezept."
Roberto kostete. "Sehr gut. Aber etwas bitter."
"Das ist Wermut. Für die Tiefe."
Sie redeten, während er aß. Über die alten Zeiten, über ihre Träume. Roberto wurde müde, seine Augen schwer.
"Was ist mit mir?", murmelte er.
"Du schläfst nur", sagte Maria. "Wie ein Kind."
Aber Roberto schlief nicht. Die Tollkirsche, die Maria in die Sauce getan hatte, ließ ihn langsam sterben. Sie hielt seine Hand, bis sein Herz aufhörte zu schlagen.
Den Anwalt rief sie am nächsten Morgen. "Roberto kommt nicht zur Scheidung", sagte sie. "Er ist verreist."
Die Polizei fand ihn drei Tage später. Versteckt im Kühlhaus, zwischen den Fleischstücken. Maria saß in der Küche und las in ihrem Kochbuch.
"Warum?", fragte der Kommissar.
"Er wollte mir meine Seele nehmen", sagte Maria. "Aber manche Dinge kann man nicht teilen."
Das Gericht verurteilte sie zu lebenslanger Haft. Mord mit Heimtücke. Maria nahm das Urteil ohne Emotion entgegen.
"Kann ich das Kochbuch behalten?", fragte sie.
"Nein", sagte die Richterin. "Das ist Beweismaterial."
Im Gefängnis arbeitet Maria in der Küche. Sie kocht für achthundert Häftlinge. Immer dieselben Gerichte, nach Vorschrift. Ohne Liebe, ohne Seele.
Das Kochbuch liegt im Archiv. Zwischen Akten und Beweismitteln. Wertlos ohne ihre Hände.
4. Der Briefkasten
Heinrich Stolz war Briefträger. Vierzig Jahre lang hatte er Post ausgetragen, Freuden und Sorgen der Menschen getragen. Er kannte jeden Briefkasten in seinem Bezirk, jede Hausnummer, jede Geschichte.
Seine Frau Ingrid hatte ihn nach dreißig Jahren verlassen. Für einen Postboten aus einem anderen Bezirk. "Du redest nie", hatte sie gesagt. "Du bringst nur Post."
Heinrich schwieg. Er hatte sein Leben lang geschwiegen. Briefe sprachen für sich.
Die Scheidung war einfach. Ingrid wollte das Haus, er sollte eine Wohnung suchen. "Du findest überall einen Briefkasten", hatte sie gesagt und gelacht.
Heinrich zog in eine kleine Wohnung am Stadtrand. Der Briefkasten war neu, ohne Geschichte. Er klebte ein Schild darauf: "H. Stolz". Zwei Buchstaben und ein Punkt. Mehr brauchte er nicht.
Jeden Tag lief er seine Route. Neue Briefe, neue Geschichten. Aber abends war er allein. Keine Post für ihn, kein Name auf Umschlägen.
An einem Freitag im November sah er Ingrid. Sie stand vor ihrem alten Haus, seinem Haus, und küsste den anderen. Heinrich hielt an, versteckte sich hinter einem Baum. Sie lachte, wie früher. Nur nicht mit ihm.
Am Wochenende fuhr er zu dem Haus. Ingrid war nicht da, aber der Briefkasten war voll. Rechnungen, Werbung, ein Brief von der Versicherung. Heinrich öffnete ihn. Aus Gewohnheit, sagte er später vor Gericht.
Die Versicherung schrieb wegen eines Unfalls. Ingrids neuer Mann hatte gelogen. Er war nicht Postbote, sondern Sozialbetrüger. Seit Jahren bekam er Geld, das ihm nicht zustand.
Heinrich las den Brief zweimal. Dann steckte er ihn in die Tasche.
Am Montag kam Ingrid zu ihm. Sie sah alt aus, müde. "Ich brauche deine Hilfe", sagte sie. "Die Versicherung will Geld von mir. Ich verstehe das nicht."
Heinrich zeigte ihr den Brief. "Dein Freund ist ein Betrüger", sagte er.
"Das ist nicht wahr!"
"Doch. Steht hier."
Ingrid wurde blass. "Du hast meinen Brief gelesen? Du hast meine Post gestohlen?"
"Ich bin Postbote", sagte Heinrich. "Ich lese immer Post."
"Du spinnst ja total!"
Sie standen sich gegenüber in der kleinen Wohnung. Heinrich sah auf den neuen Briefkasten durch das Fenster. Leer, wie sein Leben.
"Du hast mich angelogen", sagte er. "Dreißig Jahre lang."
"Womit?"
"Du hast gesagt, ich rede nie. Aber du hast nie zugehört."
Ingrid wollte gehen, aber Heinrich hielt sie fest.
"Du hörst jetzt zu", sagte er.
Er sprach eine Stunde lang. Von Briefen, die er gelesen hatte. Von Liebesbriefen, die er nicht bekommen hatte. Von Einsamkeit, die er getragen hatte wie einen Postsack.
Ingrid weinte. "Lass mich gehen", sagte sie.
Aber Heinrich ließ nicht los. Er drückte zu, immer fester. Bis Ingrid aufhörte zu weinen.
Die Polizei fand sie am nächsten Tag. Heinrich saß neben ihr und las einen Brief vor. Immer wieder denselben.
"Liebe Ingrid", las er. "Ich liebe dich. Heinrich."
"Haben Sie diesen Brief geschrieben?", fragte der Kommissar.
Heinrich nickte. "Aber nie abgeschickt. Vierzig Jahre lang."
Das Gericht sah einen Affekt. Totschlag, nicht Mord. Zehn Jahre Haft. Heinrich nickte, als das Urteil verkündet wurde.
"Kann ich Post bekommen?", fragte er. "Im Gefängnis?"
"Ja", sagte die Richterin. "Wenn Ihnen jemand schreibt."
Heinrich lächelte. Zum ersten Mal seit langem.
Aber niemand schrieb ihm. Der Briefkasten in seiner Zelle blieb leer.
5. Das Fotoalbum
Sabine Hoffmann war Fotografin. Sie fing Momente ein, hielt sie fest für die Ewigkeit. Ihre Bilder erzählten Geschichten von Liebe, Glück, Leben. Bis zu dem Tag, als ihre eigene Geschichte endete.
Thomas war ihr Mann und ihr Modell. Zwölf Jahre lang hatte sie ihn fotografiert. Tausende von Bildern, ein ganzes Leben in Schwarz-Weiß. Er war ihr Motiv, ihre Muse, ihre Welt.
An einem Mittwoch im April kam Thomas nicht ins Studio. Sabine wartete, bis die Sonne unterging.
Um neun Uhr rief er an.
"Ich komme nicht mehr", sagte er. "Es ist vorbei."
"Was ist vorbei?"
"Wir. Ich hab jemand anderen kennengelernt."
Sabine stand im Dunkeln zwischen ihren Bildern. Thomas überall, in jeder Ecke, in jedem Rahmen. "Wer ist sie?", fragte sie.
"Eine Kundin. Ich hab sie fotografiert. Für ihre Hochzeit."
Sabine lachte. "Du kannst nicht fotografieren. Du bist nur das Motiv."
"Nicht mehr", sagte Thomas. "Ich hab genug davon, betrachtet zu werden. Ich will selbst sehen."
Die Scheidung war schnell. Thomas wollte die Hälfte der Bilder, alle, auf denen er zu sehen war.
"Das ist mein Gesicht", sagte er. "Mein Körper.
Meine Rechte."