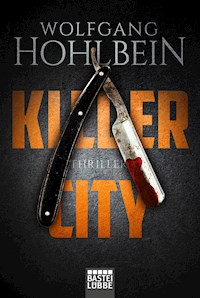
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Seine bevorzugte Waffe ist das Rasiermesser. Mit ihm nähert er sich leise aus der Dunkelheit. Er ist auf der Suche nach seinem nächsten Opfer, denn sein Impuls zu töten ist übermächtig ... Thornhill hat schon viele Menschen getötet. Die kürzlich eröffnete Weltausstellung lockt Tausende Besucher nach Chicago. Dort kann er in der Masse der Touristen untertauchen und auf Jagd gehen. Doch schon bald macht er sich Feinde unter den Gangs der Stadt. Schnell sind die ersten Toten zu beklagen — und Thornhill wird vom Jäger zum Gejagten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Seine bevorzugte Waffe ist das Rasiermesser. Mit ihm nähert er sich leise aus der Dunkelheit. Er ist auf der Suche nach seinem nächsten Opfer, denn sein Impuls zu töten ist übermächtig ... Thornhill hat schon viele Menschen getötet. Die kürzlich eröffnete Weltausstellung lockt Tausende Besucher nach Chicago. Dort kann er in der Masse der Touristen untertauchen und auf Jagd gehen. Doch schon bald macht er sich Feinde unter den Gangs der Stadt. Schnell sind die ersten Toten zu beklagen — und Thornhill wird vom Jäger zum Gejagten.
ÜBER DEN AUTOR
Wolfgang Hohlbein, am 15. August 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen sechs Kindern, umgeben von einer Schar Katzen, Hunde und anderer Haustiere, in der Nähe von Neuss. Mitte der fünfziger Jahre kam Hohlbeins Familie in den Westen und schlug ihr Domizil in Krefeld auf. In Krefeld absolvierte Wolfgang Hohlbein seine Schule und später eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Zeitweise hielt er sich durch Nebenjobs, wie etwa als Nachtwächter, über Wasser.Wolfgang Hohlbein ist ein Erzähler, es reizt ihn nicht nur die Lust am Fabulieren, sondern auch das freie Spiel mit ungewöhnlichen Ideen und fantastischen Einfällen.
Er ist ein Workaholic, der in der Zeit von Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden arbeitet. Sieben Tage in der Woche legt er selbst in seinen seltenen Urlauben kaum den Stift aus der Hand. »So ist das eben, wenn man das große Glück hat, aus seinem Hobby einen Beruf machen zu können«, bemerkt er selbst dazu.
Laut einer Aufstellung in Focus (Nr. 40, November 2006) liegt die Gesamtauflage von Wolfgang Hohlbein bei 35 Millionen Exemplaren. Er ist damit »einer der erfolgreichsten deutschen Autoren der Gegenwart«. Der Wegbereiter neuer deutscher Phantastik und Fantasy wurde bislang in 34 Sprachen übersetzt. Er hat bereits 160 Romane verfasst, den überwiegenden Teil alleine, etliche Kinder- und Jugendbücher gemeinsam mit seiner Frau Heike und einige wenige Erwachsenenromane mit Co-Autoren.
Zahlreiche Preise und Auszeichnungen hat Wolfgang Hohlbein erhalten. Vom »Preis der Leseratten« 1983 bis zum »Bester Autor National« Deutscher Phantastik-Preis 2004, dem »Sondermann-Preis« auf der Buchmesse 2005 und dem »Nyctalus« im November 2005.
Inzwischen fördert Hohlbein auf verschiedene Weise selbst Nachwuchstalente. Die Nachwuchsförderung liegt ihm besonders am Herzen. »Wer in seiner schreiberischen Karriere am Anfang steht, tut sich oft sehr schwer, einen Verlag zu finden«, weiß Hohlbein aus eigener Erfahrung
WOLFGANG
HOHLBEIN
KILLER CITY
THRILLER
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Uwe Voehl, Bad Salzuflen
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Einband-/Umschlagmotiv: © shuttershock/gyn9037; © Granger Historical Picture Archive/Alamy Stock Photo; © shutterstock
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-4989-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
DIE BURG
Viele, die auf ihrem Weg zur Arbeit oder auch aus anderen Gründen mehr oder weniger regelmäßig an dem Hotel vorbeikamen, nannten es schlicht die Burg. Auch Thornhill lag dieses Wort ganz instinktiv als Allererstes auf der Zunge, als er aus der Tram stieg und mit der linken Hand die Melone zurechtrückte, mit der er seit Jahren den immer schneller werdenden Vormarsch seiner Geheimratsecken zu kaschieren versuchte.
Dabei tat die Bezeichnung Burg dem beeindruckenden Gebäude mit seinen modernen Ziegelsteinwänden, den großen Fenstern und kühn vorspringenden Erkern mehr als unrecht, denn es stach ganz im Gegenteil eher positiv aus der Masse der umliegenden Gebäude heraus.
Und dennoch: Das große dreigeschossige Haus hatte etwas Bedrohliches. Es war nicht mit Händen zu greifen und auch nicht mit Worten zu beschreiben, sondern eher wie ein unsichtbarer Schatten, der sich vor das Sonnenlicht schob und ihm einen winzigen Teil seiner Leuchtkraft stahl; jenen Teil, der nicht den Körper, sondern die Seele wärmt.
Was für ein seltsamer Gedanke, der so gar nicht zu ihm passen wollte … und aus dem er auch unsanft und von einem ungeduldigen Schrillen herausgerissen wurde.
Thornhill brauchte noch eine weitere halbe Sekunde, um zu begreifen, dass er mit einem Fuß noch immer auf dem Trittbrett der Tram stand und sie so am Weiterfahren hinderte, und die andere Sekundenhälfte, um den Fehler zu berichtigen und ganz auf die Straße hinabzutreten. Er hatte es noch nicht ganz geschafft, da setzten sich die beiden muskulösen Zugpferde schon wieder in Bewegung, und die Tram rollte auf ihren eisernen Schienen weiter.
Das Gefährt bildete einen sonderbaren Kontrast in sich, vereinte es doch die beinahe altmodischste Art der Fortbewegung mit den modernen Schienenfahrzeugen, die mehr und mehr das Bild der Städte bestimmten. Thornhill ertappte sich dabei, so lange stehen zu bleiben, bis es den Platz überquert hatte und verschwunden war. Dann ergriff er seine Tasche fester, rückte noch einmal die Melone zurecht und nahm sowohl den Weg zum Hotel als auch seinen letzten Gedanken wieder auf. Sicher, es war ein beeindruckendes Gebäude, aber es machte ihm Angst.
Vielleicht lag es ja auch an der ganzen Gegend. Chicago an sich genoss schon keinen guten Ruf, aber Englewood war in einer schlecht beleumundeten Stadt zweifellos das Viertel, über das man am meisten die Nase rümpfte, ein Viertel, auf das nicht nur der Rest Chicagos hinabsah. Selbst die meisten Einwohner Englewoods waren mittlerweile Opfer des üblen Rufes geworden, den sie sich so mühsam erarbeitet hatten, und trauten sich nach Sonnenuntergang kaum mehr aus ihren Häusern.
Aber darüber wollte sich Thornhill nicht beschweren. Schließlich war er aus keinem anderen Grund hergekommen.
Ein Velofahrer kam ihm entgegen und entblödete sich nicht, ausgiebig die Klingel seines obszönen Gefährts zu betätigen, obwohl die Straße nun wirklich breit genug war, um ihm auszuweichen. Thornhill setzte seinen Weg unverdrossen fort und verzichtete sogar darauf, dem Fahrer auch nur einen bösen Blick nachzuwerfen. Stattdessen tröstete er sich mit dem Gedanken, was er ihm hätte antun können, wenn ihm danach gewesen wäre.
Der Wind drehte und trug einen Übelkeit erregenden Schwall des typischen Chicago-Gestanks heran, den er fast noch unerträglicher fand als den Anblick der Armut und Kriminalität ringsum.
Das Erdgeschoss des großen Eckgebäudes bestand fast komplett aus Ladenlokalen: einer Apotheke, einem kleinen Barber-Shop und einem noch kleineren Gemischtwarenladen, wie man sie fast ausschließlich in Vierteln wie diesem fand und die alles und nichts im Angebot hatten; und einen Gutteil davon vermutlich illegal. Thornhill nahm sich vor, sich demnächst das Ladengeschäft etwas genauer anzusehen und vor allem seinen Besitzer einer unauffälligen Überprüfung zu unterziehen, steuerte nun aber mit schnelleren Schritten den Haupteingang des Hotels an.
Zu seinem Erstaunen protzte der Eingang mit einer modernen Drehtür, wie man sie eher in Gebäuden und Hotels erheblich höherer Preisklasse erwartete, und die ihn in ein ebenfalls unerwartet großes, geschmackvoll eingerichtetes Foyer beförderte. Thornhill war ein wenig verwundert, und ein ganz kleines bisschen verwirrt. Selbstverständlich hatte er diskrete Erkundigungen über das Hotel eingezogen, bevor er sich auf den Weg nach Chicago gemacht hatte. Er wusste sowohl, dass sein Besitzer ein mäßig talentierter Arzt war, der auch vom Hotelgewerbe nicht viel verstand, als auch, dass sich seine Umsätze in Grenzen hielten; um es sehr diplomatisch zu formulieren.
Oder um es in einfachere Worte zu kleiden: Der Kerl brachte es fertig, mit seinem Hotel rote Zahlen in einer Stadt zu schreiben, die seit Wochen praktisch aus den Nähten platzte und in der man eigentlich meinen sollte, dass freie Zimmer mit Gold aufgewogen wurden.
Passend zu seinen Überlegungen war das Foyer menschenleer. Die Theke glänzte wie frisch poliert. Darauf befand sich eine große Messingklingel und ein in teures Leder gebundenes Gästebuch mit einer altmodischen Schreibfeder samt Tintenfass. Die meisten Zimmerschlüssel hingen unbenutzt in ordentlichen Reihen an der Wand dahinter, statt sich in den Taschen zahlender Gäste zu befinden, wo sie eigentlich hingehörten.
Thornhill stellte die Tasche ab, betätigte die Glocke und ließ höfliche zwanzig Sekunden verstreichen, bevor er noch einmal, und jetzt schon etwas weniger zurückhaltend, draufschlug. Irgendwo begann es zu rumoren, und er meinte, näher kommende Schritte zu hören.
Die Wartezeit bis zu ihrem Eintreffen vertrieb er sich damit, das Gästebuch herumzudrehen und ungeniert aufzuschlagen, um es zu studieren. Was er auf den auf feinstem Büttenpapier gedruckten Seiten las, das bestätigte seinen allerersten Eindruck dieses sonderbaren Hotels noch: Es war praktisch leer. Nur zwei von mehr als zwei Dutzend Zimmern waren belegt – und dabei war das, das er telegrafisch reserviert hatte, schon mitgezählt –, und auf den vorherigen Seiten sah es nicht viel besser aus. Thornhill war weder Buchhalter, noch interessierte er sich auch nur die Bohne für Zahlen, aber weder das eine noch das andere war nötig, um zu erkennen, dass die schöne Fassade nur Schein war und das famose Hotel kurz vor dem Bankrott stand.
Eine Tür klappte, und endlich näherte sich eine Frau schwer zu bestimmenden Alters. Sie war schlank und sauber, wenn auch für eine Umgebung wie diese eine Spur zu schäbig gekleidet. Sie hatte schwarzes Haar, das vermutlich prachtvoll ausgesehen hätte, wäre es nicht zu einem unattraktiven Dutt zusammengebunden. Auch ihr Gesicht hatte einen strengen Zug, der ihm viel von der unzweifelhaft vorhandenen Anmut nahm.
Den Rest erledigte ihr Benehmen. Und ihre Stimme, die sich anhörte, als begänne sie jeden Morgen damit, mit Metallspänen und Whiskey zu gurgeln.
»Das nicht für Gäste«, sagte sie mit einem schweren slawischen Akzent und klappte das Gästebuch mit einem Knall zu, sodass Thornhill gerade noch die Finger zurückziehen konnte. »Doktor nicht da.«
»Ich suche auch keinen Arzt, sondern habe ein Zimmer reserviert«, antwortete Thornhill, wohl wissend, dass die feine Ironie bei seinem Gegenüber nicht ankommen würde. Wahrscheinlich verstand sie nicht einmal die Worte, denn sie wiederholte nur: »Doktor nicht da.«
»Mein Name ist Porter«, stellte er sich unter der falschen Identität vor, die er sich für diese Reise zugelegt hatte; und wie es seine Art war, nicht die einer erdachten, sondern einer real existierenden Person, eines wohlhabenden Kaufmanns aus Boston, der die Weltausstellung aus geschäftlichen Gründen besuchte.
»Dann geben Sie mir doch einfach den Meldezettel, und ich fülle ihn selbst aus«, schlug er vor, während er sich – allerdings mit eher klinischem Interesse – fragte, ob ihr Gesicht wohl noch nennenswert blasser werden würde, wenn er ihr die Kehle aufschnitt und zusah, wie sie ausblutete. Wahrscheinlich nicht.
»Doktor nicht da«, sagte sie noch einmal. Sie sah weder das Meldebuch an noch seine Ausweispapiere, die er zusammen mit der telegrafischen Buchungsbestätigung aus der Tasche zog und auf den Tresen legte. Thornhill spürte, wie Zorn in ihm erwachen wollte, aber dann begriff er, dass sie des Lesens vermutlich gar nicht mächtig war. Seine wieder frei gewordene Hand glitt erneut in die Jackentasche und strich über den Perlmuttgriff des rasiermesserscharfen Todes, den er darin trug. Aber er führte die Bewegung ebenso wenig zu Ende wie den weitergehenden Gedanken. Noch nicht.
»Und wo ist der … Doktor?«, fragte er stattdessen. Doch. Genau jetzt. Die Gelegenheit ist günstig. Es gibt keine Zeugen. Niemand hat dich gesehen.
Niemand außer dem Velofahrer. Den anderen Fahrgästen der Tram, und dem Schaffner, bei dem er nicht nur sein Billett gelöst, sondern sich leichtsinnigerweise auch noch nach dem Hotel erkundigt hatte.
Er widerstand nicht nur dem Impuls, noch einmal nach dem Rasiermesser zu greifen, sondern verdrängte dessen bloße Existenz auch für den Moment aus seinen Gedanken und trat einen großen Schritt von der Theke zurück, um die räumliche Distanz zwischen ihnen zu vergrößern. Manchmal reichte schon zu viel Nähe, um sein Verlangen schier übermächtig werden zu lassen. Daher hatte er sich schon vor langer Zeit angewöhnt, einen Sicherheitsabstand von mindestens einer Armeslänge zu allen anderen Menschen einzuhalten, wenn es nur ging.
»Doktor draußen«, antwortete sie mit einiger Verspätung auf seine Frage und einem unwilligen Handwedeln in keine bestimmte Richtung. Sowie einem Räuspern, aus dem ihre grässliche Stimme das Krächzen eines großen, räudigen Raben machte, der auf einem Ast hinter der Theke saß und auf eine Gelegenheit wartete, ihm die Augen auszupicken. »Lieferung.«
»Dann werde ich hinausgehen und selbst nach ihm suchen«, sagte er. »Vielleicht sind Sie so freundlich und bringen in der Zwischenzeit mein Gepäck aufs Zimmer? Es ist nur diese eine Tasche.« Er stellte sie auf die Theke, wo sie sie mit demselben leicht angewiderten Blick bedachte wie ihn zuvor.
Ohne eine Antwort abzuwarten, wandte er sich um und durchquerte die Halle, um ein zweites Mal die moderne Drehtür zu benutzen, was ihm wie ein kleines Abenteuer vorkam. Im Hinausgehen sah er, wie sie die Tasche von der Theke nahm und davontrug. Er machte sich keine großen Sorgen über ihren Verbleib. Sie enthielt lediglich ein paar Kleidungsstücke und einen Teil seiner Werkzeuge, nichts, was Rückschlüsse auf seine Person oder gar seine Identität zugelassen hätte. Draußen angekommen, fiel ihm erneut der üble Geruch auf, der aus der Stadt heranwehte: eine Mischung, die sofort eine leise Übelkeit in ihm wecken wollte – aus heiß gelaufenen Maschinen, ranzigem Fett und Verwesung.
Thornhill kämpfte erfolgreich gegen die Übelkeit an, aber er kam nicht umhin, jenem Teil in sich zuzustimmen, der von Anfang an dagegen gewesen war, hierherzukommen. Städte boten sich für seine Zwecke selbstverständlich allein durch ihre Anonymität und Größe an, und gerade Chicago war ihm aus der Ferne besonders verlockend vorgekommen. Durch sein schwindelerregendes Wachstum und die prosperierende Wirtschaft wurden Unmengen von Menschen in die Stadt getrieben, und gerade am Vorabend der Weltausstellung sogar noch einmal mehr. Dazu kam noch einmal der besondere Ruf dieses Stadtteils. Alles hätte perfekt sein sollen …
Aber das Gegenteil war der Fall.
Seine Hand glitt zum dritten Mal in die Tasche und schloss sich um das Rasiermesser. Doch diesmal lag kein Verlangen in der Bewegung, und die einzige Belohnung, die an ihrem Ende warten mochte, bestand in der bloßen Tatsache, am Leben zu bleiben.
Was für ein Unsinn! Was brachte ihn dazu, plötzlich wie Beute zu denken und nicht wie der Jäger, der er doch war?
Thornhill erteilte sich selbst in Gedanken einen scharfen Verweis, zog die Hand mit einem Ruck wieder aus der Tasche und wandte sich nach rechts, in die Richtung, von der er zumindest annahm, dass die Rabenfrau dorthin gedeutet hatte. Der übelriechende Wind schlug ihm jetzt direkt ins Gesicht und trieb ihm nicht nur durch seine unsichtbaren Beimengungen die Tränen in die Augen. Er war schneidend wie Messerklingen und brachte eine Kälte mit sich, die dem strahlenden Blau des Himmels und der kräftigen Nachmittagssonne Hohn sprach. Thornhill drehte das Gesicht aus dem Wind, senkte den Kopf und hielt auf den nächsten Schritten die Luft an. Immerhin wusste er jetzt, warum die Einwohner Chicagos ihre Stadt auch Windy City nannten, die windige Stadt.
Obwohl stinkende Stadt genauso zutreffend gewesen wäre.
Die Fassade endete vor einer modern gestalteten Toreinfahrt, hinter der sich nicht nur der Zwischenraum zu einem unansehnlichen Nachbargebäude verbarg, sondern ein unerwartet großer Innenhof, der Platz für ganze Stapel aus Fässern, hölzernen Kisten und halb aufgeweichten Pappkartons bot. Er erinnerte tatsächlich an den Innenhof einer mittelalterlichen Burg. Die Mauern waren nicht von Zinnen oder überdachten Wehrgängen gekrönt, aber unverputzt und von großen Flecken ausgeblühten Kalks verunziert. Es gab gleich zwei kleinere Schuppen und eine dafür umso größere Remise mit einem überhängenden Dach, in die mindestens zwei Fuhrwerke passten. Die Tür stand auf, sodass Thornhill erkennen konnte, dass sie leer war. Aber er hörte Stimmen, und auch wenn er die Worte nicht verstehen konnte, klang es doch nicht nach einer freundlichen Unterhaltung.
Thornhill verhielt mitten im Schritt, lauschte einen oder zwei Atemzüge lang vergebens und wich dann rückwärtsgehend in den Schatten eines der kleineren Schuppen zurück. Etwas warnte ihn. Er wusste nicht was, sehr wohl aber, dass er gut daran tat, auf diese innere Stimme zu hören. Vielleicht waren die Instinkte des Jägers und die der Beute ja gar nicht so verschieden.
Die Stimmen wurden lauter, und nun stritten sie eindeutig miteinander, auch wenn er immer noch nicht verstand, worum es ging. Doch sie kamen näher. Noch ein paar Augenblicke, und dann würde man ihn sehen, und er würde peinliche Fragen beantworten müssen oder sich zumindest in einer unangenehmen Situation wiederfinden. Weder das eine noch das andere konnte er gebrauchen. Sein Werk musste im Verborgenen getan werden oder doch wenigstens diskret.
Es war jedoch zu spät, um den Hof noch ungesehen zu verlassen, und aus irgendeinem Grund drohte er fast in Panik zu geraten, was ihm schon seit Jahren nicht mehr passiert war.
Es musste an diesem Ort liegen, der Burg. Er fühlte sich wie ein Soldat auf feindlichem Gebiet, wo ihm die Instinkte des Jägers nichts mehr nutzten.
Er brauchte keine Ausrede, um hier zu sein, nachdem ihn die Rabenfrau ja eigens hergeschickt hatte, zerbrach sich aber trotzdem den Kopf darüber, während die Stimmen immer näher kamen. Es war ein Streit, und es ging um Geld, so viel konnte er heraushören. Irgendwie ging es ja immer um Geld. Oder Sinnesfreuden. Außer bei ihm.
Rückwärtsgehend stieß er gegen die Schuppentür, tastete nach dem Knauf und hätte beinahe vor Erleichterung laut ausgerufen, als er sich drehte und die Tür mit einem Klicken aufsprang. Rasch schlüpfte er hindurch und sah, dass der Schuppen ausgerechnet voller Fahrräder war. Er zog die Tür hinter sich bis auf einen kaum fingerbreiten Spalt wieder zu und begriff genau in diesem Moment, welches Problem er sich gerade ohne Not eingehandelt hatte: Selbst in einen peinlichen Streit zwischen Fremden hineinzuplatzen, hätte ihm allerhöchstens das missbilligende Hochziehen einer Augenbraue eingebracht oder einen strafenden Blick. Fand man ihn hier drinnen, würde er erklären müssen, was er in dem Schuppen tat.
Ohne dass er es auch nur merkte, glitt seine Hand schon wieder in die Jackentasche und schloss sich um den Perlmuttgriff, eine seiner möglichen Antworten.
Er musste sie niemandem geben, denn die drei Männer, die kaum einen Herzschlag später aus dem Halbdunkel der Remise auf den Burghof heraustraten, waren so sehr in einen von heftigem Gestikulieren und Herumfuhrwerken begleiteten Disput vertieft, dass sie ihn womöglich nicht einmal dann bemerkt hätten, wäre er einfach stehen geblieben.
Zwei von ihnen waren mittleren Alters und nach der neuesten Mode und nicht billig gekleidet – wenn auch nicht so übertrieben, dass sie wiederum aufgefallen wären: eleganter Dreiteiler, Melone, weißes Hemd mit Fliege, dezente Manschettenknöpfe und gutes Schuhwerk samt Gamaschen. Und da sie beide auch auffällige Koteletten trugen, die so gerade eben noch nicht als Backenbart durchgingen, und dieselben modernen großen Schnauzbärte, wären sie einem flüchtigen Beobachter glatt wie Brüder vorgekommen.
Wenn auch, wie er diesen Eindruck schon nach einer Sekunde relativieren musste, allerhöchstens wie Kain und Abel. Sie fielen zwar nicht mit Fäusten übereinander her, aber zumindest der Kleinere von beiden schien sich nur gerade noch beherrschen zu können, genau das nicht zu tun.
»Damit kommen Sie nicht durch, Holmes«, sagte er gerade, die Stimme bebend vor Zorn. »Das lasse ich mir nicht länger bieten!«
In den Augen des mit Holmes Angesprochenen – das war also der Doktor – blitzte zwar ganz kurz ebenfalls Zorn auf, aber er hatte sich weitaus besser in der Gewalt. Als er sprach, klang er ganz ruhig, beinahe freundlich.
»Aber ich bitte Sie, Mister Fairchild, beruhigen Sie sich doch. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam eine Lösung finden, die uns beiden zum Vorteil gereicht.«
»Oh, das habe ich schon!«, antwortete Fairchild höhnisch. »Und es ist nicht einmal kompliziert. Sie bezahlen, was Sie mir schuldig sind, und ich werde ganz friedlich und ohne weiteres Aufsehen gehen. Ich verspreche, dass Sie mich niemals wiedersehen. Ganz bestimmt sogar nicht!«
»Aber ich habe Ihnen doch erklärt, dass ich im Moment ein kleines Liquiditätsproblem habe«, antwortete Holmes ruhig. »Das Hotel läuft nicht gut, und auch der Fahrradverleih – dessen Erfolgsaussichten Sie mir nebenbei in den rosigsten Farben geschildert haben, mein lieber Fairchild – hat sich nicht wie vorausberechnet angelassen, sondern eher schleppend. Doch sobald die Weltausstellung ihre Pforten öffnet, werden gewiss Tausende von Menschen in die Stadt strömen, und dann –«
»Das erzählen Sie mir jetzt seit sechs Monaten, Holmes!«, fiel ihm der andere ins Wort. In seiner Stimme war etwas Neues: eine Entschlossenheit, die allmählich über die Hysterie obsiegte. »Meine Geduld ist erschöpft! Sie zahlen Ihre Schulden, hier und jetzt, oder ich werde Matt sagen, dass er den Wagen holt, und ich nehme mein Eigentum mit.«
Er machte eine Kopfbewegung auf den Dritten im Bunde, den Thornhill jetzt zum ersten Mal genauer in Augenschein nahm. Er wandte dem Schuppen den Rücken zu, sodass er sein Gesicht nicht erkennen konnte. Aber allein die linkische Haltung und das schulterlange Haar zeigten, dass er noch sehr jung sein musste; allerhöchstens zwanzig, schätzte Thornhill. Er trug die robusten Kleider eines Arbeiters samt schäbiger Schlägerkappe, war groß und von kräftiger Statur, und seine Haltung wurde mit jedem Wort Fairchilds ein bisschen drohender. Er ballte die Hände zu Fäusten, was von einem Geräusch wie zerbrechendem Reisig begleitet wurde. In spätestens zehn Jahren, dachte Thornhill, würde er Arthritis in den Händen haben, und in fünfzehn vor Schmerzen wimmern, wenn er sich auch nur ein Streichholz anzureißen versuchte. Falls er so alt wurde. Thornhill bezweifelte das.
Aber zumindest im Moment spürte er die Jugend und ungestüme Kraft des Burschen, die ihn umgab, wie einen verlockenden Duft. Wäre die Situation auch nur ein bisschen anders gewesen …
Aber das war sie nicht, und so nagte in ihm zwar ein uralter Hunger, den er aber mit aller Macht niederkämpfte, was ihm sehr viel schwerer fiel, als er erwartete. Er hatte zu lange gewartet und wagte sich nicht einmal vorzustellen, wie viele Jahre er möglicherweise verloren hatte.
»Sie wissen, dass Sie das nicht dürfen, mein lieber Fairchild«, sagte Holmes fast bedauernd. »Wir haben einen gültigen Kaufvertrag.«
»Den Sie nicht eingehalten haben!« Fairchild schrie fast.
»Dann bleibt Ihnen immer noch der Klageweg«, beschied ihm Holmes, noch immer im selben, fast freundschaftlichen Ton.
»Dafür habe ich keine Zeit mehr«, antwortete Fairchild wütend. »Wenn Sie nicht zahlen, nehme ich mein Eigentum mit. Die Räder sind in dem Schuppen, nehme ich an?«
Zu Thornhills nicht geringem Entsetzen deutete er genau auf die Tür, hinter der er stand und die hässliche Szene beobachtete. »Hol die Räder da raus und lad sie auf den Wagen, Matt. Acht Stück. Was noch darin ist, rührst du nicht an. Wir wollen schließlich nur unser Eigentum.«
Zum zweiten Mal schabte die Panik an Thornhills Gedanken, als sich der junge Riese gehorsam herumdrehte. Aber diesmal kam ihm Holmes zu Hilfe, indem er den Kopf schüttelte und in eindeutig traurigem Tonfall sagte: »Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. William?«
Hinter ihm polterte etwas, und Matt schien zuerst zu normaler und dann zur Größe eines Schuljungen zusammenzuschrumpfen, als der größte Mann, den Thornhill jemals gesehen hatte, auf den Hof heraustrat. Er musste den sieben Fuß deutlich näher sein als den sechs und war kräftig gebaut, wenn auch von eher schlaksiger als muskulöser Statur. Dieses Manko aber machte er durch einen brutalen Zug um Mund und Augen wieder wett. Sein Schnurrbart war beeindruckend mit nadelspitz gezwirbelten Enden, der jedem anderen Gesicht etwas ebenso Gutmütiges wie Lustiges verliehen hätte. Seinem nicht.
»Was –?«, ächzte Fairchild.
»Ich appelliere noch einmal an Ihre Vernunft, mein lieber Mister Fairchild«, seufzte Holmes. »Ich verabscheue jegliche Form von Gewalt aus tiefstem Herzen, aber ich werde mein Eigentum schützen, wenn Sie mich dazu zwingen.«
Fairchild japste nach Luft, und auch sein Gehilfe erstarrte mitten in der Bewegung. Thornhill konnte sein Gesicht immer noch nicht erkennen, aber er spürte seine Nervosität. Schließlich rang sich Fairchild ein abgehacktes Nicken ab. Seine Kiefer mahlten. »Dafür werden Sie bezahlen, Holmes«, sagte er gepresst. »Das lasse ich mir nicht bieten. Ich werde rechtliche Schritte gegen Sie in die Wege leiten.«
»Das ist Ihr gutes Recht, Mister Fairchild«, sagte Holmes kühl. »Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.«
Fairchilds Kiefer mahlten noch angestrengter. Doch statt abgebrochener Zähne (womit Thornhill beinahe rechnete) spie er nur etwas hervor, das sein Gegenüber als beliebige Beleidigung auslegen konnte, fuhr auf dem Absatz herum und stürmte mit gesenkten Schultern aus dem Hof.
Als ihm sein Begleiter kaum weniger schnell folgte, erhaschte Thornhill zum ersten Mal einen Blick auf dessen Gesicht und korrigierte die Einschätzung sein Alter betreffend noch einmal um ein gutes Stück nach unten. Der Bursche war allerhöchstens fünfzehn und strotzte vor Kraft, und er gehörte zweifellos zu jener Sorte Männer, die diese Kraft auch gerne und rücksichtslos einsetzten. Trotz seiner Jugend hatte Fairchild ihn zweifellos mitgenommen, um Holmes gebührend einzuschüchtern, und ohne den Troll, den Holmes so überraschend aus dem Hut gezaubert hatte, hätte er die beabsichtigte Wirkung auch zweifellos erzielt. So tat er Thornhill beinahe leid, wie er so unübersehbar erschrocken die Flucht ergriff.
Aber er sah ihm auch mit einem Gefühl vager Enttäuschung hinterher, bis er aus dem schmalen Ausschnitt der Welt verschwunden war, den ihm der Türspalt zeigte. Der Junge strotzte nicht nur vor Kraft, sondern auch vor Jugend, und sein bloßer Anblick reichte aus, um den Hunger neu zu entfachen, der tief auf dem Grund seiner Seele wohnte. Es gelang ihm auch dieses Mal, die Stimme zum Schweigen zu bringen. Aber es kostete ihn schon eine Winzigkeit mehr Mühe als das Mal zuvor, und das nächste Mal würde es ihn wohl wieder ein Quäntchen mehr Kraft abverlangen. Das Flüstern in seiner Seele war leise, aber geduldig.
»Schließen Sie den Schuppen ab, William«, sagte Holmes, und Thornhills Herz machte einen erschrockenen Satz bis in seinen Kehlkopf hinauf, wo es aber nicht etwa schneller weiterhämmerte, sondern einfach stehenzubleiben schien. Als sich der Riese prompt herumdrehte und auf die Tür zukam, hinter der er stand, schloss sich seine Hand nicht nur noch fester um das Rasiermesser in seiner Tasche, sondern klappte auch die Klinge heraus, ohne dass er sich der Bewegung auch nur bewusst gewesen wäre.
Thornhill wollte zurückweichen, besann sich gerade noch rechtzeitig darauf, dass er dann möglicherweise die aneinandergelegten Fahrräder umgestoßen oder doch zumindest ein verräterisches Geräusch verursachen würde, und beließ es dabei, nach festem Stand zu suchen und das Rasiermesser ganz aus der Tasche zu ziehen. Er rechnete sich keine wirkliche Chance gegen den Troll aus, aber er hatte zumindest den Vorteil der Überraschung auf seiner Seite. Und es war auch kein Zufall, dass er seit so vielen Jahren das Rasiermesser als Werkzeug bevorzugte. Es war nicht nur ebenso präzise wie vielseitig einsetzbar, die psychologische Wirkung war nachgerade verheerend. Er hatte schon Männer beim Anblick der geschliffenen Klinge mit schlotternden Knien zurückweichen sehen, denen der eines großkalibrigen Revolvers nur ein müdes Lächeln entlockt hätte.
Irgendwie bezweifelte er allerdings, dass es bei diesem brutalen Riesen funktionieren würde.
Der schmale Lichtstreifen verschwand nahezu völlig, als der Bursche die Tür erreichte und die Hand danach ausstreckte. Hinter dem Troll sagte Holmes: »Und das Tor am besten gleich auch. Ich traue diesem Dummkopf Fairchild durchaus zu, irgendetwas Närrisches zu tun. Und beeilen Sie sich, William. Sie wissen, dass wir noch etwas vorhaben.«
Statt aufzugehen, wurde die Tür vollends geschlossen, und Thornhill hätte vermutlich erleichtert aufgeatmet, wäre da nicht zugleich auch das Geräusch eines Schlüssels zu hören gewesen, der gleich zweimal im Schloss gedreht wurde. Es folgte ein anhaltendes Klappern und Hantieren, und ein knarzendes Quietschen wie das Geräusch eiserner Scharniere, die allzu lange nicht mehr geölt worden waren, dann wurde es still, und Thornhill fand sich in völliger Dunkelheit wieder.
Sein Herz nahm die Arbeit wieder auf, und er atmete so tief ein, dass es sich in der Stille des Schuppens wie ein kleiner Schrei anhörte. Mit einem Male zitterten seine Hände so heftig, dass er das Rasiermesser rasch zusammenklappte, um sich nicht selbst zu verletzen, und je schneller sein Herz schlug, desto träger schienen sich seine Gedanken zu bewegen.
Zeit verging. Thornhill konnte nicht sagen wie viel, denn seine Gedanken bewegten sich noch immer im Kreis wie Longier-Pferde, denen man die Augen verbunden hatte. Aber es musste lange gewesen sein, denn sein Rücken schmerzte, und seine Wadenmuskeln waren so verkrampft, dass er kaum noch stehen konnte.
Mit einer Hand, die schon seit Jahren nicht mehr so stark gezittert hatte – seit seiner ersten Begegnung mit der Dunkelheit, um genau zu sein –, tastete er im Finstern um sich und bekam kaltes Metall und sprödes Leder zu fassen; eines der Velos, mit denen der winzige Schuppen hoffnungslos vollgestopft war.
Zitternd und sehr behutsam berührte er weitere Gegenstände um sich herum und stellte fest, dass er sich praktisch nicht bewegen konnte, denn irgendwie war es Holmes oder seinem Gehilfen gelungen, eindeutig mehr Velozipede in den winzigen Raum zu quetschen, als eigentlich darin Platz hatten. Wahrscheinlich gab es hier drinnen auch Werkzeuge, mit denen er sich befreien konnte. Aber so vollgestopft und bei völliger Dunkelheit hatte er keine Chance, sie zu finden, und schon gar keine, es leise genug zu tun, um nicht das halbe Hotel aufzuwecken.
Eine Zeitlang amüsierte er sich damit, mit dem Schicksal zu hadern und sich selbst dafür zu tadeln, dass er es zugelassen hatte, derartig in Panik zu geraten. Es war so unnötig gewesen, sich nicht einfach zu erkennen zu geben. Er hätte höchstens ein paar peinliche Fragen beantworten und sich irgendeine hanebüchene Ausrede für sein Hiersein einfallen lassen müssen. Jetzt hatte er sich ohne Not in eine Lage gebracht, die deutlich unangenehmer ausgehen konnte. Er an Holmes’ Stelle hätte sich gewiss gefragt, ob dieser Fremde wirklich zufällig in ebenjenem Schuppen aufgetaucht war, auf den Fairchild ein Auge geworfen hatte.
Seine Hand strich nun von außen über die Tasche, in der er das Messer trug. Gut möglich, dass es blutig endete. Damit hatte er kein Problem, denn letztlich war er aus keinem anderen Grund hier.
Aber nicht so.
Thornhill verzog die Mundwinkel zu einem verächtlichen Lächeln, das seiner eigenen Weinerlichkeit galt. Selbstmitleid war eine Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben, brachte darüber hinaus aber keinerlei Nutzen und ihn schon gar nicht hier heraus. Er musste seit einer Stunde hier gefangen sein, wenn nicht länger, und es wurde Zeit, etwas an diesem Zustand zu ändern.
Er hatte die Tür und speziell das Schloss und die Angeln schon ein Dutzend Mal mit den Händen abgetastet und keine Schwachstelle gefunden, und nun tat er es ein weiteres Mal, nur um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Was also sollte er tun?
Abwarten und Gefahr laufen, dass Archäologen einer fernen Zukunft seinen versteinerten Leichnam fanden, wie er auf einem grotesken Fahrzeug saß, das einer ganz offensichtlich ebenso widernatürlichen wie die Gesundheit gefährdenden Art der Fortbewegung diente?
Die Vorstellung war so albern, dass sie ihn nicht nur zum Lachen brachte, sondern auch die Lähmung durchbrach, die von ihm Besitz ergriffen hatte. Er musste hier raus, und wie die Dinge lagen, gab es nur noch einen einzigen Weg. Die Tür war ein massives Stück amerikanischer Handwerkskunst, aber auch nicht so stabil, dass er sich nicht zugetraut hätte, sie mit einem beherzten Stoß aufzusprengen. Mit ein wenig Glück ging es ohne viel Lärm ab.
Thornhill versuchte sich den Burghof wieder in Erinnerung zu rufen. Bis zum Tor waren es nur wenige Schritte, aber er hatte gehört, wie es abgeschlossen wurde, also musste er über die zehn Fuß hohe Mauer steigen. Thornhill traute sich das ohne Weiteres zu, aber es würde schnell gehen müssen, und mit ein wenig Pech konnte er hinterher nicht mehr ins Hotel zurück. Gut, dass er sich schon vor so langer Zeit angewöhnt hatte, nur mit dem allernötigsten Gepäck zu reisen.
Noch einmal tastete er mit der Handfläche über die Tür, visierte die Stelle an, die er für die schwächste hielt, und drehte den Oberkörper, um die Schulter dagegenzurammen. Auf der anderen Seite erscholl ein gedämpftes Klappern, mit dem etwas Schweres zu Boden fiel, und gleich darauf eine erschrockene Stimme, die etwas Unverständliches zischte. Er hatte zu lange gezögert.
Hastig wich er so weit von der Tür zurück, wie es ging – ungefähr eine Handbreit –, und konnte sich in seiner Panik im ersten Moment nicht einmal mehr daran erinnern, in welche Richtung die Tür aufging. Das Messer sprang wie von selbst in seine Hand und klappte auf. Nervös wie er war, fügte er sich an der unglaublich scharfen Klinge selbst einen tiefen Schnitt im Daumen zu, und warmes Blut lief an dem funkelnden Stahl hinab und tropfte zu Boden. Er merkte es nicht einmal.
Stimmen und Lärm wiederholten sich nicht, aber schon im nächsten Moment erzitterte die Tür unter seiner Hand, und das Splittern von Holz erklang. Der helle Streifen war wieder da, wenn auch blasser. Draußen musste es dunkel geworden sein.
Das Splittern wurde lauter, und das gespaltene Ende eines Brecheisens erschien nur wenige Zoll vor Thornhills Gesicht im Türspalt und verbreitete ihn gewaltsam. Dahinter bewegte sich ein riesenhafter Schatten, bei dem es sich nur um den Troll handeln konnte.
Thornhill hob das Messer und musste nachgreifen, weil der Perlmuttgriff glitschig von seinem eigenen Blut war. Etwas Warmes lief klebrig an seinem Handgelenk herab und in seinen Ärmel. Hinter ihm regte sich die Dunkelheit.
Die Tür sprang mit einem erbärmlichen Splittern nicht nur auf, sondern flog mit einem Knall draußen gegen die Wand, der noch am anderen Ende des Viertels zu hören sein musste. Thornhill holte in der Dunkelheit des Fahrradschuppens aus, so weit er konnte. Er gewann noch einmal eine halbe Sekunde, als der Troll zurücksprang, um nicht von der Tür getroffen zu werden, und sogar noch eine weitere, als hinter dem Schatten eine erschrockene Stimme erscholl:
»Um Himmels willen, mach nicht so einen Lärm! Wenn Holmes uns überrascht, bringt uns sein Schläger um!«
Der Troll, der nicht der Troll war, drehte mit einem Ruck den Kopf und sah über die Schulter zurück, sodass Thornhill das Profil des Jungen als schwarzen Scherenschnitt erkennen konnte, der in Fairchilds Begleitung gewesen war.
»Hol die Räder!«, rief Fairchild. »Ich fahre den Wagen vors Tor!«
Matt nickte zur Antwort und drehte den Kopf. Seine Augen wurden groß, als er die schattenhafte Gestalt hinter der Tür bemerkte, hinter der er nur Leere erwartet hatte. Vielleicht sah er auch das helle Rot, das bereits auf der aufblitzenden Klinge leuchtete. Vielleicht wollte er etwas sagen, vielleicht auch schreien, aber Thornhill und die Dunkelheit hinderten ihn an allem und auch daran, weiterzuleben, indem er ihm mit einer hundertfach geübten Bewegung die Kehle aufschlitzte. Mit dem anderen Arm griff er nach seiner Hand, die das Brecheisen hielt, und zerrte ihn mit einem Ruck zu sich herein, wobei er das Bein so anwinkelte, dass das Brecheisen gegen seinen Oberschenkel prallte und nahezu lautlos daran zu Boden rutschte, statt zusätzlichen Lärm zu verursachen. Matts begonnener Schrei wurde zu einem nassen Blubbern, mit dem er Thornhills Brust und Gesicht mit warmer Nässe vollspritzte. Im Todeskampf bewies er, dass er noch stärker war, als Thornhill ohnehin schon angenommen hatte, indem er trotz seiner tödlichen Verletzung beide Hände um seinen Hals schlang und mit furchtbarer Kraft zudrückte.
Einer Kraft, der Thornhill nichts entgegenzusetzen hatte und es auch gar nicht wollte.
Er hatte genügend Erfahrung in seinem Werk, um rechtzeitig den Kopf zu drehen, sodass ihm diese entsetzlich starken Hände weder den Adamsapfel zerquetschten noch seine Halsschlagadern zudrückten und damit die Blutzufuhr zu seinem Gehirn unterbrachen, woraufhin er binnen weniger Augenblicke das Bewusstsein verloren hätte. So nahmen sie ihm nur den Atem – was nebenbei bemerkt enorm wehtat – und drückten ihn mit sogar noch mehr Gewalt nach hinten und gegen die Fahrräder.
Aber diese ungestüme Kraft floss auch mit jedem rasenden Schlag seines Herzens in roten Geysiren aus ihm heraus, und was noch davon da war, darauf stürzte sich die Dunkelheit, die mit einem lautlosen Triumphgebrüll endgültig ihre Ketten sprengte und vom Grunde seiner Seele emportauchte, um ihre Krallen in diesen köstlichen Quell süßer Jugend zu schlagen.
Es war eine solche Verschwendung! All die ungezählten Jahre des Lebens, die dieser starke junge Körper noch vor sich gehabt hätte, jeder einzelne Herzschlag und jeder lustvolle Moment, den er nun nicht mehr erleben würde, flossen jetzt ungenutzt aus ihm heraus. Sie besudelten Thornhills Gesicht und seine Hände und sammelten sich in einer dampfenden roten Pfütze am Boden, und von all den ungezählten Jahren, die er seiner eigenen Lebensspanne hätte hinzufügen können, blieben ihm nunmehr Monate, wenn nicht gar Wochen. Er nahm sie, tauchte Hände und Gesicht in das warme Blut und sog jede Sekunde verbliebener Lebenszeit gierig in sich auf.
Thornhill spürte die neue Kraft, die ihn durchströmte, Tage, Wochen und vielleicht Monate, die er seine eigene Lebensuhr zurückdrehen und wieder an Jugend gewinnen würde.
»Ich bin so weit«, drang Fairchilds Stimme durch die offenstehende Tür herein. »Wo bleibst du, verdammt? Holmes ist nicht dumm!«
Matts Griff um seinen Hals lockerte sich und erschlaffte dann ganz. Das Licht in seinen Augen erlosch endgültig, und auch in ihm war jetzt nichts mehr als Leere.
Thornhill konnte jetzt wieder atmen, aber es kostete ihn trotzdem unerwartet viel Kraft, die Finger des toten Jungen von seinem Hals zu lösen und ihn fast behutsam zu Boden gleiten zu lassen. Eine große Ruhe überkam ihn, und auch das Gefühl der Enttäuschung erlosch. Er hatte nur Monate erbeutet, statt Jahre oder gar Jahrzehnte, worauf er gehofft hatte. Doch was machte das schon? Dort draußen wartete eine ganze Stadt darauf, geerntet zu werden!
»Matt, verdammt!«, rief Fairchild.
»Ich komme«, antwortete Thornhill im gleichen, nuscheligen Flüsterton. Weil er es sich – ohne sich jemals selbst gefragt zu haben warum – schon vor Jahren zur Angewohnheit gemacht hatte, schloss er die Augen des Toten, wischte die blutige Klinge des Rasiermessers an dessen Kleidung ab und ging dann noch einmal in die Hocke, um die Schlägerkappe des Jungen aufzuheben.
Nachdem er sie aufgesetzt und den Schild weit nach vorne ins Gesicht gezogen hatte, befreite er mit einiger Mühe eines der verkeilten Velos aus der Masse der anderen Fahrräder und wuchtete es durch die schmale Tür. Das Tor stand jetzt wieder weit offen. Davor hatte ein einspänniger offener Karren angehalten. Fairchild kletterte gerade vom Kutschbock, nicht mehr in feinen Zwirn gehüllt, sondern in ebenso schweren Arbeiterkleidern, die auch sein Gehilfe trug. Er wirkte sehr nervös.
»Verdammt, Matt, trödle nicht rum!«, polterte er. »Wenn uns jemand sieht, ist der Teufel los!«
Ob er wohl ahnte, wie recht er damit hatte? Bei dem Gedanken musste sich Thornhill beherrschen, um nicht aufzusehen und ihn anzulächeln; vielleicht einen letzten Blick in seine Augen zu erhaschen, die er gleich ebenfalls schließen würde.
Stattdessen beugte er sich noch tiefer über den Lenker des Fahrrads und schob es rasch aus dem Tor. Eine Windböe schlug ihm ins Gesicht und brachte nicht nur die Kühle der herannahenden Nacht mit sich, sondern auch den üblen Geruch der Stadt, der sogar noch schlimmer geworden zu sein schien.
Die windige Stadt, dachte Thornhill und meinte ein leises, unendlich böses Lachen tief vom Grunde seiner Seele heraufwehen zu hören. Bald würden sich die Bürger Chicagos wohl einen neuen Namen einfallen lassen müssen.
Sie wussten es noch nicht, aber der Tod war in ihre Stadt gekommen.
WENDIGO
Thornhill war ungefähr zwölf, als er dem Dämon begegnete, der sein Leben so gründlich verändern sollte und das so vieler anderer beenden. Aber daran hätte er in diesem Moment nicht einmal einen Gedanken verschwendet, selbst wenn er gewusst hätte, was für ein aufregendes und vor allem endloses Leben vor ihm lag. Er rechnete nicht damit, dass es noch länger als nur wenige Augenblicke dauern würde. Vielleicht war es auch schon zu Ende und er in der Hölle.
Rings um ihn herum wütete das Chaos. Rauch und der Gestank von glühendem Metall und brennendem Fleisch erfüllten die Luft und machten jeden Atemzug zur Qual. Flammen schlugen mit rotglühenden Pranken nach ihm, versengten seine Kleider, sein Haar und sein Gesicht. In seinen Ohren gellten das Knattern von Schüssen und ein Chor verzweifelter Schmerzens- und Angstschreie, und das nicht enden wollende Krachen der Kanonen. Erdbrocken, glühende Metallsplitter und abgerissene Körperteile regneten vom Himmel oder trafen ihn wie die Schläge starker, weicher Fäuste. Er schmeckte Rauch und Blut tief in seiner Kehle; vielleicht sein eigenes, vielleicht das eines anderen.
Dabei hatte Thornhill – der damals noch Boy hieß, nicht weil das sein richtiger Name gewesen wäre, sondern weil er der Jüngste seiner mittlerweile übel zusammengeschossenen Einheit war – gehofft, es wäre vorbei. Und nach dem drei Tage währenden Blutbad von Gettysburg hatte es für einige wenige Tage tatsächlich auch so ausgesehen, als hätte der Krieg mit einem Paukenschlag geendet, nun, wo eine ganze Generation auf den Feldern und Hügeln lag und verblutete. Die Heere hatten sich zerstreut, der Rauch sich verzogen, und die Schreie waren verklungen. Wer die Apokalypse irgendwie überlebt hatte, der verkroch sich in einen Winkel, leckte seine Wunden und betete zu Gott oder sonst wem, dass es endgültig vorbei sein möge.
Aber das war es nicht.
Weder Boy noch einer der anderen Männer seiner Einheit, die im Laufe des vergangenen Jahres zu seiner Familie geworden waren, hatten es laut ausgesprochen. Aber jedem war klar gewesen, dass nicht nur das Schicksal und die Willkür des Zufalls allein dafür gesorgt hatten, dass sie vom Hauptteil der Leute getrennt worden waren, die von Pickets unglückseliger Brigade noch übrig waren. Und so mussten sie einen gewaltigen Umweg in Kauf nehmen, um sich Lees flüchtender Armee wieder anzuschließen. Ein Marsch von fünfzig, sechzig oder auch noch mehr Meilen, um den Unionspatrouillen auszuweichen, die Jagd auf versprengte Überlebende machten. Ein Gewaltmarsch, ja, aber einer, den ihnen ihr Captain als Alternative dazu geschenkt hatte, erschossen zu werden.
Jetzt wurden sie erschossen, die, die Glück hatten. Der Himmel erbrach Feuer und glühendes Metall. Kanonenkugeln pfiffen, und das zornige Hornissenschwarm-Geräusch von Musketenkugeln und Kartätschen war zu hören. Die Schreie sterbender und verwundeter Männer, und ein immer weiter anschwellendes allgemeines Tosen und Kreischen ohne eine klar erkennbare Quelle, als schrie die Schöpfung selbst unter dem Irrsinn, der ihr angetan wurde.
Manche der Männer, die vor seinen Augen in Stücke gerissen wurden, waren seine Freunde gewesen, hatten ihn gutmütig gefoppt oder auch in die Arme genommen, wenn alles zu viel und er in der Hölle der Schlacht wieder zu dem Kind wurde, das er niemals hatte sein dürfen. Sie hatten ihm seinen ersten Schnaps zu trinken gegeben und Wetten darauf abgeschlossen, wie seine Unterhose gleich aussehen würde, als sie ihm seine erste Zigarre zu rauchen gaben.
Jetzt wurden die lachenden Gesichter aus seiner Erinnerung vor seinen Augen von Schrapnells in roten Brei verwandelt, von Bajonetten aufgeschlitzt und von Kanonenkugeln zu rotem Dunst gemacht. Von den ursprünglich achtundzwanzig Mann (und einem Jungen) seiner Einheit waren sechs schon der ersten, überraschenden Salve der verdammten Abolitionisten zum Opfer gefallen, tot oder dergestalt verletzt und verstümmelt, dass sie die Toten um die Gnade eines schnellen Sterbens beneideten. Die Übriggebliebenen wurden in diesem Moment, einer nach dem anderen, geschlachtet, und er konnte rein gar nichts dagegen tun. Das alles war ganz allein seine Schuld.
Natürlich nicht wirklich. Selbst der weinende Zwölfjährige, in den er sich wieder zurückverwandelt hatte, als ihn die Kugel traf und das Töten und Getötetwerden begann, wusste, dass sie in einen wohlvorbereiteten Hinterhalt gelaufen waren. Aber was nutzte alle Logik der Welt, wenn er dabei zusehen musste, wie seine Freunde – seine Familie – vor seinen Augen abgeschlachtet wurden wie Vieh, das noch dazu freiwillig ins Schlachthaus marschierte. Ein Teil von ihm beharrte darauf, dass es seine Schuld war. Er hätte die Falle bemerken müssen, hätte schneller sein sollen, sodass nichts von alledem geschehen wäre, wenn er sich auch nur ein bisschen mehr beeilt hätte. Wenn er nur eine Winzigkeit weniger herumgetrödelt oder wenigstens seine Muskete mitgenommen hätte, um diese verdammten Sklavenfreunde einen nach dem anderen zu erschießen.
Von seinem Versteck auf der Kuppe des mit dornigem Gebüsch bewachsenen Hügels aus konnte er den Hinterhalt sehen: drei Kanonen – zwei Vier- und eine Sechspfünder –, die ihre Ladungen mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks so dicht über den Hügel hinweg abfeuerten, dass er sich einbildete, die Schleppe aus heißer Luft zu spüren, die sie hinter sich herzogen, und mindestens zwei Dutzend Pferde, eines davon mit dem verhassten Sternenbanner anstelle einer Satteldecke sowie drei von Ochsen gezogene Planwagen. Eine richtige kleine Armee, gegen die sie nicht einmal, erschöpft und am Ende ihrer Munition und Vorräte, in einem fairen Kampf eine Chance gehabt hätten.
Aber diese Chance hatten ihnen die verdammten Niggerfreunde natürlich nicht gegeben.
Trotz seiner jungen Jahre, und Gettysburg war zugleich seine Feuertaufe gewesen, erkannte er, wie hinterhältig und feige die Falle war – dazu musste man kein strategisches Genie sein. Die Kanonen waren gut getarnt und schossen nicht auf Sicht, sondern in einer ballistischen Bahn über den Hügel hinweg. Er vermutete, dass es etlicher Probeschüsse bedurft hatte, um die Geschütze entsprechend auszurichten und die Stärke der Treibladungen zu bestimmen. So wie das Lager aussah – eine ganze Anzahl großer Feuerstellen, mit Zweigen überdachter Schlafplätze und sogar ein kleines, abseits gelegenes Latrinenzelt –, befanden sie sich schon eine ganze Weile hier. Möglicherweise waren er und seine Kameraden nicht einmal die Ersten, die in diesen Hinterhalt tappten. Wahrscheinlich sogar.
Und dennoch war es ganz allein seine Schuld. Captain Spars hatte ihn vorausgeschickt, um das Gelände zu sichern, wie er es immer tat, wenn er glaubte, dass keine Gefahr bestand. Dieser mit halb verdorrtem, dornigem Gestrüpp bewachsene Hügel war ihm als Aussichtspunkt gerade richtig vorgekommen. Also war er vorausgerannt und hatte sich Hände und Gesicht zerschrammt und seine ohnehin zerfetzte Jacke noch ein bisschen weiter ruiniert, um sich einen Weg auf die kaum sechzig Fuß hohe Kuppe zu bahnen.
Er hätte es sehen müssen. Wahrscheinlich war er auf Armeslänge an einem dieser verdammten Feiglinge vorbeimarschiert, die sich im Gebüsch versteckt und auf ihre ahnungslosen Opfer gewartet hatten. Wäre er nur einen Schritt weiter nach rechts oder links gegangen und hätte er seine Muskete mitgenommen und auch nur einen einzigen Warnschuss abgegeben …
Gar nichts hätte sich geändert, beharrte sein Verstand. Der erste Schuss war gefallen, kaum dass er hier oben angekommen war und den Hinterhalt erblickte. Die Kugel hatte ihn in die Brust getroffen und auf den Rücken geworfen. Dieser erste Schuss hatte das Tor zur Hölle aufgestoßen: Pulverdampf und rotes und orangefarbenes Mündungsfeuer explodierten aus der dornengespickten Flanke des Hügels. Kanonen brüllten auf und verschlangen mit ihrem Donner die Schreie der überraschten Männer. Und noch während er verzweifelt darum rang, bei Bewusstsein zu bleiben und das Atmen wieder zu lernen, wurde ihm klar, dass dieser erste Schuss das Signal für die Kanoniere gewesen war, ihre Geschütze abzufeuern; ganz egal, ob er auf ihn oder von ihm abgegeben worden wäre.
Sein Kampf gegen das Ersticken wurde immer mühsamer. Die Kugel hatte seine Brust nur ein Stück neben dem Herzen getroffen, und er wunderte sich fast ein bisschen, dass er überhaupt noch am Leben war. Aber wie lange würde das wohl noch so bleiben? Jeder einzelne Atemzug bereitete ihm Qual, und ein unsichtbarer Reifen aus Stahl hatte sich um seine Brust gelegt und zog sich unbarmherzig weiter zusammen. Das Blei mochte sein Herz verfehlt haben, aber wenn kein Wunder geschah oder er gar das Bewusstsein verlor, sodass er sich nicht mehr zu jedem einzelnen qualvollen Atemzug zwingen konnte, würde er ersticken.
Fast wünschte er es sich. Mit seinen – geschätzten – zwölf Jahren war Boy trotz allem noch viel zu jung, um sich ernsthafte Gedanken über den Tod gemacht zu haben, auch wenn er seit Monaten zu seinem treuen Begleiter geworden war. Aber über das Sterben schon. Er hatte genug Männer elendiglich zugrunde gehen sehen, verbrannt vom Fieber und ausgezehrt vom Wundbrand oder schreiend um den Tod bettelnd, während ihnen ein Feldscher bei vollem Bewusstsein die Gliedmaßen absägte.
Aber dieses Schicksal würde ihm wohl erspart bleiben. Er hatte keine großen Schmerzen. Die Kugel hatte ihn auf den Rücken geworfen, und aus irgendeinem Grund konnte er sich immer noch nicht bewegen und war wie gelähmt. Aber der Treffer selbst hatte kaum mehr geschmerzt als ein – sehr harter – Faustschlag. Aber er würde verbluten, das war klar, wenn die verdammten Blauen nicht hinterher das Schlachtfeld abschritten und mit ihren Bajonetten dafür sorgten, dass es auch wirklich keine Überlebenden gab; eine Praxis, die ebenso hartnäckig von beiden Seiten abgestritten wie praktiziert wurde.
Aber er war guter Dinge, lange zuvor zu verbluten. Er hatte gehört, dass es eine angenehme Art sein sollte, zu sterben. Ein bisschen wie Einschlafen, nur dass man nie wieder wach wurde.
Er schlief auch ein, aber er wachte wieder auf, nicht von Kanonendonner und dem Getöse der Schlacht geweckt, sondern dem Gegenteil, einer Stille, die so tief war, dass sie in den Ohren dröhnte. Er lebte noch, sein Herz schlug noch, und er konnte noch atmen, auch wenn das Luftholen immer noch erbärmlich wehtat.
Es war auch nicht vollkommen still. Laute drangen an sein Ohr, die er eigentlich erkennen sollte, es aber nicht tat, und irgendwo sehr weit entfernt war ein dumpfes Grollen zu vernehmen, vielleicht ein Gewitter, vielleicht auch das Echo einer weiteren Schlacht. Aber er lebte noch.
Wieso eigentlich?
Nachdem er eine Weile in einen wolkenlosen Himmel geblinzelt hatte, der nur dazu erschaffen worden zu sein schien, ihn zu verspotten, hob er die Hand und tastete vorsichtig nach seiner Brust. Es tat weh, aber er fühlte kein Blut, nur etwas Hartes und Verbranntes, und als er an sich hinabsah, erblickte er auch kein Blut. Direkt über seinem Herzen prangte ein rundes Loch mit ausgefranst-verbrannten Rändern in seiner Jacke. Aber kein Blut.
Behutsam setzte er sich auf, verzog die Lippen, als sofort ein noch schmerzhafterer Stich durch seine Brust jagte, und atmete scharf ein. Er hatte Angst davor, die Jacke aufzumachen, tat es aber trotzdem und sah auch darunter kein Blut, sondern nur die zerlesene Bibel, die er zusammen mit einer Feldflasche, dem Pulverhorn und der Muskete am ersten Tag als Grundausstattung bekommen hatte. Nichts davon war neu gewesen, und zumindest die Bibel hatte ihrem Vorbesitzer wohl kein Glück gebracht, denn ein Großteil der Seiten war mit eingetrocknetem Blut verklebt. Boy hatte sich nie die Mühe gemacht, sie zu lösen. Er hatte mit Religion nur so viel am Hut, den sonntäglichen Gottesdienst zu besuchen, weil es manchmal eine Extraration Essen gegeben hatte, die er sich natürlich nicht entgehen ließ. Aber vielleicht sollte er diese Einstellung noch einmal überdenken, denn die blutige Bibel hatte ihm ganz eindeutig das Leben gerettet.
Das Buch sah so aufgequollen aus, als hätte es eine Woche im Wasser gelegen. Aber es war trocken. Auseinandergesprengt hatte es eine daumennagelgroße Kugel aus Blei, die seine Jacke und einen Großteil der Seiten zerrissen und dasselbe mit seinem Herzen vorgehabt hatte, bevor sie von Gottes eigenem Wort aufgehalten worden war.
Ungläubig lugte er unter sein Hemd und sah einen gerade erst im Entstehen begriffenen Bluterguss, der sich nicht nur so anfühlte, als hätte ihn ein Pferd getreten, sondern lustigerweise auch so aussah. Boy tastete mit spitzen Fingern danach, was mit so heftigen Schmerzen belohnt wurde, dass ihm die Tränen über das Gesicht liefen. Aber er hörte trotzdem erst auf, als er sicher war, dass ihm die Kugel keine Rippe gebrochen hatte. So harmlos es klang, auch das konnte tödlich sein. Er hatte es schon mitangesehen.
Eigentlich ohne genau zu wissen warum, steckte er die zerfetzte Bibel wieder ein und nahm all seinen Mut zusammen, um sich in eine halb gebückte Haltung hochzustemmen. Die Schlacht war vorüber, aber er wagte es nicht, mehr als einen flüchtigen Blick hinter sich zu werfen, sondern sah in die andere Richtung, wobei er sich hütete, den Kopf zu weit über das Gewirr aus trockenen Büschen und Dornengeäst zu heben. Er glaubte nicht, dass ihm die alte Bibel ein weiteres Mal das Leben retten würde.
Die Geräusche fielen ihm wieder ein, die ihn geweckt hatten, und nun erkannte er auch ihren Ursprung: Die Schlacht war offensichtlich vorbei, denn die Soldaten sammelten sich in ihrem Lager auf der anderen Seite des Hügels und waren bereits im Aufbruch begriffen. Gut die Hälfte war schon aufgesessen, und die anderen taten es nicht nur in diesem Augenblick, sondern schienen es auch ausgesprochen eilig zu haben. Boy sah jetzt, dass es sogar noch mehr Männer waren, als er befürchtet hatte, mindestens drei Dutzend, wenn nicht vier. Aber sie waren auch in keinem guten Zustand. Ihre Kleider wirkten abgerissen, Waffen und Ausrüstung ungepflegt, und man sah ihnen ihre Erschöpfung an. Viele trugen Verbände. Boy hoffte, dass sie von der vorausgegangenen Schlacht mit seiner Einheit stammten.
Aber er fragte sich auch, warum sie ihren Sieg nicht genossen, sondern schon wieder auf dem Weg waren, um vielleicht die nächste Gruppe armer Hunde zu überfallen, die nichts anderes wollten, als am Leben zu bleiben.
Vielleicht waren sie ja auch auf der Flucht, so eilig, wie sie es zu haben schienen. Die Ersten sprengten bereits los und fielen in einen raschen Galopp, noch bevor die Letzten überhaupt aufgesessen waren, und Boy fiel jetzt auch auf, dass sie tatsächlich alle aufzubrechen schienen. Zelte, Planwagen und selbst die kostbaren Geschütze blieben unbeachtet zurück, und das war nun wirklich außergewöhnlich. Wenn die Blauen auch nur im Entferntesten so waren wie die richtigen Soldaten von der Konföderation, dann wurde wertvolles Material bei ihnen allemal höher eingeschätzt als das Leben gemeiner Soldaten.
Boy sah mit angehaltenem Atem zu, wie sich die Männer entfernten. Er war misstrauisch genug, noch einmal gute fünf Minuten zuzugeben, bevor er es wagte, sich ganz aufzurichten. Er wäre nicht überrascht gewesen, hätte man sofort wieder auf ihn geschossen, was aber nicht geschah. Das Lager lag verlassen da, aber, wie er auf den zweiten Blick erkannte, nicht aufgegeben. Abgesehen von ihren Waffen hatten die Soldaten nichts mitgenommen. Boy überlegte einen Moment, hinunterzugehen und sich eine Waffe zu besorgen – ein Messer, ein Bajonett, vielleicht ein vergessenes Gewehr oder einen Revolver –, aber dann sagte er sich selbst, wie lächerlich das war. Wenn die Soldaten zu einem weiteren Überfall aufgebrochen waren und zurückkamen, würde ihm eine Waffe rein gar nichts nutzen, und wenn sie geflohen waren, dann brauchte er sie nicht.
Also wandte er sich um und ging den Weg zurück, den er heraufgekommen war. Auch wenn ihm die Vorstellung, was er dort unten finden mochte, eindeutig sogar noch mehr Angst machte.
Und wie sich zeigte, zu Recht.
Der Platz war nicht wiederzuerkennen. Aus einer grünen Prärie mit vereinzelten Bäumen und Büschen war eine Kraterlandschaft geworden, über der noch immer der Gestank des Todes hing. Überall lagen Leichen, die meisten im Grau oder improvisierten Zivil der Konföderierten, aber manche auch im verschossenen Blau der Unionstruppen, und das war etwas, das Boy nun wirklich überraschte und auch zornig machte. Sie hatten nicht einmal ihre eigenen Toten mitgenommen, und das gehörte sich nicht.
Gleich welche Überwindung es ihn kostete, zwang er sich doch, die Toten einen nach dem anderen zu untersuchen, und es war genau so, wie er es erwartet hatte: Es gab keine Überlebenden. Wer nicht im Kampf gefallen war – was auf die meisten zutraf –, den hatten sie hinterher getötet, mit Messern oder Bajonetten, um wertvolle Munition zu sparen. Etliche erkannte er nur noch an ihren Kleidern, und sämtliche Leichen waren gefleddert worden, bis hin zu Schuhen, Koppeln und Jacken.
Auf eine gewisse Weise waren die nächsten Minuten schlimmer als die Hölle von Gettysburg. Diese drei Tage waren die Apokalypse gewesen, eine Sturmflut aus Fleisch, die sich in immer neuen Wellen brach und nur aus Lärm, Entsetzen und Feuer und Schreien und dem Donner der Geschütze bestand und in der der Tod so überreichlich Ernte hielt, dass man Angst haben konnte, seine Sense würde stumpf.
Hier herrschte das Gegenteil, aber es war nicht besser. Der Gestank des Schlachtfeldes lag über dem Land. Schießpulver und Exkremente und Blut und verbranntes Fleisch und noch hundert andere Dinge, von deren Existenz er bis vor drei Tagen noch nicht einmal etwas geahnt hatte. Es hätte – wenn auch vielleicht auf eine grausame Art – friedlich sein sollen, aber das Gegenteil war der Fall: Feindseligkeit und Mord waren noch da, nur unsichtbar und lauernd, wie eine gefräßige Spinne, die sich in den Schatten verkrochen hatte und geduldig auf eine Gelegenheit zum Zuschlagen wartete.
Der Gedanke war absurd, passte nicht zu ihm und war einfach nur lächerlich. Er machte ihm so große Angst, dass er an sich halten musste, um nicht auf dem Absatz herumzufahren und schreiend davonzulaufen.
Stattdessen zwang er sich, eine zweite Runde über das Schlachtfeld zu gehen, und sei es nur, dass er doch noch etwas Nützliches fand, das ihm das Überleben oder doch wenigstens das Fortkommen von hier sicherte. Und so stieß er schließlich doch auf einen Überlebenden.
Auch wenn es der Falsche war.
Das Schlachtfeld war erschreckend klein, gerade einmal ein paar Dutzend Schritte im Durchmesser, was bewies, wie effektiv die Falle gewesen und wie schnell der Tod über seine Kameraden gekommen war. Der Überlebende lag in einem flachen Krater, den eine explodierende Kanonenkugel ins weiche Erdreich gerissen hatte. Boy musste sein Gesicht nicht sehen, um zu wissen, dass es keiner seiner Kameraden war, denn er trug das verhasste Blau der Abolitionisten, dort, wo es nicht vom Rot und Braun und Schwarz dessen besudelt wurde, was von seinem Leib übrig war, nachdem eine Kanonenkugel oder etwas mit vergleichbarer Zerstörungskraft versucht hatte, sein Innerstes nach außen zu stülpen. Und es war nicht einfach nur ein feindlicher Soldat, sondern zu allem Überfluss auch noch ein verdammter Nigger.
Nicht genug, dass jeder, den er gekannt und geliebt hatte, verblutet und in Stücke gerissen vor ihm lag. Nein, das Schicksal erlaubte sich auch noch eine besondere Grausamkeit, indem es ihm nicht nur einen Unionssoldaten als einzigen Zeugen an die Seite stellte, sondern auch noch einen verfluchten Sklaven. Konnte es noch schlimmer kommen?
Die Antwort lautete eindeutig ja, denn in diesem Moment hob der Verwundete den Kopf, drehte das blutige Gesicht in seine Richtung und versuchte etwas zu sagen, brachte aber nur ein nasses rotes Blubbern zustande. War das vielleicht die besonders hinterhältige Grausamkeit des Schicksals, dass seine letzte Erinnerung an seine ermordeten Freunde ausgerechnet die an einen dieser verfluchten Affenmenschen sein sollte, die letzten Endes die Schuld an diesem Krieg trugen, der seine Heimat verheerte?
»Hilf … mir«, flehte der Sterbende.
Zorn ergriff Boy, ein kalter, mörderischer Zorn, auf den es nur eine einzige mögliche Antwort gab, sodass er sich nach einem faustgroßen Stein bückte und ihn aufhob.
Dann erkannte er seinen Irrtum: Das Gesicht des Sterbenden war zwar dunkel, aber nicht schwarz. Unter dem zerfetzten Käppi quoll nicht nur Blut in Strömen hervor, sondern auch die verklebten Strähnen glatter Haare von einem so tiefen Schwarz, dass es beinahe blau schimmerte. Etliches von dem, was er für Brandspuren oder dunkel eingetrocknetes Blut gehalten hatte, gehörte zu einer komplizierten Tätowierung, die das Gesicht in eine grimmige Dämonenmaske verwandelte. Augen so schwarz wie Kohle und eine Nase wie eine Axtklinge machten den Schock komplett, und nun wurde aus seinem Groll gegen das Schicksal etwas Schlimmeres, für das er nicht einmal ein Wort hatte. Es war kein Nigger, der sein bisheriges Leben zu Grabe tragen würde, sondern etwas Schlimmeres, eine verfluchte Rothaut und nicht einmal ein richtiger Mensch.
Und schlimmer noch: Der sterbende Indianer starrte ihn nicht nur an, er stemmte sich mit unglaublicher Kraft ein Stück in die Höhe und streckte den Arm nach ihm aus, und das war eindeutig zu viel. Boy war mit einem einzigen Satz bei ihm, fiel auf die Knie und riss den Arm mit dem Stein in die Höhe, um sein bemaltes Gesicht endgültig zu Brei zu schlagen, und der Indianer flehte noch einmal:
»Hilf … mir.«
Boy hob die Hand sogar noch höher, und seine Finger schlossen sich noch fester um den Stein. In diesem Moment drehte sich der Indianer ein Stück weiter auf die Seite, und er sah, was die Kanonenkugel seinem Körper wirklich angetan hatte, und erstarrte. Es war unmöglich. Der Indianer konnte nicht mehr leben.
Aber er tat es, starrte ihn aus Augen an, in denen ein Schmerz und eine Furcht jenseits aller Vorstellungskraft geschrieben standen, und wimmerte sogar noch einmal:
»Hilf … mir. Bitte. Ich … habe Durst.«
Statt zuzuschlagen (was vermutlich eine Gnade gewesen wäre), ließ Boy den Arm sinken, und den Stein schließlich fallen. Er starrte den zerfetzten Leib des Indianers an und fragte sich immer wieder und immer wieder vergebens, wie es sein konnte, dass er noch lebte und mit ihm sprach.
»Wasser«, flehte der Indianer. »Bitte, ich … ich habe solchen Durst.«
Boy starrte weiter seinen Bauch an und (großer Gott, tatsächlich durch ihn hindurch!) dann wieder in diese entsetzlich leidenden Augen. Statt den Stein wieder aufzuheben, tastete seine Hand nach der Wasserflasche an seinem Gürtel. Da war etwas, das er gehört hatte, etwas über Wasser und Bauchschüsse, und dass man einem dergestalt Verwundeten auf gar keinen Fall zu trinken geben durfte.
Andererseits bezweifelte er, dass das auch für Bauchschüsse mit einer Kanone galt.





























