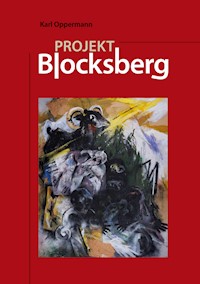Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Erinnerungen des Malers Karl Oppermann
- Sprache: Deutsch
Zunächst als schlichtes Erlebnisbüchlein für die Söhne geschrieben, sind die Feuilletons zu einem lebendig geschilderten Zeitzeugnis geraten. Meist heitere Begebenheiten ordnen sich zu einem Mosaik und geben einen Ausschnitt von den Jugendjahren in seiner Geburtsstadt Wernigerode bis zu Arabesken des Kunst-Aktionismus West-Berlins, den Autor in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hautnah miterlebte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Söhne Daniel, Karl Felix und Mauritz Henrich
Inhaltsverzeichnis
Harzer Käse
Schlachtfest
Unser Naturgarten
Das Cornet
Haarsträubend
Au Backe!
Penne I
Motive
Deutschland – heiliges Wort
Kehrt Marsch
Grenznähe
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein
Penne II
Weichenstellung
Hinter den Kulissen
Trainingseinheiten
Medizin und Anatomie
Wegkreuze
Angekommen
Die zweite Runde
Rochade
Auf Reisen
Im Bildhauer-Atelier
Guten Morgen Herr Klepp
Szenenwechsel: Elßholzstraße
1954
Am Steinplatz
Das deutsche Wirtschaftswunder …
Family
Duisburger Straße
Bundesratufer 1
Die Milchkuh
Zunge in Sahnesoße
Szene
Postkunst
Altea
1964
Moabit
Das Institut
Caràcas, Bogotá, Via Corta
Verband, Verein, Gruppe
Personenregister
Harz-Käse
Die farbenfrohen Straßen scheinen zuweilen bis zum Gebirge hochzuklimmen. Und ist es nicht so, als hätte der freundliche, helle Geist der waldblauen Berge das Städtchen gesegnet und mit spielerischer Anmut gekrönt? So schwärmt Hermann Löns von Wernigerode. Ein hartes Stück Arbeit, diese Süsse zu neutralisieren, dem Pathos eines auf die Hörner zu geben, den Postkartenkitsch halbwegs auszuradieren.
Lange Zeit drücke ich mich, das Quietschgrün der Landschaft zu malen, diese scheußlich schön hingetupften Ziegeldächer in den Griff zu bekommen, mogele mich vorbei an luftigen Höhen und dem silberhellen Plätschern der Bergbäche, suche keinen dunkelblauen Tann, lasse Bock Bock und Kitz Kitz sein, bis mir eines alten Tages die “Stipstöberken”, “Vertellerken”, Geschichten wieder einfallen. Plötzlich stehen die Bilder meiner Jugendjahre wie im Hohlspiegel da, überhöht, ungestüm verzeichnet in ihrer so gar nicht kleinbürgerlichen Harmlosigkeit; einfach grotesk.
So wage ich mich denn – nach 40 Jahren – an meine Harzreise, male großformatig den Feinkostladen voll traurig herumhängender toter Hasen und die Preisverleihung im Kurhaus mit dem lebenden Ferkel als Hauptgewinn. Das “Große Halali” und die ‚”Mädchen mit Hasen”. “Das Hirschebrüllen” geht auf eine Geschichte zurück, die für den hintersinnigen Humor der Harzer kennzeichnend ist: Nante Ramme, der Wirt vom Gasthaus “Zur Tanne” lockt die Sommerfrischler mit dem Reklameschild: “Heute wieder großes Hirschebrüllen” Dann also müssen wir Bengel, in einer nahen Schonung versteckt, auf alten Gießkannen röhren,
Hirsche mimen, die Fremden das Fürchten lehren.
“Gefährlich ist’s, den Leu zu wecken, den Tiger scheiten ist ‘ne Kunst, doch den Hersch am Schwanze trekken makt keiner in der Hersche Brunft.”
Manchmal nimmt tatsächlich ein Platzhirsch die Gießkanne an, bricht röhrend durchs Unterholz, und die Fremden haben ihr Gruselerlebnis. Furcht wird bekanntlich mühelos mit Schnaps und Bier bekämpft. So werden neue Gäste geworben für Schmalzstullen und Harzer Käse und für Nante Rammes gefährlichen Jagdtrunk. Dazu natürlich das gute Auerhahn-Bier. Es ist wegen des reinen Quellwassers, aus dem es gebraut wird, besonders appetitlich. Frisch läuft Glas auf Glas durch die Kehle, bis Schleier die Seele umhüllen wie Regenwolken den Vater Brocken. Leider haben wir Jungs Angst vor all den Betrunkenen und pinkeln wütend an das Wasserreservoir der Brauerei; doch der Bierausstoß ist so gewaltig, daß die geringe Geschmacksabweichung gänzlich unbemerkt bleibt.
Im Kurhaus werden große Feste und Gesellschaften veranstaltet. “Schwarze Röcke, seidne Strümpfe, weiße, höfliche Manschetten, sanfte Reden, Embrassieren, - ach, wenn sie nur Herzen hätten‚ “heißt es mit Recht in Heinrich Heines Harzreise.
Nicht offene Herzen und Sinnesfreuden treiben die Einheimischen auf den Tanzboden, sondern Langeweile und Neugier, vor allem aber ein Übermaß an frischer Luft ist zu kompensieren. Die Sicherheit, auf glattem Parkett Figur zu machen, vermittelt die Tanzschule Lillig. “Gestatten, darf ich mit Ihrer Dame tanzen?” ”Darf ich zum langsamen Walzer bitten …?” Es folgt der Ohrwurm “Hörst Du mein heimliches Rufen”. Alle Gäste beherrschen die gleichen Floskeln dank Frau Lillig, einer taftraschelnden Bohnenstange, deren Lebensinhalt es ist, Generationen von Provinztölpeln und Landpomeranzen gesellschaftlichen Schliff beizubringen.
Eine ihrer besonders eindrucksvollen Unterweisungen ist der Handkuß. Dabei ergreift der Herr die Rechte der Dame, als würde er sie schütteln wollen, muß aber blitzschnell entscheiden, ob die galantere Begrüßung erwünscht ist. Wenn ja, haucht er auf den Handrücken, schüttelt leicht ab und sucht unmittelbar danach den sogenannten Augenkontakt. Diese galante Prozedur vermittelt den Charme unbeholfener Wohlerzogenheit, von der ich noch manches Jahr zehre.”Hätten Sie Lust, ein Glas Champagner zu nehmen”? Im Kurhaus wird feine Welt gespielt. “Heidsiek-Monopol” merkt sich bereits das Häkchen, bevor es ein Haken wird.
Papa hat Frau Lilligs Tanzstunde nie besucht. Er ist auf Bellen auch nur zu einem Walzer zu bewegen. Dafür wirkt er im Hintergrund als Organisator und auf der Bühne als Maitre de plaisir. Zu Kostümfesten können wir ihn in makellosem Smoking mit weißgoldenem Turban bewundern.
Wenn in der Sommersaison nicht gerade ein bunter Abend mit Verlosung auf dem Programm steht, wird auf rosenumrankter Tanzfläche im Freien geschwoft, aus der Musikmuschel tönt Rudi Beckers Salon-Orchester: “Mausy, süss warst du heute Nacht…“ Dieser Schlagerwurm kriecht genau am 1. Mai 1938 in mein Ohr. Papas Firma zieht auf den berühmten Betriebsausflug zum “Tag der Arbeit”, der kleine Karl bedient das Grammophon, legt Platten auf, macht Stimmung zum Tanz in den Mai, eben “Mausy”.
In unserer Stadt wird seit jeher viel gefeiert. Bedenke ich es recht, lebt man auch heute von Fest zu Fest.
Das Schlachtefest
Anfang Januar, wenn der harte Frost einsetzt, beginnt in der Stadt der Kampf mit eingefrorenen Wasserleitungen. Auf dem Dorf aber kann die Handpumpe kaum vereisen, die Bauern liegen auf dem Sack, denn draußen ist nichts zu tun. Dafür hat der Hausschlachter Hochkonjunktur. Wie die Weinlese im Süden, ist das Schlachten im Norden eine Arbeit mit Vergnügen. Nicht ohne Grund sagen wir dazu Schlachtfest. Genußfreudige Städter nutzen die Gelegenheit zu Verwandtenbesuchen und helfen manchem Schwein in den Darm.
Meine Mutter nimmt mich mit zu Tante Lenchen. Trudeln wir vormittags ein, ist das Schwein meist schon tot und wir hören nicht sein grausiges Todesquieken, wenn der Bolzen beim ersten Schlag sein Ziel verfehlt. Sie sind gerade dabei, das Blut für die Rotwurst aufzufangen, rühren es in einer Emaille-Schüssel, damit es nicht klumpt, schön schlank. Dann wird das Tier an den Hinterbeinen auf die Leiter gezogen.“Wenn das Schwein am Haken hängt, wird erst mal einer eingeschenkt.” Klarer Schnaps oder “Schluck” wie er bei uns heißt, ist nicht nur wegen der Kälte nötig, denn das Aufbrechen und Tranchieren findet natürlich im Freien statt, sondern wird weiter tüchtig eingenommen, um später die vielen fetten Kosthäppchen verdaulicher zu machen.
Der Schlachter, Vetter Hasenbalg, öffnet mit gekonnten Schnitten die Bauchdecke, holt die Innereien heraus und, da er das Sagen hat, drückt er gleich der hübschen Ilse die Wanne mit Därmen und Blase in die Hand, daß sie sie in heißem Wasser sauber macht. “Un Mäken, make se schön reine, damit de Wurscht wat werd”.
Tante Lenchen, in beiderwenniger Scherte, hat schon frühmorgens den kupfernen Waschkessel angeheizt, in dem die Wurscht gekocht wird. Als erstes wandern Nieren und Wellfleisch die “Steeke” hinein. Vetter Hasenbalg kommt, prüft die Hitze und wirft mit genialem Schwung die erste Ladung in die kochende Brühe. Derweilen nutzt Ilse rachsüchtig seine Abwesenheit vom Schwein, schneidet das Schwänzchen ab, zieht eine große Sicherheitsnadel durch das Ende und während der Schlachter in der Waschkücke quasselt, den Dorftratsch des ganzen Jahres abarbeitet, steckt sie ihm das Schwänzchen unbemerkt hinten an die Schürze. Beim Herausgehen baumelt es am Hintern herum. Onkel August hat das Spiel natürlich beobachtet und meint laut: “Eck gloobe et is noch ein Schwien im Huse”. Alle lachen, der Schlachter natürlich auch. Grund genug für eine neue Runde Nordhäuser Schluck.
Ist die Steeke gar, wird ausgiebig gefrühstückt. Während alle anderen das Kesselfleisch probieren, kriegt Hasenbalg “eine Striepe Kauken”, selbstgebackenen Blechkuchen, der zum Schlachtfest gehört wie starker Kaffee und Schluck. Dann schneiden “de Frunslüe” Zwiebeln für die Wurscht. Dabei arbeitet eine immer so lange, bis sie mit tränenden Augen ins Freie rennt und von der nächsten abgelöst wird.
Wir Jungen treffen uns auf dem Hüseken.Heimlich haben wir die Schnapsflasche geklaut, tränken Brotstückchen darin und füttern sie den Hühnern. Bald folgt das Riesengaudi, wenn der stolze Hahn nur noch lallend krächzt und ein ums andere Mal beim Herumstolzieren einknickt, während die Hühner wie besoffene Seeleute auf dem Misthaufen torkeln. Bei diesem Anblick werden auch die Erwachsenen albern und bestellen für den nächsten Tag Lenchens Liköreier.
Erst wenn der Hofhund mit glasigen Augen vor der Hütte jault, weil er in Alkohol getränkten Fleischabfall fraß, ist Onkels Geduld erschöpft. Er ruft uns herein, wir müssen den Nachbarn Wurstsuppe bringen. Also zuckeln wir mit Milchkannen voll heißer Brühe los. Mancher Freund kriegt noch als Kostprobe einen halbpfündigen Wurstring dazu, wir Kinder bekommen als Gegengabe oft frischen Kuchen. Kleine Würstchen aus Bratwurstteig werden übrigens auch für jedes der Kinder gemacht, denn nach alter Tradition essen wir zu Fastnacht in der Schule kein Brot, sondern haben ein Fastnachtswürstchen im Ränzel. Während der Pause entbrennt dann regelmäßig der Streit: wer hat die größte Wurst? Kommen wir vom Suppentragen zurück, sind die anderen noch immer beim Wurstmachen. Mutter knotet die letzten Zipfel. Die Neuigkeiten aus dem Landkreis sind besprochen, inzwischen hat jeder reihum einmal das Schwänzchen angesteckt bekommen, wurde ausgelacht und beprostet. Die Schluckpulle ist endgültig leer und alle stolpern fröhlich heim durch die kalte Winternacht. Zu Haus angekommen, ist die Wasserleitung endgültig eingefroren.
Unser Naturgarten
Bei aller Selbstkritik muß ich der gängigen Behauptung widersprechen, jeder echte Harzer sei von Natur aus ein Wilddieb. Die berüchtigten Harzer Jäger-Schützen, die Schnapphähne des Dreißigjährigen Krieges sind nicht unsere Großväter. Sie sind unsere Ur-Ahnen! Längst ist von ihnen nur noch die alte Regel geblieben: “Die Jäger und die Schützen, die müssen einen blitzen”.
Der heutige Harz-Mensch ist freundlich und friedlich. “Mit fröhlichem Herzen” wie ein Werbespruch beweist. Nur in wenigen Familien werden noch Gewehre mit abgesägtem Lauf vererbt, denen mal ein Böckchen oder ein Eber in die Kugel rennt. Auch werden kaum noch Leimruten gelegt oder Hasenfallen gebaut. Den Vater meines Freundes Rollo haben sie zwar mal geschnappt, weil es bei ihm zu oft nach Wildgulasch roch, aber nur einmal! Seitdem macht er die Fenster zum Acker hin auf.
Nein, dem richtigen Harzer ist der Wald oder besser “das Holz” nur sein verlängerter Garten. Damit geraten wir jedoch in ständige Konflikte mit dem Förster, der seinerseits das Revier für sich beansprucht. So ist der Grünrock im Laufe der Zeit zu unserem natürlichen Feind geworden. Nicht, daß wir gegen ihn tätlich vorgingen “bewahre“ außerdem traut der sich nicht in den Krug, kommt auf kein Schützenfest (ihm würde auch ganz schön das Fernglas beschlagen), nein, wir versuchen, ihn reinzulegen, übers Ohr zu hauen, auszutricksen, ihn zu behumpsen. Erzählt man: “Eck hebbe den Ferschter beschetten” folgt beifälliges Kopfnicken und Stühlezusammenrücken, denn er ist so unbeliebt, daß jeder bewundert wird, der ihm eins auswischt.
In den Kriegsjahren spielt der Forstmeister den Hüter des Volksvermögens, Herr über Brennholz und Waldfrüchte. Er tut, als würde ihm alles persönlich gehören; unser Eigentumsbegriff dagegen fängt im Wald erst beim fürstlichen Nutzholz, bei Hochwild und Erz an. Waldmann aber bläst sich auf, daß die Hornknöpfe von der Joppe platzen, stolziert mit umgehängter Flinte durch die Gegend, zählt die Holzbansen, sammelt feindliche Flugblätter, Brandplätzchen und solchen Kram, mit dem er seine Unabkömmlichkeit von der Front beweist.
Kriegsende! Nun gehört alles dem Volk. Er aber schikaniert uns, unbewaffnet und ängstlich geworden, jetzt mit Papierkrieg. Nur mit Forsterlaubnis dürfen wir in die Pilze gehen, ohne Beerenschein nicht pflücken, fürs Astholz müssen wir einen Holzsammelschein beantragen, haben wir ihn nicht, droht uns eine Anzeige bei der Kommandantura. Wer lässt sich solch einen Scheiß gefallen? Kein Harzer! Mit der Erfahrung von Generationen wird er von nun an systematisch bemogelt. Sammeln wir z. B. Beeren ohne Schein, wird der Eimer oberflächlich mit Pferdeäpfeln bedeckt. Haben wir jedoch einen Beerenschein, brauchen aber dringend Walderde für das Mistbeet, dekorieren wir eine dünne Schicht Heidelbeeren obenauf und behaupten, sieben Stunden gesucht zu haben. “Un nich jeströppelt Herr Oberferschter!”
In den Schulferien müssen alle Jungs ins Holz. Wenn Großvater die Parole ausgibt: “Morgen geht’s los, hat er vorher genau ausgekundschaftet, welche Runde der Förster machen wird. Beil, Messer und die zusammenklappbare Säge (falls “Dickeres” anfällt) werden in einem Sack versteckt, und so zuckeln wir frühmorgens mit dem Handwagen in entgegengesetzter Richtung bergauf. Wie vom Platzhirsch wird das Revier gesichert. Geschärfte Sinne für fremdes Geräusch haben wir, nichts entgeht uns im Wald. Wir biegen in verträumte Wege ein, dann kommt eine junge Schonung, in der wir das Gefährt verstecken.
Die Wetterlage ist bei uns im Allgemeinen feucht, Regen und Nebel sind das ganze Jahr über angesagt. Klamme Finger und nasse Klamotten allzu üblich. Wenn man aber einen schönen Sommertag erwischt, haut man sich erst mal in die Wiese, guckt den Hummeln zu, wie sie am Fingerhaut saugen, bis sie Herzkrämpfe kriegen, kaut Sauerampfer und zählt die Zitronenfalter.
Solche Tage sind unvergeßlich und brennen sich in alle Sinne. Auch dieser Herbsttag ist schön. Großvater durchstöbert die Gegend. Kurz danach ist er schon wieder zurück, er hat eine traumhafte Pilzstelle gefunden. Hallimasch und Steinpilze wie Sand am Meer. In einer Stunde liegt ein voller Sack in der Schonung. Aber was tun? Wir haben zwar einen Holz- aber keinen Pilzschein. Also: in die Ferne wittern, die Gegend sichern, Großvater kaschiert den Sack mit trockenen Ästen der vorgeschriebenen Stärke “nichts Gesägtes natürlich” und schon stolpern wir, harmlos tuend, bergab, ein Bund Hecke schleift als Bremse hinterher.
Es ist ein erfolgreicher Ausflug geworden, denn die Familie sitzt längst bei Pilzstippe und Pellkartoffeln bevor der Förster im Mühlental die durchrumpelnden Handwagen der Holzsammler visitiert.
Wir Harzer sind geborene Naturfreunde, die es nicht nötig haben, sich von einem Eberswalder Festmeterstrategen über den Baumbestand belehren zu lassen. Wird für den Winter etwas dickeres Holz gebraucht, fällt auch mal die eine oder andere Fichte um. Aber bitte, so sauber ausgesucht, als hätte der Forstinspektor sie selbst markiert. “De staht da falsch” wird fachmännisch geurteilt und ruck zuck, schon liegt sie. Dann herrscht Stille und wir verzichten auf den Harzer Jodler. ”Frunslü süt jiech op den Stuken, wie möt erst den Brennewien schluken.”
Ein bißchen heikler ist die Sache mit den Tannenspitzen, den hellgrünen, jungen Frühjahrstrieben, die Großvater in Spiritus ansetzt, als Einreibmittel gegen sein Gliederreißen nimmt. Da kommen schon leichte Bedenken und der kleine Karl schmuggelt sie lieber auf Schleichwegen in den Ort. Übrigens auch die dunkle Zuckerflasche voll frischer Waldameisen, gut verkorkt, wird im Eßkorb transportiert. Zu Hause gießen wir Alkohol darauf und machen damit den Himbeersaft haltbar. Die Flaschen liegen im Keller neben dem selbstgebrannten Schlehenschnaps, den Opa seiner Leibschmerzen wegen schnabuliert. Ich höre noch sein fürchterliches Bölken, wie er im Keller die beiden Pullen verwechselt und der Ameisensprit seinen Magen ausbrennt. Einen Moment denkt er vielleicht “kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort!” Doch die Reue verfliegt im Nu, schließlich sind Wald und Flur für alle da. Den Harzer trennt kein Gatter von Gottes Garten.
Im langen Winter ist wenig los im Wald. Nur ein paar Pferdefuhrwerke fahren Langholz. Hirsche und Rehe haben vom Harsch blutige Läufe und die Wildschweine trauen sich zur Fütterung bis in die Nähe der Häuser. Eine lange, düstere Zeit, in der Mutter über die Singer-Nähmaschine gebeugt für uns Kinder Indianer-Anzüge näht, Federschmuck bastelt, damit die Häuptlinge im Sommer stolz auf Kriegspfad ziehen können. Da steht dann meist die Frage des Weihnachtsbaums an und man erinnert sich eines Tännchens, das partout nicht in die Lichtung passt, auf der es steht: oben bei “Papen Anneken”, wo wir im Frühjahr die Himmelschlüsselchen pflückten. Es wird wiederholt auf seinen Wuchs überprüft und fällt eines Nachts bei Schneetreiben lautlos um. Zum Heiligen Abend aber erstrahlt es geputzt in der guten Stube.
Im Frühjahr dann beweist sich, daß es richtig war, gerade an dieser Stelle Platz zu schaffen, denn die Lichtung ist plötzlich viel offener, einfach schöner geworden. Private Durchforstungen dieser Art sind für Heimatfreunde das Natürlichste der Welt. Bestätigen sie doch die Lehre unseres alten Schlossgärtners: “Der tüchtige Gärtner gestaltet mit der Axt”. So wachse ich in völliger Harmonie mit der Natur auf.
Das Cornet
Das Wernigeröder Wappen schmückt eine dicke, fette Forelle, die Graf Adalbert I. erwischt haben soll. Solcherlei Prachtexemplare gibt es längst nicht mehr im Zillierbach. Dennoch schmecken die kleinen Biester, die wir Jungs mit der bloßen Hand fangen, eingelegt ganz gut. Mit Geduld kraulen wir den Fischen sogar den Bauch, bevor wir sie in hohem Bogen auf das Ufer werfen.
Eines Tages jedoch taucht Walter Rasehorn auf, ”Hörnchen” mit Spitznamen. Er ist Wirt der Nöschenröder Klause, einer Wirtschaft, in der normalerweise Holzknechte und Handwerksburschen saufen. Während der Ferien gibt es aber auch einen bescheidenen Mittagstisch für die Sommerfremden, den “Hörnchen” mit selbstgeangelten Forellen erweitern will. Also pachtet er ein paar Kilometer Bach und an schönen Nachmittagen sieht man ihn in Gummistiefeln aufwärts patschen, an tieferen Stellen wirft er die Angel aus.
Zunächst finden wir es ganz komisch, wie er da als Petrijünger herumstolpert, und klatschen Beifall, wenn wieder ein Fischlein in seinen Eimer wandert.
Später aber schleichen wir ihm voraus, verscheuchen die Forellen systematisch, so daß Hörnchen von Mal zu Mal weniger fängt. Ihm macht das, scheint’s, nicht viel aus, denn seine nachmittäglichen Exkursionen dienen nur nebensächlich der Nahrungssuche. In erster Linie bekämpft er damit seinen berufsbedingten Kater und schnappt frische Luft für die nächste verqualmte Kneipennacht. So passiert es regelmäßig, daß er talaufwärts hinter den letzten Häusern die Angel mit Steinen festlegt, die Schnur mit der Fliege auswirft, sich unter einen Baum legt – und schnarcht. Schlechte Gewohnheiten verderben gute Sitten! Wir binden ihm heimlich eine bunte Kindertrompete an die Angel und stimmen aus dem dichten Ufergebüsch gegenüber das Lied des Trompeters von Säckingen an: “Behüt’ dich Gott, es wär’ so schön gewesen, behüt’ dich Gott, es hat nicht sollen sein.” Er schreckt aus dunstigen Träumen auf und greift Halt suchend zur Angel. Bunt blinkend baumelt die Kindertröte am Haken. “Jammerbengels” rast Rasehorn, wirft fluchend die Angel wie eine Mistgabel in unsere Richtung, doch wir sind längst über alle Berge.
Danach werden seine Anglerausflüge seltener und die Nöchenröder Bach-Forellen wollen wieder, wie früher, erst gestreichelt und dann mit der Hand geschnappt aufs Trockene fliegen.
Die Morgenschicht in der Klause bewältigt Hörnchens Ehefrau Hermine, eine imponierend trinkfeste, stämmige Matrone. Zu ihren Frühschoppengästen gehört der Bezirksschornsteinfegermeister Gustav Freitag. Direkt vor der Klause steigt der schwarze Glücksbringer aus seinem Dienstauto. Unter dem Zylinder brennt ein rußiges Augenpaar der Marke “Nimmersatt”, welches die gezwirbelten Spitzen seines Kaiser-Wilhelm- Schnurrbartes scharf akzentuiert. Jovial zwei Finger an den Chapeau legend grüßt er in die Runde. Zwar will er die Fegerei seiner Gesellen in Nöschenrode kontrollieren, bemüht sich aber erst einmal deren Kundenfreundlichkeit zu hinterfragen.
Derlei Auskünfte erhält man am zuverlässigsten an der Theke. Hermine erteilt ein tadelloses Gutachten und bald gerät das Gespräch zu einem philosophischen Diskurs über die Macht des Durstes, den die Wirtin dominiert. Als Hobby- Astrologin interessiert sie besonders die Spannung zwischen ihrem Gatten, Wassertype Angler, und dem feurigen Feger. Aus fachlich zodiakischer Neugier schmeißt sie die erste Lage “Polnische Rakete” - halb und halb Danziger Goldwasser mit Brockenkräuter auf Würfelzucker. Trotz der explosiven Mischung erinnert sich Meister Freitag seines Kontrollauftrages, wirft zunächst einen Blick über die Dächer, auf denen seine Gesellen herumturnen, will schon zur Inspektion einer anderen Truppe in die Neustadt aufbrechen, da spielt ihm das Schicksal einen Streich – sein Wagen springt nicht an. Dreimal versucht er mit der Handkurbel das Automobil zu zünden – vergeblich. In die Klause zurück gekehrt , überrascht er die Thekenbrüder mit der Fernanalyse: “In der Neustadt wird nichts gebrannt, also gibt’s auch nichts zu fegen.” Von so weiser Schlussfolgerung beeindruckt, spendiert Hermine eine Runde “Ratzeputz für deutsche Eichen”. Hierbei handelt es sich um ein Branntweingemisch, das wirkungsvoll Kleintiere tötet und Bäume entlaubt. Feger Freitag revanchiert sich natürlich angemessen, bis ihn ein dringendes Bedürfnis ankommt. Wenn auch leicht schwankend schreitet er doch würdevoll nach draußen, um sich im Windschatten seines lahmen Automobils zu entleeren. Darunter sackt die deutsche Eiche dann zusammen. Die Blätter der bepinkelten Linde aber gilben urplötzlich und bedecken mit ihrem fallenden Laub den schwarzen Feger, wie Kirschblüten einst seinen Philosophenbruder Lao-Tse 2500 Jahre zuvor im fernen China.
Haarsträubend
Otto Rieselbergs Friseurladen hat einen blitzblanken Barbierteller als Ladenschild. Im Herrensalon hängt das Regal mit nummerierten Rasierseifentöpfen und den persönlichen Servietten der Stammkundschaft. Zum ersten Mal besuche ich an der Hand meines Vaters den Laden, der die nächsten 15 Jahre für meinen Putz verantwortlich zeichnen soll. Während Papa in den Rasierstuhl komplimentiert wird, setzt man mich in den Kinderdrehsessel, den zwecks Ablenkung des kleinen Geistes ein geschnitzter bunt bemalter Pferdekopf mit Zügeln und Zaumzeug ziert, wie man ihn schöner auf keinem Schützenplatz findet. Ein Lehrjunge seift meinen alten Herrn ein und ich erfahre erstmalig das kribbelnde Zupfen der Handmaschine, höre das flotte Klappern der Schere und spüre das Kitzeln abgeschnittener Haare auf Augenwimpern und Nase. Der Meister säbelt unter fortwährendem Redeschwall an meinem Schopf herum. Dann wieder wetzt er das Messer an der Lederschlaufe, rasiert Papa, klappert schon wieder um mich herum. Der Lehrling muß den Bart des Alten zur Nachrasur seifen – ruck, zuck. Ob nun, abgelenkt durch das Hin und Her zwischen Vater und Sohn, Messer und Schere, oder verunsichert durch die Hoppe-Hoppe-Reiter-Attacken des Haarfirmlings auf dem Drehstuhl, mein Schopf jedenfalls wird immer kürzer. Am Ende der Prozedur liegt ein Berg Haare auf dem Boden, der Kopf aber ist eine sogenannte kahle Bombe. Dies Ergebnis berührte mich selbst viel weniger als das Kitzeln der rieselnden Härchen zwischen Hals und Hemd. Ich fühle bis heute deutlich das Zwicken und mein Zeigefinger führt instinktiv den Hemdkragen entlang, wenn nur der Name Rieselberg fällt.