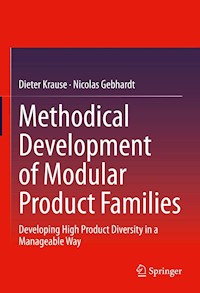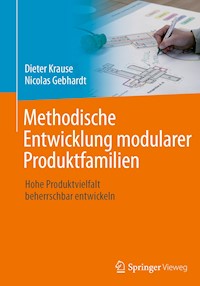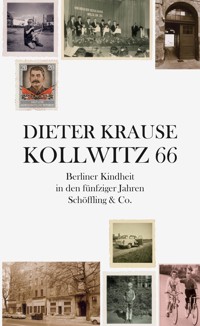
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieter Krause wächst am Ost-Berliner Kollwitzplatz auf, dessen Hinterhöfe den Murmelspielern und Indianern gehören. Anstelle von ideologischen Kämpfen werden Konflikte mit Tüten voller Wasser und Stinkbomben ausgefochten. Die fünfziger Jahre sind für den Jungen eine Übergangszeit: Zwischen heimlich gehörten Elvis-Songs und Begegnungen mit russischen Soldaten wechselt er regelmäßig von einem Sektor in den anderen und beinah ebenso häufig die Schule. Ende der Fünfziger wird die Wohnung der Eltern heller, buntes Geschirr, ein Fernseher, erst ein Motorrad mit Beiwagen und dann sogar ein Trabi werden angeschafft. Vor den persönlichen Abenteuern und familiären Fortschritten rückt das politische Geschehen in den Hintergrund und bleibt lediglich in den Liedern, die den Teenager umgeben, präsent. Dies ändert sich jedoch, als mitten in die Sommerferien 1961 die Nachricht vom Mauerbau platzt. Dieter Krause schildert liebevoll die Freiheit seiner Berliner Straßenkindheit, kommentiert scharfzüngig ihre staatliche Begrenzung und erzählt so das Heranwachsen am Prenzlauer Berg zur Frühzeit der DDR wie unter dem Mikroskop: Man sieht alles sehr genau vor sich - man atmet gewissermaßen die Luft aus Schwefel und Bohnerwachs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 735
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
Das Haus, die Stadt, die Zeit
Der Russe vor der Tür und »Onkel Tobias« im Kopf
Der Ernst des Lebens beginnt
Ein Ami-Jeep unterm Tannenbaum
Mit der S-Bahn zur West-Clique
Groschenangeln für eine Kinokarte
Der Traum vom kleinen »Halbstarken«
»Strafversetzt« im Doppelpack
Mit Herberger auf der Tribüne
Schmetterlinge vor dem Mauerbau
Der Klassenfeind im Schulaufsatz
Vom Schusterjungen zum Krieger
Glossar
Mein Dank …
Autorenporträt
Über das Buch
Impressum
[Leseprobe – In Berlin]
[Leseprobe – Die Sintflut in Sachsen]
FürFranki, Micha, die Süße, Pummel, Sohni, Jürgen, Monika, Bernhard, Kalle, Marlies, Klaus L., Fred, Angelika R., Wolfgang, Hans-Jürgen, Angelika H., Horst, Jörki, Ete, Wölfi, Klaus T. und meine Eltern.
Kollwitz 66Berliner Kindheit in den fünfziger Jahren
Das Haus, die Stadt, die Zeit
Das Haus in der Kollwitzstraße 66 war nicht besser und nicht schlechter als andere. Es hatte den Krieg heil überstanden. Die 68 links daneben nicht. Das zählte. Es hatte vier Stockwerke und einen Hinterhof, von dem rechts und links Seitenflügel abgingen. Und es besaß damals, Anfang der fünfziger Jahre, einen frischen glatten Putz, der die hässlichen Kriegswunden an der Fassade zugedeckt hatte. Auf der einen hinteren Seite des Hofes war die Klopfstange angebracht, gegenüber standen die Müllkästen. Da endete auch der Hof – mit einem großen Lattentor. Und dahinter begann eine neue Welt: eine kleine Schnapsfabrik namens »Westphal«.
Sie bestand aus einer einstöckigen Ziegelsteinhalle und einem verzweigten Barackenbau und verband die Kollwitz 66 mit der 64. Dort im Vorderhaus unterhielt die Schnapsmanufaktur auch eine Probierstube. Quer über ihrem Eingang und den beiden Fenstern prangte der Schriftzug »C. Westphal«, dazu kam ein dreieckiges beleuchtetes Schild mit dem Firmenlogo: ein Männchen mit weiten, schwarz-weiß karierten Hosen und einem Tablett mit Likörglas. Die Fabrik und die beiden Häuser gehörten der Familie Hammel, die »Westphal« unter früherem Namen weiterführten. Die alte Frau Hammel wohnte in der 64, unten rechts, sogar mit einer kleinen Terrasse, zu der Stufen vom Bürgersteig führten. Ein Relikt aus der Zeit, da umzäunte Vorgärten noch beide Häuser schmückten. Ihr Sohn, der auch die Firma leitete, lebte mit seiner Familie in der 66, zweite Etage mit Balkon. Die anderen Mieter im Haus hießen Schlüter, Weinert, Heese, Rochow, Nemitz, Kleinschmidt, Kurzweg, Stehr, Thomas. Schlüter gab’s gleich zweimal – »die alten« und »die jungen Schlüter«. Und eben uns, Krause. Hinterhaus, linker Seitenflügel, Hochparterre.
Natürlich waren das nicht sämtliche Bewohner, aber an diese Namen erinnere ich mich gut. Denn zu ihnen gehörten die Kinder. Sie machten das Haus vielleicht doch zu etwas Besonderem, denn wir waren viele. Allein die beiden Seitenflügel kamen auf etwa 15. Ein so simples Spiel wie Verstecken konnte für den Sucher schon mal eine Viertelstunde dauern. Hammels hatten auch Kinder, zwei Töchter. Nur, gespielt haben wir nie miteinander, vielleicht durften sie nicht. Wir waren eben die Hofkinder. Manchmal, wenn ihr Vater an seinem Auto rumschrauben ließ, tollten sie auf dem Fabrikgelände. Uns war das verboten. Wir standen dann am Lattentor und sahen zu, was mit dem Wagen passierte. Ein klappriger Opel P4, aber eben ein Auto. Das einzige im Haus. Und vielleicht eins von vier oder fünf in der ganzen Straße.
Es gab nur wenig Verkehr. Mal ein Lastwagen, mal ein dreirädriges Tempo-Auto, mal ein Pferdefuhrwerk, das sich über den grauen Asphalt quälte. Das war’s. Die noch junge DDR war auf Rand genäht. Der Westen Deutschlands wurde dank Marshallplan kräftig angeschoben, der Osten litt unter Reparationszahlungen und den Demontagen ganzer Betriebe durch die siegreiche Sowjetunion. Ein eigenes Fahrrad war da schon ein stolzer Besitz. Zwar wurde der »werktätigen Bevölkerung« mit pathetischem Eifer auch Wohlstand versprochen, aber erst für morgen. So blieb alles recht ärmlich.
Auch in den Geschäften, die vor der 66 für etwas Auflauf sorgten. Rechts neben der großen Hauseinfahrt gab es einen kleinen Zeitungsladen, geführt von einem geruhsamen dicken Mann mit Glatze. Frühmorgens heftete er immer die neuen Tageszeitungen mit Wäscheklammern an ein Leistengitter. Obwohl ich noch kein Wort lesen konnte, reichte es zur ersten Lektion: Alle Zeitungen sahen gleich aus – immerzu! Die Lebensmittelhandlung, die sich daran anschloss, war da etwas bunter. Zwei Schaufenster, an den Wänden Regale, darin Gläser und Tüten luftig aneinander ausgerichtet, und hinter der Ladentheke die Eheleute Adam, denen das Geschäft auch gehörte. Ganz links, auf der anderen Seite vom Haustor, war ein Fischladen der HO, der staatlich geführten Handelsorganisation. Alles weiß gefliest, auch zwei Schaufenster und mit einem großen Karpfenbecken. Allein das Drama, welcher Fisch im Köcher landete und welcher entwischte, konnte uns Kinder eine Weile in Atem halten. Und dann kam, direkt neben der Einfahrt, eine winzige Eisdiele. Waffel-Eis, direkt in die Hand. Schon eine kleine Attraktion, die das Haus im Sommer »verzauberte«. An heißen Tagen stand die halbe Buddelkasten-Besatzung vom Kollwitzplatz bei uns Schlange.
Überhaupt der Kollwitzplatz, der gehörte natürlich dazu. Der riesige Sandkasten samt Klettergerüst, die drei Skattische aus massiven quadratischen Steinplatten, die großen Rasenflächen, umsäumt von Wegen mit vielen rotbraun gestrichenen Parkbänken. Und an der Ecke Knaackstraße das immer stinkende Pissoir. Blöde waren nur die Schilder, die man überall ins Gras gerammt hatte: »Betreten der Grünanlage verboten! Eltern haften für ihre Kinder!« Also doch Buddelkasten. Allein im Winter, wenn alles mit Schnee bedeckt war, galt das Verbot nicht. Den Schnee durften wir betreten.
Mit der Einschulung erweiterte sich unser Territorium beträchtlich. Nun marschierten wir jeden Tag links in die Knaackstraße, vorbei an einer der letzten noch nicht geräumten Ruinen am Kollwitzplatz. Vorbei an einer Gardinenspannerei, wo die frisch gewaschenen weißen Stores auf große Holzrahmen gezogen und an schönen Tagen vor dem Geschäft zum Trocknen aufgestellt wurden. Dann weiter am Wasserturm entlang, rechts in die Kolmarerstraße, und schon verschluckte uns die 13. oder 14. Grundschule. Ein alter, typischer gelb-roter Ziegelbau mit Turnhalle. Irgendwann kamen wir alle dort an, drückten uns auf eine der Holzbänke und lernten in der Fibel lesen: dass Walter Ulbricht ein sehr guter Schüler war und Stalin nie abschreiben ließ. Wir schon.
Ein anderer Weg, den wir nahmen, führte rechts in die Wörtherstraße vor bis zur Prenzlauer Allee – zum Kino »Berolina«. Vor dem Eingang eine kleine Kasse, drinnen vielleicht 20, 30 Reihen mit Klappstühlen und diesem eigentümlichen Zaubergeruch aus Staub und Zelluloid. Jeden Sonntag vor elf Uhr spazierten wir, fein rausgeputzt, 25 Pfennig in der Tasche, zu unserer Flohkiste und johlten berauscht bei den Filmszenen, in denen die Helden zum Sieg stürmten: »Öööööh, die Guten!« Das waren meist Partisanen oder Rotgardisten. Oder Kinder wie »Timur und sein Trupp«. Natürlich auch gut, hilfsbereit, vorbildlich. Aber eben doch auch etwas Rasselbande. Und das nahmen wir mit. Der Erziehungsappell blieb im Kino.
Bald kamen ganz andere Filme hinzu, andere Helden, in der anderen Hälfte der Stadt. Wir müssen acht oder neun Jahre alt gewesen sein, als wir zum ersten Mal alleine loszogen. Natürlich ohne unsere Eltern vorher zu fragen, sie hätten es bestimmt aus Sorge (eher) oder Gesinnung (weniger) verboten. Also dann lieber heimlich: quer über den Kollwitzplatz, durch die Wörther, über die Schönhauser, in die Oderberger und dann vor bis zur Ecke Bernauer. Ein beklemmender Ort damals, denn hier standen immer vier oder fünf Volkspolizisten. Sie patrouillierten auf dem Bürgersteig und auf der Straße, musterten scharf die Passanten, kontrollierten beliebig deren Taschen und nahmen einen – bei Verdacht – in Gewahrsam. Ein paar Schritte weiter atmete man erst mal durch, man war im Westen.
Und der empfing uns mit einer Parade von Marktständen, vollgepackt mit Schokolade, Kaugummi, Marzipan, Kaffee, Kakao, Apfelsinen, Bananen. Verführungen, die es im Osten nicht gab oder dort nicht schmeckten. Um die Ecke lockte das Kino »Vineta« mit rauchenden Colts und Tarzan-Filmen. Alles kaum 15 Minuten von unserem Haus in der Kollwitz entfernt. Wir waren kleine »Weltenbummler« – spazierten mehrmals in der Woche von Ost nach West und von West nach Ost. So wie ein Großteil der Ostberliner damals. Es war irgendwie immer noch eine Stadt und das Procedere längst eingeübt. Viele der grenznahen Läden und Verkaufsstände nahmen auch Ostgeld, ansonsten musste man die gewünschte Summe vorher umtauschen, meist zum Kurs von 1 (West) : 4 (Ost). Das ging ganz rasch über die Bühne, in extra »Wechselstuben« oder manchen Geschäften, man wusste schon in welchen. Alles im Westen natürlich. Der Rückweg allerdings war gefährlicher, denn wir waren selten »sauber«. Irgendwas musste immer geschickt am Körper versteckt und an den Vopos vorbeigeschmuggelt werden: »Micky Maus«- oder »Jerry Cotton«-Hefte, Knallplättchen-Pistolen oder Elvis-Platten. Unsere Wünsche änderten sich, wurden mit uns »älter«, das Herzklopfen an der Grenze blieb.
Letztlich war es Zufall, ob man im amerikanischen, britischen, französischen oder im sowjetischen Sektor lebte. Der Krieg hatte Berlin in weiten Teilen in eine Trümmerlandschaft verwandelt, jedes fünfte Gebäude war eingestürzt, ausgebrannt oder schwer beschädigt. 600000 Wohnungen – verloren. Luftbilder muten noch heute surrealistisch an. Die Menschen waren glücklich, wenn sie überhaupt eine Wohnung hatten und nicht in Kellern oder Baracken hausen mussten. Und ob die vier Wände nun im Westen oder im Osten, in Treptow oder in Spandau standen, war in den frühen Nachkriegsjahren noch unwichtig. Man wollte vor allem leben, unter allen Umständen.
Doch der Kalte Krieg machte sich mehr und mehr bemerkbar. Die »Freie Welt« auf der einen Seite, die »Baumeister des Sozialismus« auf der anderen. Und im geteilten Deutschland feuerten zwei alte Männer, Konrad Adenauer und Walter Ulbricht, unablässig Worthülsen aufeinander. Den Bundeskanzler und den SED-Parteichef einte eine tiefe gegenseitige Abneigung und das Bemühen um die Sicherung der eigenen Macht. Fernsehen kam erst später, also fand der Krieg in der Presse und im Äther statt. Glitzerwelt gegen Versprechen. Und Verbote. Die staatliche Propaganda klang plump und falsch, besonders in jenen frühen Jahren. Die meisten Ostberliner (gefühlt!) hörten Westradio – den RIAS. Selbst am 1. Mai hingen in unserem Straßenzug höchstens zwei rote Fahnen zum Fenster raus. Wir waren zwar von politischen Losungen an Behörden, Bahnhöfen, Betrieben umzingelt, auch in den Schulen, aber wir nahmen sie kaum wahr. Und wenn, dann störend.
Wie den »Augenzeugen«, die DDR-Wochenschau, mit der jede Kinovorführung begann. Auf unseren Wunschfilm mussten wir warten, zuerst kamen die Erfolgsberichte: Neue Traktoren aus der Sowjetunion. Oder: Die Brigade »T.D. Lyssenko« hat in Akkordarbeit 100 Tonnen Getreide verladen – Kommentar etwa: »Jeder volle Sack ein Schlag ins Gesicht der Bonner Kriegstreiber!« Oder man zeigte uns rührende Bilder vom spitzbärtigen Genossen Ulbricht beim Volleyballspiel. Irgendeiner aus der hinteren Kinoreihe ahmte spöttisch das Meckern einer Ziege nach. Und die, die es hörten, lachten. War ja dunkel, sah ja keiner.
Für uns Kinder waren die fünfziger Jahre eine aufregende, abenteuerliche Zeit. Eine Kindheit, die anders war als andere, die es so nie wieder gegeben hat – zwischen Naziruinen und Neuaufbau, Stalinkult und American Way of Life, West-Ausflügen und Mauerbau, Brausepulver und Chewinggum, Jungen Pionieren und Donald Duck.
Der Russe vor der Tür und »Onkel Tobias« im Kopf
Mein Vater kam mit dem Rad. Schade, dass es keine Zeitnehmer gab. Denn er war ein guter Radrennfahrer, und er muss die zehn Kilometer bis zur Klinik nach Berlin-Wittenau in einem Höllentempo runter getreten haben. Er hatte einen gewichtigen Grund an diesem 14. August 1947. Ich war gerade mal vier Stunden alt, schlief selig in den Armen meiner Mutter, als er in das Zimmer stürmte und vor ihrem Bett niederkniete: »Hat er Arme? Kann er Klavier spielen! Hat er Beine? Kann er Rad fahren!« Und der Kopf? Gut, nur den hatte er wahrscheinlich gesehen, eingemummelt, wie ich war.
Um es gleich zu sagen: Keiner dieser Wünsche wurde erfüllt. Ich habe – leider – nie Klavier spielen gelernt und wurde auch kein Radrenner. Das mit dem Klavier konnte er leicht verschmerzen, dass ich kein Radsportler wurde, nicht. Dabei fing es gut an: Zu meinem dritten Geburtstag bekam ich ein winziges weinrotes Kinderrad. Einfach, aber stabil, mit Vollgummireifen und »starrer Geige« – also ohne Bremsen, ohne Freilauf. Bei meinen ersten wackligen Fahrversuchen hielt mich mein Vater noch am Kragen fest und rannte neben mir her. Doch schon nach ein paar Tagen fuhr ich wie ein Kunstradfahrer kreuz und quer durch die Wohnung. Er muss gejubelt haben: Angesteckt! Radsport war sein Leben, dort hatte er seine Freunde und bis zu jenem Tag im August auch seine große Familie. Dann kam ich, meine Mutter hatte er schon ein Jahr früher kennengelernt. Sie war in den letzten Kriegsmonaten als Rotkreuzschwester rekrutiert worden und danach für die Krankenpflege im Prenzlauer Berg unterwegs – zu Fuß, von Haus zu Haus. Und in einem dieser Häuser (Danzigerstraße, Ecke Kollwitz) traf sie meinen Vater. Nicht als Kranken, sondern bei einem Familienfest, zu dem man beide eingeladen hatte.
Damals wurde bei jeder sich bietenden Gelegenheit gefeiert. Es reichte, ein paar Flaschen, ein paar Zigaretten, ein paar Margarinestullen zusammenzukratzen, den Wohnzimmertisch beiseite zu rücken – und schon drehten sich die Schellackplatten mit 78 Umdrehungen pro Minute. Und kurz darauf drehten sich alle:
Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja.
Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama.
Man lebte, man hatte wieder Spaß. Wenigstens für drei, vier Stunden. So begann es mit Hilde und Herbert, meinen Eltern. Typisch, sie feierten gern.
Ein Jahr später zogen sie in die 66, in unsere Hochparterre-Wohnung. Drei Zimmer, zwei davon gingen nach hinten zum Hof der Schnapsfabrik, eine Küche und ein Klo. In den ersten Jahren gab es auch noch eine Untermieterin – Frau Altwasser. Sie war schon hochbetagt und lebte sehr zurückgezogen. Meine früheste Erinnerung an unser Zuhause ist merkwürdig: Ich bin fest überzeugt, im Schlafzimmer gebuddelt zu haben. Möglich, dass die Dielen erneuert wurden und ich, einen Moment unbeobachtet, in die Schüttung kroch. Backe, backe Kuchen. Das lag mir fast im Blut, so oft war meine Mutter mit mir buddeln. Wir mussten ja nur über die Straße. Auf dem Weg dorthin – oder wenn wir einkaufen gingen oder zum Arzt – überquerten wir den Hof. Der kleine Sohnemann brav an Mamas Hand, mitten durch die lärmende Kinderschar. Und dann kam die immer gleiche Frage: »Darf Dieter runter?« Er durfte nicht. Noch nicht. Ich war etwa fünf und von den vielen kessen Kindern ziemlich eingeschüchtert. Schnell weiter, habe ich bestimmt gedacht, und »Ooch, schade« gesagt.
Schon ein paar Schritte aus dem Haus genügten, um in der grauen Wirklichkeit anzukommen: Ruinen. Die 68 stand zwar – trotz Treffer – noch und war auch in den unteren Stockwerken bewohnt, aber nur notdürftig. Es waren vor allem die Eckhäuser am Kollwitzplatz, die es erwischt hatte. Von manchen Gebäuden standen noch Fassadenreste oder Teile des Treppenaufgangs, andere waren bereits geräumt und nun schuttstaubige Freiflächen, auf denen nur Unkraut sich festkrallen konnte. Die schlimmsten Bombenschäden gab es zwischen der Belforter und dem Senefelderplatz. Bis auf die Ecke Metzer waren beide Straßenseiten ein einziges Ruinenfeld. Dort zog sich das Abräumen der Trümmerberge bis tief in die fünfziger Jahre, dort gab es auch ein provisorisches Schienennetz, auf dem kleine Kipploren Ziegelsteine und Schutt fortschafften.
Nach Feierabend hoben Arbeiter die Loren immer von den Schienen – damit nichts passierte. Ein paar Minuten später zog es uns genau dorthin. Und dann: Vier Kinder eine Ecke, ruck, zuck! war die Lore wieder auf der Schiene. Einige der Jungs sprangen in die Kippmulde, andere brachten die Fuhre mit Karacho in Fahrt. »Tuff, tuff, tuff, die Eisenbahn …« Die Kleinsten konnten gerade mal über den Rand der rostigen Mulde gucken und hatten ziemlichen Bammel. So rumpelten wir vierzig, fünfzig Meter über die Schmalspurgleise mitten durch die Schutthaufen. Und dann in wildem Tempo wieder zurück. Für uns ein Mordsspaß. Bis ein schnauzender Polizist auftauchte oder einer von uns zu heulen begann, dann hauten wir ab. Die Lore war für den nächsten Arbeitstag schon startklar. Unser Beitrag zum Nationalen Aufbauwerk. Aber das gehört weiter nach hinten.
Zur Wirklichkeit gehörte auch, dass man tagtäglich auf Männer traf, die der Krieg zu Krüppeln gemacht hatte. Ihnen fehlten Arme oder Beine, und nun saßen sie in eigenartigen Rollstühlen auf drei Rädern, die sie mit Handhebeln antrieben, andere gingen an Krücken oder führten ihre leeren Ärmel spazieren. Sie gehörten damals zum Straßenbild. Anfangs schauten wir Kinder allzu auffällig auf diese sonderbaren Gestalten und wurden sofort von unseren Müttern ermahnt. »Hör auf, den Mann anzustarren! Ist schon traurig genug.«
Bevor meine Mutter mit mir zu Einkaufstouren aufbrach, wusste sie schon, was es gab und was nicht. Von Fenster zu Fenster, kreuz und quer über den Hof, tauschten unsere Mütter Neuigkeiten aus.
»Beim Fleischer gibt’s heute Blutwurst.«
»Und auf dem Markt Blumenkohl, ist aber ’ne lange Schlange!«
»Was kochen Sie?«
»Linsen.«
Berliner Milieu wie bei Zille. Jeder von uns wusste so etwa, was beim Nachbarn auf den Tisch kam. Oft das Gleiche. Das Besorgen von Lebensmitteln war eine einzige Rennerei. Man musste schneller sein als andere, Glück haben und – noch wichtiger – Beziehungen.
Vieles war rationiert und die Verteilung von Brot, Butter, Fleisch, Zucker über Lebensmittelkarten gesteuert. Die gab es jeden Monat neu, bis 1958. Kartoffel- und Kohlenkarten gab es sogar noch länger. Alles purer Goldstaub. Gut zu kalkulieren und die paar Marken (»Butter 125 g«) über vier Wochen zu strecken war eine hohe Kunst. Wenn ich auf dem Markt meine Mama mit großen Augen anbettelte: »Eine Bockwurst, bitte, bitte.« Dann kassierte die Verkäuferin vierzig oder fünfzig Pfennige und schnipselte eine Fleischmarke von unserer Karte. Das riss ein Loch, ein Mittagessen perdu. Am Monatsende wurden oft Brotscheiben in der Pfanne gebraten, hat auch geschmeckt. Oder meine Mutter setzte Milch auf, gab zwei Löffel Zucker dazu und brockte dann ein Brötchen in den Suppenteller. »Pappchen« nannten wir das. Es wurde allenthalben improvisiert – beim Essen, bei der Einrichtung, bei der Kleidung. Anzüge wurden gewendet, Decken zu Mänteln geschneidert, abgeschnittene Hemdschöße zu neuen Kragen verarbeitet. Not macht erfinderisch.
Der Markt war damals in der Prenzlauer Allee (zwischen der Christburger und der Marienburger) und zog sich durch die Häuserlücken runter bis zur Winsstraße. Im Gedränge streiften unsere Mütter an den Ständen vorbei und suchten nach Rotkohl, einer Gurke oder ein paar Äpfeln. Südfrüchte habe ich dort nie gesehen. Dafür gingen wir in den Westen, in die Bernauer, wenn die Zeit knapp war, in die Brunnenstraße, wenn es zu einem kleinen Bummel reichte.
Westen hieß für uns vor allem Brunnenstraße. Zwar war die Straße geteilt, und die eine Hälfte lag in Ostberlin, aber wer Brunnenstraße sagte, meinte fast immer die im Westen. Sie war die Einkaufsstraße im Norden Berlins und für uns »nur einen Sprung« entfernt. Ein-, zweimal in der Woche spazierte meine Mutter mit mir dorthin. Im Sommer, sie mit einem weit schwingenden, wadenlangen Blümchenkleid und nicht allzu großer Einkaufstasche, um an der Sektorengrenze nicht aufzufallen, ich mit kurzer Lederhose, bunt kariertem Hemd und weißen Kniestrümpfen. Der Bürgersteig war voller Menschen, viele aus dem Ostteil oder Umland. Manche kamen nur, um zu gucken.
Es müssen weit über hundert Geschäfte gewesen sein, aufgereiht wie auf einer Perlenschnur. Mit von Zauberhand gefüllten Schaufenstern und leuchtenden Reklametafeln. Es gab praktisch alles: Radio- und Elektroartikel, Fahrräder, Bekleidung, Uhren, Kaffee, Süßigkeiten, Lederwaren, Seifen, Parfüms. Und mindestens zwei, drei Spielzeuggeschäfte. Die Vitrinen voller Verführungen. Indianer! An den Zeitungskiosken unzählige bunte Kindermagazine und Comics! Und dann machte ich als Knirps dort noch eine Entdeckung, bei einem Schuhkauf: »Lurchis Abenteuer«. Die grünen Heftchen mit den lustigen Geschichten über den gut beschuhten Feuersalamander. Für uns Kinder umsonst, auch ohne Schuhe. Sobald wir nahe an den Salamander-Laden kamen, hielt mich nichts mehr.
»Mama, darf ich vorrennen und nach einem neuen Lurchi fragen?«
»Ja, aber warte dort.«
Als Vier- oder Fünfjähriger musste ich höllisch aufpassen, meine Mutter nicht in den Menschenmassen zu verlieren. Trotzdem ist es manchmal passiert – für ein paar Minuten. Da kullerten die Tränen, und zum Trost gab es ein Eis am Stiel oder eine Banane. Gleich an der nächsten Straßenecke, beim nächsten Obststand mit einem laut preisenden Händler: »Sechs Bananen für ’ne Mark. Ach, sieben, ne, acht. Und ick pack noch ene druff, für’n Heimweg!« Leicht fleckige Bananen gab’s für die Hälfte. Das passte meiner Mutter haushälterisch, und mir schmeckten sie sogar noch besser, süßer.
In einem Radiogeschäft in der Brunnenstraße erlebte ich auch den ersten Plattenkauf meines Lebens: »Das machen nur die Beine von Dolores«. Von Gerhard Wendland. 1952 der Hit. Für mich wichtiger: meine erste Nietenhose. Bei »Held« erstanden, dem neu gebauten Kaufhaus an der Ecke Stralsunder – »Spare Geld – kauf bei Held«. Nietenhosen waren damals große Mode und so etwas wie Jeansvorläufer. Meine war schwarz mit bunt kariertem Umschlag und jeder Menge Nieten an den Gürtelschlaufen und Taschen. Und ich war stolz!
Sachen aus dem Westen mussten eisern erspart werden. Der eine hatte von dort ein Nickihemd und eine kurze Lederhose, der andere helle Jubo-Lederschuhe mit dicken Specksohlen und die Nietenhosen. Glückliche besaßen das Nickihemd, die Leder- und die Nietenhose und auch noch die Lederschuhe. Andere nur die Wünsche. Aber für gewöhnlich hatte jeder von uns gute Sachen, Sonntagssachen. Einiges kam aus Westkaufhäusern. Meine Spielklamotten waren gemischt, manche waren Westsachen (die unverwüstliche Lederhose mit den Hirschhosenträgern), manche Ostsachen (die Turnschuhe). Beim Westbummel war man jedenfalls als Ostler nicht an der Kleidung zu erkennen. Irgendwie lief man ähnlich rum. Und auch im Westteil lebten Leute ärmlich. Der Unterschied lag mehr in der Zahl: Hatte man eine oder drei Nietenhosen im Kleiderschrank. Das war keine Frage des Geschmacks, sondern des Geldes, das unsere Eltern verdienten. Eben Ostmark oder korrekt »Deutsche Mark der Deutschen Notenbank«. Arbeiter kamen Anfang der fünfziger Jahre mit annähernd 300 Mark nach Hause. Manche spazierten vorher mit der Lohntüte in die nächste Eckkneipe und dünnten sie weiter aus.
Bei unseren Vätern kam das nicht vor – oder nicht oft. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass irgendeiner lallend über den Hof der 66 torkelte und wenig später eine Riesenbrüllerei aus dem Fenster quoll. Es waren meist einfache Leute, Schornsteinfeger, Drucker, Maurer oder Rohrleger, wie mein Papa. Auch ein Polizist wohnte im Hinterhaus, Jürgens Vater. Da schalteten wir schon auf »Vorsicht«, war aber unnötig, als Vertreter der Staatsmacht machte er sich nie bemerkbar. Am Gehaltstag brachten die alle nicht viel heim. Doch die meisten unserer Eltern waren fleißig, sparsam und wollten endlich normal leben, und im besten Falle: halbwegs gut.
Sie waren damit beschäftigt, sich dringliche Wünsche zu erfüllen. Dafür wurde Monat für Monat ein kleiner Betrag auf die Seite gelegt. Unverdrossen, unermüdlich. »Größere Anschaffungen«, hieß das. Mal sollte es eine Uhr sein, mal ein Mantel, ein Radio oder eine Stehlampe. Nach dem Kauf stand man zu Hause beglückt vor dem neuen Stück und ließ sich von dem stolzen Gefühl, wieder was erreicht zu haben, erwärmen. Und weiter ging’s, zur nächsten Anschaffung. Stück für Stück richtete man sich ein – und auf.
Doch größere Möbellieferungen gab es nicht, nicht in unserem Haus und auch nicht in unserer Gegend. Alle hatten sich mit gerettetem, geerbtem, getauschtem Mobiliar irgendwie eingerichtet – behaglich oder kärglich. In der einen Wohnung standen Möbel mit poliertem Furnier, ein Stockwerk höher waren sie behelfsmäßig zusammengeleimt. An diesen Grundausstattungen, also Schränke, Betten, Tische, Sessel, mit denen man in die Nachkriegszeit gestartet war, änderte sich lange nichts oder nicht viel. Es dauerte noch etwas, bis die Nierentische kamen, und noch etwas länger, bis man sie auch schön fand. Zunächst füllten die neuen Anschaffungen Lücken, modernisierten hoffnungslos veraltete Dinge, machten das Zuhause wohnlicher, komfortabler. Es ging voran, in kleinen Schritten. Manchmal in sehr kleinen. Der verchromte Wasserhahn war so einer. Mein Papa hatte den silberglänzenden Hahn von der Arbeit mitgebracht und anstelle des alten Messingteils angeschraubt. An der Küchenwand, gleich daneben, befestigte er noch eine kleine Glasablage für unsere rotbraunen Bakelit-Zahnputzbecher. Eine Freude damals.
Im Grunde war unsere knapp 75 Quadratmeter große Wohnung ganz herkömmlich eingerichtet: In der Mitte vom Wohnzimmer, unter einer mehrarmigen Deckenlampe, stand der große Ausziehtisch, vier Stühle ringsum, dazu kam ein schwerer Schrank mit Glasvitrine, die unentbehrliche Singer-Nähmaschine, eine alte Musiktruhe mit immer rauschendem Radio und aufklappbarem Plattenspieler, ein wuchtiger Schreibtisch (sein Fußraum war mein allererstes Versteck), zwei braun bezogene Sessel mit passender Couch und einem kleinen Tisch samt Stehlampe. Und wie in fast allen Wohnungen waren auch die Dielen gestrichen: rotbraun. Darauf lag ein orientalisch gemusterter dicker Fransenteppich. Neben dem dunkelgrünen Kachelofen führte eine Tür ins Schlafzimmer. Auch hier der übliche Standard: Schlafzimmerschrank, Ehebetten, auf beiden Seiten kleine Nachttische, Frisierkommode mit Glasplatte und Spiegel – und mein Gitterbettchen.
Die Küche war gleich rechts neben der Wohnungstür. Bis Mitte der fünfziger Jahre stand dort noch ein großer, weiß gekachelter Herd, der an kalten Wintertagen auch geheizt wurde. Darauf gekocht wurde aber nicht mehr, das erledigte meine Mutter mit dem Gasherd. Daneben standen ein kleiner Kohlenkasten, dann ein Büfett, vis-à-vis ein Küchentisch, aus dem zwei Waschschüsseln herausgezogen werden konnten – eine war für den Abwasch, in der anderen wurde ich als Baby gebadet. Unter dem Fenster zum Hof befand sich ein Spind und in der Ecke der nun verchromte Wasserhahn mit emailliertem Ausguss. Kein Warmwasser, kein Waschbecken. Kein Problem – man kannte es nicht anders. Bad und Balkon, wie in den Vorderhauswohnungen, blieben für mich noch lange Zeit ein Traum. Wenigstens hatten wir eine Innentoilette, in der Größe einer Telefonzelle, mit einem Trieselklo aus Gusseisen. Für die Not in nächtlichen Stunden standen unter den Betten Nachttöpfe. Nicht nur für kleine Kinder wie mich. Auch für die Großen, ganz nach alter Sitte. Die Dinger waren aus Glas, Keramik oder glasiertem Blech. Je nach Geschmack oder familiärer Tradition.
So oder so ähnlich sah es damals in den meisten Berliner Wohnungen aus – Ost wie West. Etwas aus dem Rahmen fiel unser Flur. Er war schmal und recht lang, also bestens geeignet für meine Radübungen. Und er hing voller Siegerschleifen meines Vaters. Schleife an Schleife, den ganzen Flur entlang. Eine bekam er Ende der vierziger Jahre für das Radrennen »Berlin-Wismar«. Über 250 Kilometer! Er wird danach Sitzprobleme gehabt haben. Doch am folgenden Wochenende war mein Papa bestimmt wieder am Start. Für den nächsten großen Ritt bei den Senioren. So war es vom Frühjahr bis zum Herbst, meine Mutter und ich immer dabei. Sie mit ihrem feinen Sportrad, ich vorn im Körbchen. Radsport war äußerst populär. Ein Champion wie Täve Schur wurde in der DDR verehrt wie ein Nationalheld. Die Leute kamen in Scharen, säumten die Strecke, standen in Zehnerreihen am Ziel. Man wollte dabei sein, wollte die Begeisterung mit anderen teilen. Die Menschen dürsteten nach Unterhaltung, Zerstreuung, Ablenkung. War ja sonst nicht viel los.
Allein in Ostberlin gab es damals wohl zwei Dutzend Radsportvereine – meistens als Betriebssportvereine gegründet. Und so hießen sie auch: »BSG Post«, »BSG Turbine Gaswerke«, »BSG Einheit«, »BSG Empor«, »BSG Rotation«. Sportlich Rivalen, menschlich eine Familie. Unser Familienzweig war die SG Semper. Blaues Trikot mit weiß-rot-weißem Brustring. Ich kannte alle, spätere DDR-Meister wie Rainer Pluskat und Harry Seidel oder den Silbermedaillen-Gewinner von Rom, Manfred »Alka« Klieme. Sie wurden als Jugendfahrer von meinem Vater trainiert. Er war ein guter Trainer, hart mit Herz. Klar, dass ich auch für Semper war und sogar mal einen Weihnachtswunsch für den Verein opferte. Mit krakeliger Schrift malte ich auf meinen Wunschzettel: »Detlef Zabel soll zu Semper.« Der Vater von Erik war damals mein Lieblingsradrenner, und der sollte zu meinem Lieblingsverein. Klappte nicht. Es wurde eine Aufzieheisenbahn.
An irgendeinem lauen Sommerabend Anfang der fünfziger Jahre fand in der Kollwitz 66 ein Hoffest statt. Alle machten mit. Die einen hatten mit wenigen Zutaten Kuchen gebacken, andere ein paar Brotscheiben dünn mit Schmalz bestrichen, Hammels Getränke aus ihrer Fabrik spendiert. Quer über den Hof wurden Wäscheleinen gespannt und mit vielen bunten Papierlampions dekoriert. Als es dunkel wurde, erschien der sonst so triste Innenhof wie verzaubert. Musik kam abwechselnd vom Leierkasten und einem Radio, das ans offene Fenster gerückt und aufgedreht worden war. Die Stimmung stieg, die Stimmen auch:
»Wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen
und die erste und die zweite Hypothek.«
Es wurde getanzt, gelacht, getrunken. Und wir Kinder mitten im Getümmel. Ich war wohl der Kleinste, jedenfalls wurde ich von meiner Mutter bald ins Bett gebracht. Doch die gedämpften Töne vom fröhlichen Feierlärm waren auch dort noch zu hören. Und so lauschte ich, solange ich konnte und endlich einschlief.
So toll es alle fanden, es sollte sich nicht wiederholen. Vielleicht war es das falsche Radioprogramm, das da aus dem Küchenfenster dudelte, der RIAS: eben noch Bully Buhlans»Mäcki-Boogie« und Trubel, plötzlich Nachrichten. Vom »Hetzsender«. Eher nicht. Dazu war man zu vorsichtig. Jeder hatte schon davon gehört, dass Leute für das Verbreiten von RIAS-Meldungen verhaftet wurden. »Abgeholt worden«, sagte man damals. Manchmal waren das Gerüchte, manchmal nicht.
Angst lag wie ein Hauch über vielem. Zu vielem. Man wuchs damit auf, sie gehörte irgendwie dazu. Nur nicht aus der Reihe tanzen. Nicht aufmucken! Stalins Erben fehlte jede demokratische Legitimation – und so verhielten sie sich auch. Jede Abweichung wurde platt gewalzt. Freie Wahlen gab es in Ostdeutschland nur zweimal: ganz zum Anfang und ganz zum Schluss. Als im Oktober 1946 die Stimmen in der Sowjetischen Besatzungszone und in Groß-Berlin ausgezählt worden waren, herrschte in der frisch aus KPD und SPD (und unter sowjetischem Kommando) zusammengenagelten SED Sprachnot. Zwar kam die Einheitspartei in den fünf Ländern insgesamt auf 47,5 Prozent, aber das bedeutete Koalitionsregierungen. Reinreden! Die Katastrophe erlebte sie in Berlin. Hier wurden auch die von ihr als »Rest-SPD« verspotteten Sozialdemokraten zu den Wahlen zugelassen. Die »Rest-SPD« gewann triumphal: 48,7 Prozent der Stimmen. Selbst die CDU lag mit rund 22 Prozent noch vor der SED, die nur auf 19,8 kam. Das sollte sich nicht wiederholen! Ab da gab es nur noch Einheitslisten. Die Zustimmung war nun immer überwältigend, sie wurde der Einfachheit halber vorher festgelegt. Etwa so:
Genosse Erster Sekretär, die Bevölkerung wird wieder ein begeistertes Bekenntnis zu den Kandidaten der Nationalen Front abgeben.
Nu, wie eindrucksvoll war es bei den letzten Wahlen?
99,7 Prozent.
Nu, das Bewusstsein ist zielstrebig weitergewachsen, aber vereinzelt gibt’s bei uns immer noch schwankende kleinbürgerlicheElemente. Wir sollten realistisch sein, ich denke, es werden 99,4 Prozent.
Und die wurden es dann. Eine Farce. Wie viele der propagierten Fortschritte. Sicher gelang es auch im Osten, die Not der Bevölkerung zu lindern, doch die Hoffnungen auf ein besseres, freieres Leben schwanden mehr und mehr. Der anfängliche Enthusiasmus war merklich vom fest installierten Kommandosystem aufgezehrt worden. Als Walter Ulbricht 1952 den »planmäßigen Aufbau des Sozialismus« in der DDR verkündete, hörten viele aus der »herrschenden Klasse« (damit waren die Arbeiter gemeint) kaum noch zu. Verheißungen machen nicht satt.
Politik erreichte bei vielen nur den Küchentisch, am feierlichen Wohnzimmertisch hatten unsere Väter ein anderes Thema: den Krieg. Er war zwar schon einige Jahre vorbei, doch er steckte noch immer unter ihrer Haut. Das, was sie erlebt hatten, war zu grauenvoll, das verschwand nicht einfach so. Sie waren tief traumatisiert. Und nun mussten sie versuchen, da selbst rauszufinden. Sie redeten – miteinander. Wenn wir Besuch bekamen, Radsportfreunde, Kollegen oder Nachbarn, nach kurzer Zeit waren sie bei ihren Geschichten. Stundenlang, jahrelang. Wie oft habe ich in einer Zimmerecke mit Bauklötzern oder Indianern gespielt und heimlich ihren Gesprächen gelauscht. Allzu sehr gegruselt oder geängstigt haben sie mich nicht. Sicher, es ging darin um Tote und Verwundete, um Hunger, Zerstörung und Gefangenschaft. Doch der Schrecken dahinter blieb dem kleinen Jungen, der ich war, verborgen. Mehr noch: Nach meiner Erinnerung erzählten sie sich meist die komischen, launigen Begebenheiten, die sie im Krieg eben auch erlebt hatten. Schnurren halt. Ihre probate Therapie. Dass Lachen befreien kann, konnte ich sogar als Kind spüren. Es hellte sich auf, jedes Mal. Der Abschied war meist heiter.
Und man blieb nüchtern. Vielleicht war es woanders anders, bei uns zu Hause gab es jedenfalls bei solchen Runden entweder Ersatzkaffee oder Tee zu trinken. Wein- oder Bierflaschen hatten wir gar nicht vorrätig. So etwas gab es mal am Wochenende und sonst zu Geburtstagen oder zu Weihnachten. Einfach eine Flasche Wein aufmachen, dafür war gar kein Geld da. Solche bescheidenen Wohlstandsgesten konnten wir uns erst ein paar Jahre später erlauben. In den frühen Fünfzigern war das noch Luxus wie »echter Bohnenkaffee«. Den gab es nur in dieser Wortkombination. Der Alltagskaffee war Malzkaffee oder einfach »Muckefuck«. Zu kaufen in einer weißen Tüte mit blauen Punkten und dem Etikett »Kathreiners Malzkaffee«. Unser ständiges Getränk zum Frühstück und zum Mittagessen und zum Kuchen. Das Gewese um »echten Bohnenkaffee« konnten wir Kinder nie verstehen, viel zu bitter. Zum Abendbrot kam dünner schwarzer Tee auf den Tisch. Brause oder Malzbier musste man sich einteilen – etwa drei, vier Flaschen pro Woche kaufte meine Mutter bei »Westphal«. Wenn die ausgetrunken waren, wurden die leeren Bügelverschluss-Flaschen mit Himbeersirup und Wasser gefüllt. War auch gut, doch das Prickeln fehlte.
Milch fehlte leider nicht. Ich trank sie nur unter Protest, sie musste in mich reingezwungen werden. Aus Sorge vor irgendwelchen Krankheitskeimen wurde sie stets abgekocht, und dabei bildet sich dummerweise diese eklige Pelle. Selbst nachdem sie abgeschöpft worden war, blieben meine Lippen fest zusammengepresst. Also gab’s »Pappchen« – Milch versteckt sozusagen. Das Einkaufen von Milch war dagegen ein Erlebnis. »Komm, wir müssen noch zu Frau Bansemer«, so lautete der Zauberspruch. Und der führte mich – meine Mutter an der einen Hand und eine Milchkanne in der anderen – zu richtigen Kühen. In der Kollwitz. Irgendwo auf der linken Straßenseite Richtung Dimitroff-, zwischen Wörther- und Szredzkistraße, gab es auf einem der Hinterhöfe eine kleine »Molkerei« samt Kuhstall mit schwarz-weiß gefleckten Kühen. Die standen brav im Stroh und mampften geduldig vor sich hin, und muhten mitunter. Alles roch streng nach Dorfleben. Mitten in der Kollwitz! Zwar gab es auch andernorts im Prenzlauer Berg noch einige solcher Hinterhof-Meiereien, doch es war damals schon etwas Besonderes. Zum Kühe-Gucken mussten wir jedenfalls nicht auf’s Dorf. Dank Frau Bansemer und der frischen Milch.
Zu jener Zeit machte ich über die Milch noch eine andere aufregende Entdeckung: Es gab sie auch als Pulver. Selbst der Weg zu dieser Erkenntnis war aufregend. Um die trostlose Lage in unserem Küchenschrank wenigstens für ein paar Wochen aufzubessern, nahm meine Mutter allen Mut zusammen und fuhr mit mir an einem Winterabend nach Westberlin. Nach Tempelhof oder Schöneberg? Keine Ahnung, es war schon dunkel und ich noch klein. Wir gingen schließlich in ein Haus, an einen Schalter. Meine Mama war recht aufgeregt, daran erinnere ich mich gut, weil mir deshalb etwas bange wurde. Sie kramte in ihrer Einkaufstasche und zeigte schließlich irgendwelche Papiere. Ihren Ausweis bestimmt. Der Mann nickte kurz, nahm ein großes Paket aus dem Regal und schob es über den Tisch. »Viel Glück«, sagte er noch. Dass es ein CARE-Paket war, habe ich erst später erfahren. Aber genau das war es. Ein Hilfspaket der Amis, das damals millionenfach an Verteilungsstellen in Westdeutschland und Westberlin geschickt wurde.
Der Karton war nicht nur groß, er war auch schwer. Und meiner Mutter war klar, dass wir damit nie über die Grenze kommen würden. Jedenfalls nicht auf einmal. Also fuhren wir mit der U-Bahn zu West-Bekannten. Dort wurde mit Bedacht die Einkaufstasche gepackt – voll, doch nicht zu voll. In meinen Manteltaschen verschwanden kleinere Dinge wie Rosinen und Schokolade. Wenig später saßen wir wieder in der U-Bahn und passierten die Grenzstation »Potsdamer Platz«. Keine Kontrollen, alles ging gut. Am nächsten Abend wiederholten wir die Fuhre. Dann war unser Küchentisch voll mit Dosenfleisch und Dosenkäse, Honig, Zucker, Mehl, Kaffee, Schmalz und anderen Dingen. Und Milchpulver. Lauter Kostbarkeiten damals.
Bei solchen etwas größeren Selbstversorgungsgängen begleitete einen stets die Furcht, erwischt und dann als angeblicher Lebensmittelschmuggler bestraft zu werden. Derartige Fälle machten oft die Runde. Dann wurde im Haus oder auf dem Hof geflüstert: »Wissen Sie schon? Der kleine Dicke, drei Häuser weiter, ist verhaftet worden. Soll geschoben haben.« Das schüchterte ein, auch wenn es bei den richtigen Schiebern um mehr als um zwei, drei Dosen oder Tüten ging. Doch wie sicher konnte man da sein? Kam man bei einer Kontrolle mit der Standardausrede »Habe ich geschenkt bekommen« noch durch, wenn die Tasche voll war? Es war wie beim Lotto.
Schmuggel- und Schiebergeschäfte zwischen den Westsektoren und dem Ostsektor waren alltäglich: Kaffee, Zigaretten und Tabak wurden in den Osten geschleust, Butter, Fleisch und Wurst in den Westen. Bei einem Wechselkurs von 1:4 waren Lebensmittel in Ostberlin weit unter Wert zu kriegen. Da stiegen manche Ganoven groß ein. Unterm Strich verschwanden so Monat für Monat Tausende Tonnen und verschlimmerten die Versorgungslage der Menschen im Ostteil noch mehr.
Bei größeren Ladungen Schmuggelgut wurde es schwierig, denn der Verkehr über die Grenze war schon recht früh vonseiten der DDR eingeschränkt worden. Autos und Motorräder aus Westberlin durften zwar in den Osten Berlins fahren, aber nicht in das DDR-Umland. An sämtlichen Ausfallstraßen rund um die Stadt versperrten Schlagbäume die freie Fahrt. Auf beiden Straßenseiten. Die Wegsperre auf der Zufahrtspur nach Ostberlin sollte vor allem DDR-Bürger, die nicht in Berlin wohnten, stoppen. Waren die erst einmal im Osten, waren sie praktisch schon im Westen. Eine Schreckensvorstellung für die Funktionäre. Also wurde abgesperrt und kontrolliert. Ohne Personalausweis, der in Ostberlin ausgestellt worden war, war kaum ein Durchkommen. Selbst an Flüssen und Kanälen warteten Kontrollposten: »Den Ausweis bitte!«
Ostberliner hingegen durften ohne Sondergenehmigung weder mit dem Motorrad noch mit dem Auto nach Westberlin. Nur das Fahrrad war erlaubt. Damals erzählte irgendein Freund meines Vaters eine lustige Begebenheit, vielleicht war es auch ein Witz, ich habe sie jedenfalls nicht vergessen:
Ein Radfahrer kam mit einem kleinen Rucksack an die Grenze. Prompt wurde er von einem Volkspolizisten gestoppt: »Was haben Sie da in dem Rucksack?«
»Sand.«
»Na, dann machen Sie den Sack mal auf!«
Der Mann knüpfte den Rucksack auf – und tatsächlich, es war nur Sand drin.
Ein paar Tage später wiederholte sich die Szene. Wieder kam der Radfahrer mit dem Rucksack, wieder kontrollierte ihn der Polizist, wieder sah der nur Sand. So ging es immer weiter, bis der Volkspolizist beim achten oder neunten Mal völlig verzweifelt war: »Also, ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen nichts passieren. Aber sagen Sie mir bitte: Was schmuggeln Sie eigentlich?«
»Fahrräder.«
Dass Ostberliner nicht mit Autos oder Motorrädern »rüber«fahren durften, war zu verschmerzen: Es betraf sie ja kaum. Autos im Privatbesitz waren selten, entweder hatten sie mit viel Glück Krieg und Beschlagnahmen überlebt, wie Hammels Opel P4, oder sie gehörten den wenigen Geschäftsleuten, die sich einen F8, F9 oder sogar einen in Eisenach gebauten EMW 340 leisten konnten. Selbst den Traum von einem Motorrad konnte man sich erst nach beharrlichem Sparen und einer mehrjährigen Wartezeit erfüllen. Meine Eltern waren 1954 am Ziel: Für 2290 Mark kauften sie sich eine EMW R35. Mit umwerfenden 14 PS. Und mit einem Beiwagen, der auch rund 800 Mark kostete. Wir waren überglücklich. Es war das zweite Gefährt in der Kollwitz 66.
Schon ein kleiner Luxus zu einer Zeit, in der auch im Westen die meisten noch ohne eigenen Motor unterwegs waren. Nun knatterten wir also an den Wochenenden mit Gespann zu den Radrennen. An den anderen Tagen stand die EMW geputzt in der Garage, im Hinterhof der 69. Ging ja auch so. Unsere Gegend war von Straßenbahn- und U-Bahn-Gleisen regelrecht eingekreist. Auch zum S-Bahnhof Prenzlauer Allee war es nicht weit. Bis zum Januar 1953 konnte man mit der Straßenbahnlinie 4 sogar noch über die Sektorengrenze an der Eberswalder und Bernauer fahren. Dann machte der Kalte Krieg damit Schluss. Nun mussten alle Fahrgäste dort aus den Wagen der BVG-Ost aussteigen, zu Fuß über die Grenze gehen, und konnten erst, nach etwa fünfzig Metern, mit den wartenden Zügen der BVG-West weiterfahren. In der Gegenrichtung war es umgekehrt.
Die Fahrt kostete für uns Kinder 15, für Erwachsene 20 Pfennige. Kassiert wurde von einem Schaffner in grau-schwarzer BVG-Uniform, vor der Brust die »Münzenorgel«, eine blecherne Wechselkasse, in der er Kleingeld der Größe nach rasch verschwinden ließ und wieder hervorzauberte. Alles mit einer Hand, in der anderen hielt er ein kleines Brett, auf dem die Fahrscheinblöcke festgeklemmt waren: für Erwachsene, Umsteiger, Kinder. Während ich noch über die Fingerfertigkeit an der »Orgel« staunte, drängelte er sich schon weiter durch die Bahn: »Jemand zugestiegen?« Manche taten, als hätten sie die Frage glatt überhört, mit einem Gesichtsausdruck: Also ich bin hier drin geboren. Später, als Schulkinder, versuchten wir auch mit dieser Masche durchzukommen und die 15 Pfennige lieber anders anzulegen. Für eine Eiswaffel in der 66 etwa.
Meine Eltern sparten auch manchmal am Fahrgeld, nur anders – sie liefen. Jedes Mal, wenn wir unsere Tante Elsa am Reinickendorfer Schäfersee besuchten, wusste ich schon vorher: Das dauert, und endet mit einem langen Nachtmarsch. Hurra! Sie behielten die West-Pfennige im Portemonnaie, und ich rannte auf dem Heimweg selig von einem beleuchteten Schaufenster zum nächsten. Völlig aufgedreht und ungestört. Denn selbst die Brunnenstraße war nachts fast menschenleer. Die Leute saßen zu Hause, hörten Radio, spielten Karten oder schliefen schon.
Aber ich war noch draußen und erkundete die Geschäfte. Besonders die Spielzeugläden mit ihren vollgestopften Auslagen. Bergeweise Kinderwünsche. Zwar unerreichbar hinter Schaufensterscheiben, und dennoch hatte man in der Fantasie damit auf der Stelle zu spielen begonnen: Wiking- und Siku-Autos, Metallbaukästen, Kaufmannsläden, Cowboys mit Planwagen, Ritterburgen, Blechpanzer, Indianerhauben, Zündplättchen- und Wasserpistolen. Manchmal fuhr sogar eine elektrische Eisenbahn rastlos um all die ausgestellten Spielsachen. Mitten in der Nacht! Und irgendwie nur für mich. »Dieter, komm!« Ich musste weiter. So ging es kilometerlang, bis zur Ecke Bernauer. Ab da war Osten und dunkel. Und ich augenblicklich müde. Und auch das blieb in meiner frühen Kindheit gleich: Den letzten Kilometer bis zur Kollwitz musste mein Papa mich immer tragen.
Eine andere Gewohnheit betraf nicht nur mich, sondern fast die ganze Gegend: Zum Wochenende hin wurde gebadet – im Stadtbad in der Oderberger. Wohnungen mit Bad gab es gerade mal in Vorderhäusern, wenn überhaupt. Manche Aufgänge hatten nicht mal Innentoiletten, und die Mieter mussten eine halbe Treppe höher oder tiefer und sich ein winziges, zugiges Klo mit den Nachbarn teilen. Also fand sich jeder, der keine eigene Wanne und keinen besser ausgestatteten Verwandten oder Bekannten hatte, der einen großzügig zum Fremdbaden einließ, irgendwann in der Oderberger ein. Meist am Freitag oder Sonnabend. Da war dann Hochbetrieb. Wem geregelte Abläufe weniger bedeuteten, der wich auf andere Tage aus. Der Königstag war aber der Sonnabend.
Auch für uns. Nach dem Frühstück und kleineren Einkäufen packte meine Mutter Handtücher, Seife und frische Wäsche in unsere Badetasche, und flugs machten wir uns auf den Weg, zehn Minuten zu Fuß. Sechs Stufen hoch, die schwere graue Holztür aufgedrückt, noch mal ein paar Stufen, durch eine Pendeltür zur Kasse: »Einmal Wanne, bitte.« Kostete wohl 30 Pfennige. In der Badeanstalt erschien mir alles riesig, wie in einem Schloss: hohe gewölbte Räume, die Wände mit weißen Fliesen bedeckt, rechts und links Treppenaufgänge mit schmiedeeisernem Geländer, in dem Schilfgräser und Fische dargestellt waren. Auch der Lärm, das Kreischen aus dem Schwimmbad, klang hier anders. Es hallte überall. Für mich war das immer eindrucksvoll.
Wir mussten in die erste Etage zur Badeabteilung. Und zunächst auf einer der Holzbänke warten. Bis »Der Nächste!« uns galt. Dann wurden wir in einen sehr langen Gang geführt, von dem alle paar Meter Badekabinen abgingen. Eine Frau in weißem Kittel und großen Holzpantinen schrieb mit Kreide die Zeit auf eine kleine, an der Tür befestigte Schiefertafel, und wir riegelten von innen zu. Unser Reich für knapp zwanzig Minuten: etwa fünf Quadratmeter, drei, vier Kleiderhaken, eine an der Wand verschraubte Sitzbank aus Holzlatten, ein immer beschlagener Spiegel und jede Menge Rohrleitungen – wie auf einem U-Boot. Oft lief das Wasser schon. Und schwups, saßen wir in der Wanne. Ich war erst fünf! Meine Mutter mit Seife, ich mit einem winzigen Segelschiff. Noch vor Ablauf der Zeit klopfte es an der Tür: »Fertig werden!« Das waren wir. Während ich noch schnell mein Schiffchen verstaute, scheuerte die Badefrau schon kopfüber mit Ata die leergelaufene Wanne. Für den nächsten Besucher.
Wieder zu Hause wurde gleich das Mittagessen vorbereitet, meist Suppe. Der Sonnabend war auch Eintopftag, nicht nur bei uns. So als ob die Küche Schwung holen wollte für das »festliche« Sonntagsessen. Mein Papa kam, wie fast alle Väter, so gegen halb eins von der Arbeit – damals war der Sonnabend noch ein halber Werktag. Nachdem er sich schnell Gesicht und Hände gewaschen hatte, wurde die Erbsen- oder Kartoffelsuppe aufgeteilt, dazu für jeden eine Scheibe Brot und eine Tasse Muckefuck. Und es wurde am Küchentisch viel beredet: Wie der Tag bisher war, was man am Wochenende so plante, ein Radrennen besuchen oder Bekannte. Waren wir mit dem Essen fertig, flitzte auch mein Vater in die Oderberger. Mit oder ohne Rad, mit oder ohne Windjacke, doch bestimmt mit einer seiner geliebten Knickerbocker aus Manchesterstoff. Der sportliche Mann jener Zeit trug Knickerbocker, wie der »Kombiniere«-Meisterdetektiv Nick Knatterton, Held einer Comicserie. Ach, und er bog in der Badeanstalt in Richtung Duschen ab. Mein Papa auch.
Dann kam der Sonntag. Und der begann für uns Berliner Kinder pünktlich um 10 Uhr mit »Onkel Tobias vom RIAS«. Ich hockte vor dem Radioapparat auf einem Sofakissen und wartete aufgeregt. Erst kam das Pausenzeichen und dann der Kindergesang:
»Der Onkel Tobias vom RIAS ist da,
was wird er wohl heute uns bringen?
Er bringt uns zum Lachen,
will Freude uns machen,
erzählen und spielen und singen!«
Kaum verklungen, sagte eine Knaben- oder Mädchenstimme: »Die RIAS-Kinder besuchen Onkel Tobias.« Und schon klopfte es an dessen Tür. »Ja, ja, ja, immer rein meine Kinderlein, und frohen Sonntag.« Vielleicht etwas viel »RIAS«, aber Klappern gehörte schon immer zum Handwerk. Dann gab es eine halbe Stunde Frohsinn, Lieder, Geschichten und einmal im Monat Kasperletheater. Es war wie beim Hörspiel. Wir Kinder tauchten träumend ins Radio ein. Bis zum Schlusslied:
»Der Onkel Tobias vom RIAS war da,
vorbei sind für heut’ nun die Lieder.
Es hat uns gefallen, drum sagen wir allen:
Am Sonntag, da kommen wir wieder!«
Wir auch. Jahrelang.
Es gab auch kaum ein anderes hörbares Kinderprogramm. Und Fernsehen? Das ging zwar Ende 1952 fast gleichzeitig in Ost (planmäßig zu Ehren von Stalins 73. Geburtstag) und West mit Versuchsprogrammen auf Sendung, doch von den anfangs gerade mal sechzig DDR-Flimmerkisten hatte es bestimmt keine in die Kollwitz geschafft. Wir wussten zumindest von keiner, und so was sprach sich rum!
Blieb zu Hause nur die Spielecke. Meine war in der Küche, ein Kindertisch mit kleinem Hocker. Auf dem Tischchen war mein ganzer Besitz aufgebaut: eine blecherne Sparbüchse, ein gelbroter Minol-Tankwagen, ein Segelboot, ein Schuco-Auto, das – sterbenslangweilig! – nur im Kreis fuhr, ein Holzbaukasten, ein Klumpen Knete, ein Karton mit Märchenwürfeln und vielleicht zehn Elastolin-Indianer und -Cowboys. Unter dem Tisch lagen noch zwei bunte Bälle. Und dann war da noch eine große hellblaue XOX-Keksedose, bis an den Rand gefüllt mit kleinen weißen Margarinefiguren aus Kunststoff: Häuser, Scheunen, Zäune, Pferde, Hühner, Giraffen, Elefanten, Bäume, Bauern, Motorradfahrer, wieder Indianer, wieder Cowboys. Meist zwei bis vier Zentimeter groß, egal ob Haus oder Huhn. Das war manchmal schon ulkig und doch egal. Beim Spielen brachte man alles unter einen Hut, irgendwie.
Dazu kamen noch ein paar Bilderbücher wie »Der Struwwelpeter«. Die Geschichten konnte ich zwar noch nicht lesen, Furcht bekam ich trotzdem bei jedem Blättern. Allein die Zeichnungen jagten mir Schauder ein. »Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug«, grausam. »Max und Moritz« dagegen war mein Lieblingsbuch – bis auf den »letzten Streich«, den mochte ich nicht: Max und Moritz durften nicht sterben! Das war’s etwa. Ende der Aufzählung meiner Besitztümer. Das Spielzeug, das man hatte, war ein Sammelsurium aus alt und neu, Blech, Holz und Bakelit, West und Ost. Vieles sah aus wie vor zwanzig Jahren, wurde tatsächlich nur wenig verändert weiter hergestellt. Nazi-Kriegsspielzeug dagegen war wie durch eine geheimnisvolle Kraft verschwunden – na, fast. Da blieb eben nicht viel. Jedes Teil wurde gehütet wie ein Schatz.
Auch von unseren Eltern. Gute Spielsachen waren in der Regel nicht für draußen, sie konnten ja verloren gehen oder geklaut werden, und »dafür haben wir die nicht gekauft!«. »Oben« spielten wir mit unserer Habe, »unten« spielten wir miteinander. Wir waren ja genug. Verluste Richtung Kindergarten oder Hort gab es in der 66 nicht. Selbst dort, wo Mütter die Familie allein durchbringen und Geld verdienen mussten, waren die Jungs und Mädchen oft »Schlüsselkinder«. So nannte man die Kinder, die ihren Wohnungsschlüssel an einer Schnur um den Hals trugen. Doch die meisten Mütter damals waren Hausfrauen. Die Rekordquoten an »werktätigen Frauen« erzielte die DDR erst später. Kindergartenbesuche waren eher die Ausnahme. Genauso wie Wohnungsbesuche von Freunden – das mochten viele Eltern nicht so recht. Ich erinnere mich nur an ein einziges Mal vor meiner Schulzeit, dass ein Nachbarsjunge bei uns zu Hause war und mit mir spielte. Er wohnte nebenan, in der durch Bomben schwer beschädigten 68, war in meinem Alter und hatte mit mir »Kinderpost« gespielt. Vielleicht wären wir Freunde geworden, bedauerlicherweise waren die Kriegsfolgen dagegen: Die 68 wurde abgerissen, und er zog weg. Dabei blieb es, bis zu dem Tag, ab dem ich richtig »runter« durfte.
Andere Kinder aus der 66 traf es da besser: Sie hatten Geschwister. Bruder oder Schwester oder beides gleich mehrfach. Ich war von Geschwisterkindern umringt. Von meinen Spielfreunden war nur noch Jörki Einzelkind, doch der wohnte in der 64. Unsere Eltern hatten sich meist in den Nachkriegswirren kennengelernt. Und nach all dem Schrecken waren sie ganz sehnsuchtstrunken nach einem geordneten Leben, nach einer eigenen Familie und eigenen Kindern. Gern auch mehr. Ich wollte das auch, also Geschwister, nicht länger allein sein.
Es war mühsam. Kaum begann ich, darum zu betteln, tischten mir meine Eltern den Klapperstorch auf. Besonders mein Vater, der gab mir sogar noch einen »Geheimtipp«: »Du musst für den Klapperstorch einen Zuckerwürfel aufs Fensterbrett legen, dann kommt er.« Jaaa! Und dann kriege ich meine Evelyne. So hieß eine Tochter von Hammels, den Hausbesitzern. So sollte auch meine Schwester heißen, wie eine kleine Melodie. Tagelang, wochenlang, platzierte ich – gut sichtbar! – einen Zuckerwürfel auf dem Fenstersims vom Schlafzimmer. Nichts passierte, obwohl der Zucker jeden Morgen verschwunden war. Erst dachte ich: Gut, so was kann schon dauern. Dann war ich ratlos, zum Schluss sauer. Der nahm einfach die Würfel und brachte nichts! Meinen letzten verzweifelten Versuch sollte mein Vater nie vergessen. Es war im Frühjahr 1953, wir besuchten zusammen den Zoo. Plötzlich sah ich auf einer umzäunten Wiese eine Kolonie von Flamingos oder Reihern. Für mich waren das, ganz klar, Klapperstörche! Ich rannte sofort los, umklammerte mit meinen Händchen die Gitterstäbe, holte tief Luft, und dann schrie ich so laut, wie ich konnte: »Lieber, lieber Klapperstorch, bring mir eine Evelyne!« Die Leute lachten. Mein Papa löste sich mit hochrotem Kopf aus der Besucherschar und zog mich schnell weiter: »Du wolltest doch zu den lustigen Affen.«
Für Zoo-Besuche war fortan meine Mutter zuständig. Ein unnötiger Rückzieher. Denn nur wenig später bestand für ihn keine Gefahr mehr: Da wurde mir auf unserem Hof von den älteren Kindern amüsiert erklärt, dass die Babys aus dem Bauch der Mutter kämen und dass der Klapperstorch reiner Schwindel sei. Bei der Gelegenheit wurden auch gleich Osterhase und Weihnachtsmann mitliquidiert. An Tränen oder Proteste erinnere ich mich nicht, mein Glaube an die drei sagenhaften Gestalten muss schon erschüttert gewesen sein. Und dennoch, für meine kleine Welt war es ein schwerer Verlust. Wie Evelyne – ich blieb Einzelkind.
Ich weiß nicht, ob es mir half, aber ich begann damals zu ahnen, dass es noch viel schlimmere Verluste geben musste. Einer wurde just zu dieser Zeit ausschweifend betrauert. Wie so oft warf ich vor dem Haus einen Blick auf die Auslagen vom Zeitungsladen, um mir die Fotos anzuschauen. Doch diesmal war auf sämtlichen Titelblättern derselbe Mann mit Schnurrbart und strengem Gesicht abgebildet. Und alles schwarz umrandet. Verwirrt stand ich davor: Was hat das zu bedeuten? Der dicke Zeitungshändler lehnte an der Tür und sagte nur so etwas wie: »Det is Stalin. Und nu issa tot.« Basta. Dass das Stalin war, wusste ich selber. Schließlich hingen im Osten überall Bilder von ihm – auf Postämtern, in Krankenhäusern, HO-Schaufenstern, Büros und Schulen oder, ganz groß, an manchen Fabriken und grauen Häusern. Der war nun also tot? Das war neu. Dann kam bestimmt meine Mutter aus der Haustür, und ich hüpfte an ihrer Hand davon.
Der »Generalissimus« und »weise Führer aller Völker« war am 5. März 1953 verstorben. Die sozialistische Welt stürzte in eine Art Schockstarre. Für viele stellte sogar die Erde ihre Umdrehung ein. Wie weiter ohne IHN? Bestimmt haben meine Eltern an diesem Abend auch über Stalin gesprochen, bei Wurstbrot und Tee vermutlich, doch ganz sicher ohne Trauerminute. Was auch immer sie sprachen, sie mochten Stalin nicht, das wusste ich, das konnte ich oft raushören, eigentlich mochten sie die alle nicht, den Ulbricht auch nicht. Dabei war mein Vater gar kein »Klassenfeind« oder »Reaktionär«. Er kam selbst aus der proletarischen Ecke, trat Ende der zwanziger Jahre dem Arbeitersportverein »Fichte« und dem »Kampfbund gegen den Faschismus« bei. Er hatte auch nichts gegen sozialistische Ideen, ihn störte nur, dass viele davon lebten und sich in ihrer Sonderstellung einrichteten: Toll, so als »Vorhut der Arbeiterklasse«.
Ein paar Jahre später, nach Chruschtschows Abrechnung mit Stalin, fielen die gleichen Leute erneut in einen Schockzustand: Ihr »Gott« war plötzlich gar keiner, sondern für schlimmste Verbrechen verantwortlich – Massenexekutionen, Arbeitslager, Schauprozesse. Doch davon wussten sie im Frühjahr 53 noch nichts oder verdrängten es, aus sturer Parteidisziplin. Sie drängten lieber »vorwärts zu neuen Erfolgen«. Bloß, wo war jetzt »vorwärts«, ohne Josef Wissarionowitsch?
Ich hatte natürlich erst recht keine Ahnung von all dem, war fünf, bald sechs, der Kopf voller bunter Kringel, und doch spürte ich, dass etwas in der Luft lag. Da passierte etwas sehr Ungewöhnliches, das blieb sogar mir als Kind nicht verborgen. Die Menschen verhielten sich auf einmal anders, sie redeten laut miteinander, waren erregt, empört, wütend. Vorher war es so: Geschimpft wurde zu Hause. Nun in den Geschäften, auf der Straße. Es knisterte. Auffällig auch die Allgegenwart der Volkspolizisten. Dass sie auf den Straßen zu zweit Streife liefen, mit ihren martialischen Stiefelhosen und schwarzen Tschakos, oder in einem Toni-Funkwagen sich langsam durch die Wohnviertel schoben, selbst dass sie dann und wann mit einem voll besetzten Überfallkommando vor einer Spelunke am Kollwitzplatz aufkreuzten, war man gewohnt. Kneipenschlägereien gehörten nun mal zur Tagesordnung. Doch nun fuhren die Rollkommandos ständig durch unsere Straßen, auch die Streifen kamen öfter vorbei. Das hatte etwas Einschüchterndes, Bedrohliches, und so war es gewollt.
Der ehrgeizige Kurs der II. SED-Parteikonferenz, nun mit Volldampf die »Grundlagen des Sozialismus« aufzubauen, führte zu einer einseitigen Entwicklung der Schwerindustrie – auf Kosten der Herstellung von Konsumgütern. Verschärft wurde die Lage durch die fortdauernden Reparationsleistungen an die Sowjetunion, durch eine rigorose Steuerpolitik gegen kleine private Betriebe und Läden, dazu kamen die Unruhe in der Landwirtschaft infolge der Kollektivierungskampagne und schließlich auch noch die Folgen der Missernte von 1952. Die Versorgung der Bevölkerung verschlechterte sich dramatisch. Es fehlte an Butter, Fleisch, Zucker, Mehl, Gemüse. Bei der breiten Masse wuchs der Unmut. Doch die führenden Genossen rissen das Ruder nicht rum, sie gaben weiter Gas, wollten nichts als »vorwärts« und dafür die Arbeiter mehr arbeiten lassen.
Unbeirrt, ihrer Sache sicher, beschlossen Partei und Regierung im Mai 1953, »die für die Produktion entscheidenden Arbeitsnormen um durchschnittlich mindestens 10 Prozent« zu erhöhen. Das Knistern wurde zum Brodeln. Nun merkte man auch im Kreml, dass die Männer um Parteichef Ulbricht den Bogen überspannt hatten, und pfiff sie zurück. Erschrocken suchte die Parteispitze nach der Bremse. Per Kommuniqué wurde eingeräumt, dass es leider »eine Reihe von Fehlern« gegeben habe; das »Neue Deutschland« schrieb verheißend: »Es wird Zeit, den Holzhammer beiseitezulegen.« Zu spät. Die Wut, besonders unter den Arbeitern, war längst Gemeingut und setzte sie in Bewegung.
Zufälligerweise war es genau die Zeit, die auch mir mehr Bewegung brachte: Ich durfte endlich allein runter – in den Hof, auf die Straße und den Kollwitzplatz. Beim ersten Mal schlich ich die wenigen Treppenstufen vom Hochparterre bestimmt scheu, mit klopfendem Herzen nach unten. Fröhliches Gelächter hallte mir entgegen. Noch ein Schritt. Hof.
»Tach.«
»Tach Dieter, willste mitspielen!«
»Mhmm.«
Die Kinder freuten sich – einer mehr! Und nach ein paar Stunden hatte ich das Gefühl, schon ewig zur Hofmeute zu gehören: zu Gabi, die alle nur »die Süße« nannten, ihrer Schwester »Pummel«, eigentlich Renate, Moni und Klaus und den »Großen« Bernhardt und Horst. Es war auch egal, ob einer fünf, zehn oder zwölf Jahre alt war, wir kamen miteinander klar, spielten »Einkriegezeck«, »Verstecken«, »Hase und Jäger«, die großen Jungs am liebsten »Klimpern«. Und trotz allen Spieleifers bekamen wir mit, dass oft Passanten vor unserem Zeitungsladen standen, aus irgendeinem Artikel vorlasen und hitzig Worte auftürmten. So heftig, dass wir Kinder immer wieder unser Spiel unterbrachen und zuhörten. Für uns hatte es etwas Abenteuerliches.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ich mich an eine Begebenheit sehr gut erinnern kann. Wenige Tage vor dem 17. Juni fand ein Radrennen in der Schönhauser Allee und der Cantianstraße statt. Mein Papa schwirrte beim Wettkampfausschuss rum, meine Mama und ich schauten den Rennern am Straßenrand zu. Wie immer damals war es ein Ereignis, wie immer kamen Tausende Zuschauer. Doch es lief nicht ab wie immer. Schon vor dem Start des Rundstreckenrennens war eine eigenartige Spannung zu spüren. Das Polizeiaufgebot war auffällig stärker als sonst. Und aus der anwachsenden Menge kamen aufreizende Rufe, aber wohl noch keine Sprüche wie: »Der Spitzbart muss weg!« Es war eher allgemeiner Unmut.
Das Rennen lief, und bald auch die Volkspolizei, kommandiert zu den Stellen, an denen es zu Handgemengen kam. Die Zuschauer drängten vor, die Polizei drängte sie zurück. Hin und her. Schreie, Gebrüll, Prügeleien, Festnahmen. Ich stand wie gebannt, so etwas hatte ich noch nie gesehen. Das Radrennen war längst einerlei oder schon abgebrochen. Meine Mutter nahm mich verängstigt in den Arm und lief mit mir fluchtartig nach Hause. Und dort? Der Kollwitzplatz döste friedlich in den Nachmittag. Die Kinder spielten im Buddelkasten, die Skatbrüder kloppten Karten, die Alten saßen plaudernd auf den Parkbänken. Mich verblüffte der Kontrast. Doch vier Tage später war es auch damit vorbei.
Der 17. Juni, der Tag, der als Arbeiter- und Volksaufstand in die Geschichte eingehen sollte, begann bei uns zu Hause schon am 16. Einem Dienstag. Sonnig, wie ich meine. Der frühe Vormittag verlief noch völlig normal, möglich, dass meine Mutter öfter Radio hörte, die Nachrichten vom RIAS. Doch dann passierte etwas Ungewöhnliches: Mein Vater kam schon gegen zehn von der Arbeit zurück. Aufgeregt stellte er sein Rad im Korridor ab, drückte meiner Mutter seine Arbeitstasche in die Hand und rief beim Rausgehen: »Wir streiken! Ich weiß nicht, wann ich zurück bin.« Weg war er. Und wir standen da mit Herzklopfen. Streiken? Wieder was Neues für mich. Meine Mutter hat es mir bestimmt fix erklärt. Doch Streik war selbst für viele Bauarbeiter, die zur gleichen Stunde durch die damalige Stalinallee demonstrierten, neu. Sie mussten es dennoch wagen, sie hatten einfach die Schnauze voll. Zwar gelobte die Regierung Besserung und hob einige restriktive Maßnahmen auf, doch ausgerechnet die gehasste Normenerhöhung hielt sie aufrecht. Die Wut kochte über. Nichts konnte die Protestler mehr stoppen: Generalstreik morgen!
Das war dann der berühmte 17. Mein Vater brach auf, als ich noch schlief. Und meine Mama machte uns beiden das Frühstück, wie abwesend, voller Sorge. Vielleicht um sich zu beruhigen, spielte sie Normalität: Ich durfte auf die Straße, und bald ging sie mit mir einkaufen in die Oderberger, zu »Lederle«, der Lieblingsfleischerei der ganzen Gegend. Drinnen bediente die Chefin mit ihren stets freundlich lächelnden Töchtern, alle in weißer Kittelschürze und weißem Häubchen, draußen war das Ende der Schlange. Und ich. Gedränge machte keinen Spaß. Kurz darauf zog ein Marschblock mit FDJlern vorbei, Richtung Grenze, unerschrocken im Blauhemd, laut ein Lied durch die Straße schmetternd:
»Auf, auf zum Kampf, zum Kampf!
Zum Kampf sind wir geboren!«
Ob sie auch dazu geboren waren, in die Bernauer einzumarschieren, konnte ich nicht erkennen. Sie wollten Farbe bekennen. Wohl ein vergebliches Manöver in den Arbeiterquartieren. Die Frauen in der Warteschlange schüttelten nur die Köpfe. Später wurde erzählt, dass ein paar FDJler, die sich an der Gertraudenbrücke oder Mühlendammbrücke tollkühn den Demonstrationszügen in den Weg stellen wollten, von den Arbeitern in die Spree geworfen worden waren.
Zu Hause wurden die Nachrichten ernster. Der RIAS berichtete von T34-Panzern, die aufgefahren waren, von Straßenbarrieren, brennenden Gebäuden, Gewehrschüssen, fliehenden Demonstranten, Toten. Gebannt lauschten meine Mama und ich den Stimmen der Reporter und Augenzeugen. Es war schmerzlich, unheilvoll. Um die Mittagszeit wurde »im sowjetischen Sektor von Berlin der Ausnahmezustand verhängt«: Alle »Menschenansammlungen über 3 Personen« wurden verboten, ein Ausgehverbot »zwischen 9 Uhr abends bis 3 Uhr morgens« verfügt und bei Verstößen mit »Kriegsgesetzen« gedroht. Das sendete der DDR-Rundfunk pausenlos.
Uns war bange. »Wann kommt Papa?« Er kam am frühen Abend. Und er zitterte vor Erregung. So was hatte ich bei ihm noch nie gesehen, die Angst kroch wieder in mir hoch. Am Küchentisch erzählte er dann. Lange. Leider entsinne ich mich nur an zwei Sätze: »Ich kenne einen Toten.« »Die Russen haben nicht geschossen.« Anderntags hörte ich das auch von einigen Hofkindern, deren Väter gleichfalls vor allem die kasernierten Volkspolizisten als Schützen nannten. Das war für uns schon wichtig.
Denn seit dem frühen Morgen des 18. Juni standen Soldaten der Roten Armee vor unserer Hauseingangstür. Vor allen Haustüren unseres Viertels. Der Ausnahmezustand war aufmarschiert. Im Haus verbreitete sich diese Kunde in wenigen Minuten, wie immer von Fenster zu Fenster: »Draußen steht ein Russenposten.«
»Dürfen wir jetzt nicht mehr raus?«
»Doch, aber wir müssen ihm den Ausweis zeigen!«