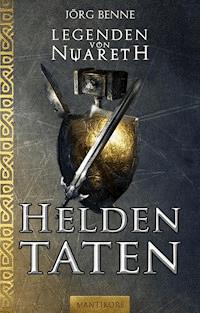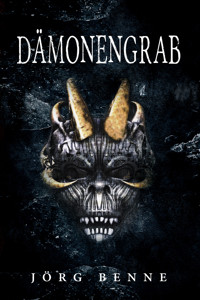Contents
Karte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Personenregister
Nachwort
Leseprobe - Dämonengrab
Weitere Romane aus der Welt Nuareth
Impressum
Karte
1
Ferron krallte sich mit den Fingern ins Mauerwerk. Er hing erst einige Augenblicke an der steinernen Brüstung, doch es kam ihm schon wie eine Ewigkeit vor, und seine Gelenke begannen zu protestieren. Wann ging der Wächter endlich weiter?
Er war kurz davor, sein Vorhaben aufzugeben, als sich endlich die Schritte des Nachtwächters entfernten. Nichtsahnend vor sich hin pfeifend, setzte der seine Runde im Inneren des Anwesens fort.
Mühsam ein Ächzen unterdrückend, zog sich Ferron über die schmale Mauerbrüstung. Prüfend sah er nach unten, entdeckte kein Hindernis und ließ sich mit den Füßen voran auf der Innenseite der Mauer nach unten gleiten. Er landete weich im sauber gestutzten Gras und verharrte dort einen Moment, um zu verschnaufen und seine verkrampften Finger zu lockern. Obwohl es eine eher frische Frühlingsnacht war, klebte ihm das dunkle Hemd schon jetzt schweißnass am Rücken.
So war das nicht geplant, verdammt!, fluchte Ferron innerlich. Er hatte das Haus und das Verhalten des Wachpersonals genau ausgekundschaftet, aber aus irgendeinem Grund hatte der Wächter seine Route ausgerechnet diesmal verändert. So war er schneller zur Mauer gekommen als üblich und hätte Ferron um ein Haar entdeckt, als der gerade über die schmale Brüstung klettern wollte.
Schwer atmend sah Ferron der tanzenden Laterne des Nachtwächters nach, die sich im weitläufigen Garten des Grundstücks entfernte. Eigentlich war es eher ein Park. Der Kaufmann Bilan Markot, dem das Anwesen gehörte, hatte einen Teich anlegen und Bäume sowie zahlreiche exotische Gewächse anpflanzen lassen, die aus aller Herren Länder herbeigeschafft worden waren. Davon war nun allerdings wenig zu sehen, denn die drei Monde lugten nur gelegentlich hinter den Wolken hervor.
Gern hätte Ferron noch länger Atem geschöpft, doch die Runde des Wächters würde nicht ewig dauern. Bevor der wieder an der Mauer anlangte, musste Ferron das Haus erreicht haben, sodass er dort eindringen konnte, wenn der Wächter am weitesten entfernt war.
Ferron rief sich in Erinnerung, wie der Park angelegt war, und machte sich geduckt auf den Weg. Er hielt sich links von dem großen Teich, suchte Deckung hinter den vereinzelten Büschen und kam allmählich dem Haus näher, das sich als dräuender Schatten abzeichnete.
Das Gebäude hatte Ferron ebenfalls bei Tage ausgekundschaftet, soweit das vom Dach eines Nachbargebäudes aus möglich gewesen war. Der Kaufmann hatte auch bei seinem Haus nicht gespart und einen zweistöckigen Palazzo aus edelstem Stein errichten lassen. Dank der Baupläne, die Ferrons Obmann von der Diebesgilde ihm gezeigt hatte, wusste Ferron um die zahlreichen Räume im Inneren. Ein Salon, ein Speisesaal und ein Tanzsaal im Erdgeschoss, im ersten Obergeschoss Schlafgemächer und Ankleidezimmer für die Familienmitglieder nebst mehreren Badezimmern. Das Dachgeschoss nahm ein riesiges Schlaf- und Arbeitszimmer für den Hausherren ein, der Gerüchten zufolge schon länger nicht mehr das Bett mit seiner Gemahlin teilte. Markots Palazzo war eine protzige Zurschaustellung von Geld und Macht, selbst für die Verhältnisse hier oben, auf den Hügeln von Nurud, wo die reichsten unter den raffgierigen Drecksäcken aus Adel und Kaufmannszunft ihre Domizile hatten. Ferron hatte für so viel Geltungssucht nichts als Geringschätzung übrig.
Das Gebäude lag wie vorhergesagt dunkel und verlassen da. Nur in der kleinen Wachstube, die man an eine Seite des Hauses angebaut hatte, brannte eine Laterne. Heute saß hier bloß noch ein zweiter Wächter, der abwechselnd mit dem anderen über Markots Besitz patrouillierte. Der Rest des Wachpersonals begleitete den Hausherren als Leibwache zu einer Versammlung der Kaufmannszunft. Markots Frau war mit den drei jugendlichen Kindern zu ihrer greisen Mutter aufs Land gefahren. Einmal im Haus würde Ferron also leichtes Spiel haben.
Er duckte sich hinter einen Busch und wartete ab, bis der patrouillierende Wachmann mit der Laterne das Wachhaus erreichte. Leise unterhielten sich die beiden Wächter, tauschten die Laterne aus und der andere machte sich auf den Weg an der vier Meter hohen Mauer entlang.
Ferron lief los, verbarg sich hinter einem Baum und sah noch einmal zur Wachstube. Dort rührte sich nichts. Dennoch musste er jetzt vorsichtig sein. Vor ihm lag der breite Kiesweg, der vom Haus um den Teich herum zum Eingangstor des Grundstücks führte. Ganz vorsichtig setzte Ferron einen Fuß vor den anderen, damit die Steine nicht verräterisch knirschten. Er betete, dass nicht gerade jetzt die Wolkendecke aufriss, denn dann würde er im Licht der Monde wie auf dem Präsentierteller stehen, trotz seiner dunklen Kleidung.
Erleichtert atmete er auf, als er wieder Rasen unter den Füßen spürte, rannte geduckt weiter, bis er die linke Seite des Hauses erreichte. Hier war er sicher, denn die Wächter liefen nur selten in diesen Bereich, weil das Gelände jenseits der Mauer so steil zum Meshac-See hin abfiel, dass niemand mit einem Eindringen von dort rechnete. So sorglos, wie die Wächter ihre Runden drehten, schienen sie allerdings ohnehin keine Gefahr zu erwarten.
Im Schatten der Hauswand schlich Ferron bis zu einem Nebeneingang. Die Tür war verschlossen, aber das beunruhigte ihn kaum. Er nahm seinen Rucksack von der Schulter und holte einen Diebeshaken hervor. Damit war das Schloss im Nu aufgebrochen und er glitt ins Innere des Hauses.
Der Flur vor ihm lag weitgehend in Dunkelheit, nur durch ein Fenster fiel ein wenig Mondlicht.
Ferron wartete einen Moment, damit sich seine Augen an die Verhältnisse gewöhnen konnten. Dann orientierte er sich kurz, fand die Treppe, die er gesucht hatte, und schlich hinauf in den ersten Stock. Am oberen Treppenabsatz angekommen, verharrte er und lauschte. Zwar sollte niemand im Haus sein, aber er hatte gelernt, sich stets zu vergewissern. Das eine Mal, als er sich blind auf seine Informationen verlassen hatte, musste er Hals über Kopf fliehen und war nur mit knapper Not der Stadtgarde entgangen.
Ferron hörte nichts, keine knarrenden Dielen, kein Murmeln, kein Schnarchen. Er war tatsächlich allein.
Nun galt es, die gesuchte Beute zu finden. Ferron war kein gewöhnlicher Einbrecher, der einfach alles von Wert mitnahm. Die Diebesgilde handelte nur im Auftrag, und in diesem Fall ging es um ein verschwenderisch mit Edelsteinen besetztes Collier, das am Dekolleté von Lady Markot offenbar den Neid mindestens einer anderen Dame der Gesellschaft geweckt hatte. Jedenfalls war jemand bereit, der Gilde viel Geld dafür zu zahlen, dass sie das Schmuckstück beschaffte. Wer der Auftraggeber war und was er mit dem Collier vorhatte, war Ferron gleichgültig. Er bekam einen ordentlichen Anteil von dem, was die Gilde für ihre Dienste verlangte.
Sein Obmann ging davon aus, dass das Collier entweder im Schlafzimmer von Lady Markot oder in einem Tresor in Bilan Markots Gemach im Dachgeschoss zu finden sein würde. Ferron entschied, mit dem Schlafgemach der Hausherrin anzufangen.
Das Zimmer war größer als manche Wohnung. Ein riesiges Bett, das Ferrons Meinung nach für vier oder fünf Menschen Platz geboten hätte, dominierte den Raum. Das restliche Mobiliar konnte er im Halbdunkel nur erahnen.
Er kramte in seinem Rucksack und holte einen Leuchtstein hervor, einen seltenen Runenstein vom Volk der Nurasi, der nach einer kurzen Berührung bläulich zu glimmen begann. Das Licht war zwar nur schwach, erfüllte aber seinen Zweck und war außerdem nicht so hell, dass es den Wächtern draußen hätte auffallen können.
Ferron umrundete das Bett und näherte sich einer Kommode. Er lächelte zufrieden, als er darauf ein Kästchen stehen sah, und öffnete es erwartungsfroh. Tatsächlich enthielt es allerlei Schmuck und Geschmeide, einiges davon machte auch einen durchaus wertvollen Eindruck. Doch das Collier, das man Ferron detailliert beschrieben hatte, war nicht darunter. Er legte alles wieder zurück, obwohl die Versuchung groß war, einen der edelsteinbesetzten Ringe einzustecken. Das hätte jedoch gegen den Kodex der Gilde verstoßen.
Ferron wandte sich den Schubladen der Kommode zu, fand darin aber nur Bücher und Unterwäsche sowie ein etwas mehr als fingerlanges, stabförmiges Utensil aus poliertem, abgerundetem Holz, das ihn die Stirn runzeln ließ.
Auch wenn er nicht glaubte, dass jemand ein Schmuckstück wie das Collier in einem Kleiderschrank verstauen würde, öffnete Ferron als nächstes dieses wuchtige Möbelstück. Unmengen von Kleidern hingen ordentlich auf Bügeln darin, kein Hinweis auf Schmuck. Seufzend schloss er die Türen des Schrankes und sah sich im Licht des Leuchtsteines weiter um. Er untersuchte flüchtig den Nachttisch, ohne Erfolg. Auch im Ankleidebereich auf der anderen Seite des Zimmers wurde Ferron nicht fündig. Allmählich wurde die Zeit knapp, denn wie lange Markots Zunftversammlung dauerte, war völlig offen. Ferron entschied, es zunächst im Dachgeschoss zu versuchen, bevor er sich den unwahrscheinlichsten Stellen in diesem Zimmer zuwandte. Er huschte die Treppe hinauf.
Sie mündete in eine Galerie. Ein großes Fenster im Giebel ließ trotz des bewölkten Himmels so viel Mondlicht herein, dass Ferron den Leuchtstein wegstecken konnte. Linker Hand wurde der Raum von einem großen Schreibtisch dominiert, in der rechten Ecke befand sich ein Bett, das dem aus Lady Markots Zimmer in seiner Breite in nichts nach stand. Der Kleiderschrank nahm sich hier allerdings deutlich kleiner aus. Auf den ersten Blick sah Ferron nichts, das wie ein Tresor aussah und verharrte ein wenig ratlos am Treppenabsatz.
Plötzlich hörte er von unten ein Knarren und fuhr heftig zusammen. Das Lachen von Frauen und Männerstimmen hallten herauf.
»Herr, seid Ihr sicher, dass …?«, fragte einer.
»Ich brauche nichts mehr, außer diesen beiden«, unterbrach ihn eine andere Männerstimme, die vom Alkoholgenuss schon ein wenig schwer klang. »Folgt mir, ihr Hübschen, ich zeige euch mein Reich.«
Schritte auf der Treppe, das Kichern der Frauen kam näher. Offenbar hatte der Kaufmann vor, die Abwesenheit seiner Familie zu seinem Vergnügen zu nutzen.
Ferron fluchte stumm, hier oben saß er in der Falle. Ein rascher Blick zum Giebelfenster zeigte ihm, dass es sich nicht öffnen ließ. Um die Treppe hinabzustürmen, war es schon zu spät, er würde den Leuten im ersten Stock unweigerlich in die Arme laufen. Fieberhaft sah er sich nach einem Versteck um. Der offene Raum bot nicht viele davon, also entschied er sich für den Schreibtisch, hoffend, dass der Mann mit den Frauen sofort das Bett aufsuchen würde. Er kauerte sich hinter dem massiven Möbelstück zu Boden und behielt die Tür im Auge.
Der Lichtschein einer Laterne kündigte das Trio an, das kurz darauf den Raum betrat. Voran ging ein Mann mit bereits schütter werdendem, graumeliertem Haar, feistem Gesicht und einem perfekt gestutzten Schnauzbart - Bilan Markot. Er war in einen modisch geschnittenen Gehrock und ein Rüschenhemd gekleidet. Ihn begleiteten zwei Frauen, sehr jung, eine blond, die andere dunkelhaarig. Beide waren wirklich ausgesprochen hübsch und trugen offenherzige Kleider, die ihre Leiber derart einschnürten, dass die Brüste herauszuquellen drohten. Ihre Gesichter waren stark geschminkt und die professionelle Art und Weise, mit der sie Markot umschmeichelten und ihre behandschuhten Hände immer wieder wie beiläufig über seinen Körper gleiten ließen, zeigte mehr als deutlich, dass sie Huren waren - von der edelsten Sorte allerdings.
»Na, ist das ein Bett?«, prahlte Markot. Er lallte schon ein bisschen und hielt eine beinahe geleerte Flasche in der Hand, aus der er nun einen Schluck nahm.
»Ein richtiger Spielplatz«, bestätigte die Blonde anerkennend.
»Da können wir eine Menge mit dir anstellen«, fügte die Dunkelhaarige in verführerischem Ton hinzu.
»Ach ja?« Markot grinste lüstern. »Na, darauf bin ich gespannt.« Er trat auf den Schreibtisch zu. Ferron duckte sich und hielt den Atem an. Der Kaufmann stellte jedoch nur die Laterne auf der Tischplatte ab. »Dann wollen wir mal.«
Ferron wagte wieder aufzublicken. Die Blonde zog Markot soeben den Gehrock aus und die Dunkelhaarige machte sich an seinem Hemd zu schaffen. Als die Frau es dem Händler abstreifte, kam ein gewaltiger, behaarter Bauch zum Vorschein, aber die Huren waren professionell genug, darüber hinwegzusehen.
Die Blonde drehte ihm den Rücken zu und ließ ihn die Verschnürung ihres Kleides lösen. Damit hatte er einiges zu tun, denn seine Bewegungen waren fahrig und er verhedderte sich immer wieder in den Schnüren.
»Überlass das mir«, gurrte die Dunkelhaarige und machte sich mit geübten Handgriffen ans Werk. Wenige Augenblicke später schälte sich die Blonde aus ihrem Korsett, unter dem sie verführerische Spitzenwäsche trug.
»Ah, was für ein Anblick«, schwärmte Markot und betatschte die Brüste der halbnackten Frau. »Warte, ich habe genau das Richtige, um deinen Busen zu schmücken.«
Ferron, der ebenfalls einen Blick auf die Reize der Blonden gewagt hatte, zog sich hastig zurück, da der Kaufmann sich wieder dem Schreibtisch näherte. Markot stieß sich die Hüfte an der Tischkante und fluchte, was Ferron Zeit gab, sich noch tiefer in den Fußraum des Schreibtisches zu ducken. Zum Glück war dieser an der Vorderseite geschlossen, sonst hätten die Frauen ihn entdeckt.
Aus seinem Versteck konnte Ferron nur Beine und Bauchansatz des Kaufmanns sehen, der sich an einer der Schubladen zu schaffen machte. Markot hob einige Schriftstücke an und zog einen Schlüssel hervor. Mit dem in der Hand wankte er davon. Ferron atmete auf und zwängte sich aus seinem Versteck soweit hervor, dass er wieder um den Tisch herumspähen konnte.
Der Kaufmann stand vor dem geöffneten Kleiderschrank, in dem er eine Weile herumfuhrwerkte und dann eine der Bodenplatten anhob. Die beiden Frauen tuschelten leise miteinander, Ferron schüttelte den Kopf. Wie leichtsinnig, vor ihnen das Geheimversteck zu öffnen. Frauen wie diese wussten genau, dass die Diebesgilde für derlei Kenntnisse gut bezahlte. Vermutlich hatte der Obmann durch eine andere Hure von dem Tresor erfahren.
Als Markot sich von dem Schrank abwandte, machte Ferron große Augen und auch die Frauen sogen überrascht die Luft ein. Der Kaufmann hielt das Collier in den Händen, das im Licht der Laterne glitzerte und funkelte.
»Ha, da staunt ihr, was?«, protzte er. »Hat mich ein Vermögen gekostet. Was tut man nicht alles, um sein Weib zufriedenzustellen. Komm her, ich will es auf deinem Vorbau sehen.«
Die Blonde trat zu ihm und Markot hängte ihr das Schmuckstück um. Eine Weile ließ sie ihn den Anblick genießen, dann wandte sie sich lächelnd der Dunkelhaarigen zu. Ferron musste zugeben, dass sie einen schönen Anblick bot.
Der Kaufmann schlang von hinten die Arme um die Blonde und zog sie an sich. Sie kicherte gekünstelt, während er sie in den Nacken küsste. Als seine Hand sich unter die Wäsche der Frau schob, wandte Ferron den Blick ab. Wenig später war der Kaufmann mit den Frauen im Bett zugange. Er grunzte und die Frauen gaukelten mit übertrieben lautem Stöhnen Ekstase vor.
Derweil hockte Ferron hinter dem Schreibtisch und rang mit sich. Einerseits war jetzt wohl die beste Gelegenheit, aus dem Zimmer zu entkommen. Solange das Trio mit Intimitäten beschäftigt war, würden sie ihn kaum bemerken. Andererseits trug die Blonde noch immer das Collier, Ferron hörte es im Rhythmus des Liebesspiels klirren. Es fiel ihm schwer, nun aufzugeben, da er seiner Beute doch so nahe war.
»Au«, fluchte Markot unvermittelt. »Au, verdammt.«
»Entschuldige, ich wollte nicht ...«
»Ja, ja, nicht deine Schuld. Aber wenn wir es so machen, schlägt mir das Collier ins Gesicht.«
»Soll ich mich andersherum auf dich ...«
»Nein, nein. Du, nimm ihr das Collier ab und leg es auf den Tisch.«
Ferron duckte sich wieder in den Fußraum und wartete gespannt. Erneut klirrten die Edelsteine, dann meinte er Schritte zu hören, und kurz darauf wurde das Collier auf die Tischplatte gelegt.
»Komm wieder her, Schönheit«, kommandierte der Kaufmann. »Ja, leg dich zu mir.« Die Laken raschelten und das Trio begann bald von Neuem, Laute der Lust von sich zu geben.
Jetzt oder nie!
Ferron lugte über die Tischplatte. Das Collier lag kaum zwei Handbreit von ihm entfernt, allerdings direkt neben der Laterne. Beim Griff nach dem Schmuckstück hätte Ferrons Hand einen riesigen Schatten an die Wand geworfen, der den drei anderen kaum entgehen konnte, zumal die Blonde rücklings auf Markot saß und in Richtung des Schreibtischs gewandt war. Zwar hielt sie die Augen geschlossen, während sie sich auf ihm bewegte, aber Ferron wollte sich nicht darauf verlassen, dass das auch so blieb.
Das Collier zu sich zu ziehen kam auch nicht infrage, das Schaben auf der Tischplatte hätten die drei mit Sicherheit gehört.
Ferrons Blick fiel auf die Laterne. Der Schieber, mit dem man die Luftzufuhr regeln konnte, befand sich auf der ihm zugewandten Seite.
Nach kurzem Zögern gab Ferron dem Schieber einen leichten Stoß, sodass sich der Schlitz für die Luftzufuhr schloss. Es dauerte eine Weile, dann wurde die Flamme an der Spitze des im Öl schwimmenden Dochtes langsam kleiner, die Schatten im Raum wurden länger und schließlich erlosch das Licht.
»Oh«, stieß eine der Frauen hervor.
»Egal, mach weiter«, ächzte Markot nur und das geräuschvolle Liebesspiel setzte sich fort.
Ferron richtete sich halb auf, langte nach dem Collier und hob es vorsichtig vom Tisch. Behutsam ließ er das Schmuckstück in seinen Rucksack gleiten, schulterte diesen und huschte an der Wand entlang auf die Galerie zu, das Bett immer im Blick behaltend.
Die Geräusche vom Bett her wurden lauter, der ideale Moment um zu verschwinden. Auch wenn es ihm nicht behagte, wandte Ferron den dreien den Rücken zu und schlich in Richtung Treppe. Ihm stellten sich die Nackenhaare auf und er glaubte, die Blicke der drei auf sich zu spüren, doch es gab keinen überraschten Aufschrei. Unbehelligt erreichte er die Stufen und stieg rasch hinab, bis er außer Sicht war.
Auf halbem Weg ins erste Stockwerk hielt er inne, versuchte das Stöhnen vom Dachgeschoss zu ignorieren und stattdessen auf Geräusche aus dem Flur zu lauschen, den er überqueren musste, um zu der Treppe zu gelangen, die ins Erdgeschoss führte. Der Flur lag im Dunkeln und Ferron konnte nichts Verdächtiges hören. Vermutlich waren die Wachen, die Markot auf seine Zunftversammlung begleitet hatten, im Erdgeschoss.
Ferron setzte seinen Weg fort, die Treppe hinab, über den Flur. Im Treppenhaus spähte er nach unten in den Eingangsbereich. Dort glomm nun Licht und er meinte, einen Schatten zu erkennen. Sicher blieb mindestens einer der Wächter auf, bis die Huren ihr Werk getan und das Haus verlassen hatten. Das erschwerte die Flucht erheblich. Wenn ein Wächter in Richtung der Treppe blickte, konnte er Ferron unmöglich übersehen.
Er zögerte.
Mit einem letzten lauten Stöhnen kamen die Geräusche aus dem Dachgeschoss zum Erliegen. Kurz darauf meinte Ferron leise Schritte zu hören. Wenn sie jetzt oben die Laterne wieder entzündeten, dann ...
»Wo ist es?«, rief Markot auch schon aus. »Wo habt ihr das Collier versteckt?«
»Ich habe es dort hingelegt, du hast es doch ...«
»Es ist weg!« Markots Stimme überschlug sich. »Alarm!«, brüllte er.
Ferron zog sich hastig von der Treppe und tiefer in den Flur zurück, der zu den Zimmern der Kinder führte.
Schon polterte ein Wächter mit gezogenem Säbel die Treppe hinauf, sah sich aber nicht um, sondern stürmte sogleich weiter ins Dachgeschoss. »Was ist, Herr?«, rief er, noch bevor er oben angelangt war.
Sobald der Mann außer Sicht war, eilte Ferron leise die Stufen hinab, wandte sich dem Ausgang zu ... und rannte beinahe in einen weiteren Wachtposten hinein, der ihm zum Glück den Rücken zuwandte.
Der Wachmann drehte sich ahnungslos zu ihm um. »Was hat der Alte denn …?«, fragte er leise und machte große Augen, als er statt seines Kollegen Ferron vor sich sah. »Wer …?«, begann er noch und griff nach seinem Kurzschwert.
Er kam nicht mehr dazu, es zu ziehen. Ferron drang vor und rammte ihm mit voller Wucht das Knie ins Gemächt. Mit einem dumpfen Ächzen brach der Wächter zusammen.
Ferron eilte weiter, achtete nicht auf die Rufe, die von oben zu hören waren, und mit denen Markot und der Wachmann das ganze Anwesen alarmierten. Jetzt ging es um jeden Augenblick. Ferron riss die Tür des Seiteneingangs auf, durch den er vorhin das Gebäude betreten hatte, wandte sich nach links und sprintete los. Er konnte nur hoffen, dass die Wachleute im Garten noch nicht wussten, was los war, und den Tumult dem Besuch des Kaufmanns zuschrieben. Trotzdem rechnete er jeden Moment damit, das Sirren einer Bogensehne zu hören. Er hielt sich außen an der Mauer, umging so den Kiesweg und war durch Bäume und Büsche weitgehend geschützt. Flüchtig hielt er nach der Laterne des patrouillierenden Wachmannes Ausschau und entdeckte sie am gegenüberliegenden Ende des Gartens. Offenbar waren die Götter Ferron hold. Er sah bereits die Mauer vor sich aufragen, als er Stimmen vernahm. Im Schatten eines Baumes hielt er an und sah sich schwer atmend um.
Ganz in seiner Nähe verlief der Kiesweg zum Haupttor. Dort standen zwei Posten, einer draußen und einer drinnen und unterhielten sich mit gedämpften Stimmen. Wenn Ferron seinen Weg an der Außenmauer entlang fortsetzte, würde sie ihn vermutlich sehen, dasselbe galt allerdings, wenn er den Kiesweg überquerte. Verdammt!
»Alarm!«, gellte es vom Haus her. »Eindringling!«
Ferron duckte sich hinter den Baum. Beide Wächter am Tor drehten sich zu dem Haus um und zogen ihre Waffen. Aufmerksam spähten sie in die Dunkelheit des Gartens. Von der anderen Seite des Grundstücks sah Ferron die Laterne rasch näherkommen.
Mit pochendem Herzen kauerte er sich hin. Für den Moment saß er in der Falle. Er musste abwarten, was die Wachleute unternahmen, und den besten Moment abpassen, um zu der Mauer zu sprinten. Unbewusst tastete er nach dem Griff seines Wurfmessers. Er hoffte, die Waffe nicht benutzen zu müssen, aber wenn es zum Äußersten kam, würde er sich damit zur Wehr setzen.
»Wisst ihr, was los ist?«, fragte der Wächter mit der Laterne atemlos.
»Das wollte ich dich auch gerade fragen«, erwiderte einer der beiden am Tor.
»Seht doch, Hemak kommt her. Wieso läuft der so komisch?«
»Ich glaube, er ist verletzt. Komm, wir gehen ihm entgegen.«
Der Wächter mit der Laterne und der andere liefen auf dem Kiesweg in Richtung Haus und dabei auch dicht an Ferron vorbei. Nun verblieb nur noch der eine Posten, der draußen vor dem Tor stand.
Ferron huschte an der Mauer entlang, bemüht, keinen Laut von sich zu geben. Da der letzte Wachmann gespannt beobachtete, was seine Kollegen taten, achtete er nicht auf die Schatten in denen Ferron sich bewegte. Unbemerkt gelangte dieser an die Ecke der Mauer und begann sofort daran emporzuklettern, indem er sich mit gespreizten Beinen an beiden Wänden abstützte. Derlei Klettereien bewältigte er oft, sodass er innerhalb weniger Augenblicke die Mauerkrone erreichte.
»Ein Dieb hat dem Meister Schmuck gestohlen!«, hörte er jemanden rufen. »Los, sucht das ganze Gelände ab, er darf auf keinen Fall entkommen.«
Ferron hockte auf der schmalen Mauerkrone. Unmöglich konnte er von hier auf die Straße springen, ohne dass ihn der Wachtposten, der fast direkt unter ihm stand, bemerkte. Rechts von ihm fiel der Hang steil zum See ab, er hatte also nur den einen Ausweg, und hier oben war er deutlich zu sehen. Er musste handeln.
Kurz entschlossen sprang Ferron auf den Wächter hinab. Der sah ihn im letzten Moment kommen, versuchte noch auszuweichen, dennoch traf Ferron ihn schwer an der Schulter und riss ihn mit sich zu Boden.
»Du Hund«, ächzte der Mann. »Ich werde dir ...«
Ferron verpasste ihm einen Fausthieb und rannte los.
»Er ist hier! Er entkommt. Haltet den Dieb!«
Es war schon spät, niemand war auf den Straßen. Ferron bog in eine schmale Gasse ab, änderte an jeder weiteren Kreuzung die Richtung. Hinter sich hörte er noch eine Weile Rufe. Kurz darauf hallten die Pfeifen der Stadtgarde durch die Nacht, doch sie würden ihn nicht finden, sein Vorsprung war schon viel zu groß.
Als er das Reichenviertel hinter sich ließ und in die vertrauten Schatten der Altstadt-Gassen eintauchte, verlangsamte Ferron sein Tempo. Nun war es nicht mehr weit bis zum Quartier der Diebesgilde, wo er das Collier loswerden konnte.
Die meisten Bewohner Nuruds schliefen tief und fest, als Ferron den Hafen erreichte. Auch hier war auf den Kais und den angrenzenden Straßen niemand mehr zu sehen.
Ferron hielt sich trotzdem in den Schatten der Gassen und schlich bis zu einem Kontor, der am größten Kai lag, wo tagsüber das Erz aus den Ostkuppen auf die Lastkähne verladen wurde. Nachdem er sich mit einem Blick über die Schulter noch einmal vergewissert hatte, dass ihm niemand gefolgt war, klopfte er in einem bestimmten Rhythmus an eine unscheinbare Tür an der Seitenwand des Kontors.
In Kopfhöhe wurde eine kleine Sichtluke geöffnet und zwei wachsame Augen starrten erst Ferron misstrauisch an und zuckten dann nach links und rechts. »Hast du es?«, fragte die dazugehörige Männerstimme.
»Ja«, erwiderte Ferron knapp.
Die Luke wurde wieder geschlossen und mehrere Riegel beiseitegeschoben. Die Tür wurde gerade so weit geöffnet, dass Ferron sich durch den Spalt zwängen konnte, und sofort hinter ihm wieder geschlossen und verriegelt.
»Hat ganz schön lang gedauert«, knurrte der drahtige Mann, der ihm geöffnet hatte.
Ferron zuckte nur die Achseln. »Ist Grauauge noch wach?«
Der Mann lachte freudlos. »Der ist doch immer wach«, gab er zurück und deutete auf eine Treppe, die ins Innere des Kontors führte. »Er ist oben bei seinen Karten.«
Ferron stieg die Stufen hinauf und erreichte den repräsentativen Teil des Kontors, in dem tagsüber Geschäfte getätigt wurden. Hier lagen Teppiche aus, Gemälde hingen an den Wänden und in einem Kamin knisterte ein Feuer.
An einem übergroßen Schreibtisch, auf dem mehrere Kerzen standen, saß ein Mann mit einem ausladenden Bierbauch in einem ebenso ausladenden Sessel über ein Dutzend Spielkarten gebeugt. Seine Haare waren ergraut und gingen ihm an den Schläfen aus. Auf den ersten Blick sah Nurbek Halgar aus, wie viele andere reiche Kaufleute. Aber sein linkes Auge war trübe und stumpf, von einer gräulichen Farbe, und stand in starkem Kontrast zu dem fast schwarzen rechten Auge. Es machte ihn unverwechselbar und hatte ihm den Beinamen Grauauge eingebracht.
Den gewöhnlichen Geschäften in diesem Kontor ging Grauauge nur nebenher nach. In erster Linie war er der Repräsentant der Diebesgilde für ganz Meshacia, die nicht etwa im Stillen operierte, sondern ganz offen – zumindest für die Kreise, die die Dienste der Gilde bezahlen konnten. Nicht einmal die Krone behelligte ihn, im Gegenteil. Man munkelte, dass das Königshaus selbst schon den ein oder anderen Diebstahl in Auftrag gegeben hatte.
Potentielle Auftraggeber kamen zu Grauauge und er entschied, welche Aufträge angenommen wurden und welche nicht. Die Planung überließ er normalerweise den Obleuten, die die Diebe auswählten und auch später die Beute entgegennahmen. Aber zwischen Ferron und Grauauge ging es heute um mehr als nur das.
Grauauge blickte nicht auf, als Ferron eintrat, sondern starrte weiter konzentriert auf die Karten. Ferron wusste, dass es bei dem Spiel darum ging, den verdeckten Stapel auf die offenen Stapel auszuspielen und dabei bestimmten Regeln zu folgen. Wie die genau funktionierten, war ihm genauso schleierhaft wie der Spaß bei einem Kartenspiel mit sich selbst. Ferron bevorzugte das Spiel gegen andere. Es war aber allgemein bekannt, dass Grauauge es nicht schätzte, bei dem Spiel gestört zu werden, also wartete Ferron geduldig ab.
»Ach verdammt«, knurrte Grauauge unvermittelt und schleuderte den Stapel verbliebener Karten auf den Tisch. Er maß Ferron mit seinem gesunden Auge. »Ich hoffe, du warst erfolgreicher?«
Ferron nickte, trat vor und legte das Collier auf den Tisch.
Grauauge hob es hoch und betrachtete es eine Weile eingehend. »Wirklich ein schönes Stück«, brummte er anerkennend. Er lehnte sich in seinem Sessel zurück und hielt es sich an den Hals. »Würde sogar mir stehen, was?« Er lachte glucksend.
Ferron lächelte unverbindlich und wartete.
Grauauge legte das Schmuckstück auf den Tisch, öffnete einen Schublade und holte einen verschnürten Beutel hervor, in dem es klimperte, als er ihn auf die Tischplatte warf. »Wie vereinbart.«
Ferron steckte den Beutel ein ohne nachzuzählen. In all den Jahren, die er für die Diebesgilde tätig gewesen war, hatte er immer genau den ausgemachten Preis bekommen. Im Moment beschäftigte Ferron ohnehin weniger die Anzahl der Münzen. Er räusperte sich. »Auch der andere Teil unserer Vereinbarung steht?«, fragte er unsicher. »Dies war also mein letzter Auftrag?«
Grauauge blickte aus den Tiefen seines Sessels zu ihm auf. »Selbstverständlich. Aber bist du dir wirklich sicher, dass du das leicht verdiente Geld, den Nervenkitzel und den Spaß aufgeben willst?«
Ferron nickte entschlossen.
Grauauge hob in einer hilflosen Geste die Hände. »Dann sei es so. Wenn du dir ein ehrliches Leben aufbauen möchtest, werden wir dir nicht im Wege stehen.« Er beugte sich vor und seine Augen wurden schmal. »Aber wir erwarten natürlich, dass du dich weiter in Schweigen übst, was deine Aufträge angeht. Und sollten außergewöhnliche Umstände es einmal erfordern, stehst du der Gilde zur Verfügung.«
»So war es ausgemacht.«
»Nun denn.« Grauauge sammelte die Karten auf und mischte sie. »Leb wohl, Ferron. Vielleicht läuft man sich ja mal wieder über den Weg.« Er begann die Karten auf dem Tisch auszulegen und beachtete ihn nicht weiter.
Ferron wandte sich ab und machte sich auf den Heimweg. Der erste Schritt ist getan, dachte er, auch wenn sein Gefühl ihm sagte, dass er Grauauge nicht trauen konnte. Aber ihm blieb nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass der sich an die Abmachung hielt.
2
»… drei Fässer Salz.«
Ferron überflog seine Eintragungen ins Warenbuch des Kontors noch einmal und glich sie mit den Gütern ab, die die Arbeiter von den Karren abgeladen hatten. Er hatte alles erfasst. »Ihr könnt die Sachen jetzt ins Lager schaffen«, wies er die Arbeiter an, klappte das Buch zu und ging in seine Schreibstube zurück.
Der Alltag hatte ihn wieder. Zwar hätte er von seinem Anteil an den Beutezügen ein bequemes Leben führen können, doch wenn er keiner geregelten Arbeit nachging, hätte das früher oder später Aufmerksamkeit erregt. Deshalb arbeitete Ferron als Buchhalter im Handelskontor von Jewin Duska.
In der Hierarchie der Handelshäuser von Nurud war die Familie weit unten angesiedelt und gerade wohlhabend genug, um einen Familiennamen zu rechtfertigen, den nur der Adel und die Oberschicht führen durften. Ihre Flotte umfasste gerade einmal drei Lastkähne, die den Fluss Meshac zwischen Nurud und der Hauptstadt Serend befuhren und einfache Waren wie Lebensmittel oder Tuch transportierten. Die Einkünfte reichten aus, um den kleinen Betrieb der Familie am Laufen zu halten und ein Dutzend Arbeiter und Angestellte zu beschäftigen, aber bei Weitem nicht, um sich ein Anwesen wie das von Bilan Markot zu leisten oder anderweitig zu prahlen und Geld zu verprassen. Markot verdiente vermutlich mit einer Gewürzlieferung so viel, wie die Duskas in einem ganzen Jahr.
Ferron hatte sich diese Anstellung mit Bedacht ausgesucht. Nicht nur, weil er die Duskas für ihre ehrliche Kaufmannsarbeit respektierte, sondern auch, weil es bei dieser Familie nichts von außerordentlichem Wert zu holen gab und er so keinen Interessenkonflikt mit der Diebesgilde fürchten musste. Aber das war ja nun ohnehin vorbei.
Ferrons Aufgaben waren nicht besonders anspruchsvoll. Er führte das Waren- und das Kassenbuch, nahm Bestellungen von Marketendern entgegen und sorgte dafür, dass die Waren wie bestellt ausgeliefert wurden. Keine Tätigkeit die ihn ausfüllte, aber als Tarnung war sie ideal gewesen. Und mittlerweile gab es noch einen anderen Grund, warum er gern hier arbeitete.
Der Gedanke an Melina Duska, die älteste Tochter von Jewin, ließ ihn lächeln und sein Herz schlug ein wenig schneller. Er blickte aus dem schmalen Fenster. Die Schatten waren schon lang, er konnte Leute von der Arbeit nach Hause gehen sehen. Bald würde er Melina treffen.
Zweimal schon hatten die Mondbrüder Vejan und Xajan sich über das Firmament gejagt, was jeweils dreißig Tagen entsprach, seit jenem ersten Abend, an dem Ferron Melina im strömenden Regen nach Hause begleitet hatte. So lange ging ihre Liebelei nun schon, aber nur im Geheimen. Sie fürchteten, dass Melinas Vater einschreiten und Ferron gar entlassen könnte, wenn er erfuhr, dass seine Tochter dem Werben eines einfachen Angestellten nachzugeben gedachte. So blieb es meist bei einem flüchtigen Kuss hier, einer sachten Berührung da und vielleicht mal einem intimen Gespräch, das aber sofort zu unverfänglichen Themen wechselte, sobald jemand kam. Nur wenige Male hatten sie es gewagt, sich heimlich nachts zu treffen, waren im Mondschein auf den See hinausgefahren und hatten die Zweisamkeit genossen.
Ferron stellte Waren- und Kassenbuch an ihren Platz und wollte seine Stube eben wieder verlassen, als Jewin Duska in der Tür auftauchte.
»Ah, Ferron. Ist die Ladung geprüft, alles in Ordnung?«
»Ja, Herr.«
»Sehr schön. Sag, hast du Melina gesehen?«
»Ähm … nein. Sollte ich?« Ferron schluckte. Ahnte Jewin etwas?
Der winkte jedoch ab. »Ich dachte sie sei noch mit den Auftragsbüchern beschäftigt. Dann ist sie wohl schon zu Hause.« Er schlug einen vertraulichen Ton an. »Ich habe gestern mit Selani Haskea gesprochen. Sie sucht nach einer Braut für ihren Sohn Jevad, der bald die Führung des Hauses Haskea übernehmen soll. Ein ganz ansehnlicher Bursche, macht einen netten Eindruck. Ich habe die beiden für morgen zum Essen eingeladen, damit Melina ihn kennenlernen kann. Hoffentlich ist er ihr gut genug.« Er seufzte theatralisch. »Melina ist sehr wählerisch, musst du wissen.«
»Vielleicht … will sie sich ihren Mann selbst aussuchen«, wagte Ferron sich vor.
»Ihr jungen Leute.« Jewin schüttelte tadelnd den Kopf. »So einfach ist das alles nicht. Melina will ja schließlich auf nichts verzichten, und ich habe noch drei weitere Kinder, die alle auch irgendwann einmal Familien haben werden. Unser Kontor wirft nicht genug ab, um vier Familien zu versorgen, selbst für zwei wird es schon knapp. Also muss Melina jemanden ehelichen, der Geld hat - so wie Jevad Haskea.« Er seufzte abermals. »Sie hofft hingegen wohl immer noch, dass ihr eines Tages ein Prinz über den Weg läuft, auf Anhieb ihr Herz an sie verliert und sie in sein Schloss entführt. Dagegen wäre auch nichts einzuwenden, aber Träume füllen einem nun mal nicht den Teller.« Er winkte ab. »Aber was behellige ich dich mit den Sorgen eines Vaters. Deine Arbeit ist getan, mein Junge. Geh nach Hause.«
Damit wandte er sich ab und ließ Ferron allein.
Der brauchte einige Augenblicke, um das Gehörte zu verdauen. Dann erinnerte er sich, dass sein Treffen mit Melina unmittelbar bevorstand und beeilte sich, zum Hafen zu kommen.
Die Nacht war recht kühl aber Ferron schwitzte dennoch. Nicht wegen der paar Ruderschläge, mit denen er das kleine Boot, in dem Melina und er sich gegenübersaßen, auf den See hinaus gesteuert hatte, sondern vor Aufregung.
Heute ist der Tag, beschwor er sich. Heute sage ich ihr die Wahrheit. Jewins Ankündigung, Melina morgen einen reichen Kaufmannssohn vorzustellen, hatte Ferron in seiner Absicht noch bestärkt. Doch sein Mund war wie ausgedörrt und er hatte einen Kloß im Hals. Wie würde sie wohl reagieren, wenn sie erfuhr, dass er für die Gilde gearbeitet hatte?
Melina musterte ihn, die sanft geschwungenen Augenbrauen zusammengezogen. »Ist irgendwas?«, fragte sie.
»Ich … ich …«, stammelte er. Bei allen Göttern, gestern bin ich noch in Markots Palazzo eingestiegen, und heute versagt mir vor Feigheit die Stimme.
Melina löste mit sanften Fingern seine Hand vom Ruder und umfasste sie. In ihren Augen glomm Sorge auf. »Was ist?«
»Es ist nur … dein Vater«, brachte er hervor, auch wenn es gar nicht das war, was er ihr sagen wollte. »Vorhin kam er zu mir in die Stube und hat mir von Jevad Haskea erzählt, einem reichen, ansehnlichen Kerl, den er dir morgen vorstellen will.«
»Ansehnlich?« Melina machte große Augen und prustete unvermittelt los. »Er hat eine ansehnliche Zahl Sommersprossen und eine ansehnlich schiefe Nase, das stimmt wohl. Aber alles andere an ihm ist entsetzlich gewöhnlich und er ist furchtbar langweilig. Redet immer nur über Erz und Kohle.«
Ferron mochte ihr freches Mundwerk, aber im Moment war ihm nicht nach Lachen zumute. »Dein Vater meint aber, dass du jemanden mit Geld heiraten musst und …«
»… und deshalb denkst du nun, du bist nicht gut genug für mich, nicht wahr?« Sie strich ihm über das Knie und schüttelte lächelnd den Kopf. »Ach Ferron. Ich weiß doch, wer du bist und …«
»Nein, weißt du nicht«, stieß er hervor, spie die Worte aus wie einen Bissen schlechtes Obst.
Melina zog überrascht ihre Hand zurück. »Was meinst du?«
Er seufzte, sammelte sich. Sag es einfach geradeheraus. »Bis gestern habe ich für die Diebesgilde gearbeitet«, eröffnete er ihr.
Sie lächelte unsicher. »Das ist ein Scherz, oder?«
Ferron schüttelte den Kopf. »Nein, es ist mein Ernst. Die Stelle bei deinem Vater habe ich nur zur Tarnung angenommen.« Nun war es heraus, aber er wagte es nicht, Melina anzusehen und starrte stattdessen auf den See.
Sie antwortete nicht. Abgesehen von den Wellen, die am Bug des Bootes leckten, umfing sie bedrückende Stille.
Schließlich hielt Ferron es nicht mehr aus. »Ich konnte es dir vorher nicht sagen, eigentlich darf ich es auch jetzt nicht. Aber ich wollte unsere Zukunft nicht auf einer Lüge aufbauen. Jetzt habe ich mich von der Gilde gelöst, einen letzten Auftrag musste ich erfüllen und dann ...«
»Bist du in ein Haus eingebrochen?«
Ferron versuchte aus Melinas Gesichtsausdruck schlau zu werden. War da ein Vorwurf in ihrer Stimme? »Ja, bin ich.«
»In wessen Haus?«
»Darüber darf ich nicht sprechen.«
»Einer von den reichen Pfeffersäcken, oben auf dem Hügel, oder?« Ihre Augen blitzten. »Wie lange hast du für die Gilde gearbeitet?«
Ferron zuckte die Achseln. »Fast zehn Jahre.«
Melina riss die Augen auf. »So lange? Und war es gefährlich?«
»Manchmal. Einmal hätten sie mich beinahe erwischt.« Er schluckte. »Verzeihst du mir, dass ich es dir verschwiegen habe?«
Melina wiegte den Kopf, ließ sich Zeit mit einer Antwort. »Sagen wir mal, ich verstehe, dass du es mir nicht gleich an unserem ersten Abend erzählt hast. Wobei – vielleicht hätte ich dich dann noch interessanter gefunden, wer weiß?« Sie lächelte verschmitzt, wurde dann aber wieder ernst. »Und bei der Diebesgilde kann man einfach so aufhören? Besteht nicht die Gefahr, dass sie dich irgendwann einmal als früheren Dieb enttarnen?«
»Dann müssten sie ja fürchten, dass ich über meine Aufträge rede.«
Melina schwieg eine Weile und sah Ferron in die Augen. »Du hast wegen mir aufgehört. Es ist dir also wirklich ernst mit uns?«
Ferron nickte und ergriff ihre Hand. »Ich möchte dich heiraten. Ich habe als Dieb auch eine Menge verdient, ich habe Geld, so wie dein Vater es sich wünscht. Nur …«
»Nur kannst du nicht erklären, woher du es hast. Keine reichen Verwandten in Serend, zufällig?« Sie lachte.
Kurz verschlug es Ferron den Atem und es kostete ihn Mühe den Kopf zu schütteln. »Niemand, der sich an mich erinnert.« Immerhin nur eine halbe Lüge. Aber Ferron wollte mit Melina ein neues Leben beginnen und dies nicht mit den anderen Schatten aus seiner Vergangenheit belasten.
Sie zuckte die Schultern. »Wir werden schon einen Weg finden«, sagte sie, beugte sich vor und küsste ihn.
Es war spät am Abend, als Ferron bei dem einfachen Haus am Marktplatz ankam, in dessen erstem Geschoss er wohnte. Die Straßen waren leer, nur aus einer nahen Taverne drang Gesang - oder viel mehr das, was die grölenden Besucher dafür hielten. Müde stieg er die Treppe zu seiner kleinen Wohnung im ersten Stockwerk empor. Durch den Diebeszug in der vorherigen Nacht hatte er nicht viel Schlaf bekommen, den er nun dringend nachholen musste. Doch die Müdigkeit verflog mit einem Schlag, als er am Treppenabsatz anlangte und eine gedrungene Gestalt im Halbschatten neben der Tür zu seiner Wohnung lehnen sah.
Jemand muss mich gestern erkannt haben, dachte Ferron alarmiert und griff instinktiv nach dem schmalen Wurfmesser, das er auch jetzt in einer Scheide am hinteren Hosenbund versteckt hielt. Gehetzt blickte er sich um. Sicher war nicht nur ein einzelner Gardist gekommen, um ihn festzunehmen. Am unteren Ende der Treppe stand aber niemand. War etwa schon das ganze Haus umstellt?
»Ah, da seid Ihr ja. Verzeiht, ich muss eingenickt sein.«
Der Tonfall des gedrungenen Mannes klang affektiert und nun drang Ferron auch der Geruch eines aufdringlichen Duftwassers in die Nase. Das ist kein Gardist und auch kein Inspektor. Vielleicht ein Bote oder ein Diener aus reichem Hause? Aber von wem? Ferron blieb wachsam, entspannte sich jedoch ein wenig.
»Ihr seid doch Ferrostan Menori?«, fragte der Mann nach, da er keine Antwort erhielt.
Ferron erstarrte. »Nein, da seid Ihr hier falsch«, stieß er hervor. Er wollte bestimmt klingen und registrierte verärgert, dass seine Stimme einen heiseren Unterton hatte.
»Tatsächlich? Mitte zwanzig, mittelgroß, dunkles Haar, die Beschreibung, die man mir gab, passt sehr gut auf Euch.« Der Fremde trat ins Mondlicht, das durch ein schmales Fenster in den Hausflur fiel. Er war einen Kopf kleiner als Ferron, hatte eine Halbglatze und einen sauber gestutzten Schnurrbart, dessen Enden zu kleinen Zöpfen geflochten waren. Er musterte Ferron mit schief gelegtem Kopf.
Ferron ignorierte ihn und zog seinen Schlüsselbund aus der Tasche. Er wollte in seiner Wohnung verschwinden und diesen unliebsamen Besuch so rasch wie möglich loswerden.
»Nun, wie es scheint, habe ich mich tatsächlich geirrt«, fuhr der Fremde fort und seufzte theatralisch. »Glücklicherweise weiß ich, wo Herr Menori arbeitet. Dann werde ich ihn wohl morgen im Kontor der Familie Duska aufsuchen müssen.«
Ferron hielt mit dem Schlüssel in der Hand inne und atmete tief durch. Dann schloss er die Tür auf, öffnete sie und deutete ins Innere. »Nach Euch.«
»Vielen Dank, Herr Menori«, erwiderte der Fremde, offenbar nicht im Mindesten von dieser Wendung überrascht, und trat ein.
Ferron blickte noch einmal den Flur entlang. Es war niemand zu sehen, die Tür zur Nebenwohnung war geschlossen. Er hoffte, dass die Nachbarn nichts von dieser Unterhaltung mitbekommen hatten.
Er folgte dem Mann, bot ihm einen Stuhl an dem einfachen Tisch an und entzündete zwei Öllampen. »Wer schickt Euch?«, platzte es schließlich aus ihm heraus.
»Ich bin Kinas, Diener und Bote von Lady Hiska Menori.« Er betonte den Namen, als rede er vom tarisischen Kaiser. »Ich komme mit einer persönlichen Nachricht.«
Hiska also. Das war eine der Möglichkeiten, die Ferron in den vergangenen Augenblicken durch den Kopf geschossen waren. All die Jahre hatte er nichts von seiner Halbschwester gehört, nicht einmal nach dem Tod ihres gemeinsamen Vaters, von dem Ferron über Umwege erfahren hatte. Bislang hatte er sich eingebildet, dass er sich gut genug vor ihr verborgen hatte, aber offenbar war dem nicht so, wenn Kinas sowohl seine Wohnung als auch seinen Arbeitsplatz kannte. Wieso meldete sie sich also jetzt?
»Gebt mir die Nachricht«, forderte Ferron, bemüht seine Neugier nicht zu zeigen.
Kinas holte ein versiegeltes Kuvert aus der Innentasche seines Oberteils und reichte es ihm.
Ferron besah sich das Siegel im Licht einer Lampe. Es zeigte die Krallen eines Nobos, denn das Haus Menori war bekannt für seine Reitechsenzucht - unter anderem. Der Anblick weckte Erinnerungen, die Ferron einen Stich versetzten. Der alte Groll gegen seine Eltern regte sich in ihm. Um sich abzulenken erbrach er das Siegel, öffnete das Kuvert und faltete den enthaltenen Brief auseinander. Sein Herz klopfte, als er ihn ins Licht hielt.
Mein lieber Ferrostan,
nach deinem Verschwinden habe ich über die Jahre hinweg immer wieder versucht, dich ausfindig zu machen, vergeblich. Nun stehen mir zum Glück neue Möglichkeiten zur Verfügung und so habe ich dich in Nurud aufspüren können.
Ich hoffe meine Quellen waren so verlässlich, wie sie sein sollen, und diese Nachricht erreicht dich, bevor du anderweitig von den großen Neuigkeiten erfährst: In der ersten Mittmondjagd des Sommers werde ich Prinz Tilmon heiraten.
Ferron las den letzten Satz zweimal und blickte dann ungläubig zu Kinas auf.
»Ich habe es gerade noch rechtzeitig geschafft«, erwiderte der auf die unausgesprochene Frage. »Morgen wird die Eheschließung offiziell proklamiert, ich denke in zwei oder drei Tagen hätte die Nachricht auch Nurud erreicht.«
Seine Schwester sollte den Kronprinzen heiraten und über kurz oder lang Königin werden? In kaum mehr als einer Mondjagd? Ferron konnte es immer noch nicht glauben. Aber das erklärte, was sie mit neuen Möglichkeiten gemeint hatte. Vermutlich hatte der Prinz ihr erlaubt, den königlichen Geheimdienst zu nutzen, um ihn ausfindig zu machen. Er schluckte, als ihm klar wurde, was der Geheimdienst womöglich noch herausgefunden haben könnte. Hastig las er weiter.
Ich hoffe, du freust dich für mich, trotz allem was zwischen Vater, Mutter und dir vorgefallen ist. Bis heute bedauere ich, wie sie mit dir umgegangen sind, und ich kann verstehen, dass du Vaters Angebot, in die Familie zurückzukehren, damals ausgeschlagen hast. Wie du wohl weißt, ist Vater vor Jahren von uns gegangen, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir, die letzten beiden Menoris, anlässlich meiner Vermählung wieder zusammenfinden würden.
Deshalb lade ich dich hiermit herzlich ein, nach Serend zu kommen und der Vermählung beizuwohnen. Darüber hinaus biete ich dir an, dir deinen Namen und deinen Platz im Hause Menori wiederzugeben. Bitte teile meinem Diener Kinas mit, ob du kommen wirst.
In Liebe
deine Schwester Hiska
Ferron ließ das Blatt sinken und starrte ins Leere. Einerseits war er erleichtert, denn offensichtlich hatte der Geheimdienst nichts über seine Tätigkeit für die Diebesgilde herausgefunden, sonst hätte Hiska ihn sicherlich nicht eingeladen. Andererseits spülte der Brief aber auch viele Bilder aus seiner Vergangenheit empor, riss alte Wunden auf, deren Narben aus Verbitterung, Scham und tiefem Groll bestanden.
Aber er erinnerte sich auch an schöne Dinge: Wie er als Kind mit seiner zwei Jahre jüngeren Schwester in den weitläufigen Hallen des Anwesens Verstecken gespielt hatte, oder wie sie zusammen auf prächtigen Nobos über die weiten Wiesen der Menori-Zucht geprescht waren. Doch diese Bilder wurden fortgewischt von der letzten Erinnerung an die Menoris: Wie Vater und Hiska gemeinsam am Portal des Hauses standen und ihm nachsahen, als ein Diener ihn zum Tor geleitete.
Alter Hass loderte in Ferron auf. Diese Familie hatte ihn nicht mehr gewollt, von einem Tag auf den anderen war er zum Verstoßenen geworden. Sein erster Impuls war, den Brief zu zerknüllen und dem Diener vor die Füße zu werfen.
Aber das wäre Hiska gegenüber ungerecht gewesen. Sie hatte all das genauso wenig verstanden wie Ferron, sie trug keine Schuld daran, dass man ihn fortgeschickt hatte. Ferron selbst war es gewesen, der das Tor zu seiner Vergangenheit zugeschlagen hatte.
Vor allem bot sich ihm hier jedoch eine Lösung für sein Dilemma mit Melina. Jahrelang hatte er versucht, seine Vergangenheit zu verheimlichen, nun hatte sie ihn eingeholt. Warum das nicht nutzen? Wenn er Hiskas Angebot annahm und Jewin als Ferrostan Menori gegenübertrat, als verlorener Sohn eines der vermögendsten Handelshäuser des Reiches, ja, sogar als Bruder der Königin, wie sollte der ihm dann die Hand seiner Tochter versagen?
Ganz wohl war ihm nicht dabei, den abgelegten Namen wieder anzunehmen. Aber das musste ja nicht gleichbedeutend damit sein, wieder in die höchsten Kreise zurückkehren, die er so sehr verachtete. Er war jedenfalls fest entschlossen, nicht über die Feierlichkeiten hinaus in Serend zu bleiben.
»Nun?«, fragte Kinas und riss Ferron aus seinen Gedanken. Der Diener blickte ihn mit gewölbten Brauen an.
Ferron zögerte noch kurz, dann nickte er. »Bestellt meiner Schwester, dass ich ihre Einladung annehme.«
Kinas lächelte. »Das wird die Herrin sehr erfreuen. Für diesen Fall bat sie mich, Euch auszurichten, dass Ihr gern auch schon einige Tage vor der Vermählung anreisen könnt.«
»Ich werde sehen, ob sich das einrichten lässt. Ich habe hier in Nurud noch Verpflichtungen.«
»Selbstverständlich.« Der Diener neigte den Kopf. »Ich freue mich darauf, Euch in Serend begrüßen zu dürfen. Ich wünsche eine gute Nacht, Herr Menori.« Damit erhob er sich und ging zur Tür.
Ferron folgte ihm. »Behaltet mein Geheimnis einstweilen noch für Euch.«
»Wie Ihr wünscht, Herr … Ferron.« Kinas verabschiedete sich mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen.
3
Oberst Larmik hob das Fernrohr ans Auge und starrte zu den Mauern Helgarads hinüber. Die Stadt war fast eine halbe Meile entfernt, doch in der Vergrößerung ragte ihre Befestigung majestätisch vor ihm auf. Seit Tagen ließen die Katapulte der meshacischen Armee Salve um Salve auf die Umfriedung feuern, aber nur ein Turm zeigte schwerere Beschädigungen, die Mauern selbst hatten allenfalls Kratzer abbekommen. Die Nandrier waren berühmt für ihre Kombination von Baukunst und Magie, und dieses Bauwerk war offenbar ein Meisterstück.
Larmik ließ das Fernrohr sinken, wischte sich den Schweiß von der Stirn und sah zu seinen Leuten. Er kommandierte die Fußtruppen der Belagerer, und da der Feind hinter seinen Mauern blieb, saßen sie seit Tagen gelangweilt herum oder halfen beim Heranschleppen neuer Felsbrocken für die Katapulte, die in der näheren Umgebung mittlerweile kaum noch zu finden waren. Letzteres sorgte in der Hitze des Frühsommers nicht eben für gute Stimmung. Noch dazu wurden die Vorräte knapp. Die fast dreitausend Klingen starke Armee hatte den mitgeführten Proviant längst aufgebraucht. Die umliegenden nandrischen Dörfer waren allesamt schon ausgeplündert, die Rationen vor einiger Zeit halbiert worden. Die Moral war am Boden.
Larmik ließ seinen Blick über das Heerlager schweifen. Hunderte Zelte schmiegten sich dicht an dicht an die Flanke des Hügels, auf dessen Kuppe die Katapulte standen. Die meshacische Armee war den Verteidigern Helgarads vier oder fünf zu eins überlegen, doch so lange die Mauern nicht fielen, war an einem Sturm der Stadt nicht zu denken.
Eilige Schritte näherten sich. »Herr Oberst?«
Larmik drehte sich zu der jungen Melderin herum. »Ja?«
»Feldherr Bilagish wünscht Euch zu sehen.«
Der Oberst nickte. »Ich komme.«
Die Stimmung des Kommandostabs war nicht viel besser als die der Soldaten. Feldherr Bilagish war schon am Vortag wegen der fehlenden Fortschritte ungehalten gewesen. Vor Helgarad war er mit seiner Armee von Sieg zu Sieg geeilt und hatte sich den Ruf eines gewieften Strategen erarbeitet - der nun bröckelte, weil die Mauern Helgarads genau das nicht taten.
Larmik übergab einem seiner Hauptleute den Befehl über die Truppe und ging gemessenen Schrittes zum großen Kommandozelt, das hinter den Katapulten und dem Lager der Fußtruppen aufgeschlagen worden war. Auf dem Weg fielen ihm zwei Kutschen mit dem königlichen Wappen auf, die in der Nähe des Zeltes standen und von zwei Palastgardistinnen bewacht wurden. Larmik hoffte, dass sie neue Vorräte und ein paar Fass Bier gebracht hatten, damit ließe sich die Moral vielleicht wieder anheben.
Die Wachen vor dem Zelt ließen ihn anstandslos passieren. Er schlug die Plane beiseite und trat ein. Bilagish stand am Kopfende des großen Tisches, die Hände auf der Platte abgestützt. Wie immer trug er seinen pechschwarzen Harnisch, der seiner hoch aufgeschossenen, eher hageren Gestalt, eine gewisse Wucht verlieh. Sein kahl rasierter Schädel glänzte im Licht einiger Fackeln.
Neben ihm standen Gjard und Vensora, die beiden anderen Obersten der Armee. Gjard war ein nicht mal dreißig Jahre alter, sehr auf sein Aussehen bedachter Schönling, der in seiner adretten Reiteruniform aussah, als seien sie hier auf einem Ball und nicht auf dem Schlachtfeld. Vermutlich fühlte er sich auf Bällen auch viel wohler. Im Gegensatz zu Larmik verdankte Gjard seinen Rang nicht der Erfahrung aus geschlagenen Schlachten, sondern allein seiner adligen Herkunft. Er kommandierte die Reiterei der Armee und hatte seine Leute gut im Griff, wie Larmik ihm widerwillig zugestehen musste.
Die ergraute Veteranin Vensora hätte Gjards Mutter sein können. Die Kratzer und Beulen auf ihrer Rüstung kündeten von den zahlreichen Schlachten, die sie geschlagen hatte. Larmik hatte großen Respekt vor der Kommandantin der Belagerungseinheiten, und wusste nur zu gut, dass einige von Bilagishs glorreichen Siegen der Umsicht und Führungsstärke Vensoras zu verdanken waren. Doch in den letzten Tagen war sie bei Bilagish zunehmend in Ungnade gefallen, weil der Katapult-Beschuss einfach keine Wirkung zeigte. Natürlich traf sie daran keine Schuld, schließlich musste sie mit Felsen auf magisch verstärkte Mauern schießen lassen, und es war nicht ihre Schuld, dass der König dem Magierzirkel zutiefst misstraute und die wenigen Magier im Tross daher nur als Heiler fungieren durften. Aber Gerechtigkeit war in der Heereshierarchie nun mal nicht vorgesehen. Als für die Katapulte verantwortliche Offizierin trug sie in Bilagishs Augen die Schuld an der sich hinziehenden Belagerung - und vermutlich gab sie die Kritik selbst auch an ihre Untergebenen weiter.
Zu Larmiks Überraschung waren noch drei weitere Männer im Raum. Zwei trugen die schimmernden Rüstungen der königlichen Palastgarde und hielten sich im Hintergrund. Der dritte war ein bärtiger Mann in mittleren Jahren, der eine fein geschneiderte Tunika trug und gerade zu den anderen Offizieren sprach.
»… Majestät wünscht, dass die neue Waffe eingesetzt wird, um Helgarad umgehend zur Kapitulation zu bewegen.«
Bilagish blickte kurz auf, als er Larmik bemerkte und winkte ihn heran. »Das ist Oberst Larmik, Kommandant unserer Fußtruppen. Oberst, der Herr heißt Girk, Alchemist des Königs. Er bringt uns neue Munition für die Katapulte.«
Also doch kein Bier, dachte Larmik enttäuscht. »Eben wurde von einer neuen Waffe gesprochen?«, fragte er.
»Ja, Oberst«, erwiderte der Alchemist. »Der König hat sie höchstselbst entwickelt, ich habe ihm nur assistiert. Seine Majestät hat sie Königsfeuer getauft.« Unüberhörbar schwang Stolz in seiner Stimme mit.
Wie einfallsreich, dachte Larmik. »Was genau soll das sein?«
»Alchemisches Feuer«, erwiderte Girk mit gesenkter Stimme.
»Unsere Befehle besagten doch eindeutig, dass wir Helgarad nicht brandschatzen sollten«, wandte Vensora sich mit fragend erhobenen Brauen an Bilagish. »Sonst hätte ich schon längst Brandsätze feuern lassen.«
Der Feldherrwiegte den Kopf. »Der König erwartet Fortschritte. Bislang hat nichts und niemand unsere Armee stoppen können. Ihr Ruf eilte ihr voraus, manche Stadt ergab sich uns deshalb sogar kampflos. Das war der Garant dafür, dass sich die Vision unseres Königs erfüllt, und Meshacia das größte Reich östlich der Götterzinnen wird. Doch wenn wir hier noch lange feststecken, könnte das den Widerstand auch anderswo befeuern. Also schwebt König Tjemen mittlerweile wohl eher vor, ein Exempel zu statuieren. Habe ich das richtig verstanden, Herr Alchemist?«
Mal ganz abgesehen davon, dass die Hochzeit des Prinzen ansteht, und seine Majestät sich auf den Feierlichkeiten gern als Sieger präsentieren will, fügte Larmik in Gedanken hinzu.
Girk nickte. »Ja, Herr General. Seine Majestät hat zwar einige Fässer mit dem Königsfeuer auf die Wagen laden lassen, doch er erwartet, dass die Nandrier die Stadt schon nach kurzem Beschuss aufgeben werden.«
Larmik runzelte die Stirn. »Bislang haben sie sich von Hunderten Felsbrocken nicht beeindrucken lassen, von denen einige auch in die Stadt geflogen sind. Warum sollten ein paar Feuer das so schnell ändern?«
»Wie gesagt, es handelt sich um alchemisches Feuer«, erklärte Girk in belehrendem Tonfall. Er gab seinen Begleitern einen Wink. Einer von ihnen bückte sich und legte ein kleines, in gegerbtes Leder eingeschlagenes Paket auf den Tisch. Der andere holte ein Glasfläschchen mit einer durchsichtigen Flüssigkeit hervor und stellte es daneben.
Girk schlug das Leder auseinander. Zu Larmiks Erstaunen kam der Kadaver einer Ratte zum Vorschein. Der Alchemist entkorkte die Flasche und hielt die Öffnung über das tote Tier. Die Flüssigkeit war zähflüssig wie Gallerte und löste sich nur träge vom Flaschenboden. Als der erste Tropfen auf den Kadaver fiel, stieg Rauch auf. Binnen Augenblicken fraß sich die Gallerte durch das Fell und die Haut der Ratte. Mit dem zweiten Tropfen beschleunigte sich der Prozess, die Innereien wurden sichtbar, ein ekelerregender Geruch stieg Larmik in die Nase. Nur einen Moment später hatten die beiden Tropfen ein fingerbreites Loch durch den ganzen Kadaver gefressen.
»Eine Säure«, stellte Bilagish fest. Er wirkte wenig begeistert. »Ich dachte, es ginge um Feuer?«
»Habt einen Moment Geduld, Feldherr.« Girk hatte die Flasche mittlerweile wieder verkorkt und beiseite gestellt. Er ergriff das Leder an beiden Seiten, hob es vorsichtig an und legte es auf den Boden. »Die Fackel«, forderte er von einem der Gardisten und bekam sie. Er hielt sie nur in die Nähe des Kadavers und plötzlich gab es eine Stichflamme, die beinahe bis zur Tischkante empor loderte. Der Kadaver brannte lichterloh und der Gestank von verbranntem Fell verbreitete sich.
»Wasser«, kommandierte Girk. Der andere Gardist holte eine Karaffe und goss den Inhalt über dem brennenden Kadaver aus. Obwohl die Karaffe halb voll gewesen war, verdampfte das Wasser größtenteils, der Kadaver brannte weiter, bis nichts mehr übrig war und das verrußte Leder sich aufgerollt hatte.
»Bei der Gottkönigin«, stieß Oberst Gjard hervor.
»Beeindruckend«, befand Bilagish und strich sich nachdenklich über den sauber gestutzten Kinnbart.
Erschreckend wäre treffender, dachte Larmik erschüttert. Wenn zwei Tropfen so verheerend wirken, was mag dann ein Beschuss mit dem Inhalt der ganzen Flasche in der Stadt anrichten? Wer soll sich uns dann noch entgegen stellen? Würde der Expansionsdrang des Königs überhaupt noch ein Ende finden? Und zu welchen anderen Gräueltaten könnte der König das Feuer noch verwenden?
»Wie transportiert ihr es?
---ENDE DER LESEPROBE---