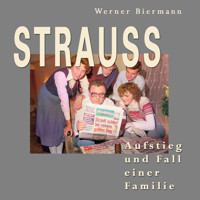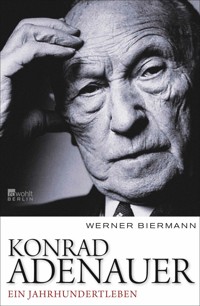
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Erfinder, Staatsmann, Gründervater: Über einen, der unser Land prägte wie kaum ein Zweiter Konrad Adenauer hat die Bundesrepublik Deutschland geprägt wie kaum ein Zweiter. Er setzte die soziale Marktwirtschaft durch, söhnte Deutschland mit Frankreich aus und verankerte den Bonner Staat im Westen. Werner Biermann erzählt dieses Jahrhundertleben, das von Bismarck bis zu den Beatles reichte. Auf der Grundlage bisher nicht beachteter Quellen, jahrelanger Recherchen sowie ausführlicher Gespräche mit der Familie schildert er den ebenso faszinierenden wie dramatischen Lebensweg Adenauers, seine Ideen und Ziele, seine Schwächen und Ängste. Besonderes Gewicht legt Biermann dabei auf das Leben vor der Kanzlerschaft: den politischen Aufstieg im Kaiserreich, die steile Karriere als Kölner Oberbürgermeister und prominenter Reichspolitiker in der Weimarer Republik und nicht zuletzt den jähen Absturz während des «Dritten Reiches» – der ihn beinahe das Leben gekostet hätte, als er 1944 verhaftet wurde. Dabei wird eines klar: Ohne sein in der Literatur bisher vernachlässigtes Vorleben ist der legendäre Kanzler nicht zu begreifen. Ein grandios geschriebenes Porträt – und ein fesselndes Panorama deutscher Geschichte von der Kaiserzeit bis zum Kalten Krieg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 907
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Werner Biermann
Konrad Adenauer
Ein Jahrhundertleben
Über dieses Buch
Erfinder, Staatsmann, Gründervater: Über einen, der unser Land prägte wie kaum ein Zweiter
Konrad Adenauer hat die Bundesrepublik Deutschland geprägt wie kaum ein Zweiter. Er setzte die soziale Marktwirtschaft durch, söhnte Deutschland mit Frankreich aus und verankerte den Bonner Staat im Westen.
Werner Biermann erzählt dieses Jahrhundertleben, das von Bismarck bis zu den Beatles reichte. Auf der Grundlage bisher nicht beachteter Quellen, jahrelanger Recherchen sowie ausführlicher Gespräche mit der Familie schildert er den ebenso faszinierenden wie dramatischen Lebensweg Adenauers, seine Ideen und Ziele, seine Schwächen und Ängste. Besonderes Gewicht legt Biermann dabei auf das Leben vor der Kanzlerschaft: den politischen Aufstieg im Kaiserreich, die steile Karriere als Kölner Oberbürgermeister und prominenter Reichspolitiker in der Weimarer Republik und nicht zuletzt den jähen Absturz während des «Dritten Reiches» – der ihn beinahe das Leben gekostet hätte, als er 1944 verhaftet wurde. Dabei wird eines klar: Ohne sein in der Literatur bisher vernachlässigtes Vorleben ist der legendäre Kanzler nicht zu begreifen.
Ein grandios geschriebenes Porträt – und ein fesselndes Panorama deutscher Geschichte von der Kaiserzeit bis zum Kalten Krieg.
Vita
Werner Biermann (1945–2016) war Autor und Filmemacher und realisierte etwa fünfzig lange Dokumentarfilme, darunter «Am Abgrund. Anatomie der Kubakrise» (2002) und «Der Erste Weltkrieg – Alptraum Verdun» (2004). Für seine Arbeiten wurde er mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Zahlreiche Buchveröffentlichungen, u.a. «Strauß. Aufstieg und Fall einer Familie» (2006, Neuausgabe 2015) und «‹Der Traum meines ganzen Lebens›. Humboldts amerikanische Reise» (2008).
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung any.way, Hamburg
Coverabbildung Will McBride/Agentur Focus
ISBN 978-3-644-10026-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Bess, Tina und Jenny
Wir betreten das Leben der Toten wie eine offene Stadt.[1]
Jean-Paul Sartre
Dass die Biographie Erzählung sein muss oder gar nichts, bedarf keines Beweises.[2]
Golo Mann
Prolog
Rhöndorf, 15. März 1967
Ein grauer, regnerischer Tag mit einem scharfen Wind, der durch das Rheintal fegt. Konrad Adenauer, einundneunzig Jahre alt, trinkt im Arbeitszimmer seines Hauses Tee mit seinem Besucher, dem Kunsthändler Heinz Kisters[1]. Adenauer fühlt sich krank. Er hustet, es sind heftige Attacken.
Die ewigen Bronchien, wissen Sie.
Damit hat er immer zu tun gehabt, sein ganzes Leben lang. Aber jetzt, seit der Spanienreise, von der er vor wenigen Tagen zurückgekommen ist, plagt ihn der Husten besonders böse; Fahrten durch eiskaltes Winterwetter, durch den Schnee nördlich von Madrid, das hängt ihm nach. Seine Hausärztin hat ernstlich mit ihm geschimpft.
Er grinst, als sei ihm ein kleines Betrugsmanöver gelungen: Aber jedenfalls habe ich endlich Spanien entdecken können. Ein wundervolles Land, voll von Kunst. Allein der Prado! Und wissen Sie, was ich in dem Moment gedacht hab? Spanier hätte man sein sollen.
Ein erstaunlicher Satz, denkt der Besucher. Dieser alte Mann, der sein ganzes Leben lang Politik gemacht hat, deutsche Politik, und der schon längst seinen Platz in der Geschichte dieses Jahrhunderts hat – der ist also noch fähig, sich ein ganz anderes Leben vorzustellen?
Sie sitzen in Adenauers Arbeitszimmer nebeneinander auf dem Sofa, um die Bilder des Raumes aus demselben Blickwinkel betrachten zu können. Rechts an der Wand ein kleinerer Tizian, das Porträt des Dogen Francesco Donà, gemalt etwa 1550; daneben das Bild des Hieronymus in einer wilden, felsigen Landschaft, der Heilige liegt auf den Knien, den Stein noch in der Hand, mit dem er sich die Brust zermartert hat, bis Gott ihm endlich Ruhe schenkte; anders konnte er dem Sturm der Versuchungen nicht widerstehen. Gegenüber eine Madonna mit Kind des Antwerpener Malers Joos van Cleve, um 1520 entstanden: Maria mit beinahe geschlossenen Augen wie in einer Meditation, während das Jesuskind auf ihrem Schoß vergnügt mit der Korallenkette spielt, mit der nach den Vorstellungen der Zeit Krankheiten abgewehrt werden. Auf der anderen Seite eine Beweinung Christi des Jan Joest von Kalkar: der tote, vom Kreuz genommene Jesus, von Maria und Johannes behutsam gestützt, während Maria Magdalena den ausgestreckten Arm des Erlösers mit einem Schwamm vom Blut reinigt – ein eindrucksvolles Bild, eine Meditation über den Tod und über die Traurigkeit, die er auslöst.
Vor diesen Bildern also verbringt Adenauer viele Stunden, um über sich selbst und die Welt, wie sie war und ist, zu meditieren. In Wirklichkeit, denkt der Kunsthändler, ist dieser alte Mann ganz anders, als man ihn zu kennen meint. Wie weit sind diese Bilder, die ihm so viel bedeuten, von der Epoche entfernt, die er doch selbst ganz wesentlich gestaltet hat und die sogar seinen Namen trägt.
Es sind Jahrhunderte.
Der Nachmittag vergeht. Draußen fängt es an zu dämmern. Ein Rest des grauen Himmels spiegelt sich unten im Tal, jenseits der Dorfkirche, im Wasser des Rheins.
Adenauer erzählt von seiner Kindheit in Köln, von der schmalen Balduinstraße nahe der Stadtmauer; eine Welt, sagt er, die es schon lange nicht mehr gibt. Er erzählt von seinen Eltern, dem Vater vor allem. Ein strenger Mann, immer korrekt gekleidet, ehrfurchtgebietend. Der Vater war ein armer Waisenjunge, hat sich aber hochgearbeitet vom Hilfsknecht zum Kanzleirat, durch nichts als Fleiß und Disziplin, stellen Sie sich vor. Ganz erstaunlich. Einmal hat der Vater den kleinen Konrad mitgenommen, um ihm einen Mann mit weißem Bart zu zeigen, der in einer prächtigen Kutsche vorbeifuhr. Das war der Kaiser, und es hieß, dank ihm sei endlich der Dom fertiggebaut worden nach so vielen Jahrhunderten.
Erstaunlich, wie im Alter alle diese Dinge wieder hochkommen.
Warten Sie einen Moment, sagt er schließlich, ich möchte Ihnen etwas zeigen. Er steht auf und geht in sein kleines Schlafzimmer, das nebenan liegt. Nach einiger Zeit kommt er zurück, ein Foto in Händen.
Sehen Sie mal.
Er reicht dem Besucher das Bild. Es zeigt einen würdigen alten Herrn mit Vollbart, den alten Kanzleirat Adenauer. Die Augen sind geschlossen. Kisters sieht sofort, dass es das Foto eines Toten auf seinem Totenbett ist.[2]
Dann nimmt Adenauer das Bild zurück, setzt sich in einen Sessel, betrachtet es lange. Er war ein seltsamer Mann, sagt er schließlich. Für uns als Kinder kam er direkt nach dem lieben Gott, vielleicht sogar noch vor ihm. Ich denke oft an ihn. Erst jetzt sehe ich, wie sehr er mein ganzes Leben beeinflusst hat.
Erster Teil
Der treue Sohn seines Vaters
1Der Aufsteiger
Meßdorf bei Bonn, 1851
Wenig weiß man über den Jungen, der einmal der Vater von Konrad Adenauer sein wird. Im Sommer 1851 arbeitet der achtzehnjährige Johann Conrad Adenauer als Jungknecht auf dem Gutshof Ostler, einem großen Bauernhof, der so eindrucksvoll ist, dass man ihn im Volksmund die «Meßdorfer Burg» nennt. Vorher hat er sich mit verschiedenen anderen Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen, wie sie sich im Dorf anbieten, unter anderem als Arbeiter in der Ziegelei. Seine Eltern sind seit langem tot.
Sein Vater, der 1810 geborene Franz Adenauer, hatte sein Glück in der Stadt versucht, im nahe gelegenen Bonn, er war Bäcker geworden, hatte mit einundzwanzig Jahren geheiratet und mit seiner Frau Katharina drei Kinder gehabt, darunter Conrad, den einzigen Sohn. Schließlich hat Franz sogar eine eigene Bäckerei eröffnet – ein verheißungsvoller Anfang in der vergleichsweise großen Stadt. Conrad wird später seinen Kindern von dieser Bonner Bäckerei erzählen, dem Duft des frischen Brotes, der schon am frühen Morgen durch das Haus zog. Einmal wird er ihnen sogar die Straße zeigen und das Gebäude, in dem er lebte.[1] Unklar ist, warum Franz Adenauer schon bald darauf, 1837, sein Geschäft einem anderen Bäcker überließ und zurück aufs Land ging, nach Meßdorf, wo ein Teil seiner weitverzweigten Familie lebte.
Allerdings brachte der Umzug dem Franz Adenauer kein Glück, denn in Meßdorf starb plötzlich eines der Kinder und, im selben Jahr, auch seine Frau Katharina, Conrads Mutter. Franz heiratete ziemlich rasch eine andere Frau, Eva Nöthen, und hatte mit ihr eine weitere Tochter, die aber auch bald nach der Geburt starb. Und schließlich, im Alter von nur neunundzwanzig Jahren, starb auch der unglückselige Franz Adenauer. Im Dorf erzählte man noch lange, er sei bei der Apfelernte von der Leiter gefallen und habe sich den Hals gebrochen.
Viel Tod, und so war es schon immer. Auch in der Generation der Großeltern und Urgroßeltern Adenauer waren die Kinder zahlreich zur Welt gekommen und allzu häufig sehr früh wieder von ihr gegangen; man nahm es hin als Fügung. Auch die Frauen starben früh, meist bei der Geburt des fünften oder sechsten Kindes im Kindbett, und die Männer heirateten rasch wieder, ganz pragmatisch. Nach dem Tod des Vaters, als der Junge gerade sieben war, ist Conrad bei seiner Stiefmutter Eva geblieben und bei ihr aufgewachsen, aber jetzt, als junger Mann, wohnt er auf dem Gutshof. Zumindest teilt er sich, solange die Erntezeit dauert, zum Schlafen eine der Kammern im Gesindeflügel der «Meßdorfer Burg».
Die flachen Niederungen und Flussauen westlich von Bonn, mit den versprengt darin liegenden kleinen Dörfern wie Meßdorf, Oedekoven, Alfter, bis hin zum Vorgebirge der Eifel im Westen, der Ville – das alles ist fruchtbares Acker- und Gartenland mit intensivem Gemüse- und Obstanbau auf gutem Lössboden und mit ausgedehnten Apfelplantagen mittendrin. Viel Arbeit für Tagelöhner wie Conrad, solange die Saison andauert. Dann aber kommt der kalte Winter und mit ihm die Arbeitslosigkeit, und manchmal kommt auch der Hunger.
Dat is schon immer so jeweese, sagen die Alten.
Aber es gibt Leute, die wollen, dass alles anders wird. Sie reden sogar von Revolution. Man konnte vor einiger Zeit im «Bonner Wochenblatt» lesen, wie sie sich im Gasthof «Römer» versammelten, alle diese Professoren und Studenten von der Universität, und freche Reden gegen die Obrigkeit gehalten haben, sogar gegen den König, der doch König ist, weil Gott der Herr es so will, und die dann singend losgezogen sind, um sich im Siegburger Zeughaus mit Waffen zu versorgen, Professor Kinkel immer voran. Aber dann reichte es, drei Dutzend preußische Dragoner loszuschicken, und aus war es mit der Revolution in Bonn. Wie dann allerdings dieser Kinkel später von seinen Kumpanen aus der Festungshaft in Spandau befreit wurde, das war ein tolles Stück, das im vergangenen Herbst wochenlang in den Zeitungen erzählt wurde. Neuerdings heißt es, Kinkel halte sich in England auf, von wo er weiterhin die Sache der Revolution zu betreiben versuche.[2]
Also bleibt wohl doch alles, wie es war.
Sommer 1851. Es gibt keine Briefe, keine Tagebücher, nur ein paar im Familienkreis erzählte Anekdoten, doch in diesem Sommer muss der Achtzehnjährige angefangen haben, intensiv über sein Leben nachzudenken: Woher und wohin? Er ist empfindsam genug, die Härten dieses ländlichen Alltags, die großen Abhängigkeiten und kleinen Demütigungen nicht einfach als gegeben hinzunehmen; er hat Phantasie genug, sich andere, bessere Welten jenseits des Horizonts vorzustellen. Und er ist intelligent genug, die richtigen Fragen zu stellen, sogar sich selbst. Was soll aus mir werden? Wer will ich einmal sein? Er kann sein künftiges Schicksal, wie es ihm wohl bestimmt ist, in den verwitterten Gesichtern der altgewordenen Knechte sehen, deren Leben sich im Kreis gedreht hat und die jetzt, nach einer lebenslangen Plackerei, ihr Gnadenbrot verzehren – wie die alten Pferde. Eine schreckliche Vorstellung.
Überall in den Dörfern, bis tief in die Eifel hinein, erzählt man von Brasilien, und manchmal kommt von einem, der die Auswanderung gewagt hat, ein Brief aus diesem fernen Land. Dort lebt der Mensch wahrhaft frei, heißt es, und wenn einer tüchtig ist und strebsam, dem stellen sich, anders als hier, keinerlei Hemmnisse in den Weg. Es gibt dort einen Kaiser, aber keine Fürsten und Grafen, und jeder ist auf seinem eigenen Land sein eigener Herr. Womöglich hat Conrad von Brasilien geträumt, von ungeheuer großen Strömen, endlosen Urwäldern und Savannen, von Reitern, die auf ihren Pferden riesige Rinderherden umkreisen. Allerdings ist es für einen Meßdorfer Jungknecht vollkommen unmöglich, das für die Auswanderung erforderliche Reisegeld aufzubringen.
Die Zukunft scheint versperrt, Meßdorf eine Falle.
Schließlich legt Conrad sein Schicksal in die Hände einer höheren Macht. Diese Macht ist nicht Gott, der zürnende Gott, der seine Gebete nicht erhört, sondern der preußische Staat, zu dem das Rheinland ja nun gehört. Conrad Adenauer tritt in die preußische Armee ein, um Berufssoldat zu werden, und das ist die entscheidende, man kann sagen schicksalhafte Wendung, die er selbst seinem Leben gibt.
Dreißig, fünfunddreißig Jahre später wird er ein würdiger älterer Herr geworden sein, hochangesehener Justizbeamter mit glänzender Laufbahn, stets korrekt gekleidet und mit gepflegtem Bart, der abends wortkarg und mit strengem Blick vom Justizpalast am Kölner Appellhofplatz nach Hause kommt, nicht ohne auf dem Heimweg bei der Schwarzen Madonna in der Kupfergasse ein Gebet verrichtet zu haben – das Prachtexemplar eines preußischen Beamten, kaisertreu und gottesfürchtig, gehorsam seinen Vorgesetzten, streng zu seinen Untergebenen, diszipliniert, strebsam, sparsam. Seinen Kindern gegenüber ist er, mehr noch als ohnehin üblich in seiner Zeit, autoritär und unnahbar. Er befiehlt und ordnet an; er verurteilt und bestraft. Konrad, sein jüngster Sohn, wird in ihm so etwas wie den direkten Gesandten Gottes sehen, der hier auf Erden – und angefangen in der Familie – nach dem Rechten zu sehen hat; eine beinahe erdrückende, überdimensionale Vaterfigur, deren prägender Wirkung er sich nicht entziehen kann.
Ein ganzes Jahrhundert nach dem Meßdorfer Sommer wird dieser Sohn, jetzt selbst schon ein alter Herr von Mitte siebzig, gerade sein Amt als deutscher Bundeskanzler angetreten haben. Und man wird erkennen, wie die Maximen und Grundsätze, die Conrad in seinem Leben als preußischer Soldat und Beamter erworben hat, noch im Charakter des Sohnes lebendig und wirksam sind. Und weil politisches Handeln immer auch von den tiefen charakterlichen Prägungen des Handelnden beeinflusst wird, hat der Meßdorfer Junge im Sommer 1851 mit seiner Entscheidung wohl ein bisschen auch die Geschichte der Bundesrepublik beeinflusst, die sein Sohn so wesentlich gestaltet hat.
Die militärische Laufbahn dieses Conrad Adenauer ist geschildert worden als erstaunliche Karriere, als Aufsteigergeschichte eines Jungen vom Lande in der preußischen Armee. Aufstieg durch Dienst. Man hört die Biographen quasi applaudieren. Was aber diese Karriere für den Charakter und die Persönlichkeit des jugendlichen Rekruten, genauer gesagt für deren systematische Zerstörung und allmähliche Umformung, bedeutet und wie diese mentale Abrichtung praktisch verläuft, ist im Falle Conrad Adenauers noch nicht erzählt worden.
Zwar ist die preußische Armee um 1850 nicht mehr die Armee Friedrichs II., der es zum Leitprinzip gemacht hatte, dass «der gemeine Soldat vor dem Officiere mehr Furcht als vor dem Feinde haben» solle, und der dies mit Stockschlägen, Arrest, Haft, Fausthieben oder tagelangem Anketten durchsetzen ließ. Anders als durch diese entsetzliche Angst vor den Offizieren, so glaubte der König, würden sich die meisten Soldaten nicht in die Schlacht und den Tod treiben lassen. Leistete dennoch einer Widerstand, war das Spießrutenlaufen eine oft verhängte Strafe: Dabei muss der Delinquent durch eine von zweihundert oder dreihundert Soldaten gebildete Gasse laufen, während die Männer mit Stöcken oder, besser noch, mit nassen Weidenruten auf ihn einschlagen, auf die nackte Haut, die aufplatzt und blutet; es sind Männer, die ihrerseits von hinter ihnen lauernden Unteroffizieren mit Stockschlägen dazu angetrieben werden, nicht zu zimperlich zuzuschlagen. Das Spießrutenlaufen kam zumeist einem Todesurteil gleich und wurde 1806 abgeschafft, zumindest offiziell.
Aber auch in der Armee, in die der junge Conrad Adenauer im Herbst 1851 eintritt, werden die Rekruten immer noch systematisch misshandelt, wird ihnen die totale Subordination, der Kadavergehorsam eingebläut – der eigentliche Geist des preußischen Militärs, die Essenz des Preußentums. Die auf diese Weise erzwungene Selbstentäußerung des Einzelnen, wie sie der Meßdorfer Junge erlebt haben muss, die Auflösung seiner Persönlichkeit und die willenlose Unterordnung unter den Angriffsbefehl wie jeden anderen Befehl, gilt als zentrale preußische Tugend. «Wer auf die preußische Fahne schwört, hat nichts mehr, was ihm selber gehört.»[3]
Der Begriff des «Kadavergehorsams» stammt zwar aus der Gehorsamsregel der Jesuiten, hat aber seine eigentliche, wahre Verwirklichung erst in der preußischen Armee gefunden – als die absolute Fügsamkeit des Soldaten, eben wie die eines Kadavers, einer Leiche, die sich widerstandslos einem fremden Willen unterwirft, da sie keinen eigenen hat, und mit der man alles tun kann (in einigen europäischen Sprachen benutzte man noch lange diesen deutschen Begriff, um die Mentalität des preußischen und deutschen Militärs und der vom Kadavergehorsam geprägten militaristischen Gesellschaft zu beschreiben).
Ein französisches Sprichwort trifft es wohl genau: «Être Prussien est un honneur, mais pas plaisir.»[4] Die einzigartige Mischung aus Selbstverleugnung, Disziplin, Gehorsam und Unterordnung, aber auch Geradlinigkeit, Ordnungssinn, Tapferkeit und Pflichterfüllung hat Theodor Fontane oft beschrieben, am genauesten vielleicht in einem Roman, in dem er einen Offizier sagen lässt, gerade dies sei etwas speziell Preußisches. «Was uns obliegt, ist nicht die Lust des Lebens, sondern lediglich die Pflicht. Wir sind dadurch vor anderen Nationen ausgezeichnet, und selbst bei denen, die es nicht begreifen und übel wollen, dämmert die Vorstellung von unserer daraus entspringenden Überlegenheit.»[5]
Die zentralen Tugenden sind Tapferkeit und Härte: «Lerne leiden, ohne zu klagen» und «Gelobt sei, was hart macht» – so sind sie sprichwörtlich geworden. Etwas von diesem preußischen Kult der Härte, wenn auch gänzlich pervertiert, schwingt noch bei Heinrich Himmler mit, wenn er über die Massenmorde seiner SS-Männer sagt, sie hätten «die Härte» haben müssen, Hunderttausende Menschen fortzuschaffen und zu töten: «Und es muss trotzdem immer so sein, dass unsere Männer niemals weich werden, sondern dass sie das mit zusammengebissenen Lippen machen.»[6]
Die erste Zeit, die viele Monate dauert, ist für Conrad Adenauer wie für jeden Rekruten die schwerste Zeit, die Zeit des Drills. Dies geschieht nicht nur, um die Rekruten militärisch zu professionalisieren; es geschieht auch, um sie zu demütigen und ihren Willen zu brechen. Nur der willenlose Soldat lässt sich operativ einsetzen. Die militärischen Abläufe werden wieder und wieder – und unter härtesten Bedingungen – exerziert, etwa wenn die Rekruten, beladen mit schwerstem Gepäck, auf wochenlange Märsche durch den Winter geschickt werden, jeden Tag zwanzig Kilometer oder mehr, bis sie irgendwann zusammenbrechen.
Wir dürfen uns den jungen Conrad also als einen unglücklichen Mann vorstellen, in tausend Momenten der Wut, des unterdrückten Aufbegehrens, der hasserfüllten Angst vor den Vorgesetzten, der Enttäuschung und existenziellen Mutlosigkeit, wenn er mit zerschlagenen Knochen und zerschundener Haut nachts auf seinem Lager liegt. Er ist ja einiges gewöhnt; oft genug ist er mit schmerzenden Gliedern nach einem langen Arbeitstag bei der Ernte auf seine Pritsche gesunken. Aber so hat er sich das Militär doch nicht vorgestellt. Da ist nichts mehr von der fröhlichen Truppe, die sonntags mit klingendem Spiel durch Bonn zog, mit den schönen preußischblauen Uniformen, den wehenden Fahnen, der Musik und den winkenden Mädchen am Straßenrand. Da ist nur noch Gewalt, körperliche und seelische Gewalt. Aber dann allmählich, da Widerstand so unmöglich wie zwecklos ist, will er natürlich da durch, will es hinter sich bringen, wenn es schon kein anderes Entkommen, kein Zurück mehr gibt. Und am Ende, früher oder später, überlebt man nicht ohne innere Zustimmung zu allem, dem man sich ausgeliefert hat. Eine lange Einübung im Ertragen des schwer Erträglichen, durch nichts als eiserne Disziplin und absoluten Gehorsam.
Wenn es andererseits eine stille Sehnsucht des jungen Conrad war, sich in einer größeren Ordnung wiederzufinden und aufgehoben zu fühlen, einem System, in dem individuelle Fragen und Entscheidungen weder möglich noch nötig sind, dann hat er dieses Ziel jetzt erreicht. Denn das ist ja die Kehrseite von Dienst, Gehorsam, Züchtigung und Gewalt: dass die Armee in festgelegter und zuverlässiger Weise für ihn sorgt, zumindest mit Nahrung, Kleidung, Obdach, Taschengeld. Und sie bietet sogar eine Perspektive: aufzusteigen durch Unterordnung und, besser noch, durch militärische Tapferkeit im Krieg. Schritt für Schritt, Rang für Rang.
Ausgebildet und geschliffen wird er – als zunächst dreijähriger Freiwilliger – beim 2. Rheinischen Infanterieregiment. Nach drei Jahren glaubt er das Schlimmste hinter sich zu haben und verpflichtet sich weiter, sei es aus innerer Überzeugung, sei es aus Mangel an Alternativen. 1858 findet man ihn im 3. Westfälischen Infanterieregiment und später, ab 1860 in Paderborn, im 7. Westfälischen Infanterieregiment, wo er den Rang eines Sergeanten hat. Ein Jahr später, nach zehn Jahren Dienst, wird er zum Feldwebel befördert. Conrad Adenauer hat bei alledem großes Glück, weil Preußen in diesen ersten Jahren seines Dienstes keinen Krieg führt. Er muss also nicht ins Feuer. Und selbst beim ersten der dann folgenden preußischen «Einigungskriege» – eine nationalistische Geschichtsschreibung nennt diese Kriege so, weil sie zur deutschen Einigung und zur Reichsgründung von 1871 führten –, also dem Krieg gegen Dänemark, 1864, nimmt sein Regiment nicht teil. Stattdessen wird es nach Köln verlegt, bezieht Quartier in der Kaserne am Neumarkt, mitten in der Stadt.
Köln, die große Stadt, hat ihn fasziniert. Siebenundzwanzig Kirchen, darunter zwölf großartige romanische, die in jeder anderen Stadt wohl ihrerseits große Dome wären; und dann die mächtige Kathedrale, der Dom, an dem seit einiger Zeit wieder gebaut wird. Zwar steht noch immer, still und regungslos wie seit über dreihundert Jahren, der gigantische hölzerne Baukran aus dem 14. Jahrhundert auf dem flachen Dach des südlichen Turms – das weithin sichtbare Symbol eines gescheiterten Traums, einer Erstarrung der Stadt in fast noch mittelalterlichen Verhältnissen. Doch seit 1848 wird nun, nach den wiedergefundenen, sechshundert Jahre alten Plänen der frühen Dombaumeister, an der Kathedrale wieder gearbeitet, vor allem die beiden später so emblematischen spitzen Türme werden aufgerichtet.
Das beeindruckt den katholischen und zutiefst frommen Feldwebel Adenauer. Aber auch das alltägliche Leben fasziniert ihn, das quirlige, lärmende Treiben in der engen und von der alten Stadtmauer eingeschnürten Stadt, der dichte Verkehr der Droschken und der von Pferden gezogenen Omnibusse, das ununterbrochene Geschrei der Kutscher, der Lärm aus den vielen Handwerksbetrieben, die bunten Märkte und lebhaften Geschäftsstraßen, die Kneipen und Kaschemmen am Rhein, wo sich die Schiffer vergnügen, die Musik der Tanzböden, die eleganten und provozierend selbstbewussten Frauen – das alles hat er bisher nicht gekannt. Es ist die Stadt, in der sich Adenauer Jahre später als Zivilist endgültig niederlassen wird.
Das preußische Cöln ist zugleich die wichtigste Garnisonsstadt im Westen, voll von Soldaten; bei ungefähr hundertzwanzigtausend Einwohnern sind es mehr als zehntausend, darunter die vornehmen und gesellschaftlich gewandten preußischen Offiziere aus den besten Familien, zumeist sogar aus dem Adel. Da hat es ein Unteroffizier nicht ganz leicht, sich bei den lecker kölsche Mädche ins Spiel zu bringen – wobei «lecker» in Kölner Mundart einfach «hübsch» bedeutet. Das älteste erhaltene Foto Conrad Adenauers, etwa aus dieser Zeit, zeigt einen ziemlich gutaussehenden jungen Mann von Anfang dreißig in der schmucken Ausgehuniform eines Feldwebels: dichtes dunkles Haar, nach hinten gekämmte Locken, dunkel auch der üppig wachsende Schnauzbart, eine virile Erscheinung, die den Mädchen gefallen haben wird; der Blick geht eher kühl und unbeteiligt an der Kamera vorbei.
Eines dieser lecker Mädche, mit denen er jetzt abends, wenn er Ausgang hat, am Rheinufer poussiert, ist Helene, ungefähr sechzehn Jahre alt, Tochter eines gediegenen Kölner Bankbeamten, der von dieser frühreifen Liaison natürlich nichts ahnt. Aber auch hier: keine Briefe, keine Tagebücher, keine späteren Erzählungen. Das Bild von Helene Scharfenberg, das noch heute im Rhöndorfer Schlafzimmer des Kanzlers hängt, zeigt Adenauers Mutter als schon etwas in die Jahre gekommene Schönheit mit Wuschelkopf, strengem Blick und einem Ausdruck von Enttäuschung und Bitterkeit, der sich ins Gesicht geschrieben hat; aber das sechzehnjährige Mädchen, das eine Beziehung zu dem doppelt so alten Feldwebel Conrad Adenauer eingeht, wird vom Leben noch alles erwartet haben. Wahrscheinlich haben sie an einem dieser Sommerabende einander die Ehe versprochen, allerdings, wegen Helenes Jugend, heimlich.
Dann, plötzlich, kommt der Krieg, wie man so sagt, und der Feldwebel zieht in die Schlacht. Aber natürlich «kommt» auch dieser Krieg nicht einfach so, er ist, wie alle Kriege, gewollt herbeigeführt: in diesem Fall vom preußischen König, seinem Ministerpräsidenten Otto von Bismarck und den Generälen. Es ist der zweite «Einigungskrieg», ein Krieg diesmal gegen das habsburgische Kaiserreich, der deshalb auch der Deutsche Krieg genannt wird – ausgelöst durch die preußische Kriegserklärung an Österreich vom 19. Juni 1866. Sein Hauptzweck ist, wie bei allen preußischen Kriegen seit den fernen Tagen des Großen Kurfürsten, den weiteren unaufhaltsamen Aufstieg Preußens zu einer führenden Militärmacht Europas zu beschleunigen – und zur dominierenden Macht eines künftigen deutschen Einheitsstaates.
Vielleicht begleitet Helene ihren Feldwebel noch zur Bahn, küsst ihn und steckt ihm eine Blume ins Revers; die ewig gleiche Szene des Abschieds, wenn der Soldat in den Krieg muss. Vergiss mich nicht, Helene. Komm bald zurück, Liebster.
Viele Männer werden aus diesem Krieg nicht zurückkommen. In Böhmen treffen die feindlichen Heere aufeinander; aufseiten der Österreicher kämpfen die Bayern, die Sachsen, die Württemberger und Tausende weitere Soldaten diverser deutscher Kleinstaaten gegen die Preußen: wahrhaftig ein deutscher Krieg. Conrad Adenauer nimmt teil an der alsbald berühmt gewordenen Schlacht von Königgrätz (heute heißt die tschechische Kleinstadt Hradec Králové), die für Preußen zur Glorie, für ihn persönlich aber zur Katastrophe wird. An einem einzigen Tag, dem 3. Juli 1866, kämpfen auf einem engen Raum von wenigen Quadratkilometern mehr als vierhunderttausend Männer in einer extrem verlustreichen Schlacht, was die übliche Umschreibung für die Tatsache ist, dass binnen weniger Stunden Tausende Männer sterben, einander töten.
Die Schlacht von Königgrätz ist in allen Einzelheiten von Militärhistorikern dokumentiert, aber auch von Literaten wie Theodor Fontane (etwa in «Effi Briest») beschrieben worden, und so wissen wir auch, wo und wie genau das 7. Westfälische Infanterieregiment Nr. 56 – und mit ihm der Feldwebel Adenauer von der 28. Brigade – an diesem Tag kämpfte: in einem grausamen, blutigen Brennpunkt der Schlacht, nahe bei dem Dorf Problus. Sie laufen gegen ein verheerendes Infanteriefeuer der Sachsen an, und von den Flanken kommt Dauerfeuer aus bayerischen Kartätschen. Detonationen, Schreie, Befehle, Angst, Blut und Tod, die «Achtundzwanzigste» mittendrin; dann Sturmangriff und blutiger deutsch-deutscher Nahkampf mit aufgesetztem Bajonett, Mann gegen Mann. «Also eine der großen Szenen für die preußischen Geschichtsbücher», schwärmt der sonst eher besonnene Adenauer-Biograph Hans-Peter Schwarz.
Dieser Krieg gilt als «moderner» Krieg mit Eisenbahnen, mit Telegraphie und mit Gewehren, aus denen man zwanzigmal pro Minute feuern kann. Aber der eigentliche Akt des Tötens ist so archaisch wie immer: irgendetwas Metallisches, ein Bajonett, eine Kugel, ein Granatsplitter muss in das allzu schutzlose Fleisch eines Mannes eindringen, muss ihn dadurch, mitten im Gefecht, außer Gefecht setzen oder, im Idealfall, töten. Wie es etwa Adenauers Hauptmann geschieht, der durch einen Kopfschuss getötet wird und fällt.
Conrad selbst wird in diesem Gefecht schwer verwundet, überlebt aber, weil es gelingt, ihn rasch in ein Feldlazarett zu bringen; später wird er zu Genesungszwecken in die Heimat transportiert. Die Art seiner Verletzung ist unklar, muss aber, wie ein späteres militärisches Dokument ausweist, erheblich gewesen sein. Darin wird Conrad als «Ganzinvalide und temporär völlig erwerbsunfähig» beschrieben, sodass man ihm eine «chargenmäßige Pension von zehn Talern monatlich» zubilligt, außerdem eine «Verwundetenzulage» von monatlich zwei Talern, die «Verstümmelungszulage» von fünf Talern und ein Extrageld von drei Talern monatlich. Diese Pension wird ihm «bis ultimo Oktober 1869», also für etwas mehr als zwei Jahre, gewährt. Summa summarum zwanzig Taler monatlich für einen verwundeten und verstümmelten Körper, von dem niemand sagen kann, ob er jemals wieder ganz gesund wird.
Sein Sohn Konrad hat sehr viel später erzählt, dass der Vater beinahe nie über seine Kriegserlebnisse gesprochen und schon gar nicht im Stil heldenhafter Veteranen, also verharmlosend, von ihnen geschwärmt hat. Allerdings hat er aus seiner langen Soldatenzeit seine grundlegenden Maximen abgeleitet, Regeln, mit denen er später seine Kinder traktiert: Als einer der Söhne einmal bei den Hausaufgaben sitzt, hört man von draußen ungewöhnliche Geräusche, aufgeregte Stimmen, die Feuerwehr ist im Einsatz. Wie sich herausstellt, ist ein Großbrand entstanden, mehrere Häuser stehen in Flammen, mitten in der Stadt am Neumarkt. Das will der Junge natürlich mit eigenen Augen sehen, die Gefahr, die Sensation. Er wirft den Griffel hin, um loszurennen. Doch der alte Krieger reagiert jähzornig: «Du bleibst sitzen! Und wenn Kanonen neben dir abgeschossen werden, du hast bei deiner Arbeit zu bleiben!»
Fünf Wochen nach jenem preußischen Rentenbescheid, am 10. August 1867, während man ihn noch im Lazarett zusammenflickt, wird Conrad befördert: «Dem bei Problus schwer verwundeten Feldwebel Adenauer wird der Charakter als Sekondeleutnants verliehen», ein recht ungewöhnlicher Aufstieg also in den Offiziersrang, wenngleich auch nur den alleruntersten. In einer durch und durch militarisierten Gesellschaft wie der preußischen ist diese Beförderung auch für das Zivilleben äußerst vorteilhaft: Adenauer, der Offizier. Entlassen wird er «nach Cöln».
Nach Köln, wo Helene wartet.
Es ist allerdings ganz unklar, was Conrad Adenauer, inzwischen vierunddreißig Jahre alt, in der folgenden Zeit in Köln gemacht hat; eine zivile Tätigkeit nimmt er jedenfalls nicht auf. Wahrscheinlich ist sein Gesundheitszustand dazu auch noch viel zu kritisch – er ist Invalide, «Ganzinvalide» sogar, die Unterscheidung wird etwas bedeutet haben. Einmal, Jahrzehnte später, wird er seinem Sohn Konrad erzählen, wie schlecht seinerzeit in den Lazaretten die Verpflegung war und wie sehr sie als angebliche Kriegshelden tatsächlich vernachlässigt wurden; sie litten sogar Hunger. Man kann vermuten, dass der Secondeleutnant a.D., wenn er in den endlosen Lazarettnächten grübelnd wach lag, seine Lage realistisch beurteilte: seinen zusammengeflickten und nur langsam genesenden Körper, die eher kümmerliche und obendrein nur befristet gewährte Pension von zwanzig Talern monatlich, die ganz und gar ungewisse Zukunft. Da wird er sich auch den Plan einer Heirat mit der inzwischen achtzehn oder neunzehn Jahre alten Helene aus dem Kopf geschlagen haben, vorerst zumindest.
Doch dann, drei Jahre nach der Entlassung aus der Armee, ist er plötzlich wieder Soldat. Ein Soldat im Krieg. Man hat ihn reaktiviert, hält ihn jetzt für gesund genug, seine Haut noch einmal zu Markte zu tragen. Am 18. August 1870 kämpft sein altes Regiment in der Schlacht von Gravelotte, und Conrad Adenauer ist dabei. Allerdings muss er nicht mehr ganz nach vorn in die Feuerlinie; er wird als «Oeconomie-Offizier» in einer Handwerker-Abteilung seines Bataillons eingesetzt.
Dies ist dann also der dritte der preußischen «Einigungskriege», der Krieg gegen Frankreich – ausgelöst durch eine gezielte Provokation Bismarcks (mit der manipulierten «Emser Depesche») und der erwarteten und prompt erfolgten Kriegserklärung Frankreichs an Preußen am 19. Juli 1870. Conrads Bataillon nimmt, wie es heißt, an «schweren Waldkämpfen» teil, dann an der Einschließung der Festung Metz, an den Kämpfen um Amiens, Bapaume, St. Quentin, an der raschen Eroberung Nordfrankreichs und der Belagerung von Paris.
Und im Januar 1871, ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn, während Paris noch bombardiert wird, erreicht Otto von Bismarck das Ziel, das er seit Jahren verfolgt: die deutsche Einigung, den Zusammenschluss zahlreicher deutscher König- und Fürstentümer unter der Führung Preußens – und unter Ausschluss Österreichs.[7] Im Spiegelsaal des Versailler Schlosses, dem Thronsaal Ludwigs XIV., des Sonnenkönigs, wird der preußische König zum deutschen Kaiser proklamiert. Es ist der Abschluss einer Serie von Kriegen, und zugleich ist es der Keim eines künftigen Krieges, denn die Proklamation eines deutschen Kaisers im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles, dem mythischen Herzen Frankreichs, ist für die Franzosen eine ungeheure, absichtsvoll zugefügte Demütigung, die nach Revanche schreit.[8]
Der Begeisterungstaumel unter den Deutschen aber ist ungeheuer, Bismarck geht als der große Held in die preußische und deutsche Geschichte ein, und in diesem nationalistischen Überschwang haben die allermeisten vergessen, dass bei der endlich gewonnenen Einheit etwas anderes – und vielleicht Wichtigeres – ganz und gar auf der Strecke geblieben ist: die Forderung nach demokratischen Freiheiten, wie sie 1848 formuliert wurden. Die Begeisterung Conrads über die deutsche Einheit, für die schließlich auch er gekämpft und beinahe sein Leben gegeben hat, ist so grenzenlos wie seine Bewunderung Bismarcks. Noch zwei Jahrzehnte später, als ein anderer deutscher Kaiser diesen Bismarck als Kanzler feuert und der «Lotse von Bord geht», diskutiert Conrad, zutiefst empört, mit seinem vierzehnjährigen Sohn Konrad diesen schmachvollen Abgang.
Jetzt endlich, nach beinahe zwanzig Jahren, hat Conrad genug; er zieht den Rock des Königs aus. Er hat sich schinden lassen, hat Leib und Leben riskiert, ist in feindliches Feuer gelaufen und hat Untergebene in feindliches Feuer geschickt. Er wird diese Momente der Angst, des Hasses und der fatalen Euphorie des Tötens auf dem Schlachtfeld tief in seinem Inneren verschließen. Es ist nicht bekannt, dass sie je hervorbrachen. Aber durch diesen Dienst hat er sich ein Anrecht erworben; er kann, seinem militärischen Rang entsprechend, in die Zivilverwaltung einsteigen, als Beamter. In seinem Fall ist das die mittlere Laufbahn. Es ist möglich, dass dies schon in jenem Meßdorfer Sommer 1851 sein eigentliches Ziel war: die Militärzeit zu machen, um Beamter zu werden, preußischer Beamter auf Lebenszeit.
Es ist die Epoche einer sehr dynamisch verlaufenden Industrialisierung, auch im Rheinland, und die alten gesellschaftlichen Klassen sind längst nicht mehr hermetisch voneinander getrennt. Der Aufstieg wird jetzt möglich durch Dienst und Bildung, wie man sagt. Oder auch durch Kreativität: Findige Techniker und Ingenieure, in Köln etwa Nicolaus August Otto, der 1864 in Deutz die erste Motorenfabrik der Welt eröffnet, werden erfolgreiche Unternehmer und steigen als Millionäre ins Großbürgertum auf. Aber für die aufstiegswilligen Söhne aus den niederen Schichten, die ohne besondere Schulbildung sind, bleibt nur der Dienst, das heißt der Militärdienst, an dessen Ende die Übernahme in den zivilen Staatsdienst möglich ist.
Conrad wird Justizbeamter am Kölner Landgericht, einem alten klassizistischen Gebäude am Appellhofplatz; es ist ein «Appellationsgericht», und also lautet sein Rang nunmehr Appellationsgerichtssekretär. Mehr als dreißig Jahre lang wird er hier seinen Dienst versehen, wird täglich zweimal, morgens und nachmittags, zum Amt gehen, an sechs Tagen in der Woche, Tausende und Abertausende Mal in vielen Jahren. Er fängt an als Gerichtsschreiber, also mit einer Aufgabe, die äußerste Korrektheit erfordert – und die seinem Charakter ganz und gar entspricht. Mit knapp vierzig hat er das Gefühl, es endlich geschafft zu haben; und das zu Recht. Es kommt nur noch darauf an, mit beständigem Fleiß und mit Eifer die ihm übertragenen Aufgaben zuverlässig und zur Zufriedenheit der Vorgesetzten zu erledigen. Dafür zahlt der Staat ihm anfangs siebenhundert Taler pro Jahr, eine gewiss nicht stattliche, aber ausreichende Summe.
Zehn Jahre später ist er bereits in der höchsten ihm möglichen Position angekommen, als Kanzleirat. In der Funktion des Ersten Gerichtsschreibers ist er der Chef der Gerichtskanzlei und zugleich Vorsteher des Schreibdienstes. Einer seiner Vorgesetzten, Justizrat Bernhard Falk, wird später über ihn sagen: «Er war ein strenger Mann, nicht sehr liebenswürdig, aber überaus pflichttreu und gewissenhaft» – das Muster eines preußischen Beamten. Und so zeigt ihn auch das Bild, das bis heute neben dem von Helene in Konrad Adenauers Rhöndorfer Schlafzimmer hängt und das der Kanzler beim Einschlafen und Aufwachen stets vor Augen hatte. Ein überraschendes Detail ist dabei, dass Conrad keinen seiner Kriegsorden ans Jackett geheftet hat; offenbar will er jetzt nicht mehr der Leutnant a.D. sein, nur noch der erfolgreiche Beamte.
Aufstieg durch Dienst oder Bildung – doch die Bildung wird immer erst in der nächsten Generation möglich. Es ist der Ehrgeiz des Kanzleirats, seine drei Söhne einmal aufsteigen zu sehen, weit über jenen Punkt hinaus, der für ihn selbst eine unüberschreitbare Grenze bildet. Tatsächlich werden alle drei Söhne studieren, und zwei davon, August und Konrad, werden – gewiss nicht zufällig bei diesem Vater – die Juristenlaufbahn einschlagen, mit Universitätsabschlüssen, wie sie nur die allerhöchsten Vorgesetzten des Kanzleirats haben. Der mittlere Sohn, Hans, wird Theologe und schließlich Priester. Welch eine Befriedigung für Conrad, die eigenen, aber unerreichbaren Ziele doch noch verwirklicht zu sehen – in den Söhnen.
Es wäre allerdings ein Missverständnis, in Conrad Adenauer eine Art workaholic sehen zu wollen, einen Mann, dem die Arbeit eine Sucht ist wie dem Alkoholiker der Schnaps; vielmehr geht es um Tugenden. Sein Sohn Konrad wird Jahrzehnte später die neben der Frömmigkeit wichtigsten Tugenden seines Elternhauses so beschreiben: «Pflichtgefühl, Redlichkeit, Fleiß und jener sachliche Ehrgeiz, der bestrebt ist, jede Aufgabe unter Anspannung aller Kräfte zu lösen.» Diese Anspannung aller Kräfte, und zwar ständig, ist ein äußerst strenges Programm. Hilfreich sind dabei: Selbstdisziplin, Genügsamkeit der Lebensführung, radikale Sparsamkeit. Und natürlich absoluter Gehorsam gegen die Eltern, gegen die Gesetze des Kaisers und die Gebote Gottes.
Viel Frohsinn und Heiterkeit kann es im Hause des Kanzleirats nicht gegeben haben.
Es ist eine festgefügte Welt, angelegt für die Ewigkeit und im Geiste «strengster Katholizität», wie der Historiker Henning Köhler sagt.[9] Eine Frömmigkeit, in deren Mittelpunkt die Idee eines zürnenden, strafenden Gottes steht, mit einem permanenten Sündenbewusstsein und der entsprechenden Angst vor der – buchstäblich geglaubten – Hölle samt ihren Qualen. Konrad, der Sohn, wird erst in sehr hohem Alter zu einer milderen, heitereren Form des Glaubens finden, dabei vor allem von seinem Sohn Paul, dem Priester und Theologen, beeinflusst.
Im Hause Adenauer in der Kölner Balduinstraße, nahe dem Hahnentor, wird vielleicht nicht der tiefe Glaube, aber doch eine vorbildliche Frömmigkeit gelebt, mit täglichem Besuch des Gottesdienstes, mit Gebeten morgens und abends und dem gemeinsamen Tischgebet mittags, mit der Heiligen Messe am Sonntagmorgen und der Andacht am Nachmittag, mit regelmäßiger Beichte und der Beachtung der Fastenzeit, mit selbstverständlicher Teilnahme an den Feiern und Festen des Kirchenjahres – und so wird es auch der alte Kanzler bis in seine letzten Jahre halten, wenn er am Sonntag seinen Platz in der Rhöndorfer Dorfkirche einnimmt oder ganz selbstverständlich am örtlichen Fronleichnamszug teilnimmt. Der Glaube der Kinderzeit bleibt im Herzen dieses manchmal zynischen, machtbewussten Politikers lebendig, unveränderlich eingeschmolzen wie ein schillerndes Insekt im Bernstein. Aber diese festgefügte Welt der Kindheit und Jugend, in der alles ist, wie es ist, weil es so sein muss und nicht anders sein kann – sie hat den Kindern gewiss auch ein Gefühl grundlegender Geborgenheit gegeben, ein Vertrauen in die Welt. Es ist die Welt, die 1918 zerbricht und so sehr in Stücke geht, dass in Konrad ein tiefes Verlangen nach Ordnung entsteht, einer neuen gesicherten Ordnung.
Dieses Verlangen wird sein politisches Handeln bestimmen.
Zur Frömmigkeit im Hause Adenauer gehört eine selbstverständliche, strenge Sexualmoral, festgelegt durch das sechste Gebot, aber auch durch die gesellschaftlichen Konventionen des Bürgertums. Man kann sich bei Conrad Adenauer vorehelichen Sex, auch außerehelichen Sex, also Ehebruch, Bruch der heiligen Ehe, ebenso wenig vorstellen wie später bei seinem Sohn Konrad. Von heute aus betrachtet – und nur so können wir es betrachten –, ist das ähnlich fremd und irritierend wie die Erziehungsmethoden jener Zeit. Zur Erziehung der Kinder, sei es im Elternhaus oder in der Schule, gehören harte Strafen, vor allem Prügelstrafen, das ist vollkommen selbstverständlich. Der Stock des Vaters, der Rohrstock des Lehrers. Die verbreiteten Ratgeberbücher zur modernen, zeitgemäßen Kindererziehung empfehlen jungen Eltern gerade diese Methode, zuerst um Gehorsam zu erzwingen, dann aber auch um jeder gefährlichen Verweichlichung vorzubeugen. Auch Konrad Adenauer wird seine Söhne schlagen, in völliger Unschuld gewissermaßen, manchmal auch regelrecht verprügeln. Sein jüngster Sohn, Schorsch, der 1931 geborene Georg Adenauer, kann diese Erfahrung bis heute nicht einfach wegwischen, etwa mit dem verbreiteten Schulterzucken «Et hat aber nich jeschadet». Er erinnert sich an demütigende Nächte, die er als Strafe für irgendeine jugendliche Missetat, etwa eine angstvolle Notlüge, im Kohlenkeller verbringen musste, hinter Schloss und Riegel.[10]
Strafende Väter, die das Urteil fällen und sofort vollstrecken.
Konrad, der drittgeborene Sohn des Kanzleirats, ist dieser Vater-Sohn-Verstrickung niemals entkommen. Nach seinem Tod im April 1967 fand man in seinem Schreibtisch einen Brief an seinen Vater, geschrieben 1895 und also mehr als siebzig Jahre sorgfältig aufbewahrt; es ist ein Rechenschaftsbericht. Er war als Student von München aus mit einem Freund nach Italien gereist, größtenteils per pedes und bei extremster Sparsamkeit. Er wollte so gerne einmal Venedig sehen. Sein Vater aber, der beamtete Pfennigfuchser, sah darin nicht nur eine sinnlose Geldverschwendung, sondern gotteslästerlichen Luxus, und machte ihm die heftigsten Vorwürfe. Es kam sogar zum Zerwürfnis, und Konrad versucht in dem Brief, die Gunst des Vaters zurückzugewinnen, indem er, wie vor einem Staatsanwalt, Punkt für Punkt jede einzelne Geldausgabe begründet – obwohl es eigentlich sowieso sein eigenes Geld war, das er sich zuvor vom Munde, das heißt vom spärlichen monatlichen Wechsel, abgespart hatte. Aber wenn diese Rechtfertigung siebzig Jahre lang, griffbereit wie eine Handakte, die man jederzeit verfügbar haben muss, in der Schreibtischschublade liegt – in welch einer Art von unerledigtem Strafprozess kämpft dann eigentlich der Verfasser dieses Briefes?
Der Schatten der Väter reicht weit.
Als der ehemalige Meßdorfer Jungknecht schließlich auf die sechzig zugeht, im Jahr 1891, wird ihm für seine Verdienste in der Justizverwaltung eine außerordentliche Ehre zuteil: Er erhält den «Rothen Adler-Orden IV. Klasse», eine Auszeichnung, die, wie Henning Köhler recherchiert hat, selbst so mancher Landgerichtspräsident nie im Leben bekommt. Vierzig Jahre nach dem entscheidenden Meßdorfer Sommer ist Conrad Adenauer ganz in der Behaglichkeit bürgerlichen Lebens und seiner Gewissheiten angekommen. Und noch einmal Jahre später, 1905, im Jahr vor seinem Tod, erhält er eine noch viel höhere Auszeichnung, den begehrten und ganz selten verliehenen «Kronenorden III. Klasse».
Wenn es einmal so weit sein wird und man ihm sein Grab richtet auf dem Kölner Melatenfriedhof, dann werden auf dem stattlichen Grabstein alle die Ränge, Titel und Orden aufgeführt, die Johann Conrad Adenauer in seinem irdischen Leben durch Fleiß, Gehorsamkeit und Pflichterfüllung erworben hat – in einem gottgefälligen Leben, in Treue fest für Kaiser und Gott.
Aber so weit ist es noch nicht.
2Frömmigkeit, Arbeit und Sparsamkeit
Da ist der Dom, dieser steinerne Traum des Mittelalters, der in den Himmel aufsteigt wie die maßlosen Gebete derer, die ihn vor Jahrhunderten planten. Als Johann Conrad Adenauer seine Helene heiratet, im Sommer 1871, ist die Kathedrale für kurze Zeit das höchste Gebäude der Welt, einhundertsechsundfünfzig Meter hoch. Nachdem er Jahrhunderte hindurch unvollendet geblieben war, wird seit etwa dreißig Jahren wieder am Dom gebaut; die beiden Türme sind beinahe schon fertig, und die ganze Stadt nimmt daran teil, wie die Männer der Dombauhütte in schwindelerregender Höhe arbeiten.
Diese Männer ihrerseits, wenn sie einen Moment den Blick über die ungeheure Weite schweifen lassen, die sie überblicken, sehen im Osten, jenseits des Rheins, in der Stadt Deutz mit Mülheim, Kalk und Pfingst, auf riesige Hallen herab, ziemlich neue und doch bereits geschwärzte Ungetüme der Industriearchitektur, und aus Dutzenden Schornsteinen sehen sie schwarzen Rauch aufsteigen und den Himmel verdunkeln. Diese Schlote sind die steinernen Symbole einer neuen Zeit, die längst auch in Köln, in die «Stadt der Träume», wie Victor Hugo sie um 1840 noch nannte, eingezogen ist. Doch auch in diesen Schloten, Hallen und blitzenden Bahngleisen manifestiert sich ein Traum: der Traum des schnellen Reichtums, des kapitalistischen Fortschritts – der allerdings für viele auch der Albtraum einer brutalen Klassengesellschaft ist. August Bebel, ebenfalls Sohn eines preußischen Unteroffiziers, ist dort drüben in Deutz auf die Welt gekommen, gerade als Victor Hugo noch romantisch von der Stadt der Träume schwärmte. Zwei Jahre vor Conrads Hochzeit mit Helene, im Jahre 1869, hat dieser August Bebel zusammen mit Wilhelm Liebknecht in Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiter-Partei (SDAP) gegründet, die Vorläuferin der SPD – auch als Reaktion auf die kapitalistische Brutalisierung der Arbeitswelt.
Dort drüben, auf der schäl Sick, der falschen oder schlechten Seite, sind Unternehmen entstanden, die bald schon Weltgeltung haben werden. In der Motorenfabrik Deutz etwa, gegründet von Nicolaus August Otto, fängt man gerade an, neue Motoren zu produzieren, den Otto-Motor mit einer Leistung von bis zu hundert PS (freilich noch nicht für Automobile, sondern für Industrieanlagen, aber die Otto-Motoren sind ein wichtiger Schritt in Richtung Automobilisierung). Technischer Direktor der Motorenfabrik ist Gottlieb Daimler – alles Namen mit großem Klang, bis heute. Felten & Guilleaume produzieren seit langem Drahtseile, aber jetzt, mit der raschen Verbreitung der Telegraphie, werden hier Millionen Kilometer Telegraphenkabel gefertigt. Um die Fabriken herum entstehen die Wohnsiedlungen der Arbeiter. In vier Jahrzehnten, bis zum Weltkrieg 1914, wird sich die Einwohnerzahl Kölns verfünffachen, auf über sechshunderttausend.
Die Stadt, in der sich Conrad und Helene niederlassen und in einem schmalen Haus in der Balduinstraße 6 ihr Leben einrichten, schleppt ihre eigene mittelalterliche Vergangenheit noch mit in die neue Zeit. Auch das sehen die Männer von den Baugerüsten hoch oben am Dom besonders gut: ein Gewirr enger Gassen, auf der Struktur der alten römischen Stadt in Jahrhunderten errichtet, eingeschnürt in die Stadtmauer, die sich im Halbkreis viereinhalb Kilometer um die Stadt legt und im Norden und Süden an den Rhein stößt, so wie Kaiser Barbarossa es sechshundert Jahre zuvor angeordnet hat. Diese innere Stadt ist mit etwa einhundertzwanzigtausend Einwohnern völlig übervölkert, die sanitären Systeme sind veraltet; Kot auf den Straßen, Misthaufen in jedem Hinterhof, die Luft stickig und stinkig. Die Stadttore sperren sich gegen die neue Zeit, sind wie Nadelöhre, maximal dreieinhalb Meter breit, durch die sich alles rein- und rausquält und -quetscht, was zum Leben und Treiben der Stadt gehört. Innen und außen vor den Toren stauen sich die Droschken und Pferdefuhrwerke.
Schon einmal, in den 1830er Jahren, hat es eine Anstrengung gegeben, die Stadt aus ihrer mittelalterlichen Einschnürung zu befreien. Der junge Stadtbaumeister Johann-Peter Weyer, inspiriert von seinen Studienaufenthalten in Paris, hatte den Kölner Stadtgrundriss neu geordnet, eine erste Ost-West-Achse vom Dom bis zum Stadtgarten gebaut, zahlreiche neue Straßen anlegen lassen und die bestehenden, die je nach Wetter meistens verstaubt oder voller Matsch waren, gepflastert. Der dörfliche Charakter vieler Stadtviertel, mit großzügigen Vorgärten und weiten Höfen voller Stallungen und Misthaufen, verschwand allmählich; in nur fünfzehn Jahren wuchs die Zahl der Kölner von fünfzigtausend auf fünfundsiebzigtausend. Einer grundlegenden Umgestaltung, welche als Erstes die Stadtmauer hätte niederlegen müssen, stand aber das preußische Militär entgegen, dem diese Stadtmauer gewissermaßen gehörte – als Teil der Verteidigungsanlagen. Der Festungsring Kölns war ab 1825 gebaut worden, mit elf halbkreisförmig um die Stadt angelegten Forts. Zudem musste außerhalb der Stadtmauer der «Rayon», also das Schussfeld, unbebaut bleiben, ein etwa ein Kilometer breiter Streifen. Erst 1881 wird man der Stadt genehmigen, ihre eigene Stadtmauer und das dazugehörige Gelände zu kaufen, um die Mauer endlich niederzulegen.
Da ist Johann-Peter Weyer, der Stadtbaumeister, längst umgestiegen auf privatwirtschaftliche Abenteuer, er ist einer der mächtigsten Eisenbahn-Tycoons des Rheinlands geworden. Natürlich haben sie voneinander keine Notiz genommen, der Feldwebel und der Eisenbahnspekulant, aber in einer jetzt noch ganz unvorstellbaren zukünftigen Konstellation wird vierzig Jahre später Konrad, der Sohn des Feldwebels, Emma Weyer heiraten, die Enkeltochter dieses Multimillionärs.
Unterhalb des Doms führt immer noch die schwimmende Schiffsbrücke über den Rhein, eine Pontonbrücke, die zweimal am Tag geöffnet werden muss, um die wartenden Schiffe durchzulassen. Aber von Osten, aus Mülheim und Deutz, aus dem Ruhrgebiet und aus Berlin, der Hauptstadt Preußens, kommen die von Dampflokomotiven gezogenen Züge über die neue, 1859 fertiggestellte Eisenbahnbrücke, die Dombrücke, die wegen ihrer seitlichen Stahlverstrebungen von den Kölnern «Gitterbrücke» genannt wird, und sie führt direkt zum neuen Centralbahnhof. Von dort öffnet sich das Streckennetz weiter in Richtung Aachen, Antwerpen, Brüssel, Paris und London: Köln wird der Eisenbahnknotenpunkt im Westen des Deutschen Reiches. Bis zur Fertigstellung der Brücke hatte es keine durchgehende Eisenbahnverbindung über den Fluss gegeben; Güter und Fahrgäste mussten von Deutz aus zuerst in Schiffen oder Fähren den Rhein überqueren. Dass allerdings zugunsten des Hauptbahnhofs, direkt neben dem Dom, ein alter, zauberhafter botanischer Garten verschwinden musste, wird noch den Oberbürgermeister Konrad Adenauer, der sonst wenig nostalgische Gefühle zeigt, tief schmerzen. Er wird es allerdings niemals schaffen, dies rückgängig zu machen.
Der Appellationsgerichtssekretär Johann Conrad Adenauer, jetzt achtunddreißig, und seine Frau Helene, geborene Scharfenberg, zweiundzwanzig Jahre alt, richten sich genau in dieser Epoche des großen historischen Umbruchs in Köln ein. Conrad, der alte Soldat, praktiziert, was er sein Leben lang durchhalten wird: eine exakt geplante Ordnung, als ob gleich neben ihm Kanonen abgefeuert würden. Eine Ordnung, die ihn stützt und zusammenhält, mit ständig wiederkehrenden Abläufen, Stunden- und Tagesplänen für jeden einzelnen der sechs Wochentage, und einen anderen, speziellen Plan für den Sonntag. Er wird seine rasch wachsende Familie streng auf diese Ordnungssysteme verpflichten. Zuerst kommen die drei Söhne auf die Welt, August (1872), Hans (1874) und Konrad (1876), schließlich noch die Tochter Emilie Helene (1879), genannt Lilli.
Conrad verordnet seiner Familie extremste Sparsamkeit und damit eine Kärglichkeit des Daseins, die, gemessen an seinem Gehalt, ganz unnötig scheint, wüsste man nicht, dass es dabei um Höheres geht: um den langfristig geplanten Aufstieg der Familie, als Fortsetzung des eigenen Aufstiegs. Ein hochgestecktes Ziel, dessen künftige Protagonisten die drei Söhne sind. Denn jetzt geht es nicht mehr um den Aufstieg durch Dienst, die mühsame Ochsentour durch die Armee, sondern durch Bildung. Für den Justizbeamten Adenauer ist der Bildungsbegriff allerdings rein instrumentell: Es geht nicht um ästhetische oder intellektuelle Aneignung, eine möglichst genaue Vorstellung von der Welt, wie sie ist, oder um die Liebe zur Malerei, zur Literatur oder Philosophie; es geht nur um einen formalen Abschluss, der den Einstieg in eine höhere Berufswelt ermöglicht. Für das Gymnasium aller drei Söhne und das Studium zumindest des Ältesten, August, muss also Geld zurückgelegt werden.
Die Bedürfnislosigkeit im alltäglichen Leben hat nebenbei aber noch den Vorzug, gottgefällig zu sein. Frömmigkeit und Arbeit, ora et labora – dies bleibt für alle Zeit Conrads Prinzip. Im Winter wird nur die Küche geheizt, die anderen Räume bleiben klirrend kalt – wie in einer preußischen Kaserne, das härtet ab. Helene, vor kurzem noch in die schönsten romantischen Abendspaziergänge mit einem hübschen Mann in Uniform verwickelt, kauft jetzt Unmengen Wachstuch en gros, um daraus Schürzen zu schneidern, die sie gewinnbringend verkauft. Ein Teil des ohnehin nicht besonders großen Hauses wird vermietet an alleinstehende Herren, die von Helene auch beköstigt werden. Es kann durchaus sein, dass Adenauers spätere Behauptung, er habe bis zu seinem siebzehnten Lebensjahr mit einem seiner Brüder das Bett teilen müssen, nicht nur ein propagandistischer Schwindel war, der gut in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg passte, als die Menschen in bitterster Wohnungsnot lebten; wahrscheinlich stimmt es sogar. Das Fehlen des eigenen Bettes ist jedenfalls ein starkes Bild für Armut.
Zur Anspannung aller Kräfte gehört es auch, wenn der Justizbeamte seine Kinder, übrigens wohl auch die Tochter, schon vor der regulären Einschulung selbst unterrichtet, abends, nach seinem Dienst; nacheinander lernen sie bei ihm, jeweils ein Jahr lang, Lesen, Schreiben und Rechnen. Conrad spart dadurch jeweils ein ganzes Schuljahr, denn die Kinder kommen, wenn sie eingeschult werden, sofort in die zweite Klasse der Volksschule. Und wo immer sie letztlich ankommen mögen auf ihrem Weg nach oben, sie kommen ein Jahr früher dort an; darum geht es. Am 13. April 1881, Konrad ist gerade fünf, stellt «Privatlehrer Papa», wie’s im Dokument heißt, seinem Schüler ein offizielles Zeugnis aus: «Betragen: sehr gut. Fleiß: die letzte Zeit lobenswerth. Lesen: gut. Schreiben: gut. Besondere Bemerkungen: Wenn er faul wird, muss er mit den Köttelchen wieder anfangen.» Köttelchen nennt man in Köln die Schulanfänger, die Abc-Schützen.
Einmal, in der Vorweihnachtszeit, verlangt Conrad von seiner Familie, ein paar Wochen lang auf das sonntägliche Fleischgericht zu verzichten, weil man sich sonst keinen Weihnachtsbaum leisten könne. Dies riecht freilich mehr nach einer pädagogischen Maßnahme Conrads, um seinen Kindern einen Zusammenhang deutlich zu machen, vom dem er felsenfest überzeugt ist: Wenn man sich etwas Besonderes leisten will, muss man immer auf etwas anderes verzichten. Jedes Vergnügen bedeutet also zugleich Verzicht. Die freiwillige Einschränkung, die dauernde Anspannung, die täglichen Verzichtsübungen als Wechsel auf eine bessere Zukunft – alles dies ist eigentlich, wie Henning Köhler[1] bemerkt hat, ganz und gar untypisch für das katholische Kleinbürgertum, zumal in Köln, wo man eher geneigt ist, das Leben zu nehmen, wie es gerade kommt. Et hät doch noch immer jut jejange. Die Prinzipien des alten Feldwebels wirken dagegen preußisch-protestantisch, fast calvinistisch.
Möglicherweise riskieren die Eltern mit ihrem radikalen Sparkurs sogar die Gesundheit ihrer Kinder. Jedenfalls hat Konrad als kleiner Junge eine gefährliche und langwierige Lungentuberkulose zu überstehen, eine in den unteren Schichten weitverbreitete Krankheit, die fast immer durch Unter- oder Fehlernährung ausgelöst wird. Krankheit als Hungersymptom. Konrad wird sein Leben lang unter einer «angegriffenen Lunge» leiden und unter großer Anfälligkeit für Bronchialerkrankungen.
Nur scheinbar im Widerspruch zu dieser rücksichtslosen Sparsamkeit stehen die erhaltenen Kinderfotos; das älteste erhaltene Bild zeigt Konrad, Lilli, August und Hans etwa Anfang der achtziger Jahre. Es ist natürlich kein Schnappschuss aus dem Alltag, sondern ein im Atelier sorgfältig inszeniertes Bild, eine Szene bürgerlichster Behaglichkeit: die vier Kinder in feinster und teuerster Kleidung, angefangen bei den vornehmen Seidenschleifen an den Hälsen der Jungen über die ungeheuer sorgsam ondulierte, geradezu damenhafte Haarpracht der kleinen Lilli, die gut geschneiderten Sonntagsanzüge, bis hinunter zu den glänzenden, teuren Lederstiefeln. Es ist eine Demonstration des geplanten Aufstiegs und gewissermaßen eine falsche Fährte für später, wenn man aus diesem Bild auf ein Leben schließen soll, das es in Wahrheit gar nicht gab.
Psychologisch interessant mag vielleicht ein Hinweis sein, der erst viele Jahrzehnte später bekannt wurde.[2] Danach hat der kleine Konrad, noch in der frühesten Kindheit, «wochenlang in Gips gelegen» und anschließend «ein ganzes Jahr lang mit Stahlschienen von den Hüften an den Beinen hinunter» laufen müssen. Der Grund für diese Fixierung des kindlichen Körpers in Gips und Stahl ist nicht bekannt. Man sagt allerdings solchen Kindern häufig eine Neigung zum Stoizismus nach, auch zur Eigenbrötelei. Ohne psychologische Spekulationen anzustellen, sei aber zumindest erwähnt, dass Adenauer selbst, als Pensionär in Rhöndorf, erzählt hat, er sei seine ganze Kindheit und Jugend hindurch «sehr scheu und schüchtern» gewesen und habe im Kontakt mit Fremden «sofort einen roten Kopf bekommen». In der späteren Jugend, während er die Tanzstunde absolviert, gilt er als «linkisch und ganz ungeschliffen», wie sich eine seiner Tanzpartnerinnen Jahrzehnte später erinnert. Und einer seiner späteren Kommilitonen meint den Jura-Studenten Adenauer immer sehr zurückgezogen, «beinahe wie hinter einer Isolierschicht», wahrgenommen zu haben. Möglicherweise hat aber das Linkische, wie auch die Schüchternheit und Reserviertheit des jungen Konrad, einen einfachen Grund: das Gefühl nämlich, einer ganz armen Familie anzugehören und deshalb zurückgestoßen, nicht akzeptiert zu werden, etwa im Gymnasium unter den Kindern des Großbürgertums; die Standesunterschiede sind damals in der Kölner Gesellschaft sehr ausgeprägt.
In Wahrheit allerdings wissen wir wenig über die innere Befindlichkeit dieses drittgeborenen Sohnes. Wenn auch das strenge Regiment des alten Feldwebels wie ein Schatten auf allem liegt, hat der Junge vermutlich doch seine Freuden im täglichen Leben mit seinen Geschwistern, zumindest in den wenigen Stunden beim Spiel auf der Straße. An manchen Sommertagen fährt man mit der Vorgebirgsbahn aufs Land, hinaus nach Meßdorf, um die dortigen Verwandten zu besuchen, und der Vater zeigt den Söhnen wohl auch die ehemalige Bäckerei seines eigenen, unglücklichen Vaters, und auch seine alten Arbeitsstätten, die Ziegelei und den Gutshof. In das Dorf, das er vor Jahrzehnten verließ, um Soldat zu werden, kehrt der Vater zurück als hochangesehener Mann. Selbst die Familie Ostler, der die «Meßdorfer Burg» gehört, wo er als Knecht arbeitete, pflegt jetzt gesellschaftlichen Verkehr mit ihm, dem inzwischen zum Obersekretär aufgestiegenen Beamten beim Kölner Appellationsgericht.
Außerdem gibt es die immer zugelassenen Vergnügen, die großen religiösen Feste, Ostern, Pfingsten, Fronleichnam, Weihnachten; die feierlichen Prozessionen, den Weihrauch, die kostbare Kleidung der Kleriker, die Musik – den ganzen «berauschenden Pomp» der katholischen Kirche, wie es ein Zeitgenosse festhält.[3] In normalen Zeiten lebt die Familie ganz zurückgezogen. Die Wochentage sind planvoll ausgefüllt, dafür sorgen die ausgetüftelten Stundenpläne des Vaters, und der Sonntag wird geheiligt. Für die Kinder ist es der Tag größter Langeweile; sie dürfen nicht weggehen, aber auch keine Freunde empfangen.
Die Kölner Familie Adenauer nimmt übrigens nicht einmal am Karneval teil, er gilt als sündige Verlockung, die auf gefährliche Weise zu Sittenlosigkeit und Trunksucht führt. Die drei tollen Tage sind eine lokale Tradition aus dem Mittelalter, die allerdings Anfang des 19. Jahrhunderts schon beinahe vergessen war. Dann aber, nach den napoleonischen Kriegen, warf sich das stolze Bürgertum in die bunten Uniformen der vergangenen Feldzüge, und der todernste «Kölle alaaf»-Kult begann seinen Siegeszug: eine narzisstische Selbstbewunderung des einheimischen Bürgertums, an der die Fremden und die unteren Schichten in Adenauers Kindheit nicht teilnehmen und auch gar nicht teilnehmen sollen. Getarnt als Hymne auf eine einzigartige Stadt, wird diese kölsche Selbstverliebtheit bis heute in tausend Liedern besungen und beschunkelt.
In dieser Zeit wird es in Köln auch chic, Mundart zu sprechen, kölsch. Denn der schnelle Zuzug zehntausender Menschen, von den Kölnern als Überfremdung empfunden, stresst das Identitätsgefühl der Einheimischen. Der Dialekt dient als Mittel der Exklusion, und wer nicht richtig Blootworsch sagen kann[4], gehört nicht wirklich dazu. Man spricht dieses Kölsch auch im Stockpuppentheater der Witwe Klotz, dem «Hänneschen-Theater», wo Tünnes und Schäl[5], die legendären Figuren der kölschen Lokalmythologie, auftreten, aber auch im Millowitsch-Theater. Das alles liegt freilich außerhalb dessen, was Johann Conrad Adenauer seiner Familie gestattet.
Einmal nimmt der Vater seine Kinder, darunter den vier Jahre alten Konrad, zu einer befreundeten Familie mit, wo er ihnen vom Balkon aus den Kaiser zeigt, der zu den Feierlichkeiten zur Vollendung der Dombauarbeiten gekommen ist, am 15. Oktober 1880. Es ist der Tag, an dem de Prüsse den Kölner Dom endgültig in Besitz nehmen, um ein deutsches Nationaldenkmal aus ihm zu machen. Sehr viele Kölner Katholiken sind ganz und gar nicht damit einverstanden, sie wollten auf der rein sakralen Bedeutung der Kathedrale vor der nationalen bestehen; wieder andere sehen in den Feiern zum Dombau ein nationalistisches Ablenkungsmanöver Preußens von den nicht gewährten demokratischen Verfassungsverhältnissen.
Neun Jahre nach seiner Proklamation als deutscher Kaiser feiert Wilhelm I. den Kölner Dom als identitätsstiftendes Element für die vielen «deutschen Stämme». Das Domkapitel und sehr viele bekannte Bürger blieben allerdings den Feiern demonstrativ fern, und der Kölner Erzbischof, Paul Melchers, stichelt aus seinem holländischen Exil gegen den «protestantischen Kaiser». Genau genommen wird der Erzbischof immer noch steckbrieflich gesucht. Jahre zuvor, in der Zeit des «Kulturkampfes», als Bismarck der Kirche den Primat über Gesellschaft und Staat entriss, hatte Melchers leidenschaftlich gegen die laizistischen Tendenzen, gegen die Trennung von Kirche und Staat, gekämpft – unter anderem gegen die Abschaffung der konfessionell gebundenen Schulen, gegen die Einführung der Zivilehe, gegen das Recht auf Ehescheidung. Wo immer es ging, verletzte Melchers diese Gesetze zielstrebig, ließ sich zunächst zu Geldstrafen, dann sogar zu einer Haftstrafe im Kölner Gefängnis Klingelpütz verurteilen, um sich als christlicher Märtyrer einer angeblichen Christenverfolgung darzustellen. Einige Jahre vor den Dom-Feiern, in Adenauers Geburtsjahr 1876, entzog sich Melchers einer neuerlichen Verhaftung durch die Flucht ins holländische Maastricht. Viele Kölner Katholiken halten ihrem Erzbischof die Treue und sehen auch jetzt noch, 1880, die Entmachtung der Kirche als brutale religiöse Unterdrückung – was in Wahrheit nur der Verlust einiger Privilegien ist.
Jedenfalls verbinden sich bei keinem anderen kirchlichen Bauwerk mit den religiösen Zwecken so viele politische Absichten. Es ist die deutsche Kathedrale der protestantischen Hohenzollern am Rhein, finanziert von einem geschichtstrunkenen Großbürgertum. Nach der Kaiserproklamation im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles ist dies die zweite große Demonstration preußisch-deutscher Macht, und auch sie ist ganz und gar gegen Frankreich gerichtet.
«Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein,
ob sie wie gier’ge Raben sich heiser danach schrei’n.»[6]
Stolz steht und fest die Wacht am Rhein.
Der Vater, immer nur der Vater – wo ist in dieser Kindheitsgeschichte die Mutter? Konrad hat, wie er später immer wieder sagt, seine Mutter sehr geliebt, obwohl sie «genauso jähzornig sein konnte wie der Vater». Er erinnert sich sogar, wie sie, immer in irgendeine Arbeit vertieft, gesungen hat; sie sang so schön. Der Hauch eines Idylls also, immerhin. Man sollte sich nicht anmaßen, es besser wissen zu wollen als der alte Rhöndorfer Pensionär, aber natürlich steckt in allen Kindheitserinnerungen ein Stück Verklärung, wenn nicht nackte Schönfärberei. Jedenfalls ist Konrad immer der treusorgende Sohn seiner Mutter geblieben: Noch als junger Ehemann und Familienvater wird er täglich nach dem Dienst zuerst zu ihr gehen, ehe er in sein eigenes Haus, zu Frau und Kindern, heimkehrt. Und nach dem Tod des Vaters wird er seine Mutter zu sich in das gerade eingerichtete eigene Haus holen und ihr dort sogar die Beletage überlassen.
Einmal gibt es ein Ereignis, das noch Jahrzehnte später dem Altbundeskanzler in seiner Rhöndorfer Einsamkeit einen Schrecken einjagt, gerade so, als ob er erst jetzt, und ganz plötzlich, verstünde, was damals geschah. Helene hat nach Lilli noch einmal ein Kind bekommen, Elisabeth, und der fünfjährige Konrad hat die rätselhaften Umstände des Lebens und Sterbens seines Schwesterchens nie verstehen können. Das erst wenige Monate alte Kind ist eines Tages sehr krank, der alte Hausarzt, Dr. Lohmer, wird gerufen und «wir Kinder erwarteten ihn aufgeregt schon stundenlang an der Haustür»[7]; dann fährt das prächtige Coupé vor, der Kutscher zügelt das Pferd und der ehrfurchtgebietende Herr Doktor mit dem langen Bart und der Arzttasche steigt aus; das ist unvergesslich. Dr. Lohmer untersucht das fiebrige Kind, zieht den Vater in den Flur und flüstert mit ihm, lange, «das Gesicht des Vaters war totenblass». Dann ist er weg, und die ganze Familie wird vom Vater um das Baby herum gruppiert zum gemeinsamen Gebet. Der Vater bittet Gott, das arme kranke Kind nicht weiter leiden zu lassen, er wolle ihm bitte einen gnädigen Tod schenken und es zu sich nehmen