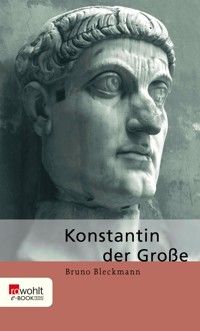
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Konstantin der Große (272-337), so will es die Legende, verhalf nach seiner wundersamen Bekehrung dem Christentum zum Sieg im Römischen Reich. Doch der kluge Stratege und weitsichtige Politiker hat sich erst am Ende seines Lebens offen zum christlichen Glauben bekannt. In seiner dreißigjährigen Regierungszeit besiegte er in blutigen Bürgerkriegen seine Mitregenten im Römischen Reich, reformierte Staat und Heer und gründete seine Hauptstadt Konstantinopel. Als Förderer des Christentums schuf er die Geschichte prägende Verbindung von Staat und Kirche. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Bruno Bleckmann
Konstantin der Große
Über dieses Buch
Konstantin der Große (272–337), so will es die Legende, verhalf nach seiner wundersamen Bekehrung dem Christentum zum Sieg im Römischen Reich. Doch der kluge Stratege und weitsichtige Politiker hat sich erst am Ende seines Lebens offen zum christlichen Glauben bekannt. In seiner dreißigjährigen Regierungszeit besiegte er in blutigen Bürgerkriegen seine Mitregenten im Römischen Reich, reformierte Staat und Heer und gründete seine Hauptstadt Konstantinopel. Als Förderer des Christentums schuf er die Geschichte prägende Verbindung von Staat und Kirche.
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Impressum
rowohlts monographien
begründet von Kurt Kusenberg
herausgegeben von Uwe Naumann
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2017
Copyright © 1996 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten
Redaktionsassistenz Katrin Finkemeier
Umschlaggestaltung any.way, Hamburg
Umschlagfoto akg-images (Konstantin I., der Große. Kopf einer Kolossalstatue aus der Konstantinsbasilika, 315 n. Chr. [?])
Satz CPI books GmbH, Leck, Germany
ISBN 978-3-644-57522-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Einleitung
«Die alten Leiden waren vergessen, und begraben war jede Erinnerung an Gottlosigkeit. Man freute sich der gegenwärtigen Güter und harrte dazu der künftigen.»[1] Nach dem Sieg Konstantins über Licinius hatten die Christen des Ostens, die eben noch Verfolgung und Bedrohung erlebt hatten und nun eine Politik bejubeln konnten, von der sie begünstigt wurden, zu Recht das Gefühl, Zeugen einer großen Wende zu sein. Zwar konnte 324 noch niemand auf die konstantinische Propaganda bauen, die eine ewige Dauer des neuen glücklichen Zeitalters verkündete. Aber die weitere Entwicklung sollte dem Optimismus der kaiserlichen Verlautbarungen und den von den Christen gehegten Erwartungen recht geben. Die Regierung Kaiser Julians des «Abtrünnigen» (361–363), der die durch Entscheidungen seines Onkels Konstantin eingeleitete Christianisierung des römischen Staats wieder rückgängig machen wollte, blieb nur ein kurzes Zwischenspiel. Von 363 an herrschten ausschließlich christliche Kaiser. Damit war die Voraussetzung dafür geschaffen, dass das Erlebnis einer Zeitenwende nach dem Ende der Christenverfolgungen sich mehr und mehr zu einer epochalen Größe im heilsgeschichtlichen Schema verfestigen und Konstantin im christlichen Geschichtsbild den Platz des durch göttliche Wunder geleiteten Gründungsvaters der christlichen Monarchie einnehmen konnte.
In Grundzügen hat schon der Zeitgenosse Euseb in seiner bald nach dem Tod des Kaisers entstandenen und nicht mehr vollendeten «Vita Constantini» dieses Bild des heiligen Kaisers entworfen. Die dem Stilempfinden klassischer Historiographie diametral entgegengesetzte Berücksichtigung von Urkunden im Wortlaut, die bereits die Struktur der Kirchengeschichte Eusebs prägt, macht den hohen dokumentarischen Wert dieser Schrift aus. Aber in der rahmenden Erzählung hat Euseb das christliche Verhalten des Kaisers bewusst überzeichnet, um den Söhnen des Kaisers ein Regierungsprogramm im Sinne seiner bischöflichen Interessen an die Hand zu geben. Diesen christlichen Fürstenspiegel haben Schriftsteller wie Gelasios von Caesarea, Sokrates oder Sozomenos, die die schon mit dem Jahr 324 endende Kirchengeschichte Eusebs fortgesetzt und dabei direkt oder indirekt auch auf den von Euseb im «Leben Konstantins» gebotenen Stoff zurückgegriffen haben, für einen Bericht über die historische Realität gehalten und im Einzelnen Züge hinzugefügt, die das Bild des mustergültig christlichen Kaisers abrunden oder variieren.
Um ganz andere Nuancen zu erfahren, muss man auf die Kirchengeschichte des Kappadokiers Philostorg zurückgreifen, der der verfolgten Gruppe der Eunomianer, das heißt der radikalen Arianer, angehörte und der ein negatives, zum Teil aus heidnischen Quellen schöpfendes Porträt des ersten christlichen Kaisers geboten hat, in dem Morde und erotische Skandale in der kaiserlichen Familie eine herausragende Rolle spielen. Diese häretische, aber interessante Kirchengeschichte wurde im orthodoxen Byzanz gerne gelesen, und so ist sie nicht nur durch eine Zusammenfassung des Patriarchen Photios bekannt geworden, sondern ihr Material ist in entschärfter Form auch in die hagiographische Literatur, etwa in eine anonyme Vita Konstantins oder in die einem Johannes Rhodios zugeschriebene «Passion des heiligen Artemius» eingegangen. Selbst in der anscheinend so frommen und auch im Abendland verbreiteten Legende, der Kaiser Constantius habe erst nach einer Suchaktion im Kind der Schankwirtin Helena, der er vor Jahren als Offizier auf der Durchreise begegnet war, seinen eigenen Sohn und Thronfolger erkannt, hat diese konstantinfeindliche Tradition ihre Spur hinterlassen. Denn der Kern dieser Legende lässt den großen Kaiser als Frucht einer Verbindung erscheinen, die man als Gelegenheitsprostitution bezeichnen muss. Wenn freilich solche Anwürfe in eine märchenhafte Heiligenerzählung einmünden konnten, dann zeigt dies besonders deutlich, dass der mit Euseb einsetzende Verfestigungsprozess zum hieratischen Bild vom «apostelgleichen» und «allerchristlichsten» Kaiser nicht ernsthaft aufzuhalten war. Teils fromme Phantasie, teils kirchenpolitisches Interesse sorgten dafür, dass immer mehr erbauliche Einzelheiten die historische Gestalt des Kaisers umrankten. Die Legende von der Auffindung des Heiligen Kreuzes durch die heilige Helena ist anscheinend bereits in den letzten Jahren der Regierung Konstantins im Pilgerbetrieb Jerusalems entstanden und wurde weiter ausgebaut, als es darum ging, die Ansprüche des lokalen Bischofs gegen den Metropoliten von Caesarea zu untermauern. Römischen Ursprungs ist die Silvesterlegende, die die konstantinische Wende als Werk der Kirche Roms erscheinen lassen sollte. Sie erzählt, Konstantin habe zunächst die Christen verfolgt, später aber durch die vom römischen Papst Silvester gespendete Taufe Heilung vom Aussatz gefunden und von da an Gesetze zugunsten der Christen erlassen. Im besonderen Maße regte natürlich die zuerst von Euseb beschriebene Vision Konstantins zu Variationen und Ausschmückungen an. Eine Tradition berichtet gleich von drei Visionen Konstantins, nämlich in Rom, in Byzanz und an der Donau. In einer anderen, besonders kuriosen Variante ist davon die Rede, wie eine himmlische Gestalt Konstantin nachts an den Nasenlöchern berührt und dieser am nächsten Tag das Kreuz als blutigen Abdruck in seinem Taschentuch oder in seinem Kopfkissen erblickt. In diesem Gestrüpp legendarischer Überwucherung wurde Konstantin zu einer überragenden mythischen Figur, dem die Byzantiner den Beinamen «Megas», «der Große», gegeben haben. Als einer der wichtigsten Heiligen der orthodoxen Kirche wird er bis heute in einem festen Ikonenschema gemeinsam mit seiner Mutter Helena und dem wiedergefundenen «Wahren Kreuz» dargestellt. Die östlichen Kirchen feiern sein Fest am 21. Mai.
Im Westen wurde das im Osten entwickelte Bild vom christlichen Modellkaiser unter anderem durch die gelehrte «Historia tripartita» des Cassiodor und seines Schülers Epiphanius bekannt gemacht, eine lateinische Bearbeitung der Kompilation des Theodoros Anagnostes, in der die Kirchengeschichten des Sokrates, des Sozomenos und des Theodoret verwertet waren. Allerdings gelang Konstantin im Unterschied zu seiner Mutter nicht der Aufstieg zu einem anerkannten Heiligen der westlichen Kirche. Denn man konnte nicht völlig übersehen, dass der Kirchenvater Hieronymus in einer kurzen Notiz seiner Chronik den Kaiser wegen seiner angeblichen Zuwendung zur arianischen Ketzerei scharf getadelt hatte: «Am Ende seines Lebens wurde Konstantin von Euseb, dem Bischof von Nicomedia, getauft und fiel zur arianischen Glaubenslehre ab. Von da an folgten bis zur gegenwärtigen Zeit Raub an den Kirchen und Zwietracht des gesamten Weltkreises.»[2] Im Hochmittelalter geriet dann Konstantin in der Hauptsache deshalb in das Kreuzfeuer der Kritik, weil der Anspruch des Papstes auf weltlichen Besitz mit einer frommen Stiftung des angeblich von Silvester getauften Kaisers begründet wurde. Im Streit zwischen den Universalmächten Kaiser und Papst, zwischen Ghibellinen und Guelfen denunzierten die Verteidiger der kaiserlichen Sache wie Otto von Freising, Walther von der Vogelweide oder Dante immer wieder die (erst in der Renaissance von Lorenzo Valla als Fälschung entlarvte) «konstantinische Schenkung» als verderbliche Maßnahme. Aber das landläufige, über das Mittelalter hinweg bewahrte christliche Geschichtsbild konnte durch diese insgesamt doch eher vereinzelt geäußerte Kritik nicht ernsthaft erschüttert werden. In der frühen Neuzeit erhielt die in Konstantin präfigurierte Verbindung von Kirche und christlichem Monarchen sogar neue Aktualität, etwa im Landesfürstentum lutherischer Prägung oder in der gallikanischen Kirche des Sonnenkönigs.
Wie die «Heiden»*[1], die alles andere als eine einheitliche religiöse Gruppe waren, zu Lebzeiten des Kaisers auf das neue Verhältnis zwischen Christen und römischem Staat reagiert haben, ist so gut wie unbekannt. Man kann ohne große Phantasie annehmen, dass Heiden, die im Besitz von Immobilien verfolgter Christen waren und diese nun auf kaiserlichen Befehl zurückgeben mussten, von der religionspolitischen Wende kaum erfreut waren. Von einer deutlich artikulierten und breiteren kritischen Strömung erfährt man allerdings nur für Rom, wo einem späten Autor zufolge im Jahr 326 die demonstrative Weigerung Konstantins, an traditionellen Riten teilzunehmen, auf massive Proteste gestoßen sein soll. Selbst Jahrzehnte nach dem Tode Konstantins wurde Kritik an der Religionspolitik des Kaisers von heidnischer Seite allenfalls verhalten geäußert, und Julian, der seinen Onkel in einer Streitschrift als «Erneuerer und Verwirrer altehrwürdiger Gesetze und der von alters her übernommenen Sitten»[3] angeprangert hatte, fand weder für seine Anklagen noch für sein Restaurationsprogramm begeisterte Zustimmung. Viele Heiden bevorzugten es, die Veränderungen einfach zu ignorieren, wie etwa der Historiker Eutrop, der am Hofe des Kaisers Valens (364–378) einen Kurzabriss der römischen Geschichte verfasste und es nicht einmal für nötig hielt, darauf hinzuweisen, dass Konstantin sich dem Christentum zugewandt hatte. Erst als nach dem Scheitern Julians und nach einer toleranten Phase unter Valentinian I. (364–375) die Kaiser Gratian (375–383) und Theodosius I. (379–395) immer restriktivere Maßnahmen gegen die heidnischen Kulte verfügten und der von Konstantin eingeschlagene Weg endgültig als irreversibel erschien, reizte dies eine kleine, aber durch ihre intellektuellen Möglichkeiten nicht einflusslose heidnische Elite, die aggressiven Töne Julians wiederaufzunehmen und das optimistische christliche Geschichtsbild in sein Gegenteil zu verkehren. Die Katastrophen, von denen das Römische Reich in der Völkerwanderung heimgesucht wurde, wurden als Ergebnis eines Dekadenzprozesses gedeutet, für den angeblich Konstantin verantwortlich war. Durch seinen Übertritt zum Christentum habe er die traditionellen Götter, die bisher angeblich das Überleben Roms garantiert hatten, vernachlässigt, ferner habe er die ehrwürdige Reichshauptstadt Rom im Stich gelassen und die Politik der militärischen Stärke gegen die an den Reichsgrenzen lauernden Barbaren in verräterischer Weise aufgegeben.
Das Werk des Eunap von Sardes, der dieses antichristliche Geschichtsbild in breiten Zügen entwickelt hat, ist zwar nur noch in Fragmenten erhalten. Dass man die antichristliche Geschichtsdeutung des ausgehenden vierten und beginnenden fünften Jahrhunderts aber noch gut nachvollziehen kann, ist vor allem dem um 500 schreibenden Zosimos zu verdanken. Dieser aus dem Dienst geschiedene Beamte der kaiserlichen Finanzverwaltung hing noch – zwei Jahrhunderte nach der konstantinischen Wende! – wie viele seiner Kollegen dem traditionellen «hellenischen» Glauben an und unternahm es, seinen Standpunkt durch ein Geschichtswerk zu untermauern, dessen Inhalt er in großen Teilen Eunap entlehnte. Weil die «Neue Geschichte» des Zosimos als Abriss der Geschichte von zwei Jahrhunderten praktische Qualitäten hatte und in einer gut lesbaren Sprache geschrieben war, konnte sie die christliche Zensur überleben, auch wenn der Patriarch Photios vor dem bedenklichen Inhalt warnte. Als die einzige erhalten gebliebene Handschrift des Zosimos nach Rom gelangt war und dort allmählich ihr brisanter Inhalt bekannt wurde, verfügte Kardinal Sirleto, die Schrift in den Giftschrank der vatikanischen Bibliothek zu verbannen, und Pius V. verbot die Lektüre des verderblichen Werks. Aber man hatte schon Abschriften hergestellt, und so konnte 1578 der Westfale Johannes Leunclavius zum ersten Mal eine lateinische Übersetzung des Werks herausgeben. Wie begründet die päpstlichen Befürchtungen waren, zeigt sich darin, dass Leunclavius in seiner «Apologie des Zosimos», die er der Übersetzung beifügte, bereits das fromme, auf Euseb zurückgehende Konstantinbild mit dem Hinweis auf Zosimos in Frage stellte und dass später die Aufklärung dankbar das bei Zosimos skizzierte Dekadenzschema für ihren argumentativen Kampf gegen die Kirche und das von ihr geprägte Geschichtsbild übernehmen konnte. In den polemischen Zeilen seines «Dictionnaire philosophique» hat dabei Voltaire Konstantin vor allem als einen politisch nicht unbegabten Kriminellen beschrieben. Dagegen entwickelte Edward Gibbon, der sich auf das Material der monumentalen Kaiser- und Kirchengeschichte von Lenain de Tillemont stützte, trotz seiner kritischen Haltung ein sehr viel differenzierteres Bild. Denn er würdigte den Umbau des Römischen Reichs durch «eine neue Hauptstadt, eine neue Politik, eine neue Religion»[4] als bedeutende, wenn auch in ihren Ergebnissen fatale staatsmännische Leistung. Gibbon löste sich damit aus der antichristlichen Interpretation der konstantinischen Wende und leitete zu einer dritten Lesart über, der historistischen Deutung, der zufolge Konstantin «mit klarem Bewußtsein seine weltgeschichtliche Aufgabe, das aus den Fugen gegangene Römische Reich für kommende Jahrhunderte neu zu begründen»[5], erfasst habe. In dieser Perspektive, die bis heute die Handbuchliteratur beeinflusst, erscheint Konstantin als ein Architekt, der das Werk vollendet, das sein religionspolitisch ganz anders orientierter Vorgänger Diokletian eingeleitet hatte, nämlich die Umgestaltung des in seiner Existenz bedrohten Römischen Reichs.
Die lange Tradition der Geschichtsbilder, in denen Konstantin bald als Rettergestalt, bald als Initiator historischer Sündenfälle, bald als Instrument des Weltgeistes gesehen worden ist, verstellt den Blick auf den Menschen. Schon deshalb hat jeder Versuch, eine anscheinend so persönliche Entscheidung wie die Hinwendung zum Christentum aus inneren Motiven des Kaisers erklären zu wollen, kaum Aussicht auf größeren Erfolg. Ein großer Teil des Quellenmaterials ist bereits von tendenziöser Traditionsbildung geprägt, und selbst die unmittelbar aus der Zeit Konstantins stammenden Zeugnisse tragen zu einem Psychogramm das wenigste bei. Zu diesen Zeugnissen gehören neben den Schriften der Zeitgenossen Laktanz und Euseb, die Konstantin als in jeder Hinsicht vollkommenen Verteidiger der christlichen Sache zeichnen, vor allem fünf lateinische Lobreden, die zwischen 307 und 321 zu Ehren Konstantins gehalten wurden. Diese Reden aus der Sammlung der «Panegyrici latini» erlauben es, in ausgesprochen detaillierter Weise aktuelle Themen der konstantinischen Propaganda zu verfolgen, die teilweise auch durch andere offizielle Dokumente wie Inschriften, Münzen oder Bilddarstellungen belegt werden. Sie lassen ferner die von interessierter Seite formulierten Erwartungen erkennen, die an den Kaiser herangetragen wurden und auf die er zu reagieren hatte. Über die Persönlichkeit des Kaisers verraten sie ungefähr so viel wie Wahlplakate über den wirklichen Charakter eines Politikers. Auch die zahlreichen Selbstzeugnisse – vor allem die eingelegten Dokumente in den kirchenhistorischen Werken, ferner die Dokumente in der «Appendix Optati» und eine Rede, die Konstantin vielleicht 317, mit größerer Wahrscheinlichkeit aber nach 325 an «die Versammlung der Heiligen» gehalten hat – taugen nur bedingt als Bausteine für ein authentisches Porträt. Sie verraten zwar bestimmte, oft wiederholte Grundüberzeugungen des Kaisers, etwa zur «Theologie des Sieges». Aber sie sind im Sinne der aktuellen Propaganda stilisiert, und im Einzelfall ist der Anteil kaum festzustellen, den der Kaiser selbst an der Konzeption oder Formulierung eines Schreibens genommen hat. Ihr mitunter ermüdender rhetorischer Aufwand verdeckt den Persönlichkeitskern des Kaisers so sehr, dass ein Gelehrter ihnen entnommen hat, Konstantin sei ein «armer Mensch, der suchend tastete»[6], gewesen, während ein anderer genau zur konträren Interpretation gelangt ist: «Dieser Mann ist aus einem Guß, wußte von Anfang an, was er wollte, und besaß die Kraft, es auch zu erreichen.»[7]
Die meisten Quellen tragen ferner schon deshalb kaum zur richtigen Einschätzung innerer Motive bei, weil sie fast immer den Kaiser im luftleeren Raum agieren lassen und den irreführenden Eindruck erwecken, er habe in einsamer Erhabenheit seine Politik durchgesetzt. Die Frage nach der Abhängigkeit des Kaisers von seiner Umgebung wird allenfalls in flüchtigen Bemerkungen über negative Aspekte seiner Regierung gestreift, wenn etwa in einer späten Quelle darauf hingewiesen wird, der alte Konstantin sei «wegen seiner maßlos verschwenderischen Ausgaben ein unmündiges Kind»[8] genannt worden, oder wenn ein anderer Autor bemerkt, die Regierung Konstantins wäre perfekt gewesen, «wenn er nicht wenig Würdigen den Zugang zu öffentlichen Angelegenheiten erlaubt hätte»[9]. Wie sehr eine genauere Kenntnis des Milieus, in dem der Kaiser lebte, die Beurteilung Konstantins beeinflussen würde, zeigt sich bei seinem Sohn Constantius. Dieser verdankte es nicht zuletzt der detaillierten Negativcharakterisierung seiner Umgebung durch den spätrömischen Historiker Ammianus Marcellinus, dass er als ein eher schwacher Herrscher gilt. Zweifellos würden aber auch ausführlichere Schilderungen der Beziehungen zwischen Konstantin und den Personen in seinem Umfeld nicht grundsätzlich die Bedeutung des Kaisers in Frage stellen können. Eine schwache, wenig charismatische Persönlichkeit hätte nicht einen solchen Eindruck auf seine Soldaten gemacht, dass noch Jahrzehnte später die Erinnerung an Konstantin für die Soldaten im Illyricum genügte, um von ihrem eigenen Kaiserkandidaten Vetranio zum Sohne Konstantins überzuwechseln. Aber es würde sich doch der Eindruck der überragenden titanischen und revolutionären Gestalt relativieren, und Kaiser und Lebenswerk würden etwas mehr dem Normalmaß seiner Vorgänger und seiner Nachfolger angeglichen werden. Der Verlust der Bücher Ammians, die die Zeit Konstantins behandelten, kann durch ein unter dem Namen «Origo Constantini» oder «Anonymus Valesianus» bekanntes, vermutlich aus einem größeren Zusammenhang herausgerissenes und mit zusätzlichen Notizen versehenes Fragment kaum wettgemacht werden. Denn die qualitätvolle Erzählung dieses Fragments bleibt vor allem auf den politisch-militärischen Verlauf der Auseinandersetzungen zwischen Konstantin und Licinius beschränkt.
Bei einigen Schwankungen der Religionspolitik des Kaisers ahnt man mitunter ein wenig von den erbitterten Intrigen, die die kaiserlichen Entscheidungen begleiteten oder beeinflussten. Dass auch den strategischen Entscheidungen des Kaisers heftige Diskussionen im Rat seiner Offiziere vorangingen, verrät das von einem zeitgenössischen Redner ausgesprochene Lob, Konstantin habe den Angriff auf Maxentius durchgesetzt, «als fast alle Angehörigen deines persönlichen Stabs und Kommandeure nicht nur stillschweigend murrten, sondern sogar offen ihre Furcht aussprachen»[10]. In der Regel dürfte der Kaiser allerdings die Übereinstimmung mit seinen Offizieren gesucht haben. Von ihnen sind sehr wenige namentlich bekannt, allen voran natürlich die auffälligen Gestalten barbarischer Herkunft wie der Franke Bonitus oder der Alamannenkönig Chrocus, der bei der Erhebung Konstantins eine herausragende Rolle gespielt haben soll.
Für die zivile Umgebung des Kaisers kann zwar in Grundzügen beschrieben werden, wie Hof und bürokratische Zentrale organisiert waren, ohne dass aber damit viel über persönliche Beziehungen zu Hofangehörigen, etwa zu den vor allem als Kammerdiener tätigen Eunuchen, ausgesagt werden kann. Vom Kaiser Licinius berichtet die «Epitome de Caesaribus», dass er – in Abwehrreaktion gegen die bereits eingetretenen Entwicklungen – «ein harter Bändiger der Eunuchen und allen Hofpersonals war und sie Motten und Spitzmäuse des Palastes nannte»[11]. Hier geht es wohl vor allem darum, Licinius in positiver Weise von seinem Kollegen Konstantin abzuheben. Der konstantinfeindlichen Tradition zufolge, der die «Epitome de Caesaribus» zuzurechnen ist, soll Konstantin nämlich gegen Ende seiner Regierung zu einem orientalischen Despoten entartet sein, und zu diesem Negativbild passt eine von den Eunuchen geprägte kaiserliche Umgebung. So wirken etwa im Bericht des Philostorg Eunuchen an der Ermordung der Ehefrau Konstantins mit. Anders als für seinen Sohn Constantius, der angeblich von seinem Oberkämmerer, dem Eunuchen Eusebius, beherrscht wurde, sind aber für Konstantin keine historischen Vertreter dieses von der spätantiken Öffentlichkeit gehassten Personenstands bekannt. Nur die Legende berichtet vom heiligen Eunuchen Euphratas, der entscheidenden Einfluss auf die Gründung des christlichen Konstantinopel gehabt haben soll.
Zur engsten Umgebung des Kaisers gehörte natürlich die Familie, und auch hier können aufgrund der Quellenlage nur grobe Umrisse skizziert werden. Konstantin war der Sohn des Offiziers und späteren Kaisers Constantius (293–306) und der Helena. Je nach Tendenz der Quelle wird diese Verbindung das eine Mal als reguläre Ehe, das andere Mal als Konkubinat dargestellt. Vermutlich handelte es sich um eine langjährige Lebensgemeinschaft, die unter Soldaten durchaus als eheähnliches Verhältnis galt. Zum sozialen Status der Helena erfährt man vom Anonymus Valesianus, sie sei von «sehr niedriger»[12] Herkunft gewesen, und der Bischof Ambrosius nennt sie eine «Stallwirtin»[13], das heißt eine einfache Gastwirtin, die auf den Poststationen den Pferdewechsel besorgte und die Reisenden beherbergte. Weil Konstantin später die bithynische Stadt Drepanon zu Ehren seiner Mutter in Helenopolis umbenannte, hat man vermutet, dies sei ihr Geburtsort gewesen. Doch ist die Umbenennung schon hinreichend damit erklärt, dass die Mutter Konstantins Lukian von Antiochia eine besonders starke Verehrung entgegenbrachte, der in Nicomedia 312 den Märtyrertod erlitten hatte und in Drepanon bestattet worden war. Wie der Vater Konstantins stammte damit wohl auch seine Mutter aus dem lateinischsprachigen illyrischen Raum, und zwar mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Nähe von Naissus (Niš), wo Konstantin vermutlich um 275 geboren wurde. Erst lange nach Konstantins Geburt trennte sich Constantius von Helena, um Theodora, die Tochter (oder adoptierte Stieftochter) des Kaisers Maximian (285–305), zu heiraten. Über Jahre in der Bedeutungslosigkeit lebend, gewann Helena erst als Greisin unter ihrem Sohn Konstantin einigen Einfluss und scheint neben ihrem Engagement für den Kirchenbau vor allem die Fäden der Familienpolitik gezogen zu haben.
Aus der Ehe des Constantius mit Theodora gingen sechs Kinder hervor. Von den drei Halbschwestern Konstantins heiratete Anastasia den später vorübergehend zum Unterkaiser vorgesehenen Bassianus und Eutropia den nicht weiter bekannten Virius Nepotianus, Konsul des Jahres 336. Constantia, die mit Kaiser Licinius (308–324) vermählt war, spielte auch nach dem Ende ihres Mannes eine wichtige Rolle. Noch auf dem Sterbebett soll sie ihrem Halbbruder empfohlen haben, die Position der Arianer anzunehmen, und auch wenn dies wohl nur ein Gerücht sein dürfte, wird man Constantia eine gewisse Bedeutung bei religionspolitischen Entscheidungen nicht absprechen können. Dies gilt freilich auch für andere Damen des kaiserlichen Hauses, von Helena über Eutropia, die Witwe Maximians, bis zu Basilina, der Mutter Julians des Abtrünnigen. Der Bischof Athanasius beklagte sich sogar darüber, dass sein Rivale Euseb von Nicomedia angeblich allein durch seinen Einfluss auf die kaiserlichen Frauen die Politik lenken konnte und «allen Furcht einflößte»[14].
Von den drei Söhnen der Theodora scheint Hannibalianus schon früh gestorben zu sein. Dalmatius und Iulius Constantius konnten erst nach dem Tode der Kaisermutter Helena, die die Söhne ihrer Rivalin Theodora mit erbittertem Hass verfolgte, herausragende Positionen bekleiden, Dalmatius nicht nur das Konsulat, sondern auch eine eigens für ihn unter dem ehrwürdigen Namen der Zensur eingerichtete Oberstatthalterschaft über die Provinzen des Ostens, Iulius Constantius ebenfalls das Konsulat sowie die Würde eines «patricius». Dass Konstantin sich bemühte, auch seine Neffen an der Herrschaft zu beteiligen, setzt ein versöhnliches Verhältnis zwischen den beiden Linien des Kaiserhauses voraus. Zwar erzählt Philostorg, Konstantin sei 337 einem Giftanschlag seiner Halbbrüder zum Opfer gefallen. Doch handelt es sich hier offenkundig um eine Version, mit der gerechtfertigt werden sollte, warum unmittelbar nach dem Tode Konstantins die Soldaten vermutlich mit Billigung seines Sohnes Constantius fast alle von Theodora abstammenden männlichen Angehörigen des konstantinischen Hauses umbrachten.
Noch vor der Kaisererhebung Konstantins wurde dessen erster Sohn Crispus geboren. Von der Mutter Minervina, die in einer ähnlichen Verbindung mit Konstantin zusammenlebte wie Helena mit Constantius, kennt man gerade noch den Namen. 307 nahm Konstantin Fausta, die Tochter Maximians, zur Frau, von der er drei Söhne, Constantinus, Constantius und Constans, und mindestens zwei Töchter, nämlich Constantina und Helena, hatte, bevor er Fausta 326 unter ungeklärten Umständen umbringen ließ.
Ein Charakterbild Konstantins zu gewinnen ist nicht nur deshalb schwierig, weil man nur wenig von der Atmosphäre kennt, in der er lebte. Auch die wenigen Nachrichten über persönliche Züge des Kaisers erweisen sich bei näherer Beobachtung als verdächtig. Die «Epitome de Caesaribus» berichtet, der Kaiser sei eher «ein spottender Zyniker als von angenehmem Umgang gewesen»[15] und habe deshalb im Volksmund den Beinamen «Trachala»[16] (was am ehesten mit «arroganter Steifhals» wiederzugeben ist) erhalten. Dagegen erfährt man vom Zeitgenossen Euseb genau das Gegenteil: Der Kaiser sei, als er im Konzil von Nicaea mit den Bischöfen verhandelte und mit großem Entgegenkommen sogar die griechische Sprache gebrauchte, ausgesprochen «freundlich und angenehm»[17] gewesen. Man muss zur Vermutung gelangen, dass Angaben über Charakterzüge des Kaisers nur eine Funktion der jeweiligen negativen oder positiven Gesamttendenz der Berichte sind.
Die Deutung der Persönlichkeit Konstantins bleibt unter diesen Umständen vor allem der Phantasie der Historiker überlassen. Das erklärt die erstaunliche Breite der bisher unternommenen Charakterisierungsversuche, von denen man angesichts der geringen Verifizierungsmöglichkeiten allenfalls einige Extreme verwerfen kann, etwa die im pietistischen Umfeld zuerst formulierte und dann durch Jacob Burckhardt berühmt gewordene Vorstellung, Konstantin habe als skrupelloser und machtbewusster Machiavellist die christliche Religion ohne innere Anteilnahme für seine politischen Zwecke missbraucht. Eine gewisse Beschränkung in der Bandbreite möglicher Interpretationen ergibt sich ferner daraus, dass Konstantin kaum in einer anderen Vorstellungswelt gelebt haben kann als seine unmittelbaren Vorgänger und Kollegen im Kaiseramt. Constantius Chlorus, der Vater Konstantins, gehörte zum Kreis der vor allem aus dem Illyricum rekrutierten Berufsoffiziere, die im Verlauf des dritten Jahrhunderts die oft dilettierenden Herren des alten Senatorenadels aus den bis dahin für sie reservierten militärischen Führungspositionen verdrängt und damit für Leute ihresgleichen den Weg zum Kaisertum gebahnt hatten. Eine gute Presse haben die illyrischen Kaiser bei der vom senatorischen Standpunkt aus urteilenden Bildungselite nicht gehabt. So geben einige Quellen dem Kaiser Galerius (293–311) den Spottnamen «Großviehhirt»[18], und Laktanz erklärt seine «naturgegebene Barbarei und nicht mit römischem Blut vereinbare Wildheit» damit, dass dessen Mutter gar keine Römerin gewesen sei, sondern «erst, als die Carpen das Gebiet jenseits der Donau angriffen, den Fluß überquerte und nach Neu-Dakien flüchtete»[19]. Maximinus Daia (305–313) soll, wiederum nach Laktanz, nicht sehr lange Zeit vor seinem Aufstieg zum Kaiser «von den Herden und aus den Wäldern»[20] geholt worden sein. Zum Bild niedriger und halbbarbarischer Herkunft fügen sich Berichte über angebliche alkoholische Exzesse der Kaiser Galerius, Severus (305–307) und Maximinus Daia. Abgerundet wird diese Negativtradition schließlich durch den Hinweis, dass die illyrischen Kaiser nur «einen geringen Grad an Bildung»[21] besaßen. Dabei schätzten sie in Wirklichkeit durchaus ein gewisses höfisches Raffinement, zu dem auch der Umgang mit Rednern wie Mamertinus oder Soterichos, mit Poeten und Philosophen gehörte. Diesen Punkt hat die «Epitome de Caesaribus» lediglich für Maximinus Daia angemessen gewürdigt, der «zwar die Abstammung und die Ausbildung eines Hirten gehabt, aber alle Philosophen und die Wissenschaften gefördert»[22]





























