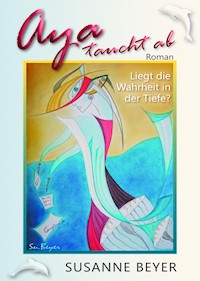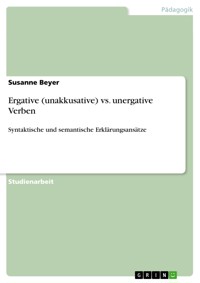16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine Kriegsenkelin auf der Spur eines düsteren Familiengeheimnisses
Susanne Beyer hat ihren Großvater nie kennengelernt. Er starb unter mysteriösen Umständen in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Wer hat ihn erschossen? Und was war eigentlich seine Aufgabe im NS-Staat?
In fast jeder Familie schlummern Geheimnisse: Haben die Eltern oder Großeltern während der NS-Zeit Schuld auf sich geladen? Was verschweigen die Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden? Susanne Beyer versucht, 80 Jahre nach dem Tod des Großvaters die Wahrheit herauszufinden. Dabei wird ihr immer klarer, welche Folgen die Vergangenheit für ihr eigenes Leben hat.
Ein bewegendes Buch über eine Spurensuche und die Auswirkungen von Familiengeheimnissen auf die Gegenwart – mit vielen hilfreichen Hinweisen für alle, die mehr über die eigenen Vorfahren und sich selbst herausfinden möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eine Kriegsenkelin auf der Spur eines düsteren Familiengeheimnisses
Susanne Beyer hat ihren Großvater nie kennengelernt. Er starb unter mysteriösen Umständen in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Wer hat ihn erschossen? Und was war eigentlich seine Aufgabe im NS-Staat?
In fast jeder Familie schlummern Geheimnisse: Haben die Eltern oder Großeltern während der NS-Zeit Schuld auf sich geladen? Was verschweigen die Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden? Susanne Beyer versucht, 80 Jahre nach dem Tod des Großvaters die Wahrheit herauszufinden. Dabei wird ihr immer klarer, welche Folgen die Vergangenheit für ihr eigenes Leben hat.
Ein bewegendes Buch über eine Spurensuche und die Auswirkungen von Familiengeheimnissen auf die Gegenwart – mit vielen hilfreichen Hinweisen für alle, die mehr über die eigenen Vorfahren und sich selbst herausfinden möchten.
Susanne Beyer, geboren 1969, ist seit 1996 beim SPIEGEL tätig. Sie hat im Kultur- und Wissenschaftsressort sowie im Hauptstadtbüro gearbeitet und war vier Jahre lang stellvertretende Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins. Heute ist sie Autorin der Chefredaktion und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, zuletzt »›Mich hat Auschwitz nie verlassen‹: Überlebende des Konzentrationslagers berichten« (mit Martin Doerry, 2015) und »Die Glücklichen: Warum Frauen die Mitte des Lebens so großartig finden« (2021).
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
SUSANNE BEYER
KORNBLUMENBLAU
Der geheimnisvolle Tod meines Großvaters 1945 und die Frage, was er mit den Nazis zu tun hatte
Eine Spurensuche
Ein SPIEGEL-Buch
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Deutsche Verlags-Anstalt, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München, und SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagabbildungen: © privat; ESN design / shutterstock
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-33099-6V001
www.dva.de
»Was man nicht verstehen kann, bildet eine schmerzhafte Leere, ist ein Stachel, ein dauernder Drang, der Erfüllung fordert«
Primo Levi, Ist das ein Mensch?
»Ich erinnre, also bin ich«
Hae Kim
Den Häftlingen des Lagers Auschwitz III, Buna-Monowitz, zum Gedenken
Inhalt
Das Geheimnis
Wo wir stehen
Vergangenheit
Was Fotos uns verraten
Sind Gene wirklich so mächtig?
Wie sich ein Stammbaum deuten lässt
Was Familien wissen und nicht wissen wollen
In einem Lebenslauf steckt mehr als gedacht
Im Bundesarchiv schlummern Antworten
»Im Raume lesen wir die Zeit«
Ein Stadtarchivar und seine Dachbodenfunde
Zeitzeugen erzählen, wie es nach dem Krieg weiterging
Dilemma
Gegenwart
Wir erben Geschichten und Gefühle – und das hat Folgen
Eine andere Perspektive
Abstand gewinnen
Ende: Kornblumenblau
Anhang
Quellen
Chronologie der Ereignisse
Hilfreiche Hinweise für die eigene Recherche
Dank
Das Geheimnis
Mein Großvater wurde in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges erschossen. Er war kein Soldat, kein Offizier, er hat überhaupt nicht gekämpft in diesem Krieg. Umgekommen ist er trotzdem, und damit fängt das Geheimnis schon an.
Mein Großvater war Chemiker. In der Familie hieß es, er habe in seiner Doktorarbeit untersucht, wie sich die Farbe Kornblumenblau synthetisch herstellen lässt. Ich fand das sympathisch und poetisch: ein Naturwissenschaftler, der sich mit dieser hübschen Farbe beschäftigte.
Sehr viel mehr wusste ich lange Zeit nicht über ihn. Meine Mutter konnte mir nur wenig über ihren Vater erzählen. Sie war dreieinhalb Jahre alt, als er erschossen wurde. Doch obwohl sie ihn kaum kannte, hat sie ihn vermisst. Sie hat das oft gesagt und auch dadurch ausgedrückt, dass sie alles Blaue liebte. Als sie jünger war, hat sie viel gemalt, es waren abstrakte Bilder ohne Namen, und immer wieder experimentierte sie mit Blautönen, mit Azurblau, Himmelblau, Kobaltblau, Königsblau – und Kornblumenblau.
Wenn ich ihr ein Geschenk machen wollte, suchte ich oft nach einer blauen Bluse oder einem Pullover, aber etwas zu finden, das der Farbe der Kornblume entsprach, fiel mir immer schwer. Jetzt erst weiß ich, woran das lag. Ich habe mir die Kornblumenblüte nicht genau genug angesehen. Als ich es neulich einmal machte, stellte ich fest, dass sich ihr Blau aus ganz unterschiedlichen Tönen zusammensetzt, aus hellen und dunklen.
Aber es ist doch merkwürdig, dass ich mich jetzt erst näher mit dieser Farbe beschäftigt habe, obwohl ich sie früh schon mit meinem Großvater verbunden habe. Auch etwas anderes wundert mich, es hängt damit zusammen: Ich wollte immer schon Genaueres über meinen Großvater, sein Leben, seine Arbeit, seinen geheimnisvollen Tod erfahren, und einiges habe ich über die Jahre auch schon herausgefunden, aber nun erst, für dieses Buch, fange ich mit einer echten Suche an. Warum so spät?
Ich glaube, ich bin mit dieser Frage nicht allein. Ich habe es selten erlebt, dass jemand wirklich Bescheid wusste über das, was der Vater, Großvater, Urgroßvater, die Mutter, die Großmutter, die Urgroßmutter im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Im »Zweiten Weltkrieg« bedeutet immer auch: im Nationalsozialismus.
Und trotzdem wundere ich mich über mich selbst. Schon als Jugendliche habe ich eigentlich viel über diese Zeit gelesen und mir Filme darüber angeschaut. Das, was wir heute »Aufarbeitung« nennen, begann erst wirklich in den 1980er Jahren, und viele junge Leute wuchsen damals damit auf.
Aber dass es möglicherweise eine Verbindung geben könnte zwischen meinem Großvater, dem Chemiker, und dem größten deutschen Chemiekonzern seiner Zeit, der I.G. Farben, darauf war ich damals nicht gekommen. Die »Interessengemeinschaft Farbenindustrie«, kurz I.G. Farben, war ein Zusammenschluss der größten deutschen Chemiefirmen – unter anderem BASF, Hoechst und Bayer – und war eng mit dem NS-Staat verflochten. Ich wusste auch so ungefähr, dass die I.G. in der Zeit des Nationalsozialismus fast alles dominierte, was mit Chemie zu tun hatte, aber ich bezog es nicht auf meinen Großvater. Es gibt diese Formulierung vom »blinden Fleck«. Ich hatte einen solchen »blinden Fleck«.
Ich weiß noch, wie in den 1980er Jahren der Vierteiler Väter und Söhne im Fernsehen lief. Vor einiger Zeit habe ich nachgelesen, worum es darin ging: Die Serie erzählt an einer Familiengeschichte entlang, wie die I.G. Farben sich vom Ersten Weltkrieg an immer enger mit den Mächtigen verbündete und dann zusammen mit dem Nationalsozialismus zugrunde ging. Die Serie war damals ein Ereignis. Es kam selten vor, dass Weltstars wie Julie Christie und Burt Lancaster in einer deutschen Produktion mitspielten. Wenn etwas groß war im Fernsehen, bekam man es durchaus mit und wollte es sehen.
Ich kann mich auch noch genau an die Anfangsszene erinnern: Ein Mann fährt im Zug. Als er fast vor seiner Haustür angelangt ist, zieht er auf freier Strecke die Notbremse, um sich den Umweg über einen Bahnhof zu sparen. Sogar die überhebliche Art, mit der der Mann auf dem Weg zu seinem Haus mit dem Koffer in der Hand über ein Feld geht, habe ich noch vor Augen. Um mich zu überprüfen, bestellte ich mir jetzt die alten Filme und schaute sie mir an. Und ja, die Serie beginnt genau so: Ein Mann zieht im Zug die Notbremse. Aber danach kannte ich keine einzige Szene mehr.
Habe ich sie alle vergessen, oder habe ich damals nicht weitergeschaut? Beides wäre seltsam: alle Szenen bis auf eine zu vergessen oder nach einer Anfangsszene, die mich beeindruckte, nicht weiterzuschauen. Ich kann es mir nicht erklären, aber vielleicht hat es etwas mit meinem »blinden Fleck« zu tun?
Mein Großvater hat im »Reichsamt für Wirtschaftsausbau« gearbeitet, das wusste ich immer schon. Aber erst vor etwa zehn oder fünfzehn Jahren habe ich mich genauer darüber informiert, was dieses Reichsamt wohl gewesen ist. Es existierte sechs Jahre lang und war eine Art Chemieministerium, das offiziell zum Wirtschaftsministerium gehörte, aber eigentlich die Pläne der I.G. Farben für den Staat und die Wirtschaft koordinierte. Es sorgte dafür, dass die Firmen im NS-Staat Rohstoffe herstellten, die im Krieg benötigt wurden. Der Chemiker Carl Krauch war Aufsichtsratsvorsitzender der I.G. Farben und leitete gleichzeitig dieses Reichsamt. Er wurde nach dem Krieg in Nürnberg als Kriegsverbrecher angeklagt.
So war also mein Großvater als Spezialist für Farben ins Zentrum der Kriegswirtschaft geraten. Seine Arbeit war gar nicht so poetisch, wie das Wort »Kornblumenblau« nahelegt. Und es kam noch viel, sehr viel schlimmer. Als ich mich nämlich genauer mit dem Reichsamt beschäftigte, fand ich Anzeichen dafür, dass es sogar eine Verbindung gegeben haben muss zwischen diesem Amt und verschiedenen Konzentrationslagern. Darunter Auschwitz.
Ich kann das Gefühl nicht beschreiben, als ich auf diese Spur gestoßen bin. Es ist immer schwierig, eine Sprache zu finden für etwas, das man vorher nicht kannte. Denn unsere Sprache beruht ja auf unseren Erfahrungen, wir drücken aus, was wir kennen. Und dieses merkwürdige Gemisch an Gefühlen, mit dem ich es zu tun bekam, war schwierig zu bestimmen. Scham war dabei, ja, große Scham, aber nicht nur. Ekel? Nicht nur. Da war die Trauer um die Opfer, die ich von frühauf schon kannte, nun aber kam das Entsetzen dazu, dass es möglicherweise eine Verbindung gab zwischen deren Leid, Not und Tod und mir als Enkelin eines Mannes, der irgendwie daran beteiligt gewesen sein muss – als einer von vielen zwar und vielleicht gar nicht direkt oder in verantwortlicher Position, so genau wusste ich es nicht, aber das machte es nicht besser.
Wie war das möglich? Mein Großvater? Der, der auf den Fotos immer so freundlich und elegant aussieht, von dem gesagt wird, er sei besonders ehrlich gewesen und in allem ernsthaft?
Ja, wahrscheinlich war es dieses Gefühl, das sich über alle anderen legte: Ich war vollkommen irritiert. Nichts passte mehr zusammen, gar nichts.
Ich erinnerte mich daran, wie ich als Kind einmal mit seiner Witwe, meiner Großmutter, fernsah. Auch das muss irgendwann in den achtziger Jahren gewesen sein. Meine Großmutter war mit ihrer Maniküre beschäftigt, die Nagelschere und die Feile lagen auf der Fernsehzeitschrift auf ihrem Schoß. Wir sahen uns eine historische Dokumentation an, Archivbilder von Adolf Hitler flimmerten über den Bildschirm.
Meine Großmutter konnte ihre Gefühle schlecht verbergen, trotzdem hatte ich sie bis dahin nie wütend erlebt. Dieses eine Mal aber, als der NS-Diktator auf ihrem Bildschirm erschien, war es anders. Sie ballte eine Hand zur Faust, schwang sie in der Luft und rief: »Du Mistkerl!«
Ich wunderte mich still über sie, weil dieser Ausbruch so gar nicht zu ihrem Alter und ihrem insgesamt sanften Wesen passte. Und ich fragte mich, ob gleich die Schere und die Feile durch die Luft fliegen würden und ob ich mich besser in Sicherheit bringen sollte.
Ich glaubte schon damals nicht, dass sich meine Großmutter für mich verstellte, und ich glaube es immer noch nicht. Nein, so war sie nicht. Sie war ein Mensch, dem es auf eindrucksvolle Weise nicht gelang, sich zu verstellen.
Und nie hat sie mir einen Anlass gegeben zu denken, sie hätte je mit den Nazis sympathisiert. Auch als sie kurz vor ihrem Tod einige Schlaganfälle bekam, die ihr Wesen und das, was sie sagte, veränderten, fiel mir kein einziger Satz auf, der mir verdächtig vorkam.
Wir jungen Leute beobachteten damals in den 1980er Jahren unsere Großeltern sehr genau. Das lag eben auch an den vielen Büchern und Filmen, die gerade über den Nationalsozialismus erschienen waren, und natürlich fragten wir uns, was unsere Großeltern in jener Zeit getan hatten.
Schulfreundinnen erzählten mir manchmal von bösen Überraschungen. Eine hatte ganz hinten im Wohnzimmerregal ihrer Großmutter Hitlers Schrift Mein Kampf gefunden. Eine andere nahm mich mal auf dem Pausenhof unserer Schule zur Seite, ganz blass war sie, und sagte mir, sie habe ihre Oma beim Putzen ein Lied singen hören: »Bomben auf England«. Meine Großmutter sang auch viel, Lieder der Nazis aber waren es nie.
In dem Moment, als ich zu ahnen begann, wie die Arbeit meines Großvaters ausgesehen haben könnte, fehlte mir jede Vorstellung davon, wie ich meine Großmutter in das neue Bild einfügen sollte, das sich da von ihrem Mann, meinem Großvater, abzeichnete.
»Das passt doch alles nicht zusammen«, dachte ich mir, »das kann doch überhaupt nicht sein.«
Ich wollte wissen, ob es sein konnte. Doch immer, wenn ich mich intensiver mit meinem Großvater und den Chemikern im NS-Reich befassen wollte, kam mir mein eigenes Leben dazwischen: Ich arbeitete, ich wollte Zeit haben für meine Kinder, und ich merkte, dass die Recherchen, die ich über meinen Großvater gelegentlich anstellte, meine Mutter beunruhigten. Sie hielt mich nie ab und machte mit sich selbst aus, was ich ihr von meinen Funden erzählte. Aber ich bekam ihren stillen Kampf mit, wollte ihr nicht wehtun und scheute immer wieder davor zurück, meine Suche fortzusetzen.
Nur gelegentlich suchte ich dann doch weiter, auch weil meine Schwester es richtig fand und mich unterstützte. Manchmal begegneten mir auch aus Zufall Informationen, die mit meinem Großvater zu tun hatten. Ich sammelte alles, was ich fand, in zwei Ordnern – einem auf meinem Schreibtisch, einem auf meinem Desktop im Computer. Dort lagern bis heute auch die Mitschnitte aller Gespräche, die ich im Laufe der Zeit geführt habe.
Auf diese Weise fand ich heraus, dass das Amt, in dem mein Großvater gearbeitet hat, am Potsdamer Platz in Berlin lag. 1943 aber, im Verlauf des Zweiten Weltkriegs, siedelten Teile des Amtes an einen verborgenen Ort um, in ein uraltes Zisterzienserkloster im Ort Lehnin in Brandenburg. Die Chemiker wollten sich vor Bomben schützen, ihre Arbeit konnte dort auch besser geheim bleiben. Niemand würde, so dachte sich die Führung des Reichsamts wohl, in einem Kloster ihr Versteck vermuten. Mein Großvater hatte dann zwei Telefonnummern, eine am Potsdamer Platz und eine draußen im Kloster. Durch den Umzug seiner Abteilung stiegen die Chancen für meinen Großvater, mit dem Leben davonzukommen. Ohnehin »bildete der Chemikerberuf wohl eine der besten Voraussetzungen, den Krieg zu überleben«, so schreibt der Naturwissenschaftshistoriker Helmut Maier im Buch Chemiker im »Dritten Reich«. Weil so viele Chemiker in der Rüstungsforschung gebraucht wurden, mussten sie, wie mein Großvater, nicht an die Front.
Ich nehme an, dass mein Großvater und seine Kollegen es in den letzten Wochen des Krieges vermieden haben, nach Berlin zu fahren. Der Krieg war schon fast verloren, die Rote Armee rückte heran, das Zentrum der Stadt war in weiten Teilen zerstört. Mein Großvater hielt sich in diesen letzten Apriltagen des Jahres 1945 jedenfalls in dem Kloster auf, das konnte ich in Akten nachvollziehen. Am 23. April drangen Soldaten der Roten Armee in das Kloster ein. Sie waren betrunken und spielten ein Spiel. So wurde es mir von meiner Mutter erzählt. Sie hatte es von ihrer Mutter so gehört, und die hatte es vom besten Freund meines Großvaters erfahren: Die Kollegen meines Großvaters, so ging das Spiel, sollten einen unter ihnen auswählen, den würden die Soldaten dann erschießen.
Die Kollegen entschieden sich für meinen Großvater.
Er wurde 38 Jahre alt.
Dies ist die erste Version der Ermordung meines Großvaters, von der ich wusste, später kamen noch andere hinzu. Mit dieser ersten Version bin ich aufgewachsen. Der beste Freund meines Großvaters soll einige Jahre nach dem Krieg das Kloster besucht und dort von den Umständen des Todes erfahren haben.
Dass die Kollegen meines Großvaters ausgerechnet ihn ausgesucht haben, hat meine Familie dann so interpretiert: Sie hätten ihn loswerden wollen. Er sei »anders« gewesen als sie. Er habe »zu viel gewusst«. So war die Formulierung: »zu viel gewusst«.
Aber warum, so frage ich mich bis heute, hat niemand nach dem Tod meines Großvaters herausfinden wollen, was das war, was er »gewusst« hat? Haben meine älteren, inzwischen verstorbenen Verwandten es als eine Form des Respekts, des Takts, des Feingefühls empfunden, nicht daran zu rühren, was er erlebt oder verursacht hat? »De mortuis nil nisi bene«, so lautet ein lateinisches Sprichwort – über die Toten soll man nur Gutes reden. Ich kann verstehen, was mit dem Sprichwort gemeint ist, und auch, was dafürspricht, sich daran zu halten. Die Toten können sich nicht verteidigen, sie können nicht sagen, was sie wirklich getan oder absichtlich nicht getan haben. Sie können ihre Beweggründe und Lebensumstände nicht mehr erklären.
Ich aber habe mich durch meine Recherchen, die bisher noch gar nicht besonders gründlich waren, selbst in eine Lage gebracht, in der es mir gar nicht mehr möglich ist, das, was ich jetzt schon weiß, zu ignorieren. Ich weiß zu viel und zu wenig. Ich erahne Verbindungen des Reichsamtes nach Auschwitz und bekomme die Ahnungen immer noch nicht mit den Bildern des angeblich so freundlichen Mannes zusammen, der meine geliebte Großmutter geheiratet hat. Meine vielen Fragen treiben mich um, ich komme nicht zur Ruhe: Sollte durch seinen Tod etwas vertuscht werden? War er ein Guter unter vielen Bösen? Solche Geschichten stimmen nie ganz – aber was stimmt denn nun?
Manchmal beschäftigt einen etwas Geheimnisvolles mehr als das Erklärliche. Ich kannte drei Großelternteile, die Gedanken an sie kommen und gehen. Mein vierter Großelternteil aber, der Großvater, den ich nie kennenlernte, setzt sich ganze Tage und Wochen in mir fest.
Ich möchte nun meine Suche nach ihm so weit treiben, bis ich mehr Antworten als Fragen habe. Ich habe zwar Skrupel und möchte ihm nicht Unrecht tun, doch es ist ja auch möglich, dass mein Großvater genau das gewollt hätte, was ich mir nun vornehme: dass jemand versucht nachzuvollziehen, was mit ihm geschah und was mit seiner Arbeit verbunden war. Und wenn es ihm nicht recht gewesen wäre? Dann wäre es wohl trotzdem richtig. Denn Geschichte setzt sich im Kleinen – in den Familien – und im Großen – in der Politik – immer fort, und sowohl die psychologische als auch die historische Forschung zeigt, dass es sich bewährt zu verstehen, was sich da fortsetzt.
Ich könnte mir übrigens auch gut vorstellen, dass es praktische Gründe gab, die die älteren Familienmitglieder davon abhielten, genauer nachzuvollziehen, was mit meinem Großvater geschah. Es gibt keine Briefe von ihm, kein Tagebuch, und hätte ich nicht die modernen Hilfsmittel zur Hand, die es inzwischen gibt, wäre es auch für mich sehr schwierig, meine Suche jetzt voranzutreiben.
Im Internet kann ich Fachliteratur finden. Dafür hätten zu früheren Zeiten erwachsene Menschen, die genug mit ihren Familien und ihren Berufen zu tun hatten, in Universitätsbibliotheken gehen müssen. Im Netz kann ich auch herausfinden, in welchen Archiven ich Dokumente über meinen Großvater und das Reichsamt einsehen kann. Inzwischen schicken Archive Akten nach Hause, die man online entdeckt hat. Ich kann im Netz nach Zeitzeugen und Verwandten suchen. Heute sind es nur ein paar Klicks. Früher aber hätte man, um an ähnliche Informationen zu kommen, Telefonbücher wälzen und verreisen müssen. Ich habe auf meinem Handy eine App, die alte Handschriften entziffern kann, oder eine Carsharing-App, sodass ich mit der Bahn irgendwo bequem hinreisen, mich an einem fremden Ort in ein Auto setzen kann, das mich mit seinem Navigator überall dort hinbringt, wo ich hinmöchte.
Es ist so viel leichter geworden zu recherchieren. Man kann manches abends schnell mal nach der Arbeit machen, es muss keine Lebensaufgabe mehr sein.
Doch ich vermute, dass es nicht nur praktische Gründe gewesen sind, die die Älteren daran hinderten, mehr über meinen Großvater herauszufinden. Ich glaube, dass sich Familien bestimmte Bilder von ihren Vorfahren bewahren und deswegen lieber nicht genauer wissen wollen, wie es wirklich gewesen ist.
Die Psychologin Marina Chernivsky hat sich mit Familiengeheimnissen beschäftigt und einen Text zu »Gefühlserbschaften des Nationalsozialismus« geschrieben, in dem sie darauf hinweist, dass in Erzählungen über frühere Zeiten auch Gefühle weitergegeben werden. Fakten über Vorfahren würden in den Erzählungen zurechtgebogen, damit sie zu den Gefühlen der Erzählenden passten. Die »imaginative Vergangenheit«, also das Bild, das jemand von früheren Zeiten habe, spiele eine viel wichtigere Rolle als die »dokumentarische Faktizität«, somit das, was tatsächlich geschehen und belegbar sei. Und das habe Folgen.
Chernivsky bestätigt, was ich bisher nur vermuten konnte: Die Geschichte, so schreibt sie, wirke »machtvoll nach«, und zwar im Körper, in der Psyche und im Gedächtnis der Nachkommen. Und das gelte sowohl für die Nachkommen der Opfer als auch für die Nachkommen der Täter oder Mitläuferinnen der NS-Zeit. Den Nachgeborenen fehle der emotionale Abstand zu den Geschehnissen der NS-Zeit, schreibt Chernivsky. Sie seien »gefangen in der Abwehr der Erkenntnis, im Gefühl, verdrängen zu müssen«.
Ich muss es also für möglich halten, dass in den wenigen Erzählungen, die über meinen Großvater überliefert sind, Fakten und Wünsche vermischt sind. Zum Beispiel in der Erzählung, dass er im April 1945 für die Todesschüsse ausgesucht wurde, weil er »anders« gewesen sei als seine Kollegen. Wenn ich mir während der ausführlichen Recherche, die ich mir für dieses Buch hier vornehme, noch einmal die Geschichten in Erinnerung rufen werde, die in meiner Familie erzählt wurden, müsste ich also versuchen, die »Gefühlsbotschaften« herauszuhören, eine mögliche Scham, Wut oder Melancholie.
Und was hat es eigentlich zu bedeuten, dass für meine Mutter ihr verlorener Vater im Alter immer wichtiger wird? Sie erwähnt ihn häufiger als in ihrer Lebensmitte. Sie ruft dann ihre wenigen Erinnerungen an ihn auf: Im Januar oder Februar 1945 brachte er seine Familie in den Westen, sie kamen durch Hannover, die Stadt wurde gerade bombardiert, überall brannte es. Ihr Vater, so erzählt meine Mutter, habe sie an die eine Hand genommen und ihr zugerufen, die andere Hand vor ihre Augen zu schlagen, damit sie die Flammen nicht sieht: »Natchen, halt die Hand vor die Augen, es brennt.«
Im Alter, so heißt es in der Forschung, treten Gefühle oft deutlicher hervor als in jüngeren Jahren. Der Kasseler Alternsforscher und Psychoanalytiker Hartmut Radebold hat mir einmal in einem Interview, das ich in meinem Beruf als Journalistin mit ihm geführt habe, gesagt, woran das liegt: »Die seelische Betondecke bricht.«
Bei meiner Mutter kommt die Liebe zu ihrem Vater zum Vorschein. Es ist die Liebe eines Kindes, das nicht viel mehr kennt als die Freude, die es spürt, wenn der Vater es umarmt, und die Sehnsucht nach ihm, wenn er nicht da ist.
Meiner Mutter ist über ihre Zeit als Kleinkind erzählt worden, sie sei eine »Vatertochter« gewesen. Wenn ihr Vater abends nach Hause gekommen sei, habe er sie sofort aus dem Laufstall genommen, habe sie in die Luft geworfen und gerufen: »Meine kleine Rübe.«
Meine Schwester sagt heute manchmal zu unserer Mutter: »Meine kleine Rübe.« Die Rollen haben sich umgedreht, und meine Schwester weiß, wie sie das Herz unserer Mutter erreicht: »Meine kleine Rübe.«
Ich frage mich jetzt, ob die Liebe meiner Mutter zu ihrem Vater etwas überdeckt, das ihr vielleicht nicht bewusst ist. Sie spricht selbst manchmal davon, dass sie in einer Zeit aufgewachsen sei, in der so viel verdrängt wurde, dass sie befürchte, es wirke sich bis heute auf sie aus.
Die Verwandten aus der Generation meines Großvaters haben immer gesagt, mein Großvater sei nicht in der Partei, er sei sogar gegen die Nazis gewesen. Aber das wenige, was ich bisher über die Arbeit meines Großvaters weiß, spricht eher dafür, dass er als Chemiker, der für eine NS-Behörde forschte, nicht frei sein kann von Schuld. Entspricht also das Charakterbild meines Großvaters als aufrechter Mann, der nicht in der Lage war zu lügen – so hieß es immer über ihn: »Er konnte nicht lügen« –, eher einem Wunsch als der Wirklichkeit? Drückt es den Wunsch aus, ihn lieben zu können, ihnen lieben zu dürfen? Oder war er genauso, wie er beschrieben wurde, und es stimmt wirklich, dass ihm das zum Verhängnis wurde?
Und hier beginnt die Recherchereise, auf die ich Sie in diesem Buch gern mitnehmen möchte. Auf die Reise selbst, aber auch auf eine Gedankenreise: Was machen die Erkenntnisse, die ich gewinnen werde, mit mir selbst? Womit beginnen?
Ich lade Sie ein, diese Reise von Anfang an zu begleiten. Ich werde mir das Fotoalbum genauer anschauen, das im Wohnzimmer meiner Mutter liegt und in dem mein Großvater häufig zu sehen ist. Ich könnte auch etwas über Genetik in Erfahrung bringen, dann seinen Stammbaum erstellen, mit Verwandten sprechen und die wenigen privaten Unterlagen, die es von ihm gibt, durchsehen. Dann könnte ich im Bundesarchiv in Berlin prüfen lassen, ob er wirklich nicht in der NSDAP gewesen ist. Ich könnte dort auch Akten des Reichsamts für Wirtschaftsausbau auswerten. Und ich könnte dort hinfahren, wo er erschossen wurde.
Im Anschluss aber, so denke ich, sollte ich versuchen herauszufinden, wie sich das, was ich in Erfahrung gebracht habe, auf mich auswirkt. Denn wenn es stimmt, dass Familien historische Gegebenheiten nicht genauer überprüfen, um sich vor Erkenntnissen zu schützen, dann muss ich damit rechnen, dass meine Erkenntnisse schmerzhaft sein werden und dass ich lernen muss, damit zu leben.
Der Dachauer Psychologe Jürgen Müller-Hohagen schreibt in seinem Buch Verleugnet, verdrängt, verschwiegen, die NS-Zeit sei zwar »historisch intensiv erforscht worden, doch auf psychologischem Gebiet liegt immer noch vieles im Dunklen«. Es sei auch nötig, sich mit den psychologischen Folgen der damaligen Zeit für die Menschen heute zu beschäftigen.
Wie aber könnte ich hier vorgehen? Vielleicht wäre es eine Idee, eine »Familienaufstellung« zu machen. Das ist ein Verfahren, bei dem man andere Leute aus einer Gruppe bittet, die eigenen Familienmitglieder zu verkörpern. Ich könnte auch mit Nachkommen von Holocaust-Opfern sprechen, wie sie auf sich und auf mich schauen. Ohnehin nehme ich mir vor, die Opfer immer wieder in den Blick zu nehmen, weil es letztlich um sie geht und auch weil ich der leider verführerischen Faszination für Täter nicht erliegen möchte. Und dann fällt mir noch ein Psychoanalytiker ein, den ich schon mal als klugen Mann erlebt habe und der schamanische Rituale begleitet. Der Mann hatte mir gesagt, es sei möglich, in einem magischen Verfahren, dessen Wirkungsweisen ich nicht ganz verstanden habe, den eigenen Vorfahren zu begegnen und deren Botschaften entgegenzunehmen.
Soll ich so etwas auch machen? Mich mit Spuk beschäftigen? Ist es Spuk, oder ist es eine sinnvolle Methode aus einer anderen Kultur? Vielleicht wäre es sogar nötig, unseren Kulturkreis zu verlassen, um eine ungewohnte Perspektive auf unser so deutsches Thema einzunehmen?
Ich möchte bei meiner Recherche jedenfalls auf eine Weise vorgehen, die andere Menschen auf der Suche nach ihren Vorfahren in etwa übernehmen könnten. Natürlich hatte mein Großvater als Chemiker eine spezielle Geschichte, aber wenn jemand beispielsweise von einem Großvater abstammt, der in der Wehrmacht gekämpft hat, dann kann er sich genauso, wie ich es nun vorhabe, an das Bundesarchiv wenden: Wenn der Name und das Geburtsdatum bekannt sind, dann kann man dort versuchen herauszufinden, in welcher Einheit die Person gekämpft und was diese Einheit an bestimmten Orten gemacht hat.
Die Geschichten unterscheiden sich, aber die Wege, an sie heranzukommen, sind oft ähnlich.
Und ich glaube wirklich, dass es nötig ist, dass noch viele Geschichten aus der NS-Zeit entdeckt werden. Es geht bei einer solchen Suche nicht nur um uns selbst und nicht nur um unsere eigenen Zeitgenossen und Nachkommen, die wir vielleicht davor bewahren wollen, unsere unbewussten seelischen Lasten mitzutragen. Ich glaube, es geht auch um unsere Verantwortung den Menschen gegenüber, die wir gar nicht kennen, den Menschen, die wir »Allgemeinheit« nennen oder »Gesellschaft«.
Denn wir haben doch diese Verantwortung für die Zeitläufte, in denen wir leben. Wir sehen um uns herum nicht nur Fortschritte, sondern auch Rückschritte, eine Erosion der Demokratien, ein Wiedererstarken der Autoritären, eine Rückkehr der Kriege in Regionen, in denen es lange schon keine Kriege mehr gab, und nicht enden wollende Kriege in anderen Regionen. Wir sehen alte Formen des Antisemitismus zurückkehren und neue entstehen.
Wir können das als Einzelne nicht aufhalten, aber wir können unsere eigenen Einstellungen korrigieren, indem wir uns unserer selbst bewusster werden. Denn wenn wir uns und unsere Herkunft kennen, fällt es uns leichter, uns ein Urteil zu bilden über die Welt um uns herum.
Außerdem kann der Abstand, den wir zu historischen Ereignissen haben, nützlich sein. Es ist dadurch besser möglich, Fragen zu beantworten, die auch heute relevant sind: Wie entstehen Kriege? Wie entstehen Diktaturen? Und welche Verantwortung tragen Einzelne?
Wo wir stehen
Das alles sind Gedanken, die weit über den Fall meines Großvaters hinausreichen. Bevor ich seine Spur weiterverfolge, möchte ich erst einmal versuchen zu begreifen, wo wir als Deutsche insgesamt beim Thema Nationalsozialismus stehen.
Eine der ersten großen Debatten zum Thema Schuld und Verdrängung haben die beiden Psychoanalytiker Alexander und Margarete Mitscherlich in den 1960er Jahren angestoßen. Sie attestierten den Deutschen in ihrem gleichnamigen Buch eine »Unfähigkeit zu trauern«. Sie lagen damit, jedenfalls aus heutiger Sicht, richtig. Die Mitscherlichs bedauerten damals, dass die Deutschen nicht in der Lage seien, um ihr »Ich-Ideal« zu trauern, das ihnen in der unmittelbaren Nachkriegszeit abhandengekommen sei – dann nämlich, als die NS-Verbrechen nicht mehr zu leugnen waren. Also hätten die Deutschen ihren eigenen Anteil an den Verbrechen verdrängt.
Ab den achtziger Jahren aber entwickelte sich das, was heute Erinnerungskultur an die Nazi-Verbrechen genannt wird. Doch parallel dazu zeigte sich, dass viele Deutsche immer noch nicht wahrhaben wollten, was in der NS-Zeit passiert ist.
Im Jahr 1995 eröffnete das Hamburger Institut für Sozialforschung die Ausstellung »Verbrechen der Wehrmacht«. Sie zeigte, dass Wehrmachtssoldaten am Holocaust und an den Massenmorden an Zivilisten beteiligt waren. Vertriebenenverbände protestierten. Rechtsextremisten verübten Anschläge auf die Ausstellung oder versuchten es. Verbände ehemaliger Wehrmachtssoldaten lehnten sie rundweg ab. Die Ausstellung wurde noch einmal überarbeitet, Jan Philipp Reemtsma selbst, der Gründer und damalige Direktor des Hamburger Instituts für Sozialforschung, nahm das in die Hand, und seine Ergebnisse hatten vor der Forschung Bestand: Es konnte nicht mehr geleugnet werden, dass die deutsche Wehrmacht in NS-Verbrechen einbezogen war.
2002 erschien dann die Studie »Opa war kein Nazi«, die ein Team um den Sozialpsychologen Harald Welzer erstellt hat. Sie beschrieb, dass Familien selten wahrhaben wollten, was ihre Vorfahren in der NS-Zeit getan haben. In den Geschichten, die sie sich erzählten, würden aus »Antisemiten Widerstandskämpfer«. Die Studie bestätigte, was die Reaktionen auf die Wehrmachtsausstellung ein paar Jahre davor schon gezeigt hatten: dass die Wahrheit schwierig zu ertragen ist.
2018, ganze 16 Jahre später, kam das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld in einer eigenen Studie immer noch zu ähnlichen Ergebnissen. Die »Memo-Studie« untersuchte, wie Familien sich an die Rolle ihrer Vorfahren in der NS-Zeit erinnern. Nur 17,6 Prozent der Befragten gaben zu, dass unter ihren Vorfahren Täter waren.
2020 gab die Wochenzeitung Die Zeit eine repräsentative Umfrage in Auftrag. Auf die Frage »Wie stand Ihre Familie seinerzeit zum Nationalsozialismus?« antworteten 30 Prozent der Befragten mit »Gegner«, mehr als ein Drittel wusste keine Antwort, nur jeder Fünfte entschied sich für Mitläufer, nur drei Prozent aber bezeichneten den eigenen Vorfahren als »Befürworter des Nationalsozialismus«.
Da scheint sich also etwas festgesetzt zu haben bis in die heutige Zeit. Die überragende Mehrheit der Deutschen ist sich zwar der Verbrechen des Nationalsozialismus inzwischen bewusst, aber das Wissen bleibt offenbar eher abstrakt. Einen – jetzt kommt dieser Ausdruck wieder – »blinden Fleck« scheint es noch zu geben, und der liegt in der eigenen Familiengeschichte. »Nur eine kleine Minderheit ist in Deutschland bereit anzuerkennen, dass die eigenen Verwandten an Verbrechen beteiligt waren«, schreibt auch der Historiker Oliver von Wrochem noch 2023 in seinem Aufsatz: »Ein Täter, Mitläufer, Zuschauer, Opfer in der Familie?«
Es ist schon merkwürdig, dass sich hier so wenig tut. An der Buchbranche liegt es nicht. Viele Autorinnen und Autoren haben sich mit der eigenen Familiengeschichte befasst und Bücher darüber geschrieben, in denen sie anerkennen, was ihre Vorfahren getan haben. Ich habe einen ganzen Stapel bei mir zuhause liegen, möchte aber, weil es sonst hier zu viel würde, nur zwei nennen: Der Schriftsteller Uwe Timm, geboren im Jahr 1940, veröffentlichte 2003 die autobiografische Erzählung Am Beispiel meines Bruders über seinen älteren Bruder, der als Mitglied der Waffen-SS Tagebuch geführt hat. Die Publizistin Alexandra Senfft, Enkelin von Hanns Ludin, Hitlers Gesandtem in der Slowakei, der für den Tod von über 60 000 deportierten Juden verantwortlich war, findet in ihrem 2007 veröffentlichten Buch Schweigen tut weh eine Erklärung für den »schleichenden Selbstmord« von dessen Tochter, ihrer Mutter. Sie konnte offenbar die Schuld ihres Vaters nie eindeutig annehmen und ging daran seelisch zugrunde. Sie hatte Depressionen, sie trank, eines Tages stürzte sie, vermutlich betrunken, in kochend heißes Badewannenwasser und starb an den Verbrühungen.
Nun sind das Werke von Nachkommen, deren Vorfahren in der NS-Zeit dann doch recht eindeutigen Aufgaben nachgingen. Aber es waren viel mehr Menschen für den Erfolg des Nationalsozialismus mitverantwortlich als die Haupttäter – und zwar um ein Vielfaches mehr Menschen als die drei Prozent, die in der Umfrage der Zeit bei ihren Nachkommen als »Befürworter« galten: Bei den Reichstagswahlen am 5. März 1933 wählten 43,9 Prozent der Wahlberechtigten die NSDAP. 1945 war jeder fünfte erwachsene Deutsche, insgesamt 8,5 Millionen Menschen, Mitglied der Partei. Und die NSDAP nahm nicht jeden. Die Führung der Partei wollte überzeugte Mitglieder, sie fürchtete »Konjunkturritter«, wie sie es nannte. Sie prüfte sorgfältig die Anträge und weigerte sich vier Jahre lang, von April 1933 bis April 1937, überhaupt neue Mitglieder aufzunehmen. Sie hob die Aufnahmesperre erst im Mai 1939 ganz auf. Deswegen ist die Zahl 8,5 Millionen hoch, sehr hoch. Und allein in die Wehrmacht wurden 17 Millionen Soldaten eingezogen. Sie gingen da nicht freiwillig hin, das stimmt natürlich, wenn aber zwar nicht alle, aber doch viele von ihnen an NS-Verbrechen und den Massenmorden an Zivilisten beteiligt gewesen sind, wie die Wehrmachtsausstellung belegte, dann haben eben auch entsprechend viele Deutsche Vorfahren – vielleicht nähere, vielleicht fernere –, die möglicherweise schwere Schuld auf sich geladen haben.
Und Deutsche mussten weder der Partei noch der Wehrmacht angehört haben, um auf eigene Weise mitverantwortlich zu sein für das, was im Nationalsozialismus geschah. Wenn Verbrechen vor aller Augen stattfinden, stellt sich immer auch die Frage, ob und inwiefern schon die Augenzeugenschaft als Mittun gewertet werden sollte. Deportationen gab es an vielen Orten. Wer es in der eigenen Straße nicht sah, konnte sehr wohl mitbekommen, wie Jüdinnen und Juden an Bahnhöfen zusammengetrieben wurden, um sie in Konzentrationslager zu bringen. Und nein, Konzentrationslager lagen nicht »irgendwo im Osten«, wie es oft heißt, sondern viele standen auf dem Gebiet des Deutschen Reichs. Zwischen 1936 und 1945 gab es in Europa insgesamt 24 Hauptlager – und über 1000 Außenlager. Ja, wirklich: über 1000.
Auch eine andere Zahl ist wichtig: Mehr als 13 Millionen Menschen mussten in der NS-Zeit Zwangsarbeit leisten. Sie mussten in Fabriken, auf Baustellen, in Handwerksbetrieben, auf Höfen, in Haushalten schuften, sie waren moderne Sklaven. Deswegen war es rechnerisch kaum möglich, in Deutschland zu leben und nie einem oder einer von ihnen zu begegnen.
Wie man es auch dreht und wendet: Die allermeisten Deutschen der NS-Zeit waren mindestens Mitwisser von Verbrechen. Der Historiker Peter Longerich schreibt in seinem Buch »Davon haben wir nichts gewusst!« Die Deutschen und die Judenverfolgung 1933 – 1945, das Regime habe die deutsche Bevölkerung absichtlich zu »Zeugen und Mitwissern des Massenmordes an den Juden« gemacht, damit sie sich vor einer Niederlage und deswegen auch vor Rache fürchteten. Als in der zweiten Kriegshälfte absehbar war, dass sie den Krieg verlieren würden, traten die Deutschen, so Longerich, die »Flucht in die Unwissenheit« an.
Für viele war es offenbar eine Flucht ohne Wiederkehr.
Der Berliner Historiker Johannes Spohr recherchiert im Auftrag von Nachkommen, was deren Vorfahren in der NS-Zeit gemacht haben. Er hat sich inzwischen mit so vielen Familiengeschichten beschäftigt, dass er allgemeine Aussagen darüber treffen kann, wie über das NS-Geschehen in Familien gesprochen wurde und wird. Im Oktober 2023 hielt er in der Gedenkstätte Topographie des Terrors in Berlin einen Vortrag über »Familiengeschichte(n) im Nationalsozialismus«. Er beschrieb darin, wie die Angehörigen der NS-Generation nach dem Krieg dafür sorgten, dass nicht nach ihrem Anteil an den Verbrechen gefragt wurde. Sie hätten Loyalitäten erzwungen, Kommunikation unterbrochen, Schweigen eingefordert, eigene Versionen der Geschichte verbreitet – und sie hätten »das materielle Erbe« gehütet.
Mit anderen Worten: Wenn Nachkommen ungebetene Fragen stellten, riskierten sie unter anderem ihr Erbe.
Die Folgen für die heutige Zeit benennt Spohr: »In der Summe lässt sich schlussfolgern, dass die bundesrepublikanische Gesellschaft vielfach auf Falschaussagen und Phantasien ihrer Mitglieder aufbaut.«
Es flogen gerade auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder Menschen auf, die behaupten, jüdische Vorfahren zu haben, obwohl das nicht stimmt. Einer wurde Vorstand einer jüdischen Gemeinde in Norddeutschland. Eine betrieb einen Blog, in dem sie davon erzählte. Einer beglaubigte als freier Journalist damit seine Kritik an der israelischen Regierung. Wollten manche dieser Leute mit solchen Lügen Schmerzen und Scham umgehen? Denn es kann beschämend und schmerzhaft sein, für möglich zu halten, dass die eigenen Vorfahren an Verbrechen wie Mord, Totschlag, Folter, Menschenversuch, Vergewaltigung, Verrat, Raub und Bereicherung beteiligt waren.
Schmerzen und Scham bedingen sich hier, denn wenn wir eingestehen müssen, dass der eigene Vorfahr möglicherweise an Verbrechen beteiligt gewesen ist, riskieren wir, von anderen verachtet zu werden.
Und wir wollen nicht verachtet werden und anderen keine Anlässe bieten, uns zu verachten, denn wir Menschen sind soziale Wesen, wir können ohneeinander nicht leben, wir sind darauf angewiesen, zu einer Gemeinschaft zu gehören und von ihr auch akzeptiert zu werden.
Ich erinnere mich an einen Kommentar, den ich einmal im SPIEGEL veröffentlicht habe. Darin wies ich darauf hin, dass die Mehrheit der Deutschen Verwandte habe, die in der NS-Zeit schuldig geworden seien. Von den meisten Reaktionen, die dann kamen, war ich nicht überrascht. Es waren E-Mails, in denen mir Leserinnen und Leser beschrieben, was die eigenen Eltern während der NS-Zeit alles durchgemacht und warum sie mit den Verbrechen nichts zu tun gehabt hätten.
Von einer Mail war ich aber dann doch überrascht, vor allem allerdings von meiner eigenen Reaktion darauf. Ein Leser beschimpfte mich als »Nazi-Susi«. Nie zuvor war mir unterstellt worden, ich hätte etwas mit Nazis zu tun (übrigens hat mich auch niemand je Susi genannt). Für einen Moment bereute ich, diesen Kommentar überhaupt geschrieben zu haben. Ich sprach auf den Leser ein, obwohl der gar nicht da war. Ich stellte mir aber vor, er säße mir gegenüber. In meinem stummen Monolog erzählte ich ihm von meinem anderen Großvater und dessen vorzeigbarer Geschichte in der NS-Zeit.
Als ich fertig war, merkte ich, dass der Leser erreicht hatte, was er vermutlich hatte erreichen wollen, indem er von sich selbst weg und dann auf mich zeigte: Ich schämte mich. Und er fühlte sich wahrscheinlich überlegen.
Doch so gern wir auch auf andere Menschen zeigen: Diejenigen unter uns, deren Familien in NS