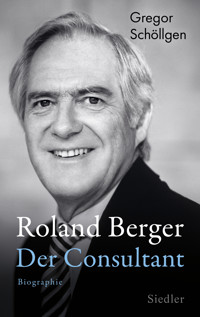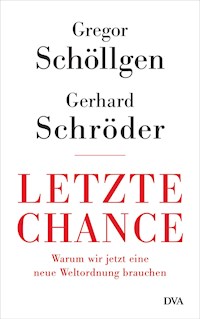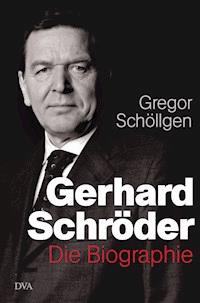5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Konflikte der letzten 100 Jahre – wie sie entstanden, wie sie miteinander zusammenhängen, wie sie weiterwirken
Wer die komplexe und konfliktreiche Gegenwart begreifen will, muss die Vergangenheit verstehen. Die Geschichte der letzten 100 Jahre ist die Geschichte miteinander verbundener, weltumspannender Kriege. Der namhafte Historiker Gregor Schöllgen schildert anschaulich die wichtigsten Konflikte und Konfliktlinien, die das Geschehen auf der Welt bis heute bestimmen. Ausgehend von der Russischen Revolution 1917, die die Grundlage für die globalen Auseinandersetzungen der folgenden Jahrzehnte legte, beschreibt er die vielfältigen Gesichter des Krieges: Revisionen und Interventionen, Raub und Annexion, Säuberung und Vernichtung, Flucht und Vertreibung bis in unsere Tage. Zeitweilig fror der Kalte Krieg die alten Konflikte der nördlichen Halbkugel ein, die Kriege fanden anderswo statt. Damit ist es vorbei. Kriegerische Auseinandersetzungen sind uns allen wieder näher gerückt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Buch
Wer die Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit in den Blick nehmen. Und wer die vergangenen hundert Jahre in den Blick nimmt, sieht eine Geschichte der Kriege. Gregor Schöllgen, einer der führenden deutschen Historiker, spürt dieser Geschichte nach. Ausgehend von der russischen Oktoberrevolution, mit der 1917 alles begann, beschreibt er die vielfältigen Gesichter dieses hundertjährigen Krieges: Revision und Intervention, Raub und Annexion, Säuberung und Vernichtung, Flucht und Vertreibung. Auf der nördlichen Halbkugel fror der Kalte Krieg den heißen Krieg für ein halbes Jahrhundert ein. Die Kriege fanden anderswo statt. Damit ist es nun vorbei. Im Krieg ist die Welt wieder vereint.
Zum Autor
Gregor Schöllgen, Jahrgang 1952, lehrte bis 2017 Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Erlangen. Er war Gastprofessor in New York, Oxford und London und überdies jahrzehntelang für die historische Ausbildung der deutschen Diplomaten verantwortlich. Er ist Mitherausgeber der Akten des Auswärtigen Amtes, konzipiert historische Ausstellungen und Dokumentationen, schreibt für Presse, Hörfunk und Fernsehen und ist Autor zahlreicher populärer Sachbücher und Biographien. Zuletzt erschien bei der DVA seine große Biographie Gerhard Schröders.
GREGOR SCHÖLLGEN
KRIEG
HUNDERT JAHRE WELTGESCHICHTE
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. AuflageCopyright © 2017 Deutsche Verlags-Anstalt, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHAlle Rechte vorbehaltenLektorat und Satz: Ditta Ahmadi, BerlinGesetzt aus der Adobe Jensen ProBildbearbeitung: Aigner, BerlinUmschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenUmschlagmotiv: © Martyn Aim/Redux/laif ISBN 978-3-641-21256-8V001www.dva.de
Inhalt
PROLOGRückblick in die Gegenwart
1 Putsch
2 Revision
3 Säuberung
4 Vernichtung
5 Blitz
6 Teilung
7 Intervention
8 Guerilla
9 Prävention
10 Mord
11 Terror
12 Flucht
13 Raub
14 Annexion
BILANZHundert Jahre Weltgeschichte
Nachwort
ANHANG
Anmerkungen
Personenregister
Geographisches Register
PROLOGRückblick in die Gegenwart
Die Gegenwart ist eine Zumutung. Sie wartet nicht auf uns. Sie stemmt sich gegen ihre Entzifferung. Zu komplex, zu vielschichtig, zu undurchsichtig sind die zeitgleich ablaufenden Vorgänge. Will man sie entschlüsseln, hat man nur eine Chance: Man muss die Vergangenheit in den Blick nehmen. Wer das tut, findet sich unvermittelt in der Gegenwart wieder. Denn die erinnert frappierend an jene drei Jahrzehnte zwischen dem Ausbruch des Ersten und dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Völker und Staaten der Erde versuchten, ihre historisch gewachsenen Konflikte mit buchstäblich allen Mitteln zu lösen. Mit dem Ende des zweiten dieser verheerenden Kriege gelangten sie 1945 – dezimiert und verwundet, ernüchtert und erschöpft – zu der Einsicht, dass sich ihre Gegensätze so nicht aus der Welt schaffen ließen.
Also blieben sie in der Welt – ungelöst und um neue vermehrt. Allerdings war die Menschheit nach dem monströsen letzten Krieg nicht mehr in der Lage, einen neuerlichen Waffengang von unbestimmter Länge zu wagen. Zudem zeichnete sich seit dem Abwurf von zwei Atombomben im August 1945 eine neue Dimension der Vernichtung ab. Daher einigten sich Sowjets und Amerikaner – noch vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs und stellvertretend auch für andere – informell auf einen Waffenstillstand.
Er hielt beinahe 50 Jahre. Denn in Washington ahnte und in Moskau wusste man, dass eine Aufkündigung dieser Übereinkunft unweigerlich in die alten Konfliktlagen zurückführen musste. Dass einer der beiden Vertragspartner einmal ohne jede Vorankündigung und zudem noch mehr oder weniger geräuschlos aus der Weltgeschichte verschwinden könnte, kam niemandem in den Sinn. Mit der Implosion der Sowjetunion trat aber 1991 genau dieser Fall ein. Damit war der 1945 geschlossene Waffenstillstand hinfällig.
Besonders hart traf diese fundamentale Erschütterung der alles in allem bewährten Lage die Russen. Denn mit der Implosion der Sowjetunion fanden sie sich im Dezember 1991 dort wieder, wo sie gewesen waren, als die Bolschewiki im Oktober 1917 die Macht an sich gerissen und wenig später – geschlagen und gedemütigt – beim deutschen Kriegsgegner um Frieden nachgesucht hatten.
Wenige Ereignisse haben sich im russischen Bewusstsein so tief festgesetzt wie das Trauma von 1917. Zugleich hat kein zweites vergleichbares Ereignis das Weltgeschehen so tief und so nachhaltig beeinflusst wie der Putsch der Bolschewiki mit seinen mittelbaren und unmittelbaren Folgen. Die Bolschewiki waren nämlich die Ersten in der neueren Geschichte, die nicht nur einem lokalen, regionalen, nationalen oder internationalen Gegner den Krieg erklärten, sondern der Welt. Das lag an ihrem Anspruch, diese Welt nicht nur revolutionieren zu wollen, sondern sie revolutionieren zu müssen, wenn sie überleben wollten. Seither haben viele andere den Weg der Bolschewiki eingeschlagen, von denen die meisten gar nichts mit ihnen zu tun haben wollten. Die Putschisten von Sankt Petersburg ahnten nicht, dass sie Weltgeschichte schreiben würden. Aber sie taten es.
Mit diesem folgenreichen Kapitel beginnt das Buch. Es ist keine umfassende Geschichte der Weltpolitik eines Jahrhunderts. Die würde Bände füllen. Es ist das Porträt einer Welt, die seit 100 Jahren am Abgrund steht. Auch während des Kalten Krieges war das nicht anders. George Orwell, der ein schonungsloses Bild des bolschewistischen Terrors gezeichnet hatte, sprach im Oktober 1945 erstmals davon, dass mit dem Abwurf der beiden Atombomben ein »Kalter Krieg« begonnen habe. Und er sagte vorher, dass ein Friede kommen werde, »der kein Friede ist«.1 Tatsächlich wurde der Waffenstillstand 1945 lediglich für einen Teil der Welt geschlossen. Nur die nördliche Hälfte des Globus – Europa, Nordamerika, außerdem einige Gebiete des pazifischen Raums – blieb während des folgenden halben Jahrhunderts vom heißen Krieg verschont.
Hingegen hat die südliche Halbkugel – oder die »Dritte Welt«, wie man sie damals nannte – auch in dieser Epoche Dutzende von Kriegen aller Art gesehen: Dekolonisierungs- und Befreiungskriege, Bürger- und Guerillakriege, Grenz- und Rohstoffkriege, Staaten- und Stellvertreterkriege – und mit ihnen Genozid und Ökozid, Flucht und Vertreibung, Hunger und Elend. Auch davon wird in diesem Buch berichtet. Nicht zuletzt weil der Norden nach 1945, wenn irgend möglich, die Augen vor dem verschloss, was dort vorging, weil er zudem eskalierende Konflikte gegebenenfalls an die südliche Peripherie verlagerte, dort band und durch andere austragen ließ, war auch der Kalte Krieg der Jahre 1945 bis 1991 ein Weltkrieg. Der dritte in Folge.
Er formte die Brücke zwischen dem Zeitalter der klassischen, weitgehend nationalen Kriege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und unserer Epoche der zunehmend transnationalen Krisen, Kriege und Konflikte. Ihre Begleiterscheinungen und ihre Folgen verschonen heute buchstäblich keinen Winkel der Erde. Auch nicht die nördliche Halbkugel. Denn die Konfliktpotentiale, die bis 1945 vor allem durch die Kolonialmächte auf der südlichen Halbkugel angelegt worden sind und nach 1945 als »Dritte Welt« ein Eigenleben entwickelt haben, sind ja 1991 mit dem Ende des Kalten Krieges nicht verschwunden. Im Gegenteil. Sie gehen jetzt eine Verbindung mit jenen Konflikten des Nordens ein, die 1945 eingefroren wurden und seit 1991 wieder aufgebrochen sind.
Wer diese komplexe Lage entschlüsseln will, muss sich ihr gleichermaßen chronologisch und systematisch nähern. Chronologisch deshalb, weil sich, so banal es klingt, heutige Geschehnisse durch frühere erklären lassen, nicht aber umgekehrt. Andererseits trägt die systematische Annäherung an den Komplex, die sich in den Kapitelüberschriften spiegelt, einem unabweisbaren Befund Rechnung: Viele Ereignisse und Entwicklungen – Revision und Intervention, Raub und Annexion, Säuberung und Vernichtung, Flucht und Vertreibung – ziehen sich wie rote Fäden durch die vergangenen 100 Jahre.
Dass manche Themen nicht in eigenen Kapiteln abgebildet werden, heißt nicht, dass sie aus dem Blick geraten. Die Zerstörung der Umwelt oder auch der Kampf um ihre Erhaltung, der Krieg um oder der Raub von natürlichen Ressourcen und andere Prozesse und Entwicklungen werden dort in den Blick genommen, wo sie Einfluss auf das Weltgeschehen genommen haben. Diese Linien in ihrem inneren zeitlichen und kausalen Zusammenhang nachzuzeichnen, ist unerlässlich, wenn es an die Entschlüsselung der Gegenwart geht. Das gilt für den Zeitpunkt, und es gilt für die Orte des Geschehens. Denn die Gegenwart lässt sich nicht mit einem geographisch verengten Rückblick entziffern. Deshalb richtet sich der Blick jeweils auf die Weltgegenden, in denen markante Entwicklungen eine geschichtsmächtige Verdichtung erfahren haben. So zum Beispiel der Nahe Osten im Falle des Präventivkrieges, China, Vietnam, Kambodscha oder auch Afghanistan im Falle des Guerillakrieges, Mittel- und Südamerika im Falle der Intervention oder Zentralafrika am Beispiel des mehr als zwanzigjährigen Mordens, das 1994 mit dem Genozid in Ruanda begann. Dass dieses Morden als der »erste afrikanische Weltkrieg« in die Geschichte eingegangen ist, zeigt, dass wir die Vergangenheit sehen, wenn wir uns in der Gegenwart umschauen.
KAPITEL 1PUTSCH
Tanz der Putschisten. Deutsche und russische Soldaten feiern Mitte Dezember 1917 den Waffenstillstand. Sie ahnen nicht, dass die kommenden Jahrzehnte alles Zurückliegende in den Schatten stellen werden.
© Süddeutsche Zeitung Photo: Scherl
Sie waren wenige. Ihre Führer lebten im Exil. Die allermeisten Russen, die durchweg auf dem Land hausten, hatten nie von ihnen gehört. Aber die Bolschewiki hatten ein Ziel, und sie hatten Wladimir Iljitsch Lenin, der sie mit eisernem Willen und konzentrierter Entschlossenheit zu diesem Ziel führte. So wagten sie in der Nacht auf den 7. November 1917 den Putsch. Als »Oktoberrevolution« ging er in die Geschichte ein, weil man nach russischem, dem julianischen Kalender den 25. Oktober schrieb. Die Umstellung auf den sonst in Europa gebräuchlichen gregorianischen Kalender zum 1. Februar 1918 gehört zu den frühen Entscheidungen der Bolschewiki.
Kein anderer Putsch der jüngeren Geschichte hat derart weitreichende Verwerfungen gezeitigt wie dieser. Es war das erste Mal, dass ein Akteur nicht nur einem lokalen, regionalen, nationalen oder internationalen Gegner den Krieg erklärte, sondern der Welt. Seither hat es keinen universellen Frieden mehr gegeben.
Für Lenin und seine Leute stand von Anfang an fest, dass die russische nur der Beginn der Weltrevolution sein könne. Und diese wiederum musste eher früher als später ins Werk gesetzt werden, weil nur durch den weltweiten Umsturz auch die russische Revolution auf Dauer zu sichern war. Lenin wusste immer schon: Scheitern die Bolschewiki in der westlichen Welt, ist ihnen insbesondere in Deutschland kein rascher, umstürzender Erfolg beschieden, wird über kurz oder lang auch das russische Modell des Sozialismus beziehungsweise Kommunismus am Ende sein.
Mit dieser radikalen, offensiven Zielsetzung katapultierten sich die Bolschewiki zwangsläufig in die Rolle eines Gegners. Sofern man sie beim Wort nahm, und das tat man bald. Wer nicht von ihnen überrollt werden wollte, musste sie bekämpfen – an jedem Ort und mit allen Mitteln: Die »Sowjets« waren der Feind. Man nannte die Bolschewiki so, weil sie zunächst in den Arbeiter- und Soldatenräten, den Sowjets, die Macht an sich gerissen und von dort aus auf nationaler Ebene konsequent ausgebaut hatten. Schon am 12. März 1918 hatten sie Moskau zur Hauptstadt erklärt, seither residierten ihre Führer im Kreml, der vormaligen Moskauer Residenz der Zaren. Am 30. Dezember 1922 war mit der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken das staatliche Fundament für ihre weltrevolutionäre Mission gelegt.
Das ist ein Grund, warum der Krieg in der Welt und die Welt im Krieg blieb. Die Sowjets konnten ihr Ziel, die Welt zu revolutionieren, nicht aufgeben, weil sie damit ihre Legitimation infrage gestellt hätten. Und die anderen konnten dieses Ziel nicht ignorieren, weil sie damit ihre Freiheit riskiert hätten. Enden konnte dieser Krieg nur, wenn sich die anderen geschlagen gaben oder die Sowjetunion die Weltbühne verließ. Dass sie 1991, sieben Jahrzehnte nach ihrer Gründung, tatsächlich implodierte, war für nicht wenige Russen zu unfassbar und ungerecht, zu demütigend und beängstigend, als dass sie sich damit hätten abfinden wollen. Also machten sie sich an die Wiederherstellung des Zerbrochenen. Und weil das nicht gewaltfrei möglich war, wurde der Kalte Krieg auch in diesem Teil der Welt jetzt wieder heiß geführt.
Zur bitteren Ironie gehört, dass sich die Sowjetunion von ihrem ersten bis zu ihrem letzten Tag in einer Situation erheblicher, mitunter bedrohlicher innerer Schwäche befand. Diese Schwäche zu kaschieren und sich so vor einem vernichtenden Angriff überlegener Gegner zu schützen, war eines der obersten Ziele sowjetischer Hochrüstungspolitik, auch in der Zeit des Kalten Krieges. Da die Rüstung Ressourcen band und verschlang, verschärfte sie den maladen Zustand noch und trug so eher zum Untergang des Ganzen bei. Michail Gorbatschow, letzter Präsident der Sowjetunion, bis auf wenige Tage letzter Generalsekretär ihrer Kommunistischen Partei und Totengräber der einen wie der anderen, hat später berichtet, dass sich die Ausgaben für das Militär auf 40 Prozent des Staatshaushalts beliefen und »buchstäblich allen Zweigen der Volkswirtschaft die Lebenssäfte« entzogen.1 In den frühen Epochen der Sowjetunion dürfte der Prozentsatz eher noch höher gewesen sein.
Nicht dass sich das alte, das zaristische Russland, bis es in der Oktoberrevolution endgültig unterging, in einer stabilen Verfassung befunden hätte, im Gegenteil: Die innere Schwäche des riesigen Landes gehörte zu den Konstanten der europäischen Geschichte. Sie war ursprünglich auch ein entscheidender Grund, warum die Putschisten Ende Oktober 1917 die Kontrolle über die wichtigsten Machtzentren im Handstreich erobern und allen widrigen Umständen zum Trotz dauerhaft sichern konnten.
Im Vergleich mit England und Deutschland, mit Frankreich und selbst mit Italien war das russische Zarenreich ein rückständiges Land, und das in praktisch jeder Hinsicht. Gewiss, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte es Bewegung gegeben. 1861 war die Leibeigenschaft aufgehoben, drei Jahre später die Justiz reformiert worden. Seit 1906 gab es – erstmals in der russischen Geschichte – eine Verfassung und ein Parlament, und die Industrialisierung des Landes machte bis zum Ausbruch des großen Krieges im Sommer 1914 bemerkenswerte Fortschritte, jedenfalls dann, wenn man die Entwicklung am äußerst bescheidenen Ausgangsniveau maß.
Allerdings kamen die Anstöße in der Regel von außen. Sie wurden den Zaren aufgezwungen, vor allem durch schwere militärische Niederlagen wie diejenigen im Krimkrieg der Jahre 1853 bis 1856 oder im Krieg gegen Japan, der 1905 für Russland in einer Katastrophe endete. Viele Errungenschaften wurden auch bald wieder zurückgenommen und verboten, so im Juni 1907 die gerade erst gegründeten Gewerkschaften und die revolutionären Parteien. Unter ihnen auch die radikalere Mehrheitsfraktion der 1898 ins Leben gerufenen Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, die seit der Spaltung von 1903 als »Bolschewiki« firmierte. Die knapp unterlegene Minderheitsfraktion der »Menschewiki« sollte während des Bürgerkrieges zu ihren Gegnern zählen.
Der Ausbruch des großen Krieges im Sommer 1914 gab dem politischen wie dem wirtschaftlichen Frühling dann den Rest. Dabei stand Russland ursprünglich auf der richtigen Seite. Denn nicht Zar Nikolaus II. hatte den Krieg begonnen, sondern sein Vetter Wilhelm II., der deutsche Kaiser und König von Preußen, hatte Russland am 1. August 1914 den Krieg erklärt und so dafür gesorgt, dass sich die Großmächte Frankreich und England auf Russlands Seite einfanden und man gemeinsam gegen Deutschland zu Felde zog. Auch militärisch schien die Gunst zunächst auf Russlands Seite zu sein, denn seine Armeen stießen tief nach Ostpreußen und Galizien vor, standen also kurzzeitig in Deutschland und Österreich-Ungarn.
Doch dann wendete sich das Blatt – auf allen Ebenen und mit einer unerhörten Dynamik, wobei nicht sicher zu sagen ist, was Ursache und was Wirkung war. Jedenfalls geriet Russland auf den Schlachtfeldern sehr bald in die Defensive und im Innern an den Rand des Zusammenbruchs: Die Versorgung großer Teile vor allem der städtischen Bevölkerung war schlicht nicht mehr sicherzustellen. Jetzt schlug die Stunde der oppositionellen und radikalen Kräfte aller Couleur, auch der Bolschewiki.
Die Bolschewiki hatten allerdings ein Problem: Ihr Anführer Lenin – Jahrgang 1870, studierter Jurist, Berufsrevolutionär und Verbannter – war nicht vor Ort, sondern im Schweizer Exil. Wie sollte er von Zürich ins russische Machtzentrum kommen? Dass ihm das gelang, dass Lenin über Deutschland, Schweden und Finnland tatsächlich im Frühjahr 1917 in der Hauptstadt eintraf, lag am Kriegsgegner Russlands, dem Deutschen Reich, und dort wiederum vor allem am Auswärtigen Amt, das diesen Coup unterstützte.
Die Diplomaten in Berlin wussten genau, was sie taten. Dort ging man nämlich davon aus, dass der Import des Agitators das explosive, revolutionäre Potential Russlands stärken und damit seine Kampfkraft im Feld schwächen werde. Ende Februar 1917 eskalierte die Lage im Zarenreich, und als sich die ersten Soldaten den revoltierenden Arbeitern anschlossen, war es um das alte System geschehen: Am 27. Februar demissionierte die Regierung, am 3. März verzichtete Zar Nikolaus II. auf den Thron, am 9. April passierte Lenin mit großem Gefolge Deutschland in Richtung Petrograd – so hieß die russische Hauptstadt Sankt Petersburg, nachdem der ursprünglich deutsche Name mit Kriegsbeginn russifiziert worden war. Nach dem Tod Lenins führte die Stadt als »Leningrad« den Namen des Revolutionsführers, und nach dem Untergang der Sowjetunion erfolgte die Wiederauferstehung als »St. Petersburg«.
Ohne die verfahrene innere Lage des Gegners wären die Deutschen sicher nicht auf die Idee gekommen, Lenin nach Russland zu transportieren. Tatsächlich wurde dieser Mann aber dann zu ihrer »Geheim- und Wunderwaffe«, zur »Atombombe des Ersten Weltkriegs«.2 Mit ihrer Hilfe gelang es Deutschland, sich auf dem Territorium Russlands einen gigantischen Einflussbereich zu sichern und etwa ein Jahr lang zu halten.
Zunächst standen allerdings die Chancen, dass ausgerechnet Lenin und seine Bolschewiki den innerrussischen Machtkampf für sich entscheiden würden, nicht besonders gut. Denn die provisorische bürgerliche Koalitionsregierung, die nach dem Sturz des Zaren ins Amt gekommen war, hielt sich auch deshalb, weil ihr prominente Vertreter des gemäßigten sozialistischen Lagers angehörten. Und diese linke Konkurrenz machte den Bolschewiki mehr zu schaffen als die alten Kräfte, gegen die sie sich zunächst gemeinsam gestellt hatten. Im Ersten Allrussischen Sowjetkongress, der Mitte Juni 1917 zusammentrat, waren die Bolschewiki eindeutig in der Minderheit, und Anfang Juli scheiterte ein Umsturzversuch so kläglich, dass Lenin nach Finnland fliehen musste.
Es war Leo Trotzki, der in den entscheidenden Tagen und Stunden des Oktobers 1917 den Putsch mit Erfolg steuerte. Er brachte es fertig, dass die ersten überfallartigen Aktionen am 24. Oktober, dass die Besetzung der Eisenbahnstationen, Brücken, Telegraphenstationen und anderer strategischer Positionen in Petrograd ohne Kampfhandlungen erfolgten und erst bei der Einnahme des Winterpalais nennenswerte Zusammenstöße gemeldet wurden. Trotzki – Jahrgang 1879, Kriegsberichterstatter, Verbannter und Emigrant – gehörte wie Karl Marx, Friedrich Engels, Mao Tse-tung und andere zu jenen radikalen Sozialisten, die sich in der Geschichte des Krieges und des Kriegshandwerks auskannten. Von März 1918 bis zu seiner Entmachtung durch Josef Stalin im Januar 1925 baute Trotzki die Rote Armee auf. Ihr verdankten zunächst die Bolschewiki die Sicherung ihrer Herrschaft im russischen Bürgerkrieg, dann die Sowjetunion ihr Überleben während des deutschen Eroberungs- und Vernichtungsfeldzugs der Jahre 1941 bis 1945.
Allerdings war der Coup des Oktober 1917 lediglich der Anfang einer gefährlichen Entwicklung. In den Wahlen zur Allrussischen konstituierenden Versammlung, die noch von der provisorischen Regierung ausgeschrieben worden waren, konnten die Bolschewiki gerade einmal ein Viertel der Stimmen holen. Daher mussten sie am 18. Januar 1918 erneut zum Mittel des Putsches greifen und diese Nationalversammlung sprengen. Was sie jetzt vordinglich brauchten, war Ruhe an allen Fronten. An der inneren wie an der äußeren. Schon am Morgen des 26. Oktober 1917 hatten die Bolschewiki – damals noch im Schulterschluss mit der linken sozialrevolutionären Konkurrenz – zwei Dekrete erlassen: über den Grund und Boden sowie über den Frieden. Das erste richtete sich mit der Aufhebung des Privatbesitzes an Grund und Boden an die aus dem Feld heimkehrenden Bauern, das zweite an die unvermindert vorrückenden Kriegsgegner, allen voran natürlich an die zentrale Macht der feindlichen Koalition, das Deutsche Reich.
Somit war Deutschland schon in der Geburtsstunde Sowjetrusslands für dessen Überleben der – alles – entscheidende Dreh- und Angelpunkt. Ohne Deutschland waren ein Waffenstillstand und der Friede nicht zu haben; gegen Deutschland war dieser Friede weder kurz- noch langfristig zu sichern; ohne den erfolgreichen Export der Revolution nach Deutschland war die Revolution auch in Russland zum Scheitern verurteilt; und ohne die technische und wirtschaftliche Unterstützung durch Deutschland konnte das revolutionäre Russland erst gar nicht auf die Beine kommen.
Genau genommen schrieb dieses Abhängigkeitsverhältnis eine Konstellation fort, die schon seit der Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 bestand. Die Reichsgründung war, von Preußen ausgehend, über den Weg dreier Kriege – gegen Dänemark, Österreich und Frankreich – durchgesetzt worden. Sie war die Antwort auf eine aus deutscher Sicht nicht länger hinnehmbare Lage. Über Jahrhunderte hinweg war das alte, das 1806 untergegangene Heilige Römische Reich Deutscher Nation das Durchzugsgebiet fremder Heere und das Schlachtfeld ihrer Kriege gewesen. Auf seine Kosten hatten die jeweiligen Großmächte der Zeit auch immer wieder zu einer Lösung bei strittigen Fragen finden können.
Für die Deutschen war das ein unhaltbarer Zustand. Ihre prekäre Lage in der Mitte Europas musste in eine stabile, aus eigener Kraft verteidigungsfähige Formation, den Nationalstaat, überführt werden. Dass die anderen das nicht ohne Widerstand hinnehmen würden, war zu erwarten, und ebenso, dass sie das Streben der Deutschen nach einer hegemonialen Stellung nicht dulden konnten. Für die Deutschen bedeutete die Hegemonie möglicherweise eine Sicherheitsgarantie, für die Nachbarn bildete sie die bedrohliche Ausgangslage für eine weit ausgreifende Eroberung.
Und so führte die nationalstaatliche Einigung Deutschlands 1871 zu einem Ergebnis, mit dem weder die einen noch die anderen wirklich leben konnten. Denn von Anfang an befand sich das Deutsche Reich in einer Lage, die man als »halbhegemonial« bezeichnet hat: als europäische Großmacht zu stark, um von den anderen ignoriert oder übersehen werden zu können, und zu schwach, um aus eigener Kraft die Hegemonie über den Kontinent errichten zu können.3
Dass diese Überlegung auch nach der Reichseinigung immer wieder einmal eine Rolle spielte, hatte seine Gründe. Zum einen galt der Krieg nach wie vor als legitimes Mittel der Politik, gewissermaßen als verlängerter Arm der Diplomatie. Und zum anderen hatte die nationalstaatliche Einigung ja nichts an der geostrategisch exponierten Lage des Landes geändert. Deutschland lag da, wo es immer gelegen hatte. Mitten in Europa. Mit acht Staaten hatte das Deutsche Reich eine gemeinsame Grenze. Darunter befanden sich mit Frankreich, Österreich-Ungarn und nicht zuletzt mit Russland drei der übrigen fünf Großmächte jener Zeit. Kein anderes vergleichbares Land der Erde war in einer solchen Lage.
Aus der Mittellage erklärte sich auch, warum die Deutschen nach 1871 immer wieder einmal mit dem Gedanken spielten, dieser Falle durch die Flucht nach vorn zu entkommen. Schon ihrem ersten Kanzler Otto von Bismarck, der bei der Reichsgründung die Regie geführt hatte, war die Vorstellung eines Präventivschlages vertraut. Und das wiederum offenbarte, dass »der höchste Triumph Bismarcks schon die Wurzeln seines Scheiterns enthielt und die Gründung des Deutschen Reiches schon den Keim seines Untergangs«.4 Denn offensichtlich war eine deutsche Großmacht dieses Zuschnitts mit dem Gleichgewicht der Kräfte in Europa nicht vereinbar.
In diesem Licht betrachtet, war auch die Reichseinigung ein Putsch, ein Angriff auf das überkommene europäische Mächtesystem. Hätte Russland in diesem entscheidenden Moment nicht stillgehalten, wäre der deutsche Putsch wohl gescheitert. So aber wurde er zu einem durchschlagenden Erfolg. Für viele Zeitgenossen war diese »deutsche Revolution« sogar »ein größeres Ereignis als die französische Revolution des vergangenen Jahrhunderts«.5 So sah es Benjamin Disraeli, produktiver Romanschriftsteller und konservativer Politiker. Disraeli war damals Oppositionsführer im britischen Unterhaus und übernahm im Februar 1874 zum zweiten Mal das Amt des Premierministers.
Nun wäre es verfehlt, würde man in der europäischen Geschichte seit der Reichsgründung eine Einbahnstraße in den großen Krieg, die »Urkatastrophe« des 20. Jahrhunderts,6 sehen. So war es nicht. Auch vor dem Sommer 1914 waren die Großmächte immer wieder einmal aneinandergeraten, ohne dass sich daraus ein Weltkrieg entwickelt hätte, etwa Engländer und Franzosen im Sudan oder Russen und Japaner in China. Seit 1908 war es den Großmächten sogar gelungen, mehrere schwere Krisen auf dem Balkan, die bis an den Rand eines großen europäischen Krieges führten, auf dem Verhandlungswege beizulegen.
Was die Deutschen im Besonderen angeht, so waren sie mit sich und mit dem, was sie erreicht hatten, lange Zeit im Reinen. Es war ja auch beachtlich und vorzeigbar. Dem spektakulären Erfolg der Reichsgründung folgten andere. Bis zur Jahrhundertwende war man – auf einigen Feldern sogar mit Abstand – die führende Wirtschaftsmacht Europas, zählte zu den stärksten Handelsnationen der Erde, hatte ein weltweit konkurrenzfähiges Bildungssystem, gehörte seit Mitte der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts zu den Kolonialmächten, und eine der schlagkräftigsten Armeen des Kontinents besaß man ohnehin.
Allerdings schienen die Nachbarn Deutschlands zusehends ihre Schwierigkeiten mit dieser atemberaubenden Karriere zu haben. So jedenfalls empfanden das die Deutschen. Im Sommer 1912 kam der deutsche Reichskanzler, Theobald von Bethmann Hollweg, gewiss kein Falke, zu dem Schluss, dass die anderen die Deutschen nicht »liebten«: »Dafür sind wir zu stark, zu sehr Parvenü und überhaupt zu eklig.«7 Das war nicht die Stimme eines Außenseiters. So dachten viele, wenn nicht die meisten. Erst recht nachdem man ihnen, wovon sie allerdings überzeugt waren, den Krieg aufgezwungen hatte.
Tatsächlich war es aber so, dass die Deutschen einiges zu ihrer zusehends unkomfortablen Lage beigetragen hatten. Großspurige Auftritte in Ton und Tat, zum Beispiel in Afrika, aber auch handfeste rüstungspolitische Aktivitäten, wie der Aufbau einer deutschen Schlachtflotte, zeitigten nicht minder handfeste Reaktionen. Vor allem brachten die Deutschen ungewollt etwas zustande, was im Lichte der europäischen Geschichte, bis es passierte, höchst unwahrscheinlich, ja geradezu revolutionär war. Zunächst Frankreich und Russland, die Gegner in den großen Kriegen am Beginn und in der Mitte des 19. Jahrhunderts, und dann sogar England und Frankreich, die weltpolitischen Erzrivalen und Gegner in etlichen Krisen und Kriegen, fanden sich zusammen und nahmen die Deutschen in die Zange. Als sich 1907 auch noch England und Russland in sensiblen weltpolitischen Fragen einigten, war die »Einkreisung« des Deutschen Reiches perfekt.
Die Deutschen wähnten sich jetzt in einer Situation, die sie in ihrem historischen Gedächtnis seit den Tagen Friedrichs des Großen als bedrohlich abgespeichert hatten. Damals, im alles entscheidenden Siebenjährigen Krieg der Jahre 1756 bis 1763, hatte man, von indirekter britischer Hilfe abgesehen, keinen Verbündeten. Jetzt hatte man immerhin Österreich-Ungarn. Die Doppelmonarchie mochte in einem beklagenswerten inneren Zustand sein und namentlich auf dem Balkan eine Politik betreiben, die den deutschen Interessen abträglich war. Aber Österreich-Ungarn durfte keinesfalls geschwächt werden oder gar in eine existentielle Krise geraten. Und eine solche bahnte sich an, nachdem Ende Juni 1914 der österreichisch-ungarische Thronfolger in Sarajevo ermordet worden war. Als die Wiener Regierung Serbien für das Attentat verantwortlich machte und Russland unzweideutig zugunsten Serbiens Position bezog, hatte die deutsche Politik kaum noch Spielräume.
In Berlin setzten sie auf den Befreiungsschlag, die Flucht nach vorn. Nicht dass man im Sommer 1914 den Krieg um jeden Preis gewollt hätte. Aber man war bereit, einen hohen Preis zu zahlen und den Krieg – sofern unvermeidlich auch gegen Russland – zu führen. Und so ließ sich die Reichsleitung auf ein hochriskantes Spiel ein. Wissend, dass die russische Regierung die serbische nicht fallenlassen konnte, provozierten sie in Berlin russische Maßnahmen in rascher Serie. Sie gipfelten am 30. Juli in der russischen Generalmobilmachung, auch gegen Deutschland. Hinter dieser deutschen Eskalationsstrategie steckte das Kalkül, dass ein offensives Russland nicht auf die Unterstützung seiner Partner würde zählen können.
Das Kalkül ging nicht auf. Und nun ging alles rasend schnell. Nachdem das Zarenreich der ultimativen Aufforderung des Deutschen Reiches, die Mobilmachung zurückzunehmen, nicht nachgekommen war, erklärte Deutschland zunächst am 1. August Russland, zwei Tage später auch dessen Bündnispartner Frankreich den Krieg und eröffnete ihn mit dem Einmarsch ins neutrale Belgien. Zu diesem riskanten Zug gab es in den deutschen Planungen keine Alternative. So wollte man einen schnellen Sieg über Frankreich herbeiführen, um sich dann ganz auf den – wie man annahm – weitaus gefährlicheren Gegner Russland konzentrieren zu können.
Als auf den Einmarsch in Belgien hin am 4. August auch England Deutschland den Krieg erklärte, fanden sich gleichsam über Nacht sämtliche europäische Großmächte, von Italien einstweilen abgesehen, auf dem Schlachtfeld wieder. Damit hatte bei Ausbruch der Krise sechs Wochen zuvor kaum jemand gerechnet. Und schon gar nicht hatte man es für möglich gehalten, dass sich dieser europäische Krieg über Jahre hinziehen und im Frühjahr 1917 mit dem Kriegseintritt der USA schließlich in einen weltumspannenden Krieg münden könnte.
Dass es dahin kam, lag vor allem am Geschehen auf dem westlichen Kriegsschauplatz. Seit die deutsche Offensive in Frankreich Mitte September 1914 ins Stocken geraten war, wurden hier zwar etliche Schlachten mit immensen Verlusten geschlagen, aber nennenswerte Fortschritte konnten weder die deutschen noch die Truppen der Gegner verbuchen. Ohne entscheidende Hilfe von außen, die nur von den USA kommen konnte, mussten die Westmächte auf Dauer ins Hintertreffen geraten. Das galt auf beiden Seiten der Front als ausgemacht.
Eine militärische Intervention der USA in Europa hielt man aber für ausgeschlossen – bis es tatsächlich dazu kam. Die konsequente amerikanische Abstinenz beruhte auf der nach ihrem Präsidenten James Monroe benannten Doktrin. Darin hatten sich dieVereinigten Staaten 1823 jedwede Intervention der Europäer in Mittel- und Südamerika verbeten, was im Gegenzug bedeutete, dass die USA sich ausdrücklich nicht in die kolonialen Angelegenheiten der Europäer und faktisch auch nicht in deren heimische Konflikte einmischen wollten.
Und dann taten sie es im Frühjahr 1917 doch und mit aller Macht. Auslöser für den Kriegseintritt gegen Deutschland waren zum einen die Wiederaufnahme des uneingeschränkten U-Boot-Krieges, dem auch amerikanische Schiffe und amerikanische Staatsbürger zum Opfer fielen, und zum anderen ein von den Briten abgefangenes Telegramm. Darin bot Arthur Zimmermann, der Chef des deutschen Auswärtigen Amtes, Mexiko – und beinahe zur gleichen Zeit auch Japan – am 19. Januar 1917 ein Bündnis an. Mit der Aussicht auf eine Rückeroberung von Texas, Arizona und New Mexico sollte der südliche Nachbar der USA zum Kriegseintritt gegen die Vereinigten Staaten bewegt werden.
Diese Maßnahmen und Aktivitäten gaben im Umfeld des amerikanischen Präsidenten jenen Kräften entscheidenden Auftrieb, die das Land im Krieg gegen Deutschland und dessen Verbündete sehen wollten. Der Kriegseintritt war kein selbstloser Akt. Mit ihm beugte Amerika auch und gewiss nicht zuletzt der Gefährdung seiner globalen Wirtschafts- und Handelsinteressen vor. Und so wurde, gewissermaßen mit deutscher Unterstützung, Woodrow Wilson – Jahrgang 1856, Ökonomieprofessor und vormaliger Gouverneur von New Jersey – zu dem Mann, in dessen Händen Deutschlands Zukunft lag. Am 6. April 1917 erklärten die Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich den Krieg und erschienen dann mit ihrer geballten militärischen Macht auf den Schlachtfeldern Frankreichs.
Vor diesem Hintergrund traten die Ereignisse auf dem östlichen Kriegsschauplatz beinahe in den Hintergrund. Dabei stellte sich die Lage hier insofern ganz anders dar, als die deutschen Truppen die anfänglichen Erfolge der russischen Armeen ins Gegenteil verkehren, erhebliche Geländegewinne verbuchen und bis Herbst 1915 große Teile des Baltikums und Polens besetzen konnten. Je länger sie diese Stellungen halten und je weiter sie dann von hier aus vorrücken konnten, umso unübersichtlicher wurde die Lage im Innern Russlands. Und je unübersichtlicher diese wurde, umso größer war die Chance, durch den Transport Lenins nach Petrograd den inneren Kollaps und mit ihm den militärischen Zusammenbruch zu beschleunigen. Im Grunde war dieses Ziel erreicht, als die Bolschewiki am 26. Oktober alter Zeitrechnung in ihrem Dekret über den Frieden den Gegnern einen sofortigen Waffenstillstand und einen »demokratischen Frieden … ohne Annexionen … und ohne Kontributionen« vorschlugen.8
Am 15. Dezember 1917 schlossen Sowjetrussland und Deutschland den Waffenstillstand. Als sich die Vertreter beider Länder, auf deutscher Seite flankiert von Vertretern der Bündnispartner Bulgarien, Österreich-Ungarn und der Türkei, sieben Tage später in Brest-Litowsk zu Friedensverhandlungen einfanden, war klar, wer in der stärkeren und wer in der schwächeren Position war. Wie ultimativ die deutsche Seite ihre Forderungen vortrug, zeigte unter anderem der wiederholte Wechsel der sowjetischen Verhandlungsführer, zu denen für einige Monate auch Trotzki zählte. Am Ende blieb den Sowjets nichts anderes übrig, als am 3. März 1918 den Vertrag und am 27. August ein Zusatzabkommen zu unterzeichnen, das ihre Lage weiter verschlechterte. Russland verlor riesige Gebiete, darunter die Ukraine, und mit ihnen ein Drittel seiner Bevölkerung sowie die Hälfte seiner Industrie. Darüber hinaus musste es erhebliche Entschädigungsleistungen erbringen.
Trotz dieses demütigenden Diktats und obgleich die deutschen Truppen auch nach Brest-Litowsk ihren Vormarsch fortsetzten, war der Pakt mit den Deutschen für Russland die beste unter lauter schlechten Alternativen. Denn die Bolschewiki standen mit dem Rücken zur Wand. Sie waren von Gegnern umstellt. Zu ihnen gehörte im Innern ein heterogenes Bündnis aus Angehörigen der alten zaristischen Armeen, liberalem Bürgertum, Menschewiki, Sozialrevolutionären und anderen Gruppen. Und von außen zogen amerikanische und japanische, englische, französische und italienische, außerdem polnische, griechische, rumänische, serbische, ja selbst tschechische Truppen, die einmal zur österreichisch-ungarischen Armee gehört hatten, gegen die Bolschewiki zu Felde. So unterschiedlich die Motive all dieser inneren und äußeren Gegner auch gewesen sein mögen, einig waren sie sich darin, wer der Gegner war: Lenin und seine Leute. Dass die Deutschen sich in dieser schier ausweglosen Situation holten, was zu holen war, aber den Machtanspruch der Bolschewiki nicht infrage stellten, hat deren Herrschaft gerettet.
So retteten die Deutschen die Revolution. Wenn man so will, kamen die deutschen Putschisten des Jahres 1871 den russischen Putschisten des Jahres 1917 zur Hilfe. 1871 hatte Russland Preußens Anspruch auf die führende Rolle in Deutschland akzeptiert. Jetzt akzeptierte Deutschland die führende Rolle der Bolschewiki in Russland. Das war schon deshalb nicht ohne Ironie, weil Lenin immer wieder erklärt hatte, dass die russische Revolution die Voraussetzung für die deutsche und die erfolgreiche Revolutionierung Deutschlands die Voraussetzung für das Überleben der Revolution in Russland sei.
Und tatsächlich deutete für einen Moment einiges auf einen bevorstehenden Erfolg der Revolution in Deutschland hin. Denn dort gab es mit der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) und dem Spartakusbund, die beide Ende 1919 zu großen Teilen in der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) aufgingen, starke Bolschewiki-affine Kräfte. Und die hatten nicht nur mittelbar einen erheblichen Anteil daran, dass am 9. November 1918 die erste deutsche Republik das Licht der Welt erblickte. Vielmehr sah es in den kommenden Wochen so aus, als könnten sie in Berlin das Heft des Handelns in die Hand bekommen und Deutschland auf den sowjetischen Weg bringen. Im April und Mai 1919 zeigte dann die Münchener Räterepublik noch einmal, was vorstellbar war.
Fasste man den Revolutionsbegriff weiter und bezog ihn nicht vornehmlich oder gar ausschließlich auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, dann musste man sogar bilanzieren, dass die Revolution in ganz Europa obsiegt hatte. Denn infolge des Weltkriegs hatte sich die politische Struktur des Kontinents derart radikal geändert, dass die Zeitgenossen die Orientierung verloren. So verschwand die Monarchie als Staatsform nicht nur in Russland, sondern auch in Österreich-Ungarn, in der Türkei und im Deutschen Reich. Dort traten im Herbst 1918 der Deutsche Kaiser und König von Preußen ab und ebenso die Monarchen aller übrigen Einzelstaaten.
Dieser revolutionäre Prozess ging mit der territorialen Auflösung oder doch Amputation der vier Großreiche einher. Und das wiederum hatte zur Folge, dass sich diese beziehungsweise die Rumpfstaaten, die von ihnen übrig blieben, an ihren Grenzen einer Reihe neuer Nachbarn gegenübersahen. Im Westen Russlands waren das Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen sowie – als Folge der Annexion Bessarabiens von Russland – ein deutlich vergrößertes Rumänien. In allen Fällen waren die neuen Grenzen umstritten, in den meisten Fällen von beiden Seiten. Davon ist im nächsten Kapitel zu berichten.
Im Herbst 1919 eröffnete einer dieser neuen russischen Nachbarn den Krieg gegen Sowjetrussland. Der polnische Staat war in der Endphase des Ersten Weltkriegs aus russischen, deutschen und österreichischen Territorien gegründet oder genauer: wieder gegründet worden. Der polnische Angriff traf die Sowjets in einer Situation, in der sie ums Überleben kämpften. Denn weder die alliierte Intervention noch der Bürgerkrieg waren beendet. Gleichwohl gelang es den Sowjets, die von Józef Piłsudski kommandierten polnischen Armeen bei Kiew aufzuhalten und bis Warschau zurückzuwerfen. Trotzki hatte vor dem Marsch auf Warschau gewarnt; Lenin, unterstützt unter anderem von Stalin, wollte ihn. Trotzki behielt recht. Die noch im Aufbau befindliche Rote Armee wurde an der Weichsel erneut zum Rückzug gezwungen, weil eine französische Militärmission den Polen zur Hilfe eilte.
Am 12. Oktober unterzeichneten die beiden völlig erschöpften Gegner einen Waffenstillstand, am 18. März 1921 folgte in Riga der Friedensschluss. Mit der Grenze, die sie vereinbarten, konnten weder Polen noch Sowjets leben. Die Frage war nicht, ob die Grenze von Riga infrage gestellt werden würde; die Frage war auch nicht, mit welchem Mittel das geschehen würde, denn das stand fest: Es war der Krieg. Die Frage war lediglich, wann das geschehen, wer als Erster losschlagen und mit welchem Partner er diesen Krieg führen würde. Beantwortet worden sind diese Fragen im Sommer 1939, als Josef Stalin mit Adolf Hitler einen Pakt einging.
So dramatisch der polnische Überfall die militärische Lage der Bolschewiki kurzfristig verschlechterte, so unschätzbar war mittelfristig sein politischer Wert. Denn jetzt waren sie es, die den russischen Boden gegen die Eindringlinge aus dem Westen, also die Polen und ihre französischen Helfershelfer, verteidigten. Dass sich vor diesem Hintergrund auch eine ganze Reihe von Offizieren der Zarenarmee in den Dienst der Roten Armee stellte und dort blieb, sprach für sich und half den Sowjets in Zeiten, die noch schwieriger sein sollten.
Und was für den Westen des Schritt für Schritt sowjetisierten russischen Rumpfreiches galt, traf auch auf seinen Osten zu. Im Westen waren es die Polen, im Osten die Japaner, die Russlands Schwäche nutzen und sich, womöglich sogar dauerhaft, in Sibirien festsetzen wollten. Dass es während der dreißiger Jahre zu einer polnisch-japanischen Annäherung zulasten der Sowjetunion kam, war für Kenner der Szene wenig überraschend. Der Konflikt zwischen Japan und Russland stand auf der weltpolitischen Tagesordnung, seit sich Nippon Mitte der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts in China festgesetzt hatte. Im Juni 1894 eröffnete Japan faktisch den Angriff auf das zwischen ihm und China umstrittene Korea. Der Verlauf des Krieges war eine Überraschung, weil die Japaner ihren Gegner militärisch und schließlich auch politisch in die Knie zwingen konnten. Mitte April 1895 musste China auf Korea, Formosa – also Taiwan –, aber auch auf die Halbinsel Liaodong mit Port Arthur verzichten. Für Russland war das eine äußerst bedenkliche Entwicklung, bedrohten die Japaner von Korea aus doch nicht nur seine mittelbaren Interessen in China, sondern ganz unmittelbar auch den strategisch enorm wichtigen Hafen von Wladiwostok. Hier liegen die Ursachen des russisch- beziehungsweise sowjetisch-japanischen Konflikts, der seither zu den Konstanten der Weltpolitik zählt und bis heute nicht beigelegt ist.
Kurzfristig zeitigte die japanische Festsetzung auf dem chinesischen Festland einen erstaunlichen Schulterschluss. Denn in Reaktion auf diese Verschiebung der ostasiatischen Kräfteverhältnisse taten sich Russland, Frankreich und Deutschland zusammen. Dabei hatten Russland und Frankreich doch erst 1892, also gerade einmal zwei Jahre zuvor, eine Militärallianz geschlossen, um sich gemeinsam vor einer möglichen deutschen Offensive zu schützen. In China mussten also erhebliche gemeinsame Interessen auf dem Spiel stehen.
Die koordinierte diplomatische Initiative der drei europäischen Großmächte, die als »Ostasiatischer Dreibund« in die Geschichte eingegangen ist, hatte weitreichende Folgen. Zum einen musste Japan schon Anfang Mai 1895 einen Teil seiner Beute, darunter Port Arthur, wieder an China abtreten. Zum anderen ließen sich Russland, Frankreich und Deutschland ihre Unterstützung Chinas honorieren und pachteten nunmehr ihrerseits von Peking strategisch und wirtschaftlich wichtige Gebiete an der Küste. Im Falle Deutschlands war das die Bucht von Kiautschou mit der Hafenstadt Tsingtau, im Falle Russlands besagtes Port Arthur, das Japan unter dem Druck des Ostasiatischen Dreibundes gerade erst wieder an China hatte zurückgeben müssen und das sich Russland jetzt von diesem zusichern ließ.
Vermutlich wäre der Konflikt zwischen Russland und Japan schon bei dieser Gelegenheit eskaliert, hätte nicht die Erhebung der chinesischen Boxer die beiden und eine Reihe weiterer Mächte kurzfristig zum Schulterschluss gezwungen. Für die Boxer – so wurden die Aufständischen von den Ausländern wegen ihrer Kampfsportübungen genannt – waren die Etablierung erst der Japaner, dann der Europäer in China, aber auch das offensive Auftreten westlicher Missionsgesellschaften Ausdruck einer nicht mehr hinnehmbaren Überfremdung des Landes. Dem Aufstand der Boxer, der Mitte Juni 1900 Peking erreichte, fielen Hunderte Ausländer und Tausende einheimischer Christen zum Opfer. Die sechs europäischen Großmächte, außerdem Japan und nicht zuletzt die USA antworteten mit einer massiven Intervention. Das militärische Vorgehen mündete in einem Massaker an der Zivilbevölkerung Pekings, und die politischen Maßnahmen, welche die ohnehin wankende chinesische Regierung im September 1901 zu akzeptieren hatte, kamen ihrer Entmündigung gleich.
Mit dem Sieg über die Boxer und der trügerischen Befriedung des Landes endete das Zweckbündnis der Mächte. Auch der kurzlebige Burgfriede Russlands und Japans zerbrach. Für Japan war es schlimm genug, dass die Russen 1898 Port Arthur besetzt hatten. Als sie dann auch noch die innerchinesischen Verwerfungen nutzten und sich in der Mandschurei festsetzten, war für Japan eine rote Linie überschritten. Rückversichert durch einen 1902 mit Großbritannien geschlossenen Bündnisvertrag, eröffnete Japan im Februar 1904 den Krieg gegen Russland und krönte seine Offensive nach durchschlagenden militärischen Erfolgen zu Lande und zur See mit einem politischen Triumph. Der vom amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt vermittelte Friede brachte Japan im September 1905 unter anderem die erneute Kontrolle über Port Arthur. Für Russland bedeutete die verheerende militärische und politische Niederlage nicht nur das Ende seiner ostasiatischen Expansion, sondern auch seiner Rolle als Seemacht im pazifischen Raum.
So gesehen war in dieser Weltgegend ohnehin schon vieles, wenn auch nicht alles verloren, als die Bolschewiki die Macht übernahmen. Allerdings wurde bald deutlich, dass es auch dort noch schlimmer kommen konnte. Und wieder war es Japan, das den Beweis antrat, als es kurzzeitig die Kontrolle Russlands über seine fernöstlichen Provinzen infrage stellte. Schon in der Endphase des Ersten Weltkriegs war in Sibirien eine japanische Kampfeinheit zusammen mit Einheiten anderer Staaten aufgetaucht, ausgestattet mit einem Beschluss des Obersten Kriegsrats der Alliierten. Gemeinsam wollte man dort eine Front gegen die Bolschewiki errichten, die nach ihrem Putsch die gemeinsame Allianz gegen die Deutschen verlassen hatten und seit dem Waffenstillstand vom Dezember 1917 offenbar mit diesen gemeinsame Sache machten. Als aber klar wurde, dass sich auf diesem Weg gegen die Bolschewiki nichts ausrichten ließ, wurden die fremden Interventionsarmeen nach und nach wieder abgezogen. Nur die Japaner blieben in Sibirien, besetzten die Küstenregion einschließlich Wladiwostok und etablierten dort eine eigene Republik.
Was folgte, war eine beachtliche diplomatische Leistung Lenins und seiner Leute.9 Da sie militärisch und politisch im Osten schon deshalb zu einer Intervention nicht fähig waren, weil der Krieg gegen Polen alle Kräfte im Westen band, veranlassten die Bolschewiki im Frühjahr 1920 hinter den Kulissen die Gründung einer sogenannten Fernöstlichen Republik. Deren Führer gaben vor, einen von Russland unabhängigen Staat etablieren zu wollen. Damit war dem weiteren Vordringen der Japaner ein Riegel vorgeschoben, denn deren Intervention war ausschließlich als Mission gegen die Bolschewiki legitimiert. Als die jetzt die Unabhängigkeit der Fernöstlichen Republik anerkannten, zwangen sie die Japaner, ihrerseits diesen Schritt zu tun. Damit entfiel jeder Grund für ihre militärische Präsenz.
Das war einer der wenigen Momente dieser frühen Jahre, in denen die Bolschewiki und die Westmächte an einem Strang zogen. Denn diese, allen voran die USA, aber auch Großbritannien, drängten Tokio zum Rückzug aus Russland. Ihnen konnte nicht daran gelegen sein, dass sich Japan die Umbrüche in Russland und China zunutze machte und zur dominanten Macht im ostasiatisch-pazifischen Raum aufstieg. Nicht zufällig zwangen die Westmächte die Japaner auch zur Aufgabe ihrer ungleich größeren chinesischen Kriegsbeute. Kaum war der Rückzug der Japaner aus Russland abgeschlossen, sorgten die Sowjets dafür, dass die unabhängige Fernöstliche Republik Mitte November 1922 ihren Geist aufgab, als Staatswesen aufgelöst und wieder in den nunmehr sowjetischen Staatsverband eingegliedert wurde.
Die Bolschewiki waren so gesehen »innovative Eroberer«,10 und das nicht nur im Fernen Osten. Genauso operierten sie in anderen zeitweilig unabhängigen Republiken wie der Ukraine und Georgien, Armenien und Aserbaidschan, Usbekistan oder Kasachstan. Alle diese Länder waren auf dem Weg zurück in den sowjetischen Staatsverband, als die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken UdSSR Ende 1922 das Licht der Welt erblickte. Und es waren die Bolschewiki, die diese patriotische Großtat vollbracht hatten. Wenn es ein Motiv gab, das die Reihen hinter ihrer Führung schließen ließ, dann war es dieser russische Patriotismus. Wer die hohe Zustimmung der Russen zu den Manövern ihres Präsidenten Putin in Georgien oder in der Ukraine verstehen will, findet in den Ereignissen zu Beginn der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts eine historische Erklärung.
Begreiflicherweise nahmen viele Georgier und Ukrainer den russischen Patriotismus zu jener Zeit ganz anders wahr. Für sie und viele außenstehende Beobachter handelte es sich beim Vorgehen der Sowjets um Nationalismus oder auch Chauvinismus in Reinkultur. Die Sowjets aber wussten fortan, wie weit sie der patriotische Impuls ihrer Landsleute tragen konnte. Schon deshalb stand für sie außer Frage, dass sie die Gebiete, die sie bis Ende 1922 nicht hatten zurückholen können, dem Staatsverband so bald wie irgend möglich einverleiben würden – ganz gleich zu welchem Preis und mit welchem Partner, sollte man einen solchen benötigen.
Im Lichte der Geschichte war es konsequent, dass diese Rolle 1939 Deutschland zufiel. Ohne den Waffenstillstand mit den Deutschen am Jahresende 1917 und ohne die pragmatische Zusammenarbeit der folgenden Monate hätten die Sowjets die dramatische Zeit des Alles oder Nichts niemals überstanden. Und ohne die unfreiwillige Hilfe der Westmächte hätten die beiden so unterschiedlichen Partner, hätten das Deutsche Reich und die UdSSR während der zwanziger Jahre wohl kaum erneut zusammengefunden. Schon mit der Pariser Friedenskonferenz stellten die Westmächte dafür die Weichen.
KAPITEL 2REVISION
Grenzenlos. Die Revisionisten des Zeitalters der Weltkriege – hier der »Große Diktator«, 1940 verkörpert von Charlie Chaplin – haben nicht nur die Änderung von Grenzen im Visier.
© Picture Alliance: United Archives/WHA
Sie waren überfordert. Schon die Zahl der Teilnehmer sprengte alle bislang bekannten Dimensionen. Mehr als 1000 Vertreter von beinahe 30 Staaten kamen am 18. Januar 1919 in Paris zusammen, um nach dem verheerenden Krieg eine tragfähige Friedensordnung auf die Beine zu stellen. Dabei waren die Mitglieder jener fünf Delegationen, die für die Verlierer nach Frankreich reisten, nicht mitgezählt. Sie waren zu den Verhandlungen nicht zugelassen und warteten in Hotels darauf, dass man ihnen, wann auch immer, die Friedensverträge präsentierte. Allein im düsteren alten Versailler Hôtel des Réservoirs harrten 180 Abgesandte aus Deutschland – Experten, Diplomaten, Sekretärinnen, Journalisten – der Dinge.1
Unter den vielen Konferenzteilnehmern gab es wichtige, weniger wichtige und besonders wichtige wie Großbritanniens Premierminister David Lloyd George, die Ministerpräsidenten Frankreichs und Italiens, Georges Clemenceau und Vittorio Emanuele Orlando, sowie allen voran den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson. Erstmals in der Geschichte der USA hatte ein Präsident sein Land verlassen, um an einer Friedenskonferenz teilzunehmen. Dass er sich in entscheidenden Punkten nicht durchsetzen konnte, war ein schlechtes Omen. Denn Wilson war der Verfasser jener Vierzehn Punkte, welche die Grundlage für die zu zimmernde Friedensordnung bilden sollten.
Überfordert war die Konferenz nicht nur mit der Zahl der Teilnehmer, sondern vor allem mit der Vielzahl von Themen. Alleine die Folgeprobleme, die aus den Konkursmassen des Osmanischen Reiches, Österreich-Ungarns, Russlands und in gewisser Weise auch des Deutschen Reiches erwuchsen, waren immens.
Es ging ja nicht nur um Europa, sondern unter anderem auch um den Nahen und Mittleren Osten, um Teile Afrikas sowie um den ostasiatisch-pazifischen Raum. Es ging um Handels- und um Wirtschaftsfragen. Es ging um das Völkerrecht und um den Völkerbund. Und dann stand von Anfang an eine Frage im Raum, die nicht ausdrücklich gestellt wurde, weil sie noch nicht zu beantworten war: Wer waren die Sieger, wer waren die Gewinner, und wer waren die Verlierer? Lediglich über den Kreis der Verlierer herrschte Einigkeit, jedenfalls im Kreis der Sieger. Es waren die fünf Staaten Deutschland, Österreich, Bulgarien, Ungarn und die Türkei, denen man einen Friedensvertrag vorlegen würde, den sie zu unterschreiben hatten. Auf der Siegerseite gab es hingegen eine Zweiklassengesellschaft, nämlich die »alliierten und assoziierten Hauptmächte« USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan auf der einen – und alle übrigen »alliierten und assoziierten Mächte« auf der anderen Seite.
In Kreis dieser »Mächte« gab es mit Polen, dem »serbisch-kroatisch-slowenischen Staat«, also dem späteren Jugoslawien, und der Tschechoslowakei Staaten, die bei Kriegsausbruch noch gar nicht existiert hatten. Das traf auch auf Finnland, Estland, Lettland und Litauen zu, nur waren diese vier auf der Friedenskonferenz gar nicht vertreten. Kurzfristig zählten diese sieben Neulinge insofern zu den Gewinnern, als sie überhaupt erst während beziehungsweise wegen dieses Krieges das Licht der Welt erblickt hatten.
Aber waren sie auch auf längere Sicht wirklich Gewinner? Und wie sah es mit den etablierten Staaten aus, die in einer ähnlichen Lage waren wie die sieben Neulinge, weil sie infolge der Friedensverträge erhebliche territoriale Zuwächse verbuchen konnten? So zum Beispiel Griechenland und Rumänien, Frankreich und Italien oder auch – bezogen auf die Ausdehnung seines ohnehin gewaltigen Empires – Großbritannien. Profitierten diese etablierten wie auch die neu entstandenen Staaten längerfristig tatsächlich von der neuen Ordnung? Oder mussten sie nicht ständig in der Furcht leben, dass ihnen ihre Eigenstaatlichkeit beziehungsweise der territoriale Zuwachs über kurz oder lang wieder abspenstig gemacht werden würde? Zogen die Gewinner eigentlich allesamt an einem Strang? Herrschte unter ihnen wenigstens so etwas wie Solidarität?
Noch bevor die Pariser Friedenskonferenz am 21. Januar 1920 offiziell zu Ende ging, gab es eine Antwort auf diese Fragen, denn nicht die Verlierer, denen dafür schlicht die Mittel fehlten, schritten als Erste zu gewaltsamer Revision, sondern die Gewinner zogen gegeneinander ins Feld. Am Abend des 11. September 1919 besetzten italienische Freischärler das kroatische Fiume, das heutige Rijeka, und gründeten einen Freistaat; 1924 wurde dieser von Italien annektiert. Dass sich die Tschechoslowakei ausgerechnet im Juli 1920 einen großen Teil des Teschener Gebietes sicherte, also zu dem Zeitpunkt, als sich Polen, wie im vorangegangenen Kapitel berichtet, gegen die Rote Armee zu verteidigen hatte, konnte man in Warschau nie vergessen: Als die Tschechoslowakei 1938/39 durch Deutschland zerlegt wurde, holte sich Polen dieses Gebiet zurück. 1920 kompensierte Polen die Niederlage andernorts, indem es sich, mit dem Einmarsch im Oktober beginnend, das zu Litauen gehörende Wilnaer Gebiet einverleibte. Diese Wunde verheilte selbst dann nicht, als Polen und Litauen gemeinsam von Deutschland und der Sowjetunion in die Zange genommen wurden.
Unter dem Strich waren die Gewinner der Friedensordnung also allesamt Verlierer. Keiner von ihnen fühlte sich sicherer als vor dem Krieg, im Gegenteil. Und wie sah es mit denen aus, die in Paris von vornherein als Verlierer gebrandmarkt wurden? Waren die Fünf auch unter dem Strich wirklich die Verlierer? Immerhin hatten sie unter- oder gegeneinander keine Ansprüche. Sie verband vielmehr die Forderung an die Adresse der alliierten und assoziierten Sieger des Ersten Weltkriegs, das zu revidieren, was man ihnen nach Abschluss der Pariser Konferenz vorgelegt hatte. Es war in den Verträgen fixiert, die Deutschland am 28. Juni 1919 in Versailles, Österreich am 10. September 1919 in Saint-Germain-en-Laye, Bulgarien am 27. November 1919 in Neuilly-sur-Seine, Ungarn am 4. Juni 1920 im Versailler Schloss Grand Trianon sowie die Türkei am 10. August 1920 in Sèvres und dann in revidierter Form am 24. Juli 1923 noch einmal in Lausanne zu unterschreiben hatten.
Dass die Fünf mit den Pariser Ergebnissen nicht leben wollten, lag nicht nur am Inhalt der Verträge, sondern auch an der Art und Weise, wie sie zustande gekommen waren, nämlich im Wesentlichen ohne Beteiligung der Betroffenen. Das gilt auch für das Deutsche Reich. Nachdem der deutschen Delegation am 7. Mai 1919 das umfangreiche Vertragswerk übergeben worden war, hatte sie für die Prüfung gerade einmal zwei Wochen Zeit, und die Gegenvorschläge, die man schriftlich einreichen musste, wurden allenfalls marginal berücksichtigt.
Mit der Unterschrift erkannte Berlin an, »daß Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des Krieges, der ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungen wurde, erlitten haben«.2 So lautete der wohl berühmteste und zugleich berüchtigtste der insgesamt 440 Artikel des Versailler Vertrages. Von Weitsicht zeugte das nicht. Allen Beteiligten musste klar sein, dass sich die Deutschen nicht mit der einseitigen und in dieser Form unhaltbaren Zuweisung der Urheberschaft – also mit der im Reich sogenannten Kriegsschuld – würden abfinden können. Zumal dieser Artikel 231, der das Kapitel »Wiedergutmachungen« des Vertrages einleitete, exorbitante Reparationsforderungen legitimieren sollte.
Es waren vor allem die Franzosen, die darauf drängten. Das war insofern nachvollziehbar, als die Schlachten an dieser Front fast ausschließlich auf französischem Boden geschlagen worden waren. Außerdem mussten auch die Franzosen die während des Krieges aufgenommenen hohen Kredite an die USA zurückzahlen. Und da die Pariser Kasse klamm und an eine Rückzahlung der Schulden Russlands nicht zu denken war, setzte man auf deutsche Quellen. Darüber hinaus hatten die über Jahrzehnte zu leistenden deutschen Reparationszahlungen für Paris eine Ersatzfunktion. Mit ihnen sollte jene nachhaltige Schwächung des Nachbarn erzwungen werden, die man in territorialer Hinsicht nicht hatte durchsetzen können.
Das, was der deutsche Nachbar zeitweilig oder dauerhaft abzutreten hatte, war erheblich. Die Rückgabe von Elsass-Lothringen konnte niemanden überraschen. Dazu kam die Unterstellung des nördlich angrenzenden Saargebiets unter den Völkerbund und die Übernahme seiner Kohlegruben durch Frankreich. Das bedeutete für Deutschland auch dann einen schweren Verlust, wenn man in Rechnung stellte, dass nach 15 Jahren eine Volksabstimmung über die Zukunft des Saarlandes entscheiden sollte. Das ungleich wichtigere Rheinland blieb zwar beim Reich, allerdings waren westlich sowie 50 Kilometer östlich des Flusses militärische Befestigungen und die »ständige oder zeitweise Unterhaltung oder Ansammlung von Streitkräften untersagt«.3 Mit anderen Worten: Deutsche Soldaten durften diese strategisch bedeutsame Region auch dann nicht betreten, wenn die alliierten Truppen jene drei Zonen des Rheinlands nach spätestens 15 Jahren verlassen hatten.
Als besonders schwere Zumutung wurden in Berlin die territorialen Regelungen im Süden und Osten betrachtet, darunter die Verpflichtung, die »Unabhängigkeit« Österreichs als »unabänderlich« anzuerkennen.4 Dieses sogenannte Anschlussverbot, das auch die Republik Österreich zu akzeptieren hatte, barg Sprengstoff. Denn der ursprünglich nur als Perspektive formulierte Anschluss wurde damit zu einer bei Bedarf oder Gelegenheit mobilisierbaren Revisionsforderung.
Unmittelbar schwerer wogen die Verluste des Hultschiner Ländchens, das an die Tschechoslowakei ging, des Memelgebiets, das zunächst unter alliierte Verwaltung, dann unter litauische Besatzung kam, und vor allem fast ganz Westpreußens und Posens, die an Polen fielen. Ausgenommen war lediglich die wirtschaftlich und strategisch äußerst wichtige »Freie« Stadt Danzig. Sie unterstand dem Völkerbund. Allerdings wurden Polen unter anderem die freie Benutzung der Hafenanlagen, die Verwaltung des Eisenbahnwesens und die »Leitung der auswärtigen Angelegenheiten«5 der Stadt zugesprochen.
Unter dem Strich gingen durch den Versailler Vertrag insgesamt mehr als 13 Prozent des deutschen Gebietsstandes von 1914 verloren und mit ihm zehn Prozent der Bevölkerung. Nicht minder schwer wog der Verlust von 15 Prozent der landwirtschaftlichen Produktion und 20 Prozent des Bergbaus sowie der eisenerzerzeugenden Industrie, zumal die Handelsbeziehungen des Deutschen Reiches, aber auch die Benutzung zahlreicher Häfen, Eisenbahnstrecken und Wasserstraßen Restriktionen und Kontrollen unterworfen wurden und Deutschland auf sämtlichen kolonialen Besitz verzichten musste. Erst wenn man all diese Zusammenhänge in den Blick nimmt, erschließt sich die ganze Dimension der Reparationsfrage.
Natürlich hatten die territorialen Amputationen, die Besetzungen, die wirtschaftlichen und finanziellen Belastungen auch mittelbare und unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheit des Reiches, soweit von einer solchen im engeren Sinne überhaupt noch die Rede sein konnte. Dass alle Festungen auch 50 Kilometer östlich des Rheins geschleift, fast die gesamte Hochseeflotte ausgeliefert und auf die Produktion von Panzern, U-Booten und anderen schweren Waffen verzichtet werden mussten, war schlimm genug.
Als geradezu unerträglich wurden die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht und die Auflösung des Generalstabs empfunden. Mit den zugestandenen 100 000 Berufssoldaten, zu denen noch 15 000 Mann Marinetruppen kamen, war im Zweifelsfall nicht einmal die innere Ordnung aufrechtzuerhalten, von der Verteidigung der Landesgrenzen gar nicht zu reden: Ostpreußen mit Königsberg war durch polnisches Territorium, den sogenannten Korridor, vom Reichsgebiet getrennt; mit zehn alten und neuen Staaten hatte das Deutsche Reich jetzt eine gemeinsame Grenze; und die Lage gegenüber Großbritannien hatte sich, seit Deutschland über keine nennenswerten Seestreitkräfte mehr verfügte, ebenso verschlechtert wie diejenige gegenüber Italien, das sich das vormals österreichische Südtirol einverleibte und so der deutschen Grenze bedenklich nahe rückte.
Das alles war schmerzlich, aber eine Katastrophe war es bei nüchterner Betrachtung nicht. Denn die Substanz war geblieben. Anders als die Franzosen hatte die Mehrheit der Sieger, hatten vor allem Briten und Amerikaner nicht ernsthaft an der Großmachtstellung des Reiches rütteln wollen. Gerade Großbritannien konnte nicht an einer unproportionalen Stärkung des alten Rivalen Frankreich und einer Erschütterung des europäischen Gleichgewichts gelegen sein.
Außerdem nahm man die Bolschewiki vor allem in London wörtlich. Da sie ihre Revolution gen Westen exportieren wollten, musste man dem etwas entgegensetzen. So kam Deutschland, nicht zum letzten Mal, die Rolle zu, eine Barriere gegen die Gefahr aus dem Osten zu bilden. Um diese Aufgabe wahrnehmen zu können, musste es stabil und überlebensfähig sein. Damit saßen die Alliierten in einer Zwickmühle, in die sie sich selbst hineinmanövriert hatten. Denn sie hatten die Sowjets erst gar nicht zur Friedenskonferenz geladen und damit eine Möglichkeit vertan, mit ihnen ins Gespräch, womöglich auch zu einer Verständigung über Deutschland zu kommen.
Allerdings hatten die Westmächte Gründe, die Sowjets nicht einzuladen. So befand sich Russland mitten im Bürgerkrieg, womit sich die Frage stellte, wen man hätte einladen sollen. Die Bolschewiki konnten es schwerlich sein, denn die waren unmittelbar nach ihrem Petrograder Putsch aus der alliierten Kriegskoalition ausgeschieden und hatten im März 1918 ihren Frieden mit Deutschland gemacht. Sie hatten auch die Tore der zaristischen Archive geöffnet und dabei zahlreiche Geheimdokumente ans Tageslicht befördert, welche die Kriegs- und Vorkriegspolitik der ehemaligen Verbündeten, namentlich der Briten und Franzosen, nicht gerade in einem vorteilhaften Licht erscheinen ließen. Vor allem aber hatten die Bolschewiki erklärt, nicht für die erheblichen Vorkriegsinvestitionen des Westens im untergegangenen Zarenreich geradestehen zu wollen. Das bedeutete für die leeren Kassen in Paris und London einen Totalverlust und war einer der Gründe, warum die Alliierten militärisch gegen die Sowjets vorgingen, just als die Konferenz zusammentrat.
Das aber hatte zur Folge, dass die in Paris entworfene neue Ordnung weder die Hand- noch die Unterschrift sowjetischer Politiker oder Diplomaten trug, so dass sich diese auch nicht daran gebunden fühlten. Ein schwerwiegender Konstruktionsfehler, der von den Sowjets von Anfang an als Element einer großräumigen antibolschewistischen Strategie gedeutet wurde. Sehr wohl saßen nämlich in Paris Vertreter einiger jener Staaten mit am Tisch, die wenig später vom Westen, und dort insbesondere von Frankreich, gegen Sowjetrussland in Stellung gebracht wurden. Dieser von Paris aus organisierte Staatengürtel, der Cordon sanitaire, erstreckte sich von Finnland bis zum Schwarzen Meer und umfasste vor allem Staaten, die zuvor ganz oder teilweise zu Russland gehört hatten. Obgleich die Konstruktion Ende der dreißiger Jahre durch Sowjets und Deutsche zum Einsturz gebracht wurde, hat sich die dahintersteckende westliche Strategie tief ins russische Gedächtnis eingegraben.
Als die Sowjetunion 1991 kollabierte und eine Reihe ihrer Nachfolgestaaten in die NATO und die EU aufgenommen wurde, war die Erinnerung an diesen Sicherheitsgürtel wieder da. Ohne sie ist die russische Politik namentlich in der Ära Putin nicht zu verstehen.
Nach dem Ersten Weltkrieg sollte der Cordon sanitaire Sowjetrussland sowohl in Schach halten als auch isolieren. Vor allem von Deutschland. Und weil man den Staatengürtel in Berlin genau so, nämlich als Schutz vor einem deutschen Revisionismus vor allem gegen Polen wahrnahm, bildete er die Brücke, über die sich Deutsche und Sowjets aufeinander zubewegten.
Natürlich hatten die Sowjets ihr Ziel einer Revolutionierung Deutschlands nicht stillschweigend aufgegeben. Aber vordringlich brauchten sie nach den kräftezehrenden Kämpfen erstens Ruhe und zweitens eine rasche wirtschaftliche Konsolidierung. Da die nicht aus eigener Kraft zu stemmen und vom Westen keinerlei Unterstützung zu erwarten war, rückte Deutschland zwangsläufig ins Blickfeld. Ein Wiedererstarken der deutschen Industrie- und Wirtschaftsmacht war mithin für die Sowjets eine entscheidende Voraussetzung, um mit deren Hilfe wieder auf die Beine zu kommen und sich solchermaßen gerade für den erfolgreichen Export der Weltrevolution zu rüsten. Deutschland, reflektierte Lenin Ende November 1920, sei zwar »vom Versailler Vertrag erdrückt«, verfüge aber immer noch über »ungeheure wirtschaftliche Möglichkeiten«. Es könne die Friedensbedingungen »nicht ertragen« und müsse »Verbündete gegen den Weltimperialismus suchen, obwohl es selbst ein imperialistisches – aber geschlagenes – Land« sei.6
Es gab also eine Chance. Für beide. Sie lag im Schulterschluss. Deutsche und Sowjets vollzogen ihn, als es die Westmächte, allen voran Frankreich, wieder einmal nicht lassen konnten, den beiden demonstrativ ihre schwierige Lage vor Augen zu führen. Das geschah auf einer internationalen Konferenz, die im April und Mai 1922 über die großen Fragen der Weltwirtschaft beriet. Am Rande dieser Konferenz schlossen das Deutsche Reich und Sowjetrussland am 16. April 1922 in Rapallo einen Vertrag. Es war ein »Jahrhundertereignis«, ein »Erdstoß, der die ganze internationale Landschaft veränderte«.7
Ein »Erdstoß« war der Vertrag schon deshalb, weil er für den Rest der Welt völlig unerwartet kam und weil sich Deutsche und Sowjets mit ihm auf eine Linie verständigten, an der sie trotz mancher Rückschläge und Enttäuschungen so lange festhielten, bis einer von ihnen in der Lage war, mit Aussicht auf Erfolg über den anderen herzufallen. Damit ist gesagt, was auch dieser Vertrag vor allem war: ein Zweckbündnis. Neben der Wiederaufnahme der diplomatischen und konsularischen Beziehungen, die Berlin im November 1918 aus Protest gegen die sowjetische Unterstützung deutscher Revolutionäre abgebrochen hatte, vereinbarten die beiden den gegenseitigen Verzicht »auf den Ersatz ihrer Kriegskosten sowie auf den Ersatz der Kriegsschäden«.8