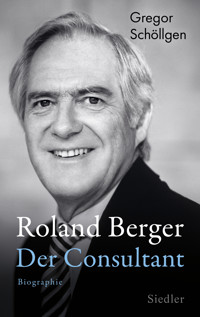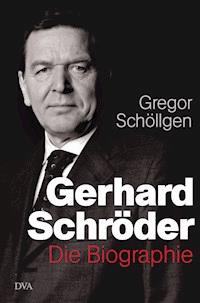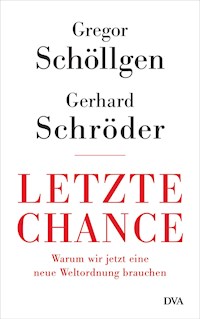
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Der Westen hatte seine Zeit. Sie war gut. Sie war politisch erfolgreich. Aber sie ist vorbei.« Der Historiker Gregor Schöllgen und Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder mit einem thesenstarken Appell
Der Westen liegt im Koma. Paralysiert und apathisch verfolgen Europäer und Amerikaner die weltweite epidemische Zunahme von Krisen, Kriegen und Konflikten aller Art. Das hat seinen Grund: Die Staaten der westlichen Welt, die es so gar nicht mehr gibt, sitzen in überlebten Strukturen fest und bekommen jetzt die Quittung für die Fehler der Vergangenheit. Die Folgen sind fatal. Gregor Schöllgen und Gerhard Schröder fragen, wie es dahin kommen konnte. Und sie sagen, wie es weitergehen muss. Mit Europa und der NATO, mit Russland und mit China, mit den Staaten der südlichen Halbkugel und nicht zuletzt mit Deutschlands Rolle in der Welt. Das Buch verbindet den analytischen Blick des Historikers mit dem gestaltenden Zugriff des Politikers. Es ist das Ergebnis eines Gesprächs, das die beiden seit vielen Jahren führen.
- »Der Westen hatte seine Zeit. Sie war gut. Sie war politisch erfolgreich. Aber sie ist vorbei.«
- Krisen, Kriege, Konflikte: Warum der Westen jetzt die Quittung für die Fehler der Vergangenheit bekommt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gregor Schöllger Gerhard Schröder
LETZTE CHANCE
Warum wir jetzt eine neue Weltordnung brauchen
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 Deutsche Verlags-Anstalt, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München Satz: Ditta Ahmadi
Inhalt
Vorwort
PROLOG Wo wir stehen
KAPITEL 1 Abserviert: Europas Stagnation
KAPITEL 2 Ohne Rücksicht auf Verluste: Die USA in der Welt
KAPITEL 3 Der wankende Riese: Russland am Scheideweg
KAPITEL 4 Dynamik pur: China auf dem Weg an die Weltspitze
KAPITEL 5 Ein Riese wird wach: Der asiatische Halbmond
KAPITEL 6 Gefährliche Nachbarn: Das kurdische Viereck
KAPITEL 7 Die Mutter aller Krisen: Der Nahostkonflikt
KAPITEL 8 Tore zur Welt: Der Persische Golf und das Rote Meer
KAPITEL 9 Das Herz der Finsternis: Zentralafrika
KAPITEL 10 Quellen des Lebens: Das Ringen um die Ressourcen
Vorwort
Die Welt liegt im Koma. Paralysiert und apathisch verfolgen wir die epidemische Zunahme von Krisen, Kriegen und Konflikten aller Art. Und der Westen, den es so gar nicht mehr gibt, sitzt in seinen überlebten Strukturen fest. Wir fragen, wie es dahin kommen konnte.
Und wir sagen, wie es weitergehen muss. Mit Europa und der NATO, mit Russland und mit China, mit den Staaten der südlichen Halbkugel und nicht zuletzt mit Deutschland und seiner Rolle in der Welt. Das Buch verbindet den analytischen Blick des Historikers mit dem gestaltenden Zugriff des Politikers. Es ist das Ergebnis eines Gesprächs, das wir seit vielen Jahren führen.
Gregor Schöllgen
Gerhard Schröder
PROLOGWo wir stehen
Es sieht nicht gut aus. Nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Globus von derart vielen Krisen überzogen. Beunruhigend sind nicht nur ihre schiere Zahl, sondern auch die vielfältigen Ursachen und Verlaufsformen und nicht zuletzt die mittelbaren oder auch direkten Verbindungen, die es zwischen vielen gibt.
Umgekehrt bedeutet das: Der Kreis der vergleichsweise krisenfreien und vor allem der befriedeten Weltgegenden ist seit dem Zusammenbruch der alten Weltordnung vor nunmehr 30 Jahren kontinuierlich geschrumpft. Wenn man den Begriff der Krise angemessen weit fasst, also nicht nur militärische Konflikte aller Art in den Blick nimmt, dann sind diese Zonen heute lediglich noch ein paar Inseln im Krisenkosmos. Solche Inseln sind Nordamerika und Europa.
Wie lange das so bleiben wird, vermag niemand sicher zu sagen. Klimawandel, Ressourcenschwund und Epidemien machen nicht an Grenzen Halt. Der Terrorismus hat den Westen nicht erst 2001 heimgesucht. Die Folgen von Krieg und Bürgerkrieg in Afrika oder im Nahen und Mittleren Osten haben inzwischen auch Europa fest im Griff. Unter dem Strich muss man bilanzieren, dass der europäische Handlungsspielraum nach dem Ende des Kalten Krieges nicht etwa gewachsen, sondern in praktisch jeder Hinsicht empfindlich geschrumpft ist.
Das ist auch die Quittung für ein kollektives Versagen. Wenn die substantielle Abtretung nationalstaatlicher Souveränität die Voraussetzung für eine Gemeinschaft ist, die diesen Namen verdient, dann hat es der alte Kontinent bis heute nicht geschafft, sich als politische, wirtschaftliche und militärische Union aufzustellen. Was Anfang der fünfziger Jahre als Gemeinschaft für Kohle und Stahl begann und sich seit fast 30 Jahren euphemistisch »Europäische Union« nennt, blieb Stückwerk und Kompromiss.
Die Folgen sind fatal. In einer Zeit, in der Europa gefordert ist, aus präventiven, ökonomischen, humanitären oder anderen Gründen auch auf anderen Kontinenten militärisch zu intervenieren, und gefordert sein könnte, sich an seinen Grenzen gegen Gefahren aller Art zu verteidigen, wäre eine einsatzfähige europäische Armee das Gebot der Stunde. Aber die ist nicht nur nicht in Sicht, sondern Europa ist bei größeren militärischen Unternehmen sogar von anderen, sprich von der NATO und damit von den Vereinigten Staaten von Amerika, abhängig.
Das ist eine delikate Konstellation. Denn die NATO wurde im Kalten Krieg und für die spezifischen Herausforderungen jener Epoche gegründet. In diesen gut vier Jahrzehnten war sie eines der erfolgreichsten Militärbündnisse aller Zeiten – weil sie nie den Bündnisfall ausrufen musste und weil der globale Gegner, die Sowjetunion und ihre Verbündeten, am Ende fast geräuschlos von der weltpolitischen Bühne abtraten. Obgleich der Sinn und Zweck der NATO damit erfüllt waren, blieb sie nach 1991 nicht nur bestehen, sondern dehnte sich geographisch und militärisch noch weiter aus. Und das hatte wiederum weitreichende Folgen.
Die USA behielten ihre militärische Vorherrschaft sowie ihre politische Vormundschaft in und über Europa. Daran haben seit 1991 alle amerikanischen Präsidenten festgehalten. Einige wie George H. W. Bush, Bill Clinton oder Barack Obama taten das diplomatischer, wenn auch in der Sache nicht minder bestimmt als George W. Bush oder vor allem Donald Trump. Joe Biden wird wohl wieder einen verbindlicheren Ton gegenüber den Europäern anschlagen; und er wird, wenn es bei seinen Ankündigungen bleibt, in multilaterale Institutionen und Verträge zurückkehren, die gerade auch den Europäern wichtig sind, so die Weltgesundheitsorganisation WHO, das Pariser Klimaschutzabkommen oder auch das Atomabkommen mit dem Iran.
Aber an der Europapolitik wird auch dieser Präsident keine grundlegende Kurskorrektur vornehmen. Denn solange es die NATO in ihrer bestehenden Façon gibt, hat Amerika gar keine Veranlassung, seine Wahrnehmung Europas zu ändern, und das wiederum heißt in der Konsequenz auch: Russland bleibt für den Westen der potentielle Gegner, der die Sowjetunion bis zu ihrem Untergang tatsächlich gewesen war. Auf diese schwerwiegende Konsequenz des Weiterbestehens der Atlantischen Allianz hat 2019 mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges öffentlich ein führender politischer Repräsentant des Westens hingewiesen.
Man muss kein Hellseher sein, um sich vorstellen zu können, wie diese konzeptionelle Kontinuität im Kreml wahrgenommen wurde, zumal die weltanschauliche von einer massiven politischen, wirtschaftlichen und militärischen Offensive seitens der NATO und der EU begleitet wurde. Dass Russland sich in die Defensive gedrängt sah und dieser Lage durch die Flucht nach vorn zu entkommen suchte, kann auch diejenigen nicht wirklich überraschen, die im Ukrainekonflikt und zumal in der Annexion der Krim zu Recht einen Bruch des Völkerrechts sehen.
Wie auch niemand überrascht sein kann, dass Russland den Schulterschluss mit einem Land suchte, das jahrzehntelang ein weltanschaulicher, politischer und Ende der sechziger Jahre sogar auch einmal ein militärischer Gegner gewesen ist. Letztlich führte die Art und Weise, wie der Westen Russland und China behandelte, die beiden zueinander. Zwar wurde die Volksrepublik seit den neunziger Jahren zu einem gefragten Handelspartner, doch löste sich der Westen nie von dem überheblichen Blick, den er sich im 19. Jahrhundert gegenüber China zugelegt hatte: Der Maßstab für den Umgang mit der Volksrepublik wie mit Russland war und ist der eigene. Das hatte Folgen. Auf ihrem hohen Sessel thronend und überwiegend von ihren wirtschaftlichen Interessen geleitet, übersahen namentlich Westeuropäer und Amerikaner jahrelang, dass China, im Ost- und Südchinesischen Meer beginnend, politisch, wirtschaftlich und auch militärisch eine konsequent offensive Politik betreibt.
Sehr früh realisierten das hingegen die näheren und mittelbaren Nachbarn des Reichs der Mitte. Denn was immer China tut oder unterlässt, tangiert Korea, Japan, Taiwan, die Staaten Südostasiens, Bangladesch, Indien, Pakistan und nicht zuletzt Afghanistan unmittelbar. Eine brisante Konstellation, schließlich tragen sämtliche Staaten des asiatischen Halbmondes, wie wir diesen Staatengürtel nennen, mit mindestens einem ihrer Nachbarn einen offenen oder latenten Konflikt aus. Mitunter haben diese Konflikte eine jahrzehntelange Vorgeschichte, in der wiederum China nicht selten eine mittelbare oder auch direkte Rolle spielt. Und manche dieser Konflikte, wie der indisch-pakistanische, scheinen heute weiter von einer Lösung entfernt als jemals zuvor. Dass beide zu den Nuklearmächten zählen, macht die Lage noch komplizierter, als sie ohnehin schon ist.
Die Lage in diesem Krisengürtel insgesamt ist beunruhigend. Dass er im Westen an ein Pulverfass grenzt, an dem gleich mehrere Lunten brennen, ist alarmierend. Wenn den Iran und den Irak, die Türkei und Syrien etwas verbindet, dann ist es die gemeinsame Gegnerschaft gegen die Kurden, die über diese vier Staaten verteilt leben, aber keinen eigenen Staat und so gesehen auch keine Heimat haben. Dass diese vier Staaten im Übrigen mehr trennt als verbindet, ist nicht zuletzt auch das Ergebnis westlicher Politik und Kriegführung. Ohne westliche Unterstützung hätte der Irak seinen achtjährigen Krieg gegen den Iran kaum überstanden, und ohne die Zertrümmerung des Irak durch eine von Amerika geführte Koalition hätte der Iran in der Region kaum jene führende Rolle erringen können, die ihn heute in die Lage versetzt, nicht nur seine näheren und ferneren Nachbarn in Atem zu halten.
Zu den erklärten Zielen Irans gehört die Vernichtung Israels, also eines Staates, der aus der Vernichtung heraus geboren worden ist. Denn ohne die Verfolgung und Ermordung des europäischen Judentums durch Deutschland wäre es 1948 wohl kaum zur Entstehung dieses Staates in Palästina gekommen. Vom Tag seiner Gründung an befand sich der Staat Israel im Konflikt mit jenen Nachbarn, zu deren Lasten er gegründet worden war. Vier Kriege haben Israel auf der einen, Ägypten, Syrien und Jordanien auf der anderen Seite bis 1973 gegeneinander geführt. Zweimal hat Israel danach im Libanon, dreimal im Gazastreifen militärisch interveniert, Dutzende von militärischen Schlägen gegen Ziele, wie zuletzt vor allem in Syrien, nicht mitgerechnet.
Dass es trotz einiger ermutigender Schritte in absehbarer Zeit zu einem dauerhaften Frieden kommen wird, glauben selbst Optimisten nicht mehr. Das liegt zum einen an der aus heutiger Sicht nicht lösbaren Palästinenserfrage und zum anderen an den angrenzenden Konfliktzonen wie der libyschen. Was immer in diesem in Auflösung befindlichen Land passiert, tangiert unmittelbar den Nachbarn Ägypten, also einen Schlüsselakteur des Nahostkonflikts, und damit die gesamte Region, weil eine Reihe von Staaten, auch der Arabischen Halbinsel, auf die eine oder andere Weise dort mitmischen.
Die Arabische Halbinsel wiederum liegt im geostrategischen Spannungsfeld von zwei der bedeutendsten Seerouten der Erde. Der Persische Golf und das Rote Meer gehören von jeher zu den Brennpunkten der Weltpolitik. Die herausragende Bedeutung des Persischen Golfs für den Ölexport der Region und des Roten Meeres als kürzeste Verbindung von Mittelmeer und Indischem Ozean macht diese Weltgegend für die Eskalationen widerstreitender Interessen hochgradig anfällig.
Hinzu kommen die konfliktgeladenen Beziehungen zwischen vielen Anrainerstaaten. Im Falle des Persischen Golfes sind das vor allem die Protagonisten des sunnitischen und des schiitischen Islam, also Saudi-Arabien und Iran, die nicht nur im Jemen einen brutalen Stellvertreterkrieg führen. Im Falle des Roten Meeres gründet die Krise in der desolaten Verfassung der westlichen Anrainer. Ägypten, Sudan, Südsudan, Äthiopien, Eritrea und Somalia haben allesamt mit immensen inneren Problemen aller Art zu kämpfen und liegen überdies noch miteinander im Konflikt.
Nicht besser sieht es in der angrenzenden riesigen Krisen- und Konfliktzone aus, die sich von Nigeria über die Zentralafrikanische Republik, den Südsudan, Uganda und Ruanda bis in die Demokratische Republik Kongo, das Herz der Finsternis, erstreckt. Was sich dort, mit dem Völkermord in Ruanda beginnend und in die drei Kongokriege mündend, seit Mitte der neunziger Jahre abgespielt hat, entzieht sich der Vorstellungskraft. Bis heute haben sich die Kriegsparteien und die an sie grenzenden Staaten nicht davon erholt, im Gegenteil. Alte und neue Konflikte brechen immer wieder auf, wobei es hier wie andernorts stets auch um die knappen und begehrten natürlichen Ressourcen geht.
Nicht erst seit dem Ende des Kalten Krieges wird um diese natürlichen Ressourcen gerungen, aber seither geschieht das verstärkt mit allen Mitteln. Wenn es um Öl und Gas, Coltan und Titan, Kupfer und Kobalt, Lithium und Seltene Erden geht, werden immer wieder auch Kriege geführt. Zunehmend dreht sich dabei alles um die wertvollste Ressource von allen: das Wasser. Wasser ist nicht nur begehrt, sondern zunehmend auch ein Grund zur Flucht. Weil sintflutartige Regenfälle, brechende oder fehlende Dämme, versiegende Flüsse und Seen sowie durch Staudämme vorenthaltenes Wasser ganze Landstriche zeitweise oder dauerhaft unbewohnbar machen, haben die Menschen oft keine andere Wahl, als ihre Heimat zu verlassen, zumal der Wassermangel in der Regel nicht der einzige Anlass oder Grund für ihre Flucht ist.
Die meisten, die gehen, sind Binnenflüchtlinge oder steuern Nachbarländer an, doch ein stetig wachsender Anteil von ihnen sucht sein Heil auf anderen Kontinenten, vor allem dem europäischen. Man kann das verstehen, denn Europa hat vieles von dem, was die Ankommenden nie besessen oder was sie verloren haben. Dass dies so ist, liegt auch an uns, den Europäern, Japanern oder Amerikanern, also den vormaligen Kolonialherren in Afrika und Asien. So gesehen kommen die Flüchtlinge und Migranten nicht nur als Bittsteller.
Aber natürlich stellt sich die Frage, wo die Grenzen der Belastbarkeit liegen. Denn Europa wird ja nicht nur von seiner Vergangenheit eingeholt. Es hat auch seine eigene Gegenwart kaum noch im Griff. Wenn Teile des Kontinents wie die Iberische Halbinsel seit geraumer Zeit unter akutem Wassermangel leiden, wenn europäische Städte wie Belgrad, Sarajevo und Skopje, Sofia oder Mailand Winter für Winter im Smog versinken, sind das auch hausgemachte Probleme. Und wenn eine Pandemie den Kontinent unvorbereitet trifft, stehen die Ressourcen, die ihre Bekämpfung erfordert, für andere Zwecke schlicht nicht zur Verfügung.
Kann und darf Europa es riskieren, die sehr nahe gerückte Grenze der Belastbarkeit zu touchieren oder gar zu überschreiten? Da niemand, der bei Sinnen ist, diese Frage bejahen wird, kann es nur um die Mittel und die Wege gehen, die noch zur Verfügung stehen, um das zu verhindern. Viele sind es nicht, denn entscheidende Weichen werden weit jenseits von Europas Grenzen und von anderen gestellt. Wo und wie das geschieht, und warum es dahin gekommen ist, wollen wir uns im Folgenden näher ansehen, um dann abschließend die Frage zu beantworten, was zu tun ist.
KAPITEL 1 Abserviert: Europas Stagnation
Europa war einmal der Nabel der Welt. Jedenfalls gingen die Europäer davon aus. Die Initiative zur raumgreifenden Eroberung, Besetzung und Entschlüsselung der Welt lag seit dem 15. Jahrhundert bei den Europäern, nicht bei den anderen. Sah man das so, konnte man schon übermütig werden und sich für den Dreh- und Angelpunkt allen Geschehens halten.
Den Anfang der Eroberung der Welt machten Spanier und Portugiesen, gefolgt von Niederländern, Engländern und Franzosen. Im Zeitalter der Nationalstaaten und des Imperialismus, also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, kamen Italiener, Belgier und Deutsche hinzu. Und Russland, das eben auch eine europäische Macht war und ist, erlangte seine territoriale Größe nicht zuletzt durch die konsequente Kolonisierung unmittelbar benachbarter Völker. Obwohl im Laufe der Zeit viele außereuropäische Besitzungen, vor allem fast der gesamte amerikanische Doppelkontinent, verloren gingen, blieb die Kolonialherrschaft für ein halbes Jahrtausend das gestaltende Prinzip der Beziehungen Europas zur außereuropäischen Welt.
Selbst der Zweite Weltkrieg brachte vielen ihrer Völker noch nicht sogleich die Befreiung von fremder Herrschaft, im Gegenteil: Die Feldzüge der Deutschen, der Japaner und der Italiener zielten auch auf territoriale Eroberungen. In Afrika kam die große Wende erst 1960, als knapp 20 Staaten unabhängig wurden. Umgekehrt hieß das: Bis in die sechziger Jahre hinein, im Falle Portugals und Spaniens sogar bis 1975, waren viele Staaten Europas immer noch Kolonialmächte. Das galt auch für vier jener sechs Nationen, die Mitte April 1951 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, den Nukleus der heutigen Europäischen Union, ins Leben riefen: Belgien, Frankreich, Italien und die Niederlande waren nach wie vor Kolonialmächte oder verwalteten ihre vormaligen Kolonien im Auftrag der UNO als Mandate. Zwei von ihnen trennten sich erst im Zuge von brutalen Kriegen gegen die von ihnen unterdrückten Völker von ihrem Kolonialbesitz: Frankreich führte von 1946 bis 1954 in Vietnam und von 1954 bis 1962 in Algerien, Belgien 1960 im Kongo Krieg.
Das waren eben jene Jahre, in denen diese beiden Staaten mit ihren europäischen Nachbarn über die Intensivierung ihrer Zusammenarbeit verhandelten. Als die Franzosen Ende März 1957 den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) unterzeichneten, galten für »Algerien und die überseeischen Departements« immer noch besondere Bestimmungen unter anderem über den freien Warenverkehr, die Landwirtschaft und den freien Dienstleistungsverkehr. In diesem Sinne hatte schon der NATO-Vertrag vom April des Jahres 1949 Frankreichs Departements in Algerien ausdrücklich in das Beistandsgebiet aufgenommen.
So gesehen lastete auf dem integrierten Europa von Anfang an ein historischer Schatten. Ganz verzogen hat er sich nie. Das Verhältnis Algeriens zu Frankreich ist nach wie vor durch die langjährige Kolonialherrschaft, die 1830 begann, und insbesondere durch den Krieg geprägt. Eine brisante Situation, denn das strategisch wichtige Land an der mediterranen Gegenküste Europas ist nicht nur ein relevanter Erdöl- und Erdgasexporteur, sondern es spielt auch eine wichtige Rolle im Kampf gegen den internationalen Terrorismus und das internationale Schleuserunwesen. Vergleichbares gilt für viele Staaten Westafrikas, dem Zentrum des ehemaligen französischen Kolonialreichs auf dem Schwarzen Kontinent, wie er von den Europäern genannt wurde. Heute erwarten diese Staaten unter Berufung auf jenes Kapitel der Unterdrückung und Ausbeutung von ihren ehemaligen Kolonialherren und damit von der Europäischen Union Unterstützung im Kampf gegen innere und äußere Gefahren.
Dieser Forderung hat sich auch Deutschland zu stellen. Zwar war das kurze Kapitel deutscher Kolonialherrschaft schon 1918 beendet, aber es hat dieses Kapitel gegeben. Und wenn Europa eine Solidargemeinschaft sein will, dann sind heute alle gefordert, wenn es um einen angemessenen Umgang mit diesem Erbe europäischer Kolonialherrschaft geht.
1945 waren ebenfalls alle gefordert, als es um Antworten auf die Frage ging, wie man mit einem Deutschland umgehen sollte, das gerade einen beispiellosen Eroberungs-, Beute- und Vernichtungsfeldzug gegen seine Nachbarn geführt hatte. Nach der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches und seiner vollständigen Besetzung im Frühjahr 1945 durfte es nie mehr zu einem wie immer gearteten deutschen Wiederaufstieg kommen.
Aber dann nahm die Weltpolitik eine Entwicklung, die kaum jemand vorhergesehen hatte: Vier Jahre nach Kriegsende standen sich die Sieger über Deutschland derart unversöhnlich gegenüber, dass der Konsens zwischen den USA, Großbritannien und Frankreich auf der einen, der Sowjetunion auf der anderen Seite zerbröselte. Das Ergebnis, die Gründung zweier deutscher Staaten westlich von Oder und Neiße, brach nicht nur mit allem, was man sich vorgenommen hatte, sondern es warf auch für die drei Gründer des westdeutschen Teilstaates, insbesondere für Frankreich, eine vitale Frage auf: Wie ließ sich verhindern, dass die im Mai 1949 mit westalliierter Geburtshilfe gegründete Bundesrepublik Deutschland nicht unversehens zu einer Bedrohung für ihre Nachbarn wurde? Die Franzosen wussten, wovon sie sprachen. Dreimal innerhalb von 70 Jahren – 1870, 1914 und zuletzt 1940, also nicht einmal zehn Jahre zuvor – hatten sie einen deutschen Angriff erlebt.
Die aus der Not geborene Strategie, die Paris entwickelte, war eine couragierte Offensive: Wenn man die Bundesrepublik an ihrer eigenen Einhegung beteiligte, schlug man mehrere Fliegen mit einer Klappe. Zum einen nahm man den Deutschen ihren alten Gegner im Westen. Zum anderen stärkte ein solcher Schulterschluss die Europäer im aufziehenden militärischen und weltanschaulichen Konflikt mit dem neuen Gegner im Osten. Und schließlich stellten die Europäer in dieser Konstellation, also mit dem westdeutschen Teilstaat in ihren Reihen, sicher, dass sie als Wirtschafts- und Handelsmacht in der ersten Liga spielten und sich künftig gemeinsam gegen den dominanten amerikanischen Verbündeten behaupten konnten. Über Nacht und ursprünglich nicht gewollt, wurde der Schulterschluss gegen Deutschland zu einem Solidarpakt, der den vormaligen Kriegsgegner einschloss.
Gelingen konnte dieses Projekt nur, weil Franzosen und Deutsche sich die Hand zur Versöhnung reichten. Was heute selbstverständlich klingt, war 1950 eine revolutionäre Tat. Es war Frankreichs Außenminister Robert Schuman, der die Initiative ergriff und den Nachbarn am 9. Mai 1950 vorschlug, »dass der Jahrhunderte alte Gegensatz zwischen Frankreich und Deutschland ausgelöscht wird«, und es war Konrad Adenauer, der Kanzler und damals zugleich Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, der die ausgestreckte Hand ergriff und sie auch in schwierigen Zeiten nicht mehr losließ. Der Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit, der sogenannte Élysée-Vertrag, den Adenauer und Charles de Gaulle, dieser bedeutende französische Staatsmann und seit 1959 erste Präsident der Fünften Französischen Republik, am 22. Januar 1963 in Paris unterzeichneten, war auch die vorläufige Krönung einer bis heute vorbildlichen Auseinandersetzung mit einer kontaminierten Vergangenheit.
Dass es den Franzosen bei alledem immer auch – wenn nicht in erster Linie – darum ging, den sich abzeichnenden Aufstieg des westdeutschen Teilstaates unter strenger Beobachtung zu halten und so gesehen in seiner Handlungsfreiheit zu beschränken, war offensichtlich. Als Schuman im Mai 1950 vorschlug, »die Gesamtheit der französisch-deutschen Kohle- und Stahlproduktion unter eine gemeinsame Oberste Aufsichtsbehörde (Haute Autorité) zu stellen«, wollte er diese natürlich auch einer strengen Kontrolle unterwerfen und damit sicherstellen, dass einer Wiederbelebung der deutschen Rüstungsindustrie von Anfang an ein schwerer Riegel vorgeschoben wurde.
Zwar erschien die Vorstellung, dass die Bundesrepublik jemals wieder eine militärische Kapazität bekommen werde, im Mai 1950 völlig abwegig. Aber dann ließ der Ausbruch des Koreakrieges, auf den wir im fünften Kapitel zurückkommen werden, nicht einmal drei Monate später den französischen Albtraum Wirklichkeit werden. Weil nämlich nicht auszuschließen war, dass es ähnlich wie im geteilten Korea auch im geteilten Deutschland zu einem massiven Vorstoß kommunistischer Truppen kommen konnte, dachten vor allem die Amerikaner darüber nach, die Bundesrepublik an der Verteidigung zu beteiligen.
Als Kanzler Adenauer die Chance erkannte, die darin steckte, als er die Bereitschaft der Bundesrepublik signalisierte, sich an der Verteidigung des Westens zu beteiligen, und als er dieses Angebot auch noch mit der Forderung verband, der Bundesrepublik im Gegenzug die ausstehende außenpolitische Souveränität zuzugestehen, blieb den Franzosen nur die Flucht nach vorn. Im Oktober 1950 schlug Frankreichs Ministerpräsident vor der Nationalversammlung die Einrichtung einer Europäischen Armee vor.
Auf dem Reißbrett ist das integrierte Europa also gewiss nicht entstanden. Zwischen Mai und Oktober 1950 wurde improvisiert, in den folgenden vier Jahren wurde dilettiert. Belgien, Italien, Luxemburg und die Niederlande nahmen Schumans Einladung an und hoben Mitte April 1951 mit Frankreich und der Bundesrepublik eine Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) aus der Taufe. Das war der erste, ein kontrollierter und gewollter Schritt. Die Sechs sind die eigentlichen Gründer der heutigen Europäischen Union.
Krachend gescheitert ist hingegen der Versuch dieser Sechs, eine gemeinsame Armee, die sie »Europäische Verteidigungsgemeinschaft« (EVG) nennen wollten, aufzustellen. Fast vier Jahre machten sie sich das Leben schwer, bis ausgerechnet die Franzosen, von denen diese Idee stammte, der europäischen Armee im August 1954 eine Abfuhr erteilten. Das hatte schwerwiegende Folgen – für Frankreich, für Deutschland und für Europa. Weil weder die Bewaffnung der Bonner Republik noch die Erlangung ihrer äußeren Souveränität vom Tisch waren, blieb jetzt nämlich nur noch ein Weg, auf dem sich dieser politische und eben auch militärische Aufstieg der Bundesrepublik aus den Trümmern des Weltkriegs flankieren und kontrollieren ließ: ihre Aufnahme in die NATO, mit der wir uns im folgenden Kapitel beschäftigen wollen. Damit stand die deutsche Aufrüstung nicht unter französischer, sondern unter amerikanischer Kontrolle.
Von diesem Rückschlag hat sich Europa nie mehr erholt. Was folgte, war Stückwerk. Versuche, das zu ändern, gab es viele. Erfolgreich war am Ende keiner. So regte die rot-grüne Bundesregierung 1999 die Einrichtung einer gemeinsamen »Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik« (ESVP) an. Diese wurde auch 2001 in das europäische Vertragsrecht eingefügt und firmiert seit dem Vertrag von Lissabon, der im Dezember 2007 unterzeichnet und zwei Jahre später ratifiziert wurde, als Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP). Dass es dann aber im Wesentlichen dabei blieb, den Worten also keine Taten folgten, hatte einen schlichten Grund: Für einen Neuanfang fehlten schon immer die Mehrheiten.
Um diese Blockade zu durchbrechen, hatten die Staats- und Regierungschefs Belgiens, Deutschlands, Frankreichs und Luxemburgs Ende April 2003 im belgischen Tervuren einen neuen Weg eingeschlagen: An der »Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion«, die sie anregten, sollten die Staaten der EU teilnehmen, die dazu bereit und fähig waren. Obgleich damit gerade keine »Abkoppelung« Europas von den USA, sondern eine Stärkung des »europäischen Pfeilers« der NATO gemeint war, wurde die Initiative von den meisten dennoch als Absetzbewegung interpretiert und damit verworfen. Heute ist die Grundidee dieser Initiative aktueller denn je.
Gewiss, begrenzte Einsätze der European Union Force (EUFOR) seit 2003 in Nordmazedonien und in Bosnien-Herzegowina, in der Demokratischen Republik Kongo, der Zentralafrikanischen Republik oder auch am Horn von Afrika signalisierten, dass die GSVP nicht nur auf dem Papier stand. Doch diese Einsätze machten auch deutlich, was schon der Jugoslawienkrieg des ausgehenden 20. Jahrhunderts offenbart hatte und was der Libyeneinsatz mehrerer EU-Mitglieder, darunter Frankreich und Großbritannien, den Europäern im Frühjahr 2011 noch einmal drastisch vor Augen führte: Ohne die NATO-Vormacht USA war und ist die Europäische Union – mit oder ohne Großbritannien – weder willens noch in der Lage, eine militärische Operation dieser Dimension durchzuführen.
Wenn es darauf ankommt, fehlt es bis heute mehr oder weniger an allem, insbesondere an Geschlossenheit und Selbstvertrauen, aber auch an ausreichender Munition, an Kapazitäten zur Aufklärung und Zielerfassung, Luftbetankungskapazitäten, Kampfhubschraubern oder auch Transportflugzeugen. Dabei hat Europa im Prinzip alles, was eine moderne Armee braucht, um den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft gewachsen zu sein, darunter eine leistungsfähige, allerdings in Teilen nicht effiziente Rüstungsindustrie und ein nukleares Abschreckungspotential.
In der Praxis scheitert jedoch auch hier vieles an nationalen Egoismen. So weigert sich Frankreich, das nach dem britischen Auszug aus der EU die einzige Nuklearmacht der Europäer ist, schon seit den Tagen Charles de Gaulles beharrlich, den Rest der Gemeinschaft an den Planungen teilhaben zu lassen. Von Mitsprache bei einem eventuellen Einsatz der französischen Nuklearwaffen gar nicht zu reden. Das Angebot Emmanuel Macrons, mit den europäischen Partnern in einen Dialog über die französischen Nuklearwaffen zu treten, könnte zu einem Umdenken führen. Man sollte es annehmen.
Was gemeinsam entwickelte Waffensysteme angeht, so hapert es an der Effizienz und Zuverlässigkeit. Weil Airbus auch ein Jahrzehnt nach dem Erstflug des Transportflugzeugs A400M nicht in der Lage war, die deutschen und die französischen Streitkräfte zeitnah mit den georderten Maschinen zu versehen, ist die deutsch-französische Lufttransportstaffel, die 2024 voll einsatzfähig sein soll, auf amerikanische C-130 J Super Hercules angewiesen. Bei anderen Ergebnissen der europäischen Rüstungsindustrie wie den Mehrzweckkampfflugzeugen der Typen Tornado oder Eurofighter waren wichtige Partner, in diesem Falle Frankreich, nicht mit an Bord. Ob und wann das von Deutschland, Frankreich und Spanien geplante Future Combat Air System (FCAS) jemals abheben wird, steht in den Sternen. Das ist eine perspektivlose Planung mit handfesten Folgen auch für die deutsche Luftwaffe.
Die Deutschen wie auch einige andere NATO-Verbündete sind nämlich verpflichtet, jene Flugzeuge zu stellen, mit denen gegebenenfalls die in Deutschland lagernden amerikanischen Atombomben zu ihren Zielen gebracht werden können. Derzeit stehen dafür noch die in die Jahre gekommenen Tornados zur Verfügung. Die Frage nach einem Nachfolger zeigt, wie einseitig abhängig die Bundesrepublik in solchen Punkten immer noch von den USA ist. Da das FCAS frühestens in zwei Jahrzehnten einsatzbereit sein dürfte, kommt auf europäischer Seite nur eine entsprechend konfigurierte Weiterentwicklung des Eurofighter infrage. Und die müsste, wann immer sie einsatzbereit ist, in den USA zertifiziert werden. Damit hätten die Amerikaner nicht nur das letzte Wort, sondern sie bekämen auch einen tiefen Einblick in die Technik des Eurofighters und hätten es überdies in der Hand, den Zeitpunkt der Zertifizierung zu bestimmen, der kaum vor 2030 liegen dürfte.
Die einzige Alternative, nämlich der Kauf Dutzender amerikanischer F-18, ist keine. Denn damit würde die Lagerung der 20 amerikanischen Atombomben in Deutschland auf unbestimmte Zeit fortgeschrieben und legitimiert, obgleich die sogenannte nukleare Teilhabe, ein Kind des Kalten Krieges, dringend auf den Prüfstand gehört: Dass sie im Ernstfall wirklich funktioniert, war schon vor 1991 schwer zu glauben. Die Nukleare Planungsgruppe (NPG), die am 14. Dezember 1966 eingesetzt wurde und der Deutschland bis heute als Ständiges Mitglied angehört, gab den Verbündeten die Möglichkeit, in dieser vitalen Frage gehört zu werden, war aber im Kern nichts anderes als ein Versuch der Amerikaner, ihr »militärisches Protektorat über Europa« beziehungsweise ihre dortige »Atomhegemonie akzeptabel zu machen«, wie Franz Josef Strauß und Henry Kissinger klarsichtig diagnostizierten.
Anzunehmen, diese Konsultationsbereitschaft gelte auch im Ernstfall, also in einer Situation, in der Entscheidungen in wenigen Minuten zu treffen sind, war schon damals weltfremd. Wenn es darauf ankommt, ist der Einsatz der amerikanischen Atomwaffen eine Angelegenheit Washingtons. Das gilt selbstverständlich auch für die in Belgien, den Niederlanden, Italien und nicht zuletzt in Deutschland gelagerten knapp 140 taktischen Atomwaffen. Dass sich die amerikanische Regierung bis heute weigert, die deutsche offiziell davon zu unterrichten, wo die Waffen gelagert sind, spricht für sich. Die Anschaffung der F-18 dürfte sie in dieser Haltung bestärken. Und dem Aufbau einer europäischen Armee ist diese Entscheidung ganz gewiss nicht förderlich.
Sechseinhalb Jahrzehnte nach dem Scheitern der EVG ist die Europäische Union von einer schlagkräftigen Verteidigungsgemeinschaft fast so weit entfernt wie 1954. Die Folgen sind unerfreulich bis verheerend. Und je weiter die Zeit voranschreitet, je unbeweglicher Europa im intellektuellen Korsett des Kalten Krieges gefangen bleibt, je mehr – weltweit und auch in westlichen Metropolen – irrational agierende Akteure das Heft des Handelns in die Hand nehmen beziehungsweise gelegt bekommen, umso schlimmer wird es.
Die Hilflosigkeit, mit der die EU die dramatischen Zuspitzungen in der Region des Persischen Golfes mahnend und warnend verfolgt, von denen wir im achten Kapitel berichten werden, ist beschämend und erschütternd. Und sie ist eine Quittung für das wiederholte Versäumnis, außen- und verteidigungspolitisch angemessene Konsequenzen aus der Lage zu ziehen, in der sich Europa ja nicht erst befindet, seit die amerikanische Politik den Rest ihrer Glaubwürdigkeit verloren hat.
Die unbefriedigend geregelte europäische Verteidigung zeigt, welche langfristigen Folgen es haben kann, wenn Vertragsparteien nicht von Anfang an bereit oder willens sind, ihre weitreichenden Vereinbarungen mit einem tragfähigen Fundament zu versehen. Dazu gehört Mut, und dazu gehört Weitsicht. Unter den Handlungszwängen der Tagespolitik, dem Druck gegenläufiger Interessen und der nicht immer ausreichend verfügbaren Kompromissfähigkeit sind diese häufig ebenfalls nicht ausreichend vorhanden. Die Rechnung für das dementsprechend wacklige Konstrukt wird Jahre, mitunter Jahrzehnte später präsentiert.
So auch im Falle der gemeinsamen Wirtschafts- und Währungspolitik der EU. Sie war von Anfang an Stückwerk. Zwar rückten die sechs Gründungsmitglieder auf diesem Feld seit Mitte der fünfziger Jahre enger zusammen. Doch blieben die 1957 von ihnen ins Leben gerufene Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die gleichzeitig gegründete Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) deutlich hinter den hehren Integrationszielen der Anfänge zurück. Daran änderte auch die Verschmelzung der Organe von EWG, EURATOM und EGKS zur »Europäischen Gemeinschaft« (EG) wenig, wie das Unternehmen seit 1967 euphemistisch genannt wurde, im Gegenteil: Je komplexer die Organisation wurde, umso mehr Energien wurden durch ihr Management absorbiert.
Die Folge war ein bizarrer politischer Autismus, gepflegt in einem monströsen bürokratischen Apparat, der nicht minder bizarre Entscheidungen hervorbrachte. Die sogenannte Milchquote, welche 1984 die Milchanlieferungsmenge des Milchwirtschaftsjahres 1983 als Referenz festlegte, war Planwirtschaft par excellence. Als die Quote 2015, also immerhin ein Vierteljahrhundert nach dem Untergang des sowjetischen Modells, aufgehoben wurde, zeigte sich, dass Europa auf die Gesetze des grenzenlosen Marktes kaum vorbereitet war: Nach dem Wegfall der Subventionen stürzten – nicht nur – die Milchpreise in dem global überversorgten Markt ins Bodenlose.
Dass den Europäern durch die Gesetze des grenzenlosen Marktes auch auf ihrem Binnenmarkt das Heft des Handelns über kurz oder lang aus der Hand genommen werden würde, hätte man schon sehen können und wohl auch müssen, als die Staats- und Regierungschefs am 7. Februar 1992 im niederländischen Maastricht eine Antwort auf die neue Lage formulierten. Tatsächlich war der Vertrag in erster Linie eine Reaktion auf die atemberaubende politische Entwicklung in Europa. Noch im Herbst 1989 hatte praktisch niemand mit der politischen Insolvenz des DDR-Regimes, mit dem Fall der innerdeutschen Grenze und der Mauer in Berlin gerechnet, gar nicht zu reden von einer Vereinigung Deutschlands, die mit der Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde zum sogenannten Zwei-plus-Vier-Vertrag im März 1991 völkerrechtlich abgeschlossen war.
Dieses im wahrsten Sinne des Wortes weltbewegende Ereignis, das mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und ihres politischen, wirtschaftlichen und militärischen Imperiums, dem Zweiten Golfkrieg oder auch der Auflösung Jugoslawiens einherging, setzte die EG unter enormen Handlungsdruck. Hinzu kam, dass sich die Zahl ihrer Mitglieder seit den fünfziger Jahren verdoppelt hatte. 1973 waren Dänemark, Irland und Großbritannien, 1981 Griechenland sowie 1986 Portugal und Spanien aufgenommen worden.
Nach dem Umsturz der alten Weltordnung und der sich abzeichnenden globalen Öffnung der Märkte zog es 1995 Finnland, Österreich und Schweden in die »Europäische Union« (EU), wie sich die Gemeinschaft seit dem Vertrag von Maastricht nennt. Lediglich die Norweger lehnten den Beitritt zweimal per Referendum ab. Bis heute haben sie ihre Entscheidung nicht bereut. Sie können sich das leisten, weil ihre Rohstoffvorkommen ihnen eine große Unabhängigkeit garantieren und weil Norwegen als Teil des Europäischen Wirtschaftsraums ein vollwertiges Mitglied des EU-Binnenmarktes ist.
Seit dem Exitus der Sowjetunion drängten dann auch noch etliche vormalige Sowjetrepubliken und Staaten ihres ehemaligen Herrschaftsbereichs in die EU: 2004 wurden Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn, außerdem Malta und Zypern, 2007 Bulgarien und Rumänien, 2013 schließlich Kroatien in die EU aufgenommen.
Spätestens als sich dieser Drang 1991 abzeichnete, hätte die Gemeinschaft die Kraft zu einer grundlegenden Reform ihrer Strukturen finden und sich nicht zuletzt auf die neuen Spielregeln eines grenzenlosen Marktes einstellen müssen. Sie tat es nicht. Die Milchquote blieb. Das planwirtschaftliche Denken überlebte. Womöglich war das, Milch hin oder her, aber auch ein entscheidender Vorteil, als es darum ging, die wirtschaftlich weit abgeschlagenen, in planwirtschaftlichen Strukturen festsitzenden Volkswirtschaften Ost- und Ostmitteleuropas an den freien Markt heranzuführen.
Das wirft die Frage auf, ob sich markt- und planwirtschaftliche Maximen grundsätzlich im Wege stehen müssen oder ob sie nicht in bestimmten Situationen eine Symbiose bilden können. Einiges spricht dafür, in kleinem Maßstab das im Kern planwirtschaftlich organisierte deutsche Gesundheitswesen, das dabei half, die Corona-Krise erst einmal in den Griff zu bekommen. Im großen Maßstab scheint das der Fall China nahezulegen, den wir uns im vierten Kapitel anschauen.
Der Vertrag von Maastricht war kein Reformvertrag im eigentlichen Sinne des Wortes. Er baute die Gemeinschaft lediglich um. Er machte die Europäischen Gemeinschaften EGKS, EWG und EURATOM zu einer von drei tragenden Säulen des Hauses EU. Die zweite Säule wurde gebildet von der besagten Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und die dritte von der später sogenannten polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen.
Dass diese komplexe Konstruktion durchschau- und beherrschbar war, bezweifelten selbst diejenigen, die sie geschaffen hatten. Das »Monstrum von Maastricht«, wie die Kritiker den Vertrag schon damals nannten, war ein Kompromiss. Das ist für sich genommen weder ein Makel, noch ist es ungewöhnlich. Verträge sind immer auch Kompromisse. Aber der Vertrag von Maastricht war ein fauler Kompromiss. Schon sein Umfang von 250 Seiten deutet darauf hin, dass er vor allem ein Sammelsurium partikularer Interessen und Ausnahmeregelungen ist. Heute kann man sagen, dass mit diesem Vertrag die Stagnation und mit der Stagnation die Vergreisung Europas begann.
Dass es so kam, liegt an seinem wohl entscheidenden Konstruktionsfehler: Die Architekten überließen die überfällige Bildung der Politischen wie auch der Wirtschaftlichen Union der künftigen Entwicklung. An dieser Aufgabe sind bis heute alle Bundesregierungen gescheitert, auch die rot-grüne und ihr Kanzler. In diese Amtszeit fällt allerdings der einzige aussichtsreiche Versuch, das europäische Haus doch noch mit dem überfälligen Fundament, nämlich mit einer Verfassung, zu versehen.
Im Juni 1995 hatte die SPD im Deutschen Bundestag den Vorschlag eingebracht, den ausstehenden europäischen Grundrechtekatalog durch einen Konvent erarbeiten zu lassen. Im Dezember 1999 trat dieser unter Leitung des vormaligen Bundespräsidenten Roman Herzog zusammen, ein Jahr später wurde die Grundrechtecharta der EU verkündet. Sie war der erste Schritt auf dem Weg zu einer europäischen Verfassung.
Was lange Zeit kaum ein Beobachter für möglich gehalten hätte, geschah dann doch. Ein zweiter, vom ehemaligen französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d’Estaing geleiteter Konvent kam zu einem Ergebnis. Nie zuvor und niemals seither war man so nahe daran, dem gemeinsamen Haus ein Fundament zu verpassen. Und man hatte in einer strittigen, wenn nicht der strittigsten Frage zu einem tragfähigen Kompromiss gefunden: Der Mehrheitsbeschluss sollte in allen Fragen möglich werden, und dafür waren 55 Prozent der Ratsstimmen und 65 Prozent der repräsentierten Bevölkerung Europas nötig. Damit wären Blockade- und Erpressungsversuche Einzelner vom Tisch gewesen.
Am 29. Oktober 2004 wurde der Verfassungsvertrag unterzeichnet. Dass er nie in Kraft trat, lag erst an den Briten, dann an den Franzosen. Schon im April 2004 hatte der britische Premier Tony Blair angekündigt, ein Referendum über den Verfassungsvertrag abhalten zu lassen. Wenn man so will, war das der erste Schritt zum Brexit. Dadurch wurden andere unter Zugzwang gesetzt, etwa Frankreichs Staatspräsident Jacques Chirac, der in seinem Land nun auch einen Volksentscheid ansetzte. Als das Referendum dort Ende Mai und in den Niederlanden Anfang Juni 2005 scheiterte, war es um die Verfassung geschehen.
War es Zufall, dass der Vertrag in dem Land scheiterte, das sich immer schon gegen Mehrheitsentscheidungen gestemmt und damit dem Wildwuchs partikularer Interessen Tür und Tor geöffnet hatte? Ein Meister dieser Politik war Charles de Gaulle. 1965 erfand er die Politik des »leeren Stuhls«, zog für ein halbes Jahr den französischen Repräsentanten aus dem Ministerrat der EWG zurück und blockierte zugleich die Planungen für ihren weiteren Ausbau.
An einer dauerhaften Sabotage oder gar Demontage konnte auch de Gaulle nicht gelegen sein. Denn zum einen brauchte der General die europäischen Gemeinschaften, um Frankreich in die ersehnte Position einer gleichrangigen Weltmacht neben den Sowjets und den Amerikanern zu bringen – im Übrigen ein Bestreben, das alle französischen Präsidenten von Format bis hin zu Emmanuel Macron mit de Gaulle teilen. Zum anderen zwang die Frontstellung des Kalten Krieges sämtliche Mitglieder der westlichen Gemeinschaften, auch die extrovertierten unter ihnen, immer wieder zum Schulterschluss.
Mit diesem Zwang ist es seit 1991 vorbei. Seit die Sowjetunion und ihr Imperium von der weltpolitischen Bühne abgetreten sind, fehlt ein entscheidendes, wenn nicht sogar das entscheidende Bindemittel. Deshalb und weil die Europäer neue Herausforderungen wie den Klimawandel, die globale Migration oder Heimsuchungen wie die Pandemie noch immer nicht als drängend genug empfinden, um die Reihen zu schließen und gemeinsam zu handeln, blühen die Partikularismen. Die daraus folgenden Risse in der Gemeinschaft sind längst nicht mehr zu »übertünchen«, wie Stefan Kornelius analysiert: Rechtsverstöße werden »begangen und wütend toleriert«, Haushaltsdefizite werden »aufgetürmt und toleriert«, militärische Defizite werden »gegeißelt, aber hingenommen«, kurzum: »Europa ist ein Amalgam aus Interessen und Besonderheiten.« Keines der Mitglieder ist dagegen gefeit.
Auch Deutschland nicht. Die Entscheidung der Bundesregierung vom September 2015, die Grenzen für Flüchtlinge und Migranten offenzuhalten, war in einer eskalierenden Situation als humanitäre Geste angemessen und wohl auch unvermeidlich. Aber sie war zugleich ebenso ein Alleingang wie die flankierende Botschaft, welche die Bundeskanzlerin mit ihrem »Wir schaffen das« der Welt zukommen ließ. Viele verstanden das als Einladung, machten sich »danach erst auf den gefährlichen Weg«, opferten ihre Ersparnisse und vertrauten »ihr Leben dubiosen Schleppern« an, sagt der Entwicklungsökonom und Migrationsforscher Paul Collier, einer der besten Kenner der Materie. Und er fügt hinzu: »Es kann nicht sein, dass ein Land anderen sagt, was sie tun müssen. Das wäre moralischer Imperialismus.« Genau so sahen das viele dieser »anderen«. Auch die Briten. Die Sorge vor einer – neuen – Welle unkontrollierter Einwanderung war maßgeblich für ihren Entschluss, dem integrierten Europa den Rücken zu kehren.
Im Übrigen ist der Brexit kein Betriebsunfall. Dass nach den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2019 in Staaten wie Belgien, Frankreich, Großbritannien oder Italien die Parteien eine Mehrheit holten, die dieses Europa auf die eine oder andere Weise demontieren wollen, ist ein Fanal. Es ist ein Indiz für den wachsenden Unmut über ein institutionelles Monster, das Zeit und Energie für ein ritualisiertes Geschacher um Posten in der EU aufbringen kann, während die drängenden Themen der Gegenwart in den Akten der Brüsseler Amtsstuben Staub ansetzen. Und dann sind die Wahlergebnisse des Frühjahrs 2019 auch ein unpolitischer, in vieler Hinsicht irrationaler Reflex auf ein politisches Vakuum. Es trat an die Stelle der bis heute ausstehenden Antwort auf die vor beinahe 30 Jahren aufgeworfene, entscheidende Frage: Wer sind wir, und wo stehen wir?
Für sich genommen ist der Austritt Großbritanniens aus der EU keine Katastrophe. Historisch gesehen ist er sogar konsequent. Denn für die Briten war die Mitgliedschaft nie eine Herzensangelegenheit wie – jedenfalls zeitweilig – für Deutsche oder Franzosen. In den fünfziger Jahren wollten sie den europäischen Gemeinschaften nicht beitreten, in den sechziger Jahren durften sie es nicht, weil Charles de Gaulle wiederholt sein Veto einlegte, und als die Briten dann 1973 aufgenommen wurden, verging kaum ein Jahr, in dem sie keine Sonderwünsche anmeldeten und deren Durchsetzung mit Forderungen oder auch Drohungen, einen möglichen Austritt inklusive, verbanden.
Im Grunde sollte nach dem Austritt schon mangels vernünftiger Alternativen alles seinen geregelten Weg gehen. Großbritannien und die Europäische Union werden Verträge, allen voran über den beiderseitigen Handel schließen, so wie das in der Weltwirtschaft üblich ist. Der Prozess mag sich hinziehen, es mag Rückschläge geben. Auch bleibt Boris Johnson wohl unberechenbar. Aber eine Rückkehr zum Protektionismus wird schon deshalb niemand wollen, weil Trumps Außenwirtschaftspolitik gezeigt hat, wohin das führen kann. So gesehen hat dieser amerikanische Präsident Europa wider Willen einen Gefallen getan.