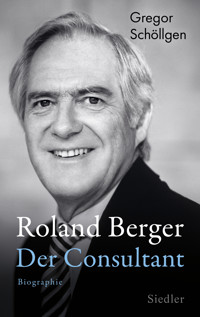6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Jahrzehntelang war er eine Institution in Millionen deutschen Haushalten: der Quelle-Katalog. Er war das Medium, das nicht nur für eine besonders enge Verbindung zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden sorgte, das darin präsentierte Produktangebot prägte vielmehr auch entscheidend den Geschmack und die Alltagskultur im Wirtschaftswunderland. Gregor Schöllgen, der wohl profilierteste Kenner deutscher Unternehmerfamilien, legt nun die erste umfassende Biographie des Quelle-Gründers Gustav Schickedanz vor. Auf der Grundlage bislang nicht zugänglicher Informationen schildert er die Anfänge des Versandhauses seit den 1920er Jahren und beschreibt den Aufbau jenes Industrieimperiums, mit dem Gustav Schickedanz seinem Unternehmen während der 1930er Jahre ein zweites Standbein neben dem Versandhandel verschaffte. Nach dem Krieg wurde Schickedanz deshalb vorgeworfen, Nutznießer von Arisierungen gewesen zu sein. Auch wenn sich die Vorwürfe am Ende als unhaltbar erwiesen, gelingt es Schöllgen doch, exemplarisch die Grauzonen aufzuzeigen, in denen sich jedes Wirtschaftsunternehmen in einer Diktatur unweigerlich bewegt. Die Zeit des Wirtschaftswunders und der aufbrechenden Konsumgesellschaft bedeutete für Quelle schließlich einen beispiellosen Aufschwung, ein Erfolg, der - so Schöllgens Fazit - am Ende ohne das unternehmerische Genie von Gustav Schickedanz keine Zukunft haben konnte. Schöllgens Werk ist die gleichermaßen faszinierende wie differenzierte Darstellung eines zentralen Kapitels der deutschen Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Gregor Schöllgen
Gustav Schickedanz
1895–1977
Biographie eines Revolutionärs
Berlin Verlag
Vorwort
Damit hatte ich nicht gerechnet. Als ich im Sommer 2007 von Madeleine Schickedanz, der jüngeren Tochter des Quelle-Gründers, mit der Sichtung und Ordnung seines Nachlasses beauftragt wurde und dabei die Idee einer Biographie entstand, habe auch ich nicht den vollständigen Zusammenbruch des Lebenswerks von Gustav Schickedanz vorhergesehen.
Allerdings wurde mir im Zuge der Recherche und der Niederschrift deutlich, dass dieses Lebenswerk in hohem Maße an seinen Schöpfer gebunden war. Eine Generationen überbrückende Zukunft wäre ihm wohl nur dann beschieden gewesen, wenn sich die Nachfolger des »großen Gustav« zu einer tiefgreifenden Reform hätten entschließen können oder wollen. Weil aber eine solche Reform aus ihrer Sicht eine Demontage des Mannes und seiner Lebensleistung bedeutet hätte, verharrten die Nachfolger lange in seinem mächtigen Schatten, suchten sich spät aus diesem zu lösen, um schließlich doch wieder in ihn zurückzukehren: Das neuerliche Engagement im Warenhausgeschäft erfolgte zu einer Zeit, als die Konkurrenz deren Zeichen längst anders gedeutet und sich neuen Horizonten zugewandt hatte.
Dieses Buch erzählt die ganze Geschichte. Zu ihr gehört die vielschichtige und zuletzt dramatische Entwicklung des Unternehmens wie der Familie Schickedanz seit dem Tod des Quelle-Gründers im Frühjahr 1977. Zum ersten Mal und auf der Basis bislang nicht verfügbarer Einsichten und Informationen wird im abschließenden Kapitel der Niedergang des Hauses Schickedanz bis zur Insolvenz geschildert und gezeigt, warum und wie es zu diesem in der jüngeren deutschen Unternehmensgeschichte beispiellosen Drama kommen konnte.
Zur ganzen Geschichte gehört aber auch der Aufbau jenes Industrieimperiums, mit dem Gustav Schickedanz seinem Unternehmen während der dreißiger Jahre ein zweites Standbein neben dem Versandhandel verschaffte. Da es sich bei den Vorbesitzern, zum Beispiel den Eigentümern der Vereinigten Papierwerke mit ihren Verkaufsschlagern »Tempo«-Taschentücher und »Camelia«-Binden, durchweg um Juden handelte, sah sich Schickedanz nach dem Krieg mit dem Vorwurf konfrontiert, deren Lage skrupellos ausgenutzt zu haben. Wegen der Prominenz des Namens wurde der Fall Schickedanz in einer Serie von Entnazifizierungs- und Wiedergutmachungsverfahren mit einer Gründlichkeit aufgerollt und untersucht wie kein zweiter.
In diesem Buch wird der Fall Schickedanz erstmals im Zusammenhang dargestellt – lückenlos und nicht zuletzt auf der Grundlage bislang unzugänglicher Dokumente. Das schließt eine Antwort auf die Frage ein, welche Personen eigentlich als Ankläger, als Gutachter, als Vorsitzende der Spruch- beziehungsweise Wiedergutmachungskammern oder auch als Treuhänder mit dem Fall befasst gewesen sind. Bisher ist diese Frage für kaum eines der prominenten Verfahren gestellt worden. Das Ergebnis zeigt, dass die Anfang der siebziger Jahre aufgestellte These von der »Mitläuferfabrik« – also die Entlastung Belasteter durch ihresgleichen beziehungsweise durch inkompetentes Personal – jedenfalls bei Schickedanz nicht greift.
Zur ganzen Geschichte gehört schließlich die Karriere jener »Quelle«, mit deren Gründung 1927 alles begann und die wie kaum ein anderes Markenzeichen zum Inbegriff der deutschen Wohlstandsgesellschaft geworden ist. Gustav Schickedanz, ihr Schöpfer, war der Mann des diskreten und eben deshalb tiefgreifenden Wandels. Das Medium seines revolutionären Wirkens war der Katalog. Mit seiner Hilfe hat der Pionier des deutschen Versandhandels die Gesellschaft der Republik auf eine Weise und mit einer Nachhaltigkeit beeinflusst und verändert, wie kein Zweiter vor und kaum ein anderer nach ihm. Heute weiß ich, was mir vor der Arbeit an diesem Buch nicht bewusst gewesen ist: Ohne den Quelle-Katalog lässt sich die deutsche Nachkriegsgeschichte nicht erzählen.
Dass ich sie erzählen konnte, lag vor allem an dem uneingeschränkten Zugang zum Nachlass der Familie Schickedanz, den mir die jüngere Tochter des Quelle-Gründers ermöglicht hat. Madeleine Schickedanz gilt daher mein besonderer Dank. Danken darf ich auch anderen Mitgliedern der Unternehmerfamilie, Weggefährten und Mitarbeitern von Gustav Schickedanz und seiner Frau Grete sowie Geschäftspartnern und Konkurrenten des Fürther Unternehmers für ihre Gesprächsbereitschaft oder auch für die Überlassung von Dokumenten aller Art.
Nicht zuletzt und einmal mehr danke ich den Mitarbeitern am Zentrum für Angewandte Geschichte (ZAG) der Universität Erlangen (www.zag.uni-erlangen.de) für die hervorragende Zusammenarbeit. Namentlich Herr Dr. Claus W. Schäfer und Herr Matthias Braun, M. A., haben entscheidend zur Entstehung dieses Buches beigetragen.
Erlangen, im April 2010
Gregor Schöllgen
Der Suchende
1895–1929
Fürth ist nicht gerade der Nabel der Welt. Aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Fürth für einige Jahrzehnte mit dem Rest der Welt so eng verbunden wie kaum eine zweite Stadt in Deutschland. Denn hier, mitten im beschaulichen Franken, hat das größte Versandhaus Europas seinen Sitz. Die Quelle, der größte Privatkunde der Deutschen Bundespost, ist das Lebenswerk von Gustav Schickedanz.
Als der kleine Gustav am Neujahrstag 1895 in Fürth das Licht der Welt erblickt, ist diese Karriere natürlich noch nicht vorhersehbar – seine eigene nicht und die seiner Stadt auch nicht. Allerdings hat Fürth schon damals einen guten Ruf als Ort des Handels und des Gewerbes. Denn sie kann dem einen wie dem anderen einiges bieten, zum Beispiel eine gute Anbindung an das Eisenbahnnetz Bayerns, zu dem Fürth nach einem kurzen, aber für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt nicht unwichtigen Intermezzo unter preußischer Herrschaft seit 1806 gehört.
Wie sich überhaupt der Name Fürth in besonderer Weise mit der Eisenbahn, dem Motor der rasanten industriellen Entwicklung der Zeit, verbindet. Hier nämlich endete im Dezember 1835 – nach rund sechs Kilometern und aus Nürnberg kommend – die Reise des »Adler«, jener legendären Lokomotive mit der Achsfolge 1A1, welche die Ludwigsbahn mit ihren Passagieren nach Fürth zog und damit das Eisenbahnzeitalter in Deutschland einläutete. Zwar ging der überregionale Verkehr danach erst einmal für rund vierzig Jahre an Fürth vorbei, aber jetzt, an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, ist die bald 50000 Einwohner zählende Stadt unter anderem durch Strecken der Bayerischen Staatsbahnen und der Münchener Lokalbahn-Aktiengesellschaft mit der Außenwelt verbunden.
Im Übrigen ist Fürth Sitz eines Land- und eines Amtsgerichts, eines Rent- und eines Hauptzollamtes, einer Reichsbanknebenstelle und einer Agentur der Bayerischen Notenbank sowie eines Bezirksgremiums für Handel und Gewerbe. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts wurden hier in rund 3000 Betrieben fast 7000 Beschäftigte gezählt, und seit die Maschinenfabrik Engelhardt 1844 die erste Dampfmaschine in Betrieb genommen hat, erarbeitet sich Fürth rasch einen Ruf als aufstrebende Industriestadt. 1907 sind in den dortigen Gewerbebetrieben 28000 Beschäftigte in Lohn und Brot. Als Jakob Wassermann, der 1873 in Fürth geboren wurde und nach dem Ersten Weltkrieg zu den meistgelesenen deutschen Schriftstellern zählt, 1921 auf seine Jugend als »Deutscher und Jude« in dieser »protestantischen Fabrikstadt« zurückblickt, erinnert er sich an eine »Stadt des Rußes, der tausend Schlöte, des Maschinen- und Hämmergestampfes, der Bierwirtschaften, der verbissenen Betriebs- und Erwerbsgier«.
Neben der traditionsreichen Spiegelindustrie spielen in Fürth die Blattmetall- und die Bronzefarbenindustrie und nicht zuletzt das Holz verarbeitende Gewerbe eine bedeutende Rolle. Dort ist auch Johann Leonhard Michael Schickedanz tätig. Als sein Sohn Gustav geboren wird, arbeitet er als Geschäftsführer bei der Möbelfabrik Hemmersbach. Er selbst ist gebürtiger Nürnberger, denn dorthin hat es seinen Vater Johann Nicolaus Schickedanz, Gustavs Großvater, 1840 verschlagen.
Ursprünglich schrieb sich die Familie »Schicketanz«. Der Name stammt aus dem schlesisch-sächsischen Raum. Das mittelhochdeutsche »schick« stand ursprünglich nicht nur für »schicklich« und »geschickt«, sondern auch für »ordnen« und »rüsten«, und »Schicketanz« bedeutete so viel wie »Tanzordner« oder auch »Tanzlehrer«. In den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts hat Johann Nicolaus »Schiketanz« übrigens vorübergehend von der alten Schreibweise des Familiennamens Gebrauch gemacht, um sich von einem nicht verwandten Namensvetter in der Stadt abzugrenzen, und auch später, zum Beispiel in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, bedient sich ein Briefpartner von Gustav Schickedanz, der Maler Matthäus Schiestl, gelegentlich der ursprünglichen Schreibweise.
Die Familie ist seit 1624 im hessischen Dietzenbach nachgewiesen. Von Johann Mendel Schickedanz, dem Vater von Johann Nicolaus und Urgroßvater von Gustav Schickedanz, wissen wir, dass er dort als »Ackermann« gearbeitet hat und mit Maria, geborene Gaubatz, verheiratet war. Ihr gemeinsamer Sohn Johann Nicolaus Schickedanz, der am 17. August 1812 in Dietzenbach zur Welt gekommen ist, tritt zum Jahresende 1829 bei einem Schreiner- und Glasermeister in die Lehre, wird drei Jahre später als Geselle freigesprochen und begibt sich wohl 1833 auf Wanderschaft.
Damit folgt er nicht nur den Gepflogenheiten der Zeit, sondern trägt auch den schweren wirtschaftlichen und sozialen Umbrüchen Rechnung, die in jenen Jahren ganze Landstriche entvölkert. Binnenwanderung, Industrialisierung und Verstädterung sind gleichermaßen Folgen wie Begleiterscheinungen dieses komplexen und folgenreichen Prozesses. Die Bevölkerung Nürnbergs beispielsweise wächst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts jährlich um gut ein Prozent; um die Jahrhundertmitte zählt die Stadt 54000 Einwohner und damit fast 50 Prozent mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor.
Zu ihnen gehört auch der Geselle Johann Nicolaus Schickedanz. Seit 1836 ist Gustavs Großvater bei dem »Schreinermeister und Spielwaarenmacher« Johann Nicolaus Löhner tätig, der auf der Sebalder Seite Nr. 1159 eine Holzgalanteriewarenfabrik betreibt. Elf Jahre lang findet der Zuwanderer aus Dietzenbach, der die »Schreinerprofession« erlernt hat und unweit seines Arbeitsplatzes, auf der Sebalder Seite Nr. 1056, wohnt, hier sein Auskommen. Dann macht er sich selbständig.
Ende Juni 1847 ersucht der jetzt Fünfunddreißigjährige den Magistrat der Stadt Nürnberg um »Ertheilung eines Licenz-Scheins zur Verfertigung von Holz-Galanterie-Waaren u. Spiegel-Rahmen«. Als Galanteriewaren gelten diverse Luxusartikel, wie zum Beispiel »unechte Bijouterien«, die zu »Putz und Zier« dienen und »in Form und Wesen von der Mode abhängig« sind. So jedenfalls steht es damals im Brockhaus zu lesen. Dass sich Johann Nicolaus Schickedanz ausgerechnet in diesen Krisenzeiten auf die Herstellung von Luxusgütern verlegt, ist bemerkenswert. Offensichtlich handelt er antizyklisch, also so, wie man es eigentlich von einem Kaufmann mit dem rechten Gespür fürs Geschäft erwartet. Ganz ähnlich wird es später sein Enkel Gustav halten.
Schon am 9. Juli 1847 wird dem Schreiner der »Licenzschein ertheilt«. Denn Johann Nicolaus Schickedanz hat einen »guten Leumund«, gilt als »geschikter & fleißiger Mann«, hat während seiner Gesellenzeit 500 Gulden zurückgelegt und damit »einen Sinn für Fleiß und Sparsamkeit« unter Beweis gestellt. Und auch sein Geschäftssinn trägt in dieser Zeit einmal mehr Früchte. Schickedanz hat nämlich seine Ersparnisse sowie eine Erbschaft, insgesamt immerhin 1400 Gulden, einer »Bierbrauers-Witwe« geliehen. Die 1000 Gulden, die ihm die Dame im September 1847 zurückzahlt, steckt er in sein neues Geschäft, und weil er schon innerhalb weniger Monate einen Umsatz von 1200 Gulden macht und davon ein Viertel als Gewinn verbleibt, hat der Armenpflegschaftsrat der Stadt keine Einwände, als der umtriebige Unternehmer sich in Nürnberg als Schutzbürger niederlassen und in den Stand der Ehe eintreten will.
Inzwischen hat die große Krise, die als sogenannte Märzrevolution von 1848 in die Geschichte eingegangen ist, den Deutschen Bund und seine Einzelstaaten fest im Griff. Mitte des Monats zwingen die Kämpfe in Wien den österreichischen Staatskanzler Clemens Lothar Wenzel Freiherrn von Metternich zur Flucht nach England, wenige Tage später veranlassen die Barrikadenkämpfe in Berlin König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, seine Truppen aus der Stadt abzuziehen, am 20. März dankt Ludwig I., der König von Bayern, angesichts schwerer Unruhen in München zugunsten seines Sohnes Max II. ab, seit dem 31. März tagt in Frankfurt ein sogenanntes Vorparlament, und am 18. Mai 1848 schließlich tritt in der dortigen Paulskirche eine verfassungsgebende Nationalversammlung zusammen, um einen ersten Versuch zur Parlamentarisierung und Demokratisierung Deutschlands zu unternehmen.
Unruhige Zeiten wie diese sind eigentlich nicht der rechte Augenblick, um sesshaft zu werden und eine Familie zu gründen. Aber Johann Nicolaus Schickedanz, »Schreiner von Dietzenbach«, hat offenbar einen triftigen Grund, um auch in dieser Hinsicht, wenn man so will, antizyklisch zu handeln. Am 12. April 1848 bekundet er mit dem Gesuch an die Stadt Nürnberg seinen Willen, »als Schutzbürger dahier sich niederzulassen, und mit der ledigen Maria Barbara Amm … von hier 21 Jahre alt sich … zu verehelichen«. Die Tochter des »Güterladers« Adam Gustav Amm und seiner Frau Anna Luzia, geborene Lauermeyer, verfügt zwar über kein »baares Vermögen«, wohl aber über eine »standesgemäße Ausstattung«. Zweifellos ist ihre Hochzeit mit dem Großvater von Gustav Schickedanz eine gute Partie, und so überrascht es nicht, dass Adam Gustav Amm rasch seinen »väterlichen Consensus« zu der »vorhabenden Verehelichung« erteilt.
Offenbar ist hier Eile geboten. Denn als der »Holzgalanteriewaarenverfertiger« Johann Nicolaus Schickedanz am 3. September 1848 seine Braut heiratet, ist er bereits Vater. Im Juli 1848 hat seine Frau Maria Barbara die erste gemeinsame Tochter zur Welt gebracht. Allerdings stirbt Charlotte Friederike Louise Schickedanz schon Mitte Juni 1850 im Alter von 23 Monaten. Das gleiche Schicksal ereilt eine zweite Tochter. Louise Friederike Charlotte Schickedanz stirbt, dreieinhalb Jahre alt, Mitte September 1854. Zu diesem Zeitpunkt wohnt die Familie in der Schlotfegergasse.
Am 30. Juni 1848 hatte der Magistrat erwartungsgemäß dem Antrag von Johann Nicolaus Schickedanz stattgegeben, nachdem dieser die entsprechenden Papiere beigebracht, die Aufnahmegebühren gezahlt und sich bereit erklärt hatte, regelmäßig einen Almosenbeitrag zu entrichten sowie sich als »Landwehrmann« zu uniformieren und zu armieren. Wenig später war ihm auch die Genehmigung erteilt worden, als »Spiegelrahmer« tätig zu werden. Damit fiel er in die Gewerbegruppe der »Holzgalanteriewaarenmacher«. Seit 1863 firmiert er als »Spielwaarenmacher«, muss aber schon vier Jahre später seine Selbständigkeit wieder aufgeben und hat fortan die »technische Leitung« bei »Jos. Beringer, Holzornamentefabrik« inne.
Warum der Großvater von Gustav Schickedanz der alten Reichsstadt Ende März 1882 den Rücken kehrt, wissen wir nicht. Gut möglich, dass ihm die abhängige Tätigkeit trotz des relativ sicheren Auskommens auf Dauer nicht behagt. Möglicherweise wird er auch ein Opfer der Wirtschaftskrise, die 1873 Deutschland erfasst, als »Gründerkrach« firmiert und ursprünglich eine Reaktion der Börse auf jene Überhitzung der Wirtschaft ist, die sich mit der Gründung des Deutschen Reiches Anfang 1871 eingestellt hat. Fast ein Vierteljahrhundert lang, bis 1896, dauert diese »Große Depression« an. Jedenfalls wird die Krise von den Zeitgenossen so empfunden.
In dieser Zeit also verlässt Johann Nicolaus Schickedanz Nürnberg, macht sich auf den Weg nach Furth im Wald und baut dort eine Fassfabrik auf. Noch einmal versucht er sich also als freier Unternehmer, und offensichtlich ist ihm dabei auch einige Jahre lang Erfolg beschieden. Bis die Fabrik einem Brandanschlag zum Opfer fällt. Diesem neuerlichen Rückschlag ist der inzwischen über Siebzigjährige nicht gewachsen. Am 25. Juli 1883 stirbt Johann Nicolaus Schickedanz nach einem Leben voller Erfolge, Niederlagen und Schicksalsschläge in Furth im Wald.
Aus seiner Ehe mit Maria Barbara sind mindestens sechs Kinder hervorgegangen. Neben den beiden früh verstorbenen Töchtern werden dem Paar zwei weitere Mädchen geboren. So gut wie nichts wissen wir von Anna Magdalena Schickedanz, die 1852 das Licht der Welt erblickt; und von der Ende Juni 1855 geborenen Jüngsten Esther Louise Schickedanz ist nur bekannt, dass sie 1884 beabsichtigt, den königlichen Eisenbahnadjunct Heinrich Bauer zu ehelichen. Nicht wesentlich besser steht es um unsere Kenntnis von Gustav Abraham Schickedanz, dem ältesten Sohn von Johann Nicolaus, obgleich dieser im Leben des gleichnamigen Fürther Neffen eine nicht unwichtige Rolle spielen wird.
Sicher ist, dass sich Gustav Abraham Schickedanz der Ältere, also der Onkel des Quelle-Gründers, Anfang November 1876 selbständig macht und in Nürnberg einen »Holzhandel« anmeldet. Das »Brennholz-, Kohlen- und Coaks-Geschäft« hat seinen Sitz an der Zufuhrstraße, das Lager befindet sich an der Kohlenhofstraße. Im Sommer 1882 folgt Gustav Abraham dem Vater nach Furth im Wald. Schon im Jahr zuvor hatte er beim Bezirksamt Cham die »Aufstellung eines Dampfkessels« beantragt. Was ihn zur Aufgabe seines Nürnberger Geschäfts bewogen hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Vielleicht will er dem Vater geschäftlich unter die Arme greifen, vielleicht ist er auch die treibende Kraft des Neuanfangs und bewegt sowohl den Vater als auch seinen jüngeren Bruder zu dem gemeinsamen Unternehmen.
Denn auch dieser findet sich im Bayerischen Wald ein. Johann Leonhard Michael, den sie »Leo« nennen, kam am 9. April 1857 als jüngstes der sechs Kinder von Johann Nicolaus und Maria Barbara Schickedanz in Nürnberg zur Welt. Über die Kindheit und frühe Jugend von Gustavs Vater schweigen sich unsere Quellen aus. Immerhin wissen wir, dass er 1873 in die Firma Jos. Beringer, Holzornamenten- & Rococoleisten-Fabrik, am Maxplatz 25 in Nürnberg eintritt, wo ja damals sein Vater, Gustavs Großvater, die »technische Leitung« innehat. Acht Jahre, so sagt es das im Oktober 1881 ausgestellte Zeugnis, ist er hier »größtenteils an Holzbearbeitungsmaschinen« tätig, unterstützt den Vater mit »Fleiß u. Umsicht« und bewährt sich »willig, ehrlich und treu«. Kurzum, sein langjähriger Arbeitgeber kann Leo Schickedanz »Jedermann empfehlen«.
Der bleibt allerdings zunächst bei der Familie, folgt Vater und Bruder nach Furth im Wald und ist seit Frühjahr 1883 gemeinsam mit diesen Besitzer der väterlichen Fassfabrik. Nachdem diese durch den Brand weitgehend zerstört wurde und der Vater wenig später gestorben ist, versuchen die Brüder zwar noch einmal einen Neuanfang und beantragen am Ende dieses Schicksalsjahres 1883 den Bau einer »Faßholztrockenanlage«, geben dann aber doch ein knappes Jahr später auf und verkaufen den »Besitz«.
Damit endet der kurze, in mancher Hinsicht tragische, in jedem Falle erfolglose Lebensabschnitt der Familie Schickedanz in Furth im Wald, denn danach finden wir den Jüngsten wieder in Mittelfranken. Allerdings nicht in Nürnberg, sondern im benachbarten Fürth. Hier, am Marktplatz Nummer 16, der späteren Nummer 2, ist seit 1884 der »Pfeiffendrechsler-Meister« »Schicketanz [sic], Leonhard« im Adressbuch der Stadt verzeichnet. Hier wohnt er bis 1893, ist allerdings nach wie vor Bürger der Nachbarstadt Nürnberg. Erst Ende Juli 1897 wird Leo Schickedanz durch Magistratsbeschluss das Heimatrecht in Fürth verliehen, und dann gehen weitere fünf Jahre ins Land, bis dem »heimatsberechtigten Maschinenmeister« Ende September 1902 das Bürgerrecht verliehen wird.
Im August 1885 tritt Leo Schickedanz in die Fürther Rahmen-, Kehlleisten- & Möbel-Fabrik Ammersdörfer & Haas ein und ist dort bis 1892 als »Werkführer« tätig. Dann macht auch er sich – wie der Vater und wie dieser im Alter von 35 Jahren – selbständig, beliefert allerdings weiterhin seinen ehemaligen Arbeitgeber. Und wie ebenfalls schon sein Vater kehrt auch Leo Schickedanz für einige Zeit in ein Beschäftigungsverhältnis zurück.
Nicht wesentlich geradliniger stellt sich seine frühe private Lebenssituation dar. Anders als bislang angenommen, ist Gustavs Vater offenbar zweimal verheiratet gewesen. Die erste Ehe mit Sophie Emilie, geborene Roesling, hält nicht lange. Wann sie geschlossen und geschieden worden ist, wissen wir nicht. Belegt ist aber, dass seine Frau nach der Scheidung in München lebt, Mitte Juli 1887 erneut in den Stand der Ehe tritt und den Postassessor Bernhard Ernst von Abtswind heiratet.
Leo Schickedanz seinerseits heiratet am 9. Oktober 1892 ein zweites Mal, und zwar die Haushaltshilfe Eva Elisabeth Kolb, die am 17. Juli 1862 als Tochter eines Bauern in Vestenbergsgreuth, also im Steigerwald, zur Welt gekommen ist. Wie Leos Mutter macht also auch Leos zweite Frau eine gute Partie, und wie der Vater hat auch der Sohn einen triftigen Grund für die Heirat: Die Braut ist schwanger. Als Leo Schickedanz sie ehelicht, wohnt er noch im zweiten Stock des Hauses Marktplatz 2. Hier wird am 19. März 1893 das erste Kind und zugleich die einzige Tochter des Paares, Elisabeth Schickedanz, geboren, die »Liesl« gerufen wird.
Knapp zwei Jahre später, am Neujahrstag 1895, folgt ihr Bruder Gustav Abraham, das zweite Kind und zugleich der einzige Sohn von Leo und Elisabeth Schickedanz. Zu diesem Zeitpunkt wohnen der »Geschäftsführer« und seine Familie bereits im ersten Stock der Fürther Theresienstraße 23. Zur Familie zählt neben dem Elternpaar und den beiden kleinen Kindern auch die Großmutter des Stammhalters.
Als Gustav Schickedanz zur Welt kommt, befindet sich diese insgesamt in einer recht stabilen Verfassung. Selbst die internationalen Beziehungen durchlaufen eine sturmfreie Zone – nicht selbstverständlich in einer Epoche, die als Zeitalter des Imperialismus in die Geschichte eingehen und mit dem Eintritt ins 20. Jahrhundert eine Serie schwerer Krisen sehen wird. Eigentlich gibt es 1895 nur einen Konflikt, der die europäischen Großmächte in Atem hält und sie dann auch zu einer folgenreichen, wenngleich vorerst nur diplomatischen Reaktion veranlasst. Seit Japan im Juni 1894 das zwischen ihm und China umstrittene Korea angegriffen hat, verfolgen Europäer und Amerikaner gleichermaßen überrascht und fasziniert die Erfolge der bis dahin eher als schwach eingeschätzten japanischen Streitkräfte, die das geschlagene China im Vorfrieden vom April 1895 zur Abtretung erheblicher Gebiete wie Koreas und Formosas zwingen.
Mit dem chinesisch-japanischen Krieg beginnt nicht nur der Aufstieg Japans zu einer Militär- und Wirtschaftsmacht, der Konflikt rückt zudem den Großraum Ostasien dauerhaft ins Bewusstsein von Amerikanern und Europäern, auch der Deutschen, die ja nicht zu den großen Kolonialnationen der Erde zählen. Die gemeinsam mit Russland und Frankreich unternommene Intervention des Deutschen Reiches in Japan, eine Reaktion auf Nippons militärischen Erfolg über China, und die ihr folgende Festsetzung im Reich der Mitte liegen ganz im Trend der Zeit: Die 1898 vollzogene Pachtung der Bucht von Tsingtau mit dem Kriegshafen Kiautschou ist in Deutschland ausgesprochen populär. Sie gilt als Ausdruck erfolgreicher deutscher Weltpolitik, und die wiederum verbindet sich mit der Person Wilhelms II., des Deutschen Kaisers und Königs von Preußen.
So umstritten mancher seiner großspurigen Auftritte vor allem im Ausland auch ist, zu Hause nimmt die Popularität des Kaisers mit jedem tatsächlichen oder vermeintlichen Erfolg des Reiches auf der weltpolitischen Bühne zu. Verwundert stellen die Deutschen fest, dass sie dort auch ohne Otto von Bismarck zurechtkommen, der übrigens im Geburtsjahr von Gustav Schickedanz seinen Achtzigsten feiert. Allerdings profitieren dessen Nachfolger, auch der junge Kaiser, durchaus von den Vorgaben und Vorlagen des ersten Reichskanzlers. Das gilt für das insgesamt stabile Gebäude des Deutschen Reiches, das Bismarck seinen Nachfolgern hinterlässt, im Allgemeinen. Und es gilt für einzelne Projekte wie den Nord-Ostsee-Kanal im Besonderen.
Als dieser am 21. Juni 1895, dem Geburtsjahr von Gustav Schickedanz, durch Wilhelm II. eröffnet und zunächst nach dessen Großvater Kaiser-Wilhelm-Kanal genannt wird, ist das auch ein später Sieg Bismarcks über die zahlreichen Kritiker und Gegner dieses Projekts. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert ist die knapp 100 Kilometer lange Wasserstraße ein sichtbares Symbol für die Kraft und Dynamik der jungen deutschen Wirtschafts- und Handelsmacht, eine »großartige technische Leistung« und ein »schönes, leuchtendes Beispiel dafür, daß unsere Zeit unter dem Zeichen des Verkehrs steht«, wie man im Fränkischen Kurier nachlesen kann.
Tatsächlich fällt die Eröffnung des Kanals ja mit dem Ende der »Großen Depression« und dem Beginn eines nahezu ungebremsten wirtschaftlichen Aufstiegs zusammen. In praktisch allen Bereichen setzt sich die deutsche Wirtschaft jetzt an die Spitze der europäischen Industrienationen – bei Kohle, Eisen und Stahl sowieso, aber auch bei den modernen Industrien, also beim Maschinenbau, der Chemie- oder auch der Elektroindustrie. Mehr oder weniger alle klassischen Industriestandorte zählen zu den Gewinnern dieser Konjunktur. Auch die fränkischen, unter ihnen Fürth.
Dass die Bevölkerung der mittelfränkischen Industriestadt zwischen 1895 und 1905, also innerhalb nur eines Jahrzehnts, von knapp 47000 auf gut 60000 Bewohner und damit um beinahe 30 Prozent wächst, hat mit dieser Entwicklung, aber auch mit einigen Eingemeindungen zu tun. Um die Jahrhundertwende kommen ein Teil der Gemeinde Höfen sowie die Gemeinden Poppenreuth, Unter- und Oberfürberg und nicht zuletzt Dambach zu Fürth.
Als Dambach zum 1. Januar 1901 eingemeindet wird, besitzt Leo Schickedanz dort, also vor den Toren der Stadt, ein kleines Grundstück. Wenige Jahre später baut er hier in mühevoller Kleinarbeit und mit Hilfe von Freunden ein bescheidenes Haus, das er und seine Frau beziehen, nachdem Tochter Liesl die elterliche Wohnung verlassen hat und diese aufgegeben worden ist. 1925 übernimmt Sohn Gustav Haus und Grundstück, erweitert das Gelände Mitte der dreißiger Jahre durch eine Reihe von Zukäufen erheblich und errichtet hier eine Villa, die in ihrer Dimension und ihrer Gestaltung dem Selbstverständnis eines erfolgreichen Unternehmers dieser Zeit entspricht.
Um die Jahrhundertwende sieht das alles noch anders aus. Einstweilen pflanzt Mutter Elisabeth hier Gemüse für den täglichen Bedarf, Vater Leo züchtet Hasen, und dem kleinen Gustav und seiner älteren Schwester Liesl dient der Garten vor den Toren der Stadt als Spielplatz. Es ist das typische Leben in »einfachen Arbeiterkreisen«, von denen Gustav Schickedanz 1945 im Rückblick spricht, nicht üppig, aber auskömmlich.
Als er sechzig wird, erinnert sich Schwester Liesl an die Jahre der Kindheit: »Unsere Eltern waren einfache, biedere und fleissige Fürther Bürger. Meinen Bruder und mich erzogen sie von Kindheit an zur Arbeit und Sparsamkeit. Geschenkt wurde uns nichts: wir mussten überall mit anpacken, was uns im späteren Leben – und noch heute – sehr zustatten kam. Mein Bruder hatte den Vorteil, daß er jünger war als ich: Er war also der Liebling seiner Mutter, weswegen ich manchmal Prügel einstecken musste, die zweifellos er verdient hätte.«
»Einfach, bieder, fleißig«: Johann Leonhard Michael (»Leo«) Schickedanz, Jahrgang 1857, mit seiner zweiten Ehefrau, der 1862 geborenen Eva Elisabeth Kolb, und den Kindern Elisabeth (»Liesl«) und Gustav 1898.
Auch Gustav erinnert sich später »oft und gern« an diese Zeit. »Da sind meine Eltern«, sagt er 1960, »mein bescheidener, fleißiger Vater, meine sorgende Mutter in der Küche, … da sind die Fürther Straßen, … die armseligen, geliebten Kiefern im Stadtwald. Wir spielten leidenschaftlich gern Fußball.« Namentlich die Mutter, berichtet er 1963 in einem Interview mit der Illustrierten Quick, gibt ihm »etwas mit, das eine unerläßliche Voraussetzung für Erfolg ist, um im Leben vorwärtszukommen: Sparsamkeit! … Meine Schwester, ich und auch mein Vater mußten alles zu Hause abgeben. Außer einem bescheidenen Taschengeld blieb für uns selbst nichts übrig. Ich erinnere mich noch gut, daß meine Mutter mich immer auf den Markt schickte mit dem Auftrag, angeknickte Eier zu kaufen, weil die billiger sind.«
Die Ferien verbringen die Geschwister meist bei den Großeltern in Vestenbergsgreuth. Die Familie der Mutter stammt von hier, und zeitlebens empfindet Gustav Schickedanz eine enge innere Bindung an die Ortschaft im Steigerwald. Kaum eine zweite frühe Erfahrung hat ihn ähnlich tief und dauerhaft geprägt. Hier hat er »das tägliche Leben und die tägliche Arbeit der Bauern kennen, achten und lieben gelernt«, hier ist er »der Natur, dem Wald, dem Feld, den Früchten und den Blumen ganz nahe gekommen«, wie er im Oktober 1959 sagt, als ihm und seiner Schwester die Ehrenbürgerwürde von Vestenbergsgreuth verliehen wird. Der Großvater, erzählt Gustav Schickedanz in hohem Alter einem Besucher, dem Journalisten Walter Henkels aus Bonn, »sei Bauer, Imker und Dorfmedicus gewesen, der Mensch und krankes Vieh behandelte; zwei Kühe zogen noch den Pflug, er höre noch den Takt der Dreschflegel, wenn das Getreide gedroschen wurde, und das alles blieb, unauflöslich in der Erinnerung, die schönste Kindheitsidylle«.
Fürsorglich: Von Kindesbeinen an hat Liesl Kießling ein wachsames Auge auf ihren jüngeren Bruder Gustav Schickedanz. Das Bild zeigt die beiden um die Jahrhundertwende.
Ganz ungetrübt sind die Kindheitserinnerungen allerdings nicht. Als Gustav vier ist und noch nicht schwimmen kann, fällt er in die Rednitz, kann in letzter Minute gerettet werden und ist »wochenlang ans Kinderspital« gefesselt. Auch daran erinnert die Schwester 1955 und fügt hinzu: »Auch in unserem späteren Leben kamen manche sehr schwere Erlebnisse und ernste Krankheiten über ihn, in denen die ›größere‹ Schwester dem ›kleineren‹ Bruder … beistand.« In der Tat wird Schwester Liesl wiederholt zur entscheidenden, nach dem Unfalltod seiner Familie eine Zeitlang auch zur einzigen Stütze im Leben des Gustav Schickedanz. Das ist eine Erklärung für die lebenslange enge und innige Beziehung der Geschwister, die im ausgehenden 19. Jahrhundert im »schlichten Elternhaus im alten Fürth« begann.
Eine Woche nach seiner Geburt ist Gustav Abraham Schickedanz in der St. Michaelis Kirche, der ältesten Kirche Fürths, getauft worden. Taufpate des Stammhalters ist sein Onkel, der ältere Bruder des Vaters. Nicht nur weil Gustav Abraham der Ältere auch der Namensgeber für seinen Neffen ist, hat er auf diesen im Laufe der kommenden Jahre eine gewisse Faszination ausgeübt. Der Onkel hat auch einen attraktiven Beruf. Er ist Kaufmann, und das ist in der traditionell dem Handwerk zugewandten Familie eine Ausnahme. Was genau Gustav Abraham der Ältere beruflich getrieben hat, lässt sich nicht mehr feststellen. Angeblich hat er deutsche und österreichische Firmen als Agent in Budapest vertreten und dort auch ein eigenes Kaufhaus besessen.
Im Sommer 1901 ist es mit der unbeschwerten Kindheit des jungen Gustav erst einmal vorbei, denn Anfang September wird der Sohn des Drechslermeisters Leo Schickedanz in der Volksschule an der Schwabacher Straße eingeschult. Die Notenlisten bescheinigen dem Knaben bis zum Abgang »sehr lobenswürdiges sittliches Verhalten«, außerdem »viele Geistesgaben«. Allerdings sind die Zeugnisse auf einen gewissen »Ludwig Schickedanz« ausgestellt – und vom Vater so per Unterschrift zur Kenntnis genommen worden. Warum Leo Schickedanz weder auf einer Korrektur des Namens bestanden noch die Änderung der gleichfalls falschen Anschrift angemahnt hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Gut möglich, dass er den Sohn nicht in Schwierigkeiten bringen wollte. Vielleicht steckt dahinter aber auch ein nicht sehr stark entwickeltes oder aber angeschlagenes Selbstbewusstsein. Der berufliche Werdegang und die wechselnden Berufsbezeichnungen deuten jedenfalls nicht auf eine Karriere hin, aus der sich Kraft und Selbstgewissheit gewinnen lassen.
Am 18. September 1905 kommt der zehnjährige Gustav auf die Königliche Realschule mit Handelsabschluss seiner Heimatstadt, die damals zu den größten und angesehensten Realschulen des Königreichs zählt. Mit der 1877 vollzogenen Umwandlung der vormaligen Gewerbeschule in eine Realschule ist das dreiklassige in ein sechsklassiges Schulsystem überführt worden, das mit dem Einjährigen abschließt. Auch deshalb nimmt die Schülerzahl rasch zu, so dass die Realschule schon 1879 ein neues Gebäude beziehen muss, bis auch dieses 1912 aus den Nähten platzt.
Dass Gustav Schickedanz diese Schule besucht, ist nicht selbstverständlich, denn bislang ist die Familie nicht mit der höheren Schulbildung in Berührung gekommen. Da gibt es Ängste und wohl auch Standesdünkel. Außerdem bedeutet die Laufbahn des Sohnes für den Vater eine erhebliche finanzielle Belastung. Neben dem Schulgeld schlagen die Ausgaben für Bücher und Schulutensilien aller Art oder auch für die Schulkleidung zu Buche. Die Empfehlung der Volksschullehrer gibt schließlich den Ausschlag, und die Entscheidung erweist sich als richtig.
Wie viele, die später große Karrieren hinlegen, ist auch Gustav Schickedanz nicht gerade ein herausragender Schüler. Schon im »Weihnachtszeugnis« des ersten Schuljahres, als es in Geographie sowie in Arithmetik und Mathematik nur für ein »ungenügend« reicht, heißt es wie so oft in den folgenden Jahren: »Muß in einigen Fächern sich steigern.« Und wie stets in den kommenden Jahren schafft er das dann auch. Gute oder auch sehr gute Leistungen erbringt er in Fächern wie Religion, Zeichnen oder auch Turnen, wobei das wiederum nicht selbstverständlich ist, scheint der Schüler Nr. 3064 seinen Lehrern doch »nicht ganz gesund zu sein«. Offensichtlich zeigen sich hier die Folgen seines frühen Unfalls, mit denen Gustav Schickedanz zeitlebens zu tun haben wird. Im Übrigen halten seine Lehrer mal im Grundbuch fest, dass er lediglich »mäßig begabt« und »langsam« sei, mal geben sie zu Protokoll, dass er »zerstreut« und »selten bei der Sache« sei. Unangenehm fällt »Schickedanz, Gustav« vor allem während der Pubertät auf. Jedenfalls vermerkt der Strafbogen für das Schuljahr 1909/10 insgesamt 13 Einträge. Anlass für einen Verweis oder gar einen Arrest ist in der Regel »Unfleiß«.
Aber dann schafft er es doch. Am 14. Juli 1911 erhält der Sechzehnjährige das »Realschul-Absolutorium« und ist damit einer von lediglich 36 des ursprünglich 130 Schüler starken Jahrgangs 1905/06, die dieses Ziel erreichen. Acht von ihnen, darunter der junge Schickedanz, schließen sich im Jahrgang 1910/11 der »Absolvia Fürth«, dem 1877 gegründeten Verein ehemaliger Schüler, zusammen.
Absolvia: Gustav Schickedanz (vorne links im Bild) im Kreis der organisierten Fürther Schulabsolventen des Jahrgangs 1910/11.
Mit dem Abschlusszeugnis wird Gustav Schickedanz außerdem auch das »Zeugnis über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Dienst«, also für den verkürzten Militärdienst, ausgehändigt. Das Absolutorium testiert ihm mehr befriedigende als gute Leistungen, wobei die Mathematik mit ihren Einzeldisziplinen einschließlich der »Handelswissenschaften« am unteren Ende der Notenskala rangiert. Die Abschlussexamina waren offenbar nicht gerade berauschend. »In der schriftlichen Prüfung leistete er in der Religion sehr Gutes, in den übrigen Fächern Genügendes. Seine Kenntnisse in der mündlichen Prüfung waren besser. Während seines Aufenthaltes an der Anstalt«, so die Bilanz, »war sein Betragen stets lobenswert, sein Fleiß zufriedenstellend.«
Naturgemäß ändert und erweitert sich mit dem Wechsel auf die Realschule auch der Bekanntenkreis des Heranwachsenden. Dass Gustav Schickedanz schon in dieser Zeit näher Bekanntschaft mit Daniel Kießling, seinem späteren Schwager und lange Zeit wichtigen Mitarbeiter im Unternehmen, gemacht hat, gehört wohl eher in das Reich der Legende. Dass er in der Schule dem zwei Jahre jüngeren Ludwig Erhard über den Weg gelaufen ist, ohne ihn im Übrigen zu beachten oder gar näher kennenzulernen, ist wahrscheinlich. Sicher ist, dass Ernst Spear, den Gustav Schickedanz zu seinen engsten Schulfreunden zählt, mit ihm seit dem Schuljahr 1908/09 dieselbe Klasse besucht.
Ernst Spear ist ein Spross der zu dieser Zeit in Nürnberg ansässigen Firma J. W. Spear & Söhne, einem der bekanntesten Spielehersteller in Deutschland. Der Firmengründer Jacob Wolf Spier, 1832 als Sohn einer jüdischen Familie im hessischen Merzhausen geboren, hatte sich als junger Mann auf den Weg nach Amerika gemacht, dort 1860 die amerikanische Staatsbürgerschaft erworben und die gleichfalls aus Deutschland stammende Sophie Rindskopf geheiratet. Aus der Ehe gehen noch in den USA die Söhne Ralph und Joseph hervor, die schon den anglisierten Familiennamen Spear tragen.
Im November 1861, ein halbes Jahr nach Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs, kehrt Jacob Wolf Spear mit seiner Familie nach Deutschland zurück, versucht sich im Fränkischen mit wechselndem Erfolg als Unternehmer, geht dann aber mit seiner Familie nach England und gründet dort ein Importgeschäft für Kurzwaren. Lange hält es ihn auf der Insel nicht. Schon wenige Monate später, am 6. November 1879, ruft der Rastlose in Fürth ein »Import-Exportgeschäft mit Kurzwaren« ins Leben. Das ist der eigentliche Beginn der Spielefabrik J. W. Spear & Söhne, die bald sechzig Menschen Arbeit und Brot gibt. 1884/85 treten zunächst die älteren Söhne des Gründers, Ralph und Joseph Spear, in das Unternehmen ein und führen dieses weiter, nachdem sich der Vater 1893 das Leben genommen hat. Wegen der besseren Anbindung an das deutsche Eisenbahnnetz zieht die Firma 1898/99 nach Nürnberg-Doos, nimmt gleichzeitig mit Eugen Mayer einen weiteren Gesellschafter auf und vollzieht bei dieser Gelegenheit die Umwandlung in eine Kommanditgesellschaft.
1919 übernehmen mit Jakob Richard und Hermann Spear zwei Enkel des Firmengründers die Leitung der Spiel- und Galanteriewarenfabrik und führen sie zu neuer Blüte, bis die Nationalsozialisten an die Macht kommen und der Betrieb zur Arisierung freigegeben wird: 1938 erwirbt der Nürnberger Unternehmer Hanns Porst, Eigentümer des nach eigener Einschätzung »größten Photohauses der Welt«, das Weltunternehmen J. W. Spear & Söhne für 100000 Reichsmark. Dass die Firma und jedenfalls Teile der Familie die folgenden Jahre überleben, verdanken sie dem Umstand, dass sie 1930 in England eine Tochtergesellschaft gegründet haben. 1948 erhält die Familie ihr deutsches Unternehmen zurück. An die alten Erfolge kann sie indessen nie mehr anknüpfen: 1984 wird der Betrieb in Nürnberg aufgegeben; 1995 geht die englische Firma an den amerikanischen Konzern Mattel, der sie wenige Jahre später schließt.
Noch bevor er das Abgangszeugnis der Realschule in Händen hält, bewirbt sich Gustav Schickedanz bei der Firma J. W. Spear & Söhne. Ob die Lehre seinen Wunschvorstellungen entspricht, sei dahingestellt. Wäre es nach dem Jungen gegangen, hätte er sich wohl einen Beruf gesucht, der mit dem Wasser in Verbindung steht. Bis ins hohe Alter hinein hat Gustav Schickedanz erzählt, dass er wohl gerne Schleusenwärter geworden wäre. Jedenfalls geht er mit den Eltern an besonderen Feiertagen gerne nach Doos, zum Ludwigskanal, und fährt von dort mit dem »Schlagrahmdampfer« kanalaufwärts nach Fürth-Kronach.
Aber aus diesem Jugendtraum wird nichts. Möglicherweise hat Gustav Schickedanz schon während des letzten Schuljahrs als Praktikant oder Aushilfe bei Spears hineingeschaut. Jedenfalls attestiert der Geschäftsführer der Nürnberger Gesellschaft Mitte Juni 1959 dem inzwischen berühmten Fürther Unternehmer auf dessen Bitte hin, dass er bereits Anfang Juli 1910 als kaufmännischer Lehrling bei der Firma beschäftigt gewesen sei und dass sich »Herr Richard Spear, der seit 1932 in England lebt« und 1911 in die Firma eingetreten ist, noch »gut an die damalige Zusammenarbeit« erinnere.
Wie immer sich das ein halbes Jahrhundert später auf den Juli 1910 datierte Eintrittsdatum erklärt, sicher ist, dass Gustav Schickedanz den »Werten Herren« Spears am 7. Juni 1911 mitteilt, seine Eltern seien mit »den vereinbarten Bestimmungen betreff Stellung … einverstanden« und er könne im August des Jahres seine Lehrstelle bei dem Nürnberger Spielehersteller antreten. Im ersten Lehrjahr verdient er 20, im zweiten 30 Reichsmark. Am 26. September 1913 hält das Austrittszeugnis fest: »Herr Gust. Schickedanz … war … als Commis bei uns beschäftigt. Derselbe war im Contor, sowie auch in der Expedition unserer Muster-Abteilung tätig und hat die ihm übertragenen Arbeiten zufriedenstellend erledigt und sich auch sonst durch Fleiss, Treue und Pünktlichkeit unsere Zufriedenheit erworben.«
Um diese Lehrzeit ranken sich – wie könnte es bei der späteren Karriere eines solchen Mannes auch anders sein – manche Legenden, darunter die, dass die Eigentümer von J. W. Spear & Söhne ihm die Vertretung ihres Unternehmens in Buenos Aires angetragen hätten. Allerdings habe der Vater den grundsätzlich an der Stelle interessierten Sohn mit Blick auf den noch abzuleistenden Militärdienst davon abgehalten. Gustav Schickedanz selbst hat wenige Jahre später eher nüchtern, aber wohl zutreffend zu Protokoll gegeben, er habe »während zwei Jahren eine ebenso gründliche, wie reichliche Ausbildung in fast allen Sparten dieses vielseitigen Berufes genießen dürfen«. Das schreibt er im Herbst 1917 in einem Lebenslauf für die Heeresverwaltung. Zu diesem Zeitpunkt trägt der inzwischen Zweiundzwanzigjährige schon seit vier Jahren Uniform. Geplant war das nicht. Aber wie viele Zeitgenossen muss auch Gustav Schickedanz die Quittung für eine Politik zahlen, die schließlich in die Katastrophe eines vierjährigen Krieges mündet.
Wer dafür die Verantwortung trägt, ist auch heute nicht eindeutig zu sagen. Die nach dem Krieg angestellte Beobachtung David Lloyd Georges, des britischen Premierministers während der Jahre 1916 bis 1922, alle Staaten seien schließlich in ihn »hineingeschlittert«, ist wohl zutreffend – wenn man davon ausgeht, dass die meisten derer, die damals in den politisch, militärisch oder auch publizistisch verantwortlichen Positionen waren, den Krieg als Mittel der Politik billigend in Kauf nahmen und folglich in der entscheidenden Situation wenig oder gar nichts taten, um seinen Ausbruch zu verhindern. Allerdings ist in Rechnung zu stellen, dass im Sommer 1914 kaum jemand mit einer langen, über Europa hinausgreifenden, zudem außerordentlich verlust- und folgenreichen Auseinandersetzung rechnet.
Hinzu kommt, dass sich die Völker Europas über die Jahre an den Gedanken des Krieges gewöhnt und viele ihn geradezu als reinigendes Gewitter herbeigesehnt haben. Denn die Zeichen stehen zusehends auf Sturm. Schon vor der Jahrhundertwende zeigt sich: Das erstaunlich reibungslose Zusammenwirken Russlands, Frankreichs und Deutschlands während des chinesisch-japanischen Krieges von 1895 ist die Ausnahme von der Regel, und die sagt, dass Russland und Frankreich auf der Basis ihrer 1892 geschlossenen Militärallianz umso enger zusammenrücken, je stärker, expansiver und vorlauter Deutschland wird oder doch zu werden scheint.
Ob das eine angemessene Reaktion auf die deutsche Hochrüstung zur See, den Drang nach einer gleichberechtigten Stellung Deutschlands im Kreis der Weltmächte oder auch die forschen Auftritte Wilhelms II. ist, sei dahingestellt. Tatsache ist, dass sich Russland, Frankreich ohnehin, immer stärker aber auch Großbritannien durch Deutschland herausgefordert und zur Reaktion gezwungen fühlen. Tatsache ist aber auch, dass diese Reaktion bei den Deutschen den Verdacht erweckt, durch die drei isoliert und »eingekreist« zu werden. Und je stärker dieser Eindruck wird, umso intensiver bindet sich das Deutsche Reich an Österreich-Ungarn, den einzigen zuverlässigen Partner, den man noch hat.
Auf keinen Fall darf dieser Partner geschwächt, gedemütigt oder gar als Großmacht in Frage gestellt werden. Koste es, was es wolle. Und so rollt der Wagen mit den Völkern Europas an Bord dem Abgrund zu, ohne dass im entscheidenden Moment der Wille oder auch der Mut vorhanden wäre, die Bremse zu ziehen. Als Österreich-Ungarn, ausgelöst durch den Mord an seinem Thronfolger Ende Juni 1914, entschieden Position auch gegen Russland beziehen will, wird es darin von seinem deutschen Partner ausdrücklich bestärkt. Und als das nicht minder unter Druck stehende Zarenreich daraufhin mobil macht, will Deutschland diesem nicht die Initiative überlassen und erklärt am 1. August 1914 Russland, zwei Tage später auch dessen Partner Frankreich den Krieg. Millionen ziehen jetzt in die große Schlacht.
Unter ihnen ist auch Gustav Schickedanz. Der hat nach seiner kaufmännischen Ausbildung bei J. W. Spear & Söhne am 1. Oktober 1913 seinen Militärdienst als Einjährig-Freiwilliger beim Königlich Bayerischen Infanterie-Regiment Großherzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Schwerin angetreten. Aus dem einjährigen wird schließlich ein mehr als fünfjähriger Militär- und Kriegsdienst.
Ruhige Lage: Als Gustav Schickedanz (vorne rechts im Bild, liegend) 1913 als Einjährig-Freiwilliger seinen Wehrdienst ableistet, ahnt er nicht, dass er die Uniform erst nach sechs Jahren wieder ablegen wird.
Das 21. Infanterie-Regiment ist im April 1897 aufgestellt worden, also eine relativ junge Einheit. Drei Jahre später wird es dem neu errichteten III. bayerischen Armeekorps, Generalkommando Nürnberg, sowie der 5. bayerischen Infanterie-Division und gemeinsam mit dem 14. Infanterie-Regiment der nunmehr 9. Infanterie-Brigade unterstellt. Bei Kriegsbeginn zählt das Regiment, zu dem seit kurzem auch eine Maschinengewehr-Kompanie gehört, 68 Offiziere, drei Beamte, sechs Sanitätsoffiziere sowie 3240 Mann. Seit dem 6. August 1914 steht es »kriegsfertig« in seinen Standorten und kommt dann mit dem III. Armeekorps und als Teil der 6. Armee unter Kronprinz Rupprecht von Bayern in Lothringen zum Einsatz.
Der Gefreite Gustav Schickedanz nimmt mit seiner Einheit an mindestens sechs Gefechten teil, zuletzt seit dem 8. Oktober 1914 bei Aprémont. Während dieser Kämpfe wird er am Unterschenkel verletzt und daraufhin zum I. Ersatzbataillon des Regiments versetzt, wo er etwa ein Jahr lang bleibt. Als sich der »Zahlmeister-Anwärter« Ende Oktober 1917 »für ein weiteres Jahr« zum aktiven Militärdienst verpflichtet, steht er im Felde und gilt als »Gesund u. felddienstfähig«.
Offensichtlich sieht der Zweiundzwanzigjährige im Militär eine Perspektive – beziehungsweise im Zivilleben derzeit keine. Daran ändert sich bezeichnenderweise auch nach dem 11. November 1918 nichts, als der Krieg mit der Unterzeichnung des Waffenstillstandes im Wald von Compiègne zu Ende geht. Jedenfalls will der »Unterzahlmeister Schickedanz«, der zu diesem Zeitpunkt im Traindepot des III. Armeekorps in Fürth stationiert ist, auch Ende März 1919 »weiter dienen«. Erst am 20. Mai 1919 bittet er um die Entlassung aus dem aktiven Militärdienst, da er jetzt eine »geeignete Zivi[l]-anstellung« gefunden habe.
Die immerhin fast sechsjährige Militärlaufbahn von Gustav Schickedanz bildet ein bemerkenswertes Kapitel in einer schließlich von großen Erfolgen gekrönten Biographie. Denn von Hinweisen auf eine bevorstehende Karriere findet sich in diesem frühen Lebensabschnitt keine Spur. Im Gegenteil. Offensichtlich sind die Jahre beim Militär eine Zeit ohne Fortune und Perspektive, eine bleierne Zeit. Schwere Rückschläge, die ja die Chance des Neuanfangs in sich bergen, oder auch Schicksalsschläge sind leichter zu meistern. Jedenfalls für einen Mann wie Gustav Schickedanz. Das wird er in den kommenden beiden Jahrzehnten wiederholt unter Beweis stellen.
Nein, die Zeit vom Oktober 1913 bis Juni 1919 ist deshalb so schwer zu ertragen, weil sie gerade keinen Gestaltungsspielraum bietet, und das wiederum hat viel mit der allgemeinen Lage Deutschlands zu tun, die umso schwieriger wird, je länger der Krieg dauert, und die sich mit dem Kriegsende keineswegs grundlegend bessert, schon gar nicht rasch und durchgreifend.
Ob auch Gustav Schickedanz wie die meisten seiner Zeitgenossen vom sogenannten Augusterlebnis erfasst worden ist, ob er den Kriegsausbruch begrüßt, ob er damit die Hoffnung verbunden hat, dass Deutschland aus dieser Auseinandersetzung gestärkt und vom Albtraum der »Einkreisung« befreit hervorgehen werde, wissen wir nicht. Vermutlich ist es so, denn auch Schickedanz ist ein Kind seiner Zeit. Eine Alternative zum Kriegsdienst gibt es für einen, der beim Ausbruch des Krieges gerade seinen Militärdienst ableistet, ohnehin nicht.
Was der Krieg bedeutet, weiß bald jeder, der auf den Schlachtfeldern Frankreichs zum Einsatz kommt. Gescheiterte Offensiven, zermürbendes Leben unter Dauerbeschuss, ein rasch wachsendes Heer von Toten und Verwundeten. Dass einer, der das erlebt hat und dabei früh verwundet worden ist, bleiben, ja schließlich gar nicht mehr fort will, wird verständlich, wenn man bedenkt, dass es zu Hause auch nicht besser aussieht. Als der Krieg zu Ende geht, werden nicht nur zwei Millionen gefallener Soldaten gezählt, sondern auch Hunderttausende toter Zivilisten. Die allermeisten sind Opfer des Hungers und seiner Folgen.
Als im Winter 1916/17 die Steckrübe zum Hauptnahrungsmittel wird, im Frühjahr 1917 in den großen Städten die ersten Hungerödeme auftreten und Hamsterer und Bettler das Bild der Straße prägen, gehen Mitte März in Nürnberg Tausende auf die Straße und fordern Kartoffeln und Brot. Im Januar 1918 sind es schon Zehntausende, die auf dem Egidienplatz von ihrer Regierung nicht nur Essen, sondern einen sofortigen Frieden verlangen. Und am 10. Oktober dieses letzten Kriegsjahres ist es die Fränkische Tagespost, das Sprachrohr der Nürnberger Sozialdemokraten, die als erste Zeitung in Deutschland die Abdankung Wilhelms II. fordert.
Vier Wochen später, am 9. November 1918, ist es dann so weit. Erst gibt der Reichskanzler die Abdankung des Deutschen Kaisers und Königs von Preußen bekannt, ohne dass dieser seine Bereitschaft zu dem Schritt erklärt hätte, und dann ruft der langjährige Redakteur der Fränkischen Tagespost, Philipp Scheidemann, von einem Fenster des Berliner Reichstagsgebäudes aus die Republik aus. Nicht dass diese Staatsform zu diesem Zeitpunkt von den meisten Deutschen gefordert oder auch nur gewünscht würde. Die Geburt der ersten deutschen Republik ist ein Betriebsunfall der Geschichte, geschuldet einem Augenblick, in dem es andernfalls noch schlimmer hätte kommen können: Eine Räterepublik nach sowjetischem Vorbild ist auch in den Wochen und Monaten nach diesem umstürzenden Ereignis nicht vom Tisch – im Reich nicht, in Bayern nicht und in Fürth auch nicht.
Seit sich die Matrosen der vor Wilhelmshaven liegenden Hochseeflotte Anfang November 1918 geweigert haben, noch einmal in die Schlacht zu dampfen, gerät die innere Lage in Deutschland außer Kontrolle. Matrosen, Soldaten, Arbeiter tun sich zusammen, bilden Räte, fordern ein Ende des Krieges und des Elends, wollen die dafür Verantwortlichen vor Gericht sehen. Einige wollen mehr, auch nach dem 9. November. Namentlich eine Gruppe um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die sich »Spartakisten« nennen, wollen eine deutsche Sowjetrepublik und gehen aufs Ganze. Als sich die Mehrheits-Sozialdemokraten Mitte Dezember 1918 auf dem zentralen Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte in Berlin gegen die radikale Linke durchsetzen und sich im Sinne der Berliner Übergangsregierung für Wahlen zu einer Nationalversammlung aussprechen, suchen die Kommunisten, wie sich die Spartakisten und andere radikale Linke inzwischen nennen, in der zweiten Woche des jungen Jahres 1919 die Entscheidung auf der Straße.
Sie scheitern hier wie auch anderenorts, etwa in Bayern, wenngleich die Entwicklung in München oder Fürth einen anderen Verlauf nimmt als in der Reichshauptstadt. Am 7. November 1918 ruft der unabhängige Sozialdemokrat Kurt Eisner im Münchener Mathäser Bräu die Republik aus und erklärt König Ludwig III. für abgesetzt. Bis zu seinem gewaltsamen Tod am 21. Februar 1919 amtiert Eisner, gewählt vom Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrat, als Ministerpräsident. Die seiner Ermordung folgenden tumultuösen Entwicklungen kulminieren schließlich am 7. April in der Ausrufung der Münchener Räterepublik, die sich bis zu ihrer gewaltsamen Auflösung durch Reichswehr und Freikorps bis zum 4. Mai 1919 halten kann, also gerade einmal vier Wochen, aber länger als jede andere, zum Beispiel die Fürther.
Auch hier ist der lokale Arbeiter- und Soldatenrat die treibende Kraft. Der hatte sich am 8. November 1918 in der Gaststätte »Grüner Baum« konstituiert, noch in der Nacht sämtliche Ämter sowie den Bahnhof, die Post und das Rathaus besetzt und auf dessen Turm die rote Flagge gehisst. Allerdings bleibt der Oberbürgermeister im Amt und so gesehen einstweilen alles beim Alten. Erst als der Fürther Arbeiter- und Soldatenrat am 7. April 1919 – unter Führung der unabhängigen Sozialdemokraten und unter dem Eindruck der Vorgänge in München – erneut zentrale Institutionen der Stadt besetzt und auf die Räterepublik zusteuert, tritt er zurück. Weil sich aber noch am Abend des Umsturzes die Mehrheits-Sozialdemokraten gegen die Räterepublik aussprechen, kapitulieren die Revolutionäre am 10. April vor dem Magistrat und lösen ihre Republik am folgenden Tag auf.
An diesem 11. April 1919 spricht sich sowohl der Arbeiter- und Soldatenrat der Stadt als auch der Soldatenrat der Fürther Garnison für die Auflösung aus. Wie Gustav Schickedanz gestimmt hat, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass der Unterzahlmeister dem Rat angehört. Im Oktober 1945 gibt er zu Protokoll, in den Arbeiter- und Soldatenrat »gewählt« worden zu sein. »Bekanntlich wurde dieser Organisation die Schuld beigemessen[,] den Zusammenbruch von 1918 veranlaßt zu haben.« Diese Episode seiner frühen Biographie wird ihn wieder einholen, als die Nationalsozialisten nach der Macht in Deutschland greifen.
Hinter seiner Mitwirkung im Arbeiter- und Soldatenrat eine ausgeprägte politische Einstellung, auch nur eine politische Entscheidung im eigentlichen Sinne des Wortes zu vermuten, wäre wohl falsch. Gustav Schickedanz ist in diesem Sinne nie ein politischer Mensch gewesen. Damals nicht und später auch nicht. Seine Militärzeit ist ganz offenkundig eine Zeit der Suche und der Orientierungslosigkeit. Seine Bestimmung hat er jedenfalls noch nicht gefunden, wohl unter den obwaltenden Umständen auch nicht finden können. Der Arbeitsmarkt der Kriegs- und der Nachkriegszeit befindet sich in desolatem Zustand, an eine Rückkehr zu J. W. Spear & Söhne ist nicht zu denken: In Zeiten des Hungers und der Not brauchen die Menschen Brot, nicht Spiele.
Und weil sich das Militär unter solchen Umständen als sicherer Hafen erweist, bleibt Gustav Schickedanz einstweilen, wo er ist, spielt auch mit dem Gedanken, nach seinem Ausscheiden die Position eines Unterzahlmeisters gewissermaßen ins Berufsleben zu verlängern und die Militärbeamtenlaufbahn einzuschlagen. So ist die Kaserne seine Heimat, und die Kameraden, mit denen er Tag um Tag zusammen ist, bilden das Milieu, in dem er sich bewegt. Als dieses von der revolutionären Welle erfasst wird, als plötzlich Leben und Perspektiven in das stupide Soldatendasein kommen, ist auch er dabei. Alles andere wäre überraschend. Was hätte er auch sonst tun sollen? Also wird Gustav Schickedanz zum Revolutionär – zum ersten Mal in seinem Leben, aber nicht zum letzten Mal.
Perspektiven? 1918/19 spielt Gustav Schickedanz, der es bis zum Unterzahlmeister gebracht hat, mit dem Gedanken einer militärischen Laufbahn.
Die Zeit des Ersten Weltkriegs und der ihm folgenden Monate gehört neben dem noch zu schildernden tragischen Verlust seiner ersten Familie zu den beiden Themen, zu denen Gustav Schickedanz zeitlebens geschwiegen hat. Mit seinen damaligen Ausflügen ins Rätedasein hat das nichts zu tun. Eher schon mit dem Eingeständnis frühen Scheiterns. Denn die Jahre vom Oktober 1913 bis zum Juni 1919 waren nicht nur eine verlorene Zeit, sie lassen auch nichts von dem entschlossenen, tatkräftigen Menschen erkennen, der sich wenig später auf den Weg macht, den Handel in Deutschland zu revolutionieren.
Schwer zu sagen, welche äußeren und inneren Umstände schließlich den Ausschlag geben und Gustav Schickedanz auf den Weg des Erfolges führen. Neben Zufällen und Gelegenheiten, die sich ihm bieten und deren Potenzial er erkennt, und den Zeitläuften, die er zu deuten versteht, sind es wohl vor allem ein sicherer Instinkt fürs Geschäft, der unbedingte Wille zum Erfolg und nicht zuletzt seine Familie, die ihm dabei hilft – seine Eltern, seine Schwester, seine Frauen.
Die Mutter freilich erlebt nur noch die Gründung des ersten Geschäfts. Eva Elisabeth Schickedanz stirbt am 2. März 1923 schwer krank im Alter von gerade einmal sechzig Jahren. Vater Leo Schickedanz, der in seinem eigenen Berufsleben nicht gerade reüssiert hat, geht dem Sohn in dessen Unternehmen mit einiger Lebenserfahrung und ganzer Tatkraft zur Hand, und auch die Schwester gehört zu den wenigen Mitarbeitern der ersten Stunde.
Liesl Schickedanz hat im Oktober 1917 den Fürther Kaufmann Daniel Kießling geheiratet, der später im Unternehmen von Schwager Gustav Schickedanz eine wichtige Rolle spielen wird. Daniel Kießling ist am 3. Januar 1890 als Sohn eines Bildhauers und Enkel eines Fotografen in Fürth geboren worden, hat nach der Schule eine kaufmännische Lehre eingeschlagen und ist dann bei der Vera Bleistiftfabrik, einem renommierten Hersteller dieser Schreibwerkzeuge in seiner Heimatstadt, untergekommen. Den Kriegsdienst leistet er wie sein zukünftiger Schwager beim 21. Infanterie-Regiment ab.
Dieser kann der Hochzeit nicht beiwohnen, da er im Feld steht. Also gratuliert er brieflich, gibt seiner Hoffnung Ausdruck, »beim nächsten Feste ›Kindertaufe‹ dabei sein zu können« – und lässt keinen Zweifel daran, »daß der oder die Erstgeborene Anna oder Gustav heißen muß!!«. Tatsächlich wird der Erstgeborene von Daniel und Liesl Kießling, der zwei Jahre später zur Welt kommt, auf den Namen »Gustav Emil« getauft, und dass Gustav Schickedanz »dabei« ist und als Pate amtiert, versteht sich von selbst.
Und natürlich hatte er seine Gründe für den alternativen Namensvorschlag »Anna«. Gustav Schickedanz hat Anna Babette Zehnder auf der Dambacher Silvesterfeier 1916 kennengelernt. Die Begegnung mit der hübschen, zupackenden Bäckerstochter geht ihm nicht aus dem Sinn und aus der Seele, und so gehen die beiden ein Jahr nach ihrer Verlobung am 28. September 1919 den Bund fürs Leben ein. Am 11. Januar 1924 kommt ihr erstes Kind, Gustavs einziger Sohn, zur Welt, den sie nach seinem Großvater benennen. Ein gutes Jahr später, am 15. März 1925, wird Tochter Louise geboren.
Auch Gattin Anna und ihre Familie unterstützen die unternehmerischen Anfänge des Gustav Schickedanz. Seine Frau gehört wie seine Schwester und der Vater seit 1923 zum kleinen Kreis der Mitarbeiter, und seine Schwägerinnen, Gretl Klinger und Lina Wüstendörfer, steuern ihren Anteil zu jener Einlage bei, mit der Schickedanz, bevor er sich wenige Jahre später selbständig macht, zunächst einmal als Teilhaber bei seinem ersten Arbeitgeber einsteigt.
Nachdem Gustav Schickedanz am 30. Juni 1919 aus dem Militärdienst entlassen worden ist, nimmt er seine Tätigkeit als Angestellter beim Grossisten Otto Lennert auf. Die alteingesessene »Kurzwarenhandlung en gros« hat ihr Ladenlokal in der Fürther Königstraße. Zu den Kunden zählen Ladenbesitzer, fliegende Händler oder auch Wochenmarktverkäufer. Schon weil er bald auch als Teilhaber engagiert ist, sucht der Jungunternehmer nach neuen Wegen für den Absatz und neuem Schwung für den Umsatz. Die Idee ist einfach, ihre Umsetzung schwierig: Zu Beginn des Jahres 1922 versucht Gustav Schickedanz die Stammkunden des Geschäfts davon zu überzeugen, sich zu einer Handelskette zusammenzuschließen, gemeinsam einzukaufen und auf diese Weise spürbar günstiger an die Waren zu gelangen als im Alleingang. Der Plan scheitert an der mangelnden Solidarität und der schlechten Zahlungsmoral der Kunden, und die wiederum geht nicht zuletzt auf das Konto der wirtschaftlichen und politischen Verfassung Deutschlands in diesen unruhigen Zeiten.
Familienbetrieb: Nicht nur Gustav und seine Frau Anna Schickedanz, hier bei ihrer Hochzeit am 28. September 1919, arbeiten in der Firma des Jungunternehmers, sondern auch dessen Eltern Elisabeth und Leo Schickedanz (rechts im Bild), seine Schwester Liesl (Dritte von links) und ihr Mann Daniel Kießling (Fünfter von rechts). Die Schwägerinnen Gretl Klinger (links im Bild) und Lina Wüstendörfer (Siebte von links) steuern ihren Anteil zu jener Einlage bei, mit der Schickedanz als Teilhaber bei seinem ersten Arbeitgeber einsteigt.
Zu den tiefgreifenden Folgen des Krieges zählt der desolate Zustand der Staatsfinanzen. Hatte die Staatsschuld 1914 etwa fünf Milliarden Reichsmark betragen, ist sie bei Kriegsende auf 156 Milliarden angewachsen, um im März 1922 astronomisch anmutende 337 Milliarden zu erreichen. Für diese Talfahrt gibt es eine Reihe von Ursachen und Gründen – darunter solche, auf die man in Berlin wenig Einfluss hat, wie die allgemeine Verfassung der Weltwirtschaft, aber auch andere, die jedenfalls zum Teil hausgemacht sind. Dazu wird man den Versuch zählen müssen, die Inflation in Deutschland zu instrumentalisieren, um die rigiden Bestimmungen des Friedensvertrags, allen voran die als drückend und demütigend empfundenen Reparationszahlungen, zu unterlaufen. So abträglich diese Politik für die deutsche Wirtschaft auch sein mag, im Land trifft sie auf Verständnis. Das liegt an diesem Vertrag und an der Art und Weise, wie er den Deutschen aufgezwungen worden ist.
Schlimm genug, dass man als Verlierer des Krieges gebrandmarkt war, obgleich an seinem Ende praktisch kein Soldat des Feindes auf deutschem, wohl aber die deutschen Truppen noch in Frankreich, Belgien und Luxemburg standen und vor allem riesige Gebiete des alten Russland besetzt hielten. Dass es die Oberste Heeresleitung gewesen war, die eine Fortsetzung des Krieges für aussichtslos gehalten und die Politiker in Berlin zu den Verhandlungen über einen Waffenstillstand gedrängt hatte, erfahren die Deutschen erst später. An ihrem Urteil über den Vertrag, den ihre Vertreter am 28. Juni 1919 im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles hatten unterzeichnen müssen, ändert das im Übrigen wenig.
Denn der sieht nicht nur die Abtretung erheblicher Territorien, insgesamt von etwa 13 Prozent des Reichsgebiets, vor, sondern auch die fast vollständige Auflösung der deutschen Militärmacht zu Lande und zur See, den Verlust sämtlicher Kolonien – und nicht zuletzt: die Zuweisung der alleinigen Verantwortung für den Ausbruch des Krieges und die Folgen an Deutschland und seine damaligen Verbündeten. Das halten die Deutschen schon deshalb für nicht akzeptabel, weil mit diesem berüchtigten Artikel 231 des Versailler Vertrages die exorbitanten Reparationsforderungen der vormaligen Kriegsgegner legitimiert werden sollen.
Und damit den Verlierern des Krieges keine Zweifel an der Entschlossenheit der Sieger kommen, ihre Forderungen auch einzutreiben, besetzen diese im März 1921 Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort und dekretieren wenige Wochen später, Anfang Mai, ultimativ einen Zahlungsplan. Die Reaktion der Regierung in Berlin ist ebenso einfach wie gefährlich: Indem man die Forderungen der Alliierten erfüllt, will man diesen die engen Grenzen der deutschen Leistungs- und Zahlungsfähigkeit vor Augen führen – koste es, was es wolle, und sei es die Lebensfähigkeit der deutschen Wirtschaft.
Daran ändert sich in den kommenden Monaten wenig. Zwar wechseln die Regierungen in Berlin und mit ihnen die Strategien, aber das Ziel bleibt im Visier – auch nach dem 11. Januar 1923, als französische und belgische Truppen unter einem Vorwand das Ruhrgebiet, eine der Lebensadern der deutschen Wirtschaft, besetzen und damit eine der schwersten Krisen der Weimarer Republik auslösen, wie die Deutschen ihr junges Staatswesen inzwischen nennen. Trägt der »passive Widerstand« gegen die Besatzer entscheidend zur Zerrüttung von Wirtschaft und Finanzen bei, so ruft der Abbruch dieses ruinösen Ruhrkampfes gut acht Monate später die radikalen Kräfte auf den Plan.
In Thüringen und Sachsen proben die Kommunisten den Umsturz, in Bayern sehen Erich Ludendorff, einer der verantwortlichen Generäle während des Krieges, und ein gewisser Adolf Hitler im Chaos dieser Tage die Gunst der Stunde für einen Putsch, und in Berlin verfolgt die Regierung hilflos den außer Kontrolle geratenden Verfall der deutschen Währung und die sprunghafte Zunahme der Arbeitslosigkeit. Ob die Mitte November 1923 mit der Währungsreform beschlossene Einführung der Rentenmark eine grundlegende Wende herbeiführen wird, ist am Jahresende noch keineswegs ausgemacht.
In diesen bewegten Zeiten lässt der Kaufmann Gustav Schickedanz, »Sitz Fürth, Moststraße 35«, am 6. Januar 1923 einen »Großhandel mit Kurzwaren« in das Handelsregister eintragen. Der Geschäftsbetrieb läuft bereits seit dem 7. Dezember 1922. Für diese auf den ersten Blick überraschende Entscheidung hat er seine Gründe, darunter die engen Grenzen, die ihm durch die Partnerschaft mit dem grundsoliden, aber wenig experimentierfreudigen Otto Lennert gesetzt sind. Obgleich sein Plan, die Kundschaft in einer Handelskette zu organisieren, ihr so zu günstigeren Preisen zu verhelfen und sie damit dauerhaft ans eigene Geschäft zu binden, vorerst nicht aufgegangen ist, hält er ihn grundsätzlich für richtig.
Gerade weil er die Kunden aufgesucht und mit ihnen gesprochen hat, kennt Gustav Schickedanz die Faktoren, an denen seine Idee gescheitert ist, allen voran die ungünstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und insbesondere die Inflation. Dabei sind doch gerade diese Umstände das stärkste Argument für niedrige Einkaufspreise. Also geht Schickedanz in die Offensive – obwohl oder gerade weil die wirtschaftliche Lage desaströs ist, der Großhandelsbetrieb alles andere als gut dasteht und die »Preise zum Teil fast schon bis zur Hälfte herabgedrückt« sind, wie Anna Schickedanz ihrem Schwager Daniel Kießling schreibt: »[Du] kannst dir denken[,] was wir schon verlieren, wir müssen mitmachen[,] um wenigstens Geld hereinzubekommen … wir kommen schon durch, die meisten aber warten.«
So ist er, dieser Gustav Schickedanz. Nicht zum letzten Mal in seinem langen Leben als eigenständiger Unternehmer, das hier beginnt und schließlich mehr als ein halbes Jahrhundert umfassen wird, handelt er antizyklisch. Schickedanz ist ein mutiger Mann, kein Hasardeur. Jetzt nicht und später auch nicht. Er »habe keine einzige Aktie und spekuliere nicht«, sagt er noch an seinem Lebensabend. Und was für den gestandenen Unternehmer gilt, galt schon für den jungen: Der Schritt in die Karriere eines freien Unternehmers ist wohl überlegt, wenn auch natürlich nicht ohne Risiko.
Zu den sicheren Posten des jungen Geschäfts zählen die Mitarbeiter. Wie gesehen, rekrutieren sich diese anfänglich ausschließlich aus dem Kreis der Familie – neben Gustavs Schwester Liesl und seiner Frau Anna, die für die Buchhaltung zuständig ist, wird vor allem der Vater in dieser Phase des Aufbaus und der Selbstbehauptung zu einer tragenden Säule des jungen Unternehmens. Leo Schickedanz ist für das Lager verantwortlich. In Zeiten rasanten Geldverfalls sind dessen Bestände das wichtigste Kapital der Firma.
Als sich die wirtschaftliche und politische Lage in Deutschland konsolidiert und auch die Geschäfte von Gustav Schickedanz, Kurz- u. Wollwaren en gros, eine erfreuliche Entwicklung nehmen, können erstmals Lehrmädchen eingestellt werden. Dass eine von ihnen, dass Grete Lachner einmal zur entscheidenden Person im Leben und im Unternehmen des Gustav Schickedanz werden und nach dessen Tod die Leitung der Geschäfte übernehmen würde, hat sich damals natürlich niemand vorstellen können – der Kurzwarengrossist nicht und sein Lehrmädchen schon gar nicht.
Grete Lachner ist fünfzehn, als sie zum 1. Januar 1927 als fünftes Lehrmädchen in die Firma eintritt. Eigentlich hat sie Kindergärtnerin werden wollen, aber dafür reichen die Mittel der Familie nicht aus. Denn die junge Frau, die am 20. Oktober 1911 um vier Uhr vormittags in Fürth geboren worden ist und »Gretchen« genannt wird, kommt aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Vater Heinrich ist Flaschnergehilfe und muss neben Gretes älteren Schwestern Maria und Betty auch noch ihre beiden jüngeren Brüder Hans und Karl durchbringen, die im Zweiten Weltkrieg fallen werden. Da das Einkommen nicht reicht, um die Familie über die Runden zu bringen, muss auch Mutter Katharina, geborene Unger, von Beruf Arbeiterin, zum Lebensunterhalt beitragen. Tochter Grete wird das nicht vergessen. Der Hunger und das Betteln bei den Bauern der Umgebung sind prägende Erlebnisse der frühen Jahre.