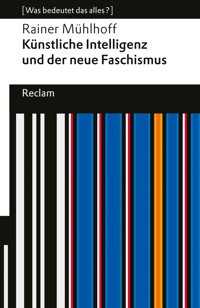
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Die Nacht der US-Präsidentschaftswahl verbringt Elon Musk bei Donald Trump. Was ist da los? Warum wird künstliche Intelligenz als Heilsbringer für die größten Probleme der Menschheit gehandelt, obwohl die Industrie auf Ausbeutung und Menschenverachtung beruht? Die öffentliche Spekulation über Erlösung oder Auslöschung durch KI lenkt von den erheblichen gesellschaftlichen Schäden heutiger KI ab. Und sie verdeckt die zunehmend faschistischen Tendenzen, die sich im Zusammenspiel von Tech-Industrie und der neuen Rechten bilden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rainer Mühlhoff
Künstliche Intelligenz und der neue Faschismus
Reclam
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962455
2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962455-6
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014666-8
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Einleitung: Ein neuer Faschismus am Horizont?
Faschismus
1. Was ist KI? – technisch und historisch gesehen
Anthropomorphisierung
Sommer folgt auf Winter folgt auf Sommer: Die KI-Hype-Zyklen
Zwei Paradigmen: symbolische und subsymbolische KI
Die Macht der KI
2. Die Gesellschaft der Präemption
Wahrheit und Wahrscheinlichkeit
Von der Fallprüfung zur Fallwette: Ein Gedankenexperiment
KI für den »Bürokratieabbau«?
Chancengleichheit in der probabilistischen Wissenskultur
3. Der KI-Hype im öffentlichen Diskurs
Artifizielle Generelle Intelligenz – AGI
Existenzielle Risiken und das Drohbild des Abgehängtwerdens
KI-Utopien und Solutionismus
Zukunft ohne Gegenwart
4. Die Ideologien hinter dem KI-Hype
Technologischer Determinismus und Techno-Optimismus
Transhumanismus und seine Unterströmungen
Extropianismus und Singularitarianismus
Eugenik 2.0
Die Rationalisten und ihre existenzial-futuristische Ethik
Effektiver Altruismus
Longtermismus
Säkulare Eschatologie
Politik im Hier und Jetzt
5. Libertarismus, Dunkle Aufklärung und Alt-Right
Cyberlibertarismus
Blutsverwandtschaft durch »Coding Skills«
Trolle und Maskulinisten
Die Manosphere
Neoreaktion und Dunkle Aufklärung
Die CEO-Monarchie
Soziale Auslese und beschleunigter Verfall
Selektiver Pronatalismus
6. Der neue Faschismus
Der Begriff »Faschismus«
Antidemokratisches Wirken
Es wird nicht diskutiert
Faschismus als Gewaltdisposition
Naturalisierung von Ungleichheit
Technologie als Machtinstrument
Ein neuer Umschlagpunkt in der Dialektik der Aufklärung
Was tun?
Antidemokratische Kräfte isolieren
Anders über KI-Technologie sprechen
Literaturverzeichnis
Zum Autor
Einleitung: Ein neuer Faschismus am Horizont?
Kurz nach der Amtseinführung von Donald Trump zum 47. US-Präsidenten waren in den USA bemerkenswerte Vorgänge zu beobachten: Der Tech-Unternehmer und damals reichste Mensch der Welt, Elon Musk, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, mit einem Gefolge aus Ingenieuren und Führungskräften seiner zahlreichen Unternehmen durch die Bundesbehörden in Washington zu ziehen, um sich Zugang zu Gebäuden, Computersystemen und Daten zu verschaffen. Am Tag der Amtseinführung wurde Musk zum Regierungsberater und de facto Leiter eines neu geschaffenen »Department of Government Efficiency (DOGE)« ernannt. In dieser Position agierte er nahezu unaufhaltsam, indem er in einer Mischung aus Überrumpelung, Einschüchterung und Hacker-Taktiken den Verwaltungsapparat der Bundesbehörden zu übernehmen versuchte.1
Diese als digitaler Staatsstreich beschriebene Übernahme2 begann in der Woche der Amtseinführung mit dem Office of Personnel Management (OPM), der zentralen Personalstelle der Bundesbehörden. Musk verschaffte sich Zugang zum Computersystem und zahlreichen sensiblen Daten – darunter den gesamten Personaldaten der Bundesangestellten –, schloss Teile des Personals aus diesem System aus und platzierte Vertraute (häufig Mitarbeitende aus seinen eigenen Unternehmen) in strategischen Positionen. In einer E-Mail an die mehr als zwei Millionen Bundesangestellten der US-Verwaltung wurden drastische Personaleinsparungen sowie die Anwendung verschärfter Loyalitätskriterien und Leistungsbeurteilungen angekündigt. Die E-Mail unterbreitete den Empfänger:innen außerdem das Angebot einer sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Lohnfortzahlung bis September 2025. Wer bisher noch nicht gekündigt hatte oder entlassen wurde, muss DOGE wöchentlich über seine Arbeitsaktivitäten unterrichten. Diese Berichte speist das Team von Elon Musk dem Vernehmen nach in KI-Systeme ein, um sie zu beurteilen und über die »Notwendigkeit der Position« zu entscheiden.3
Parallel zum OPM übernahm Musks Team die Kontrolle über die General Services Administration (GSA) sowie weitere Behörden, darunter die US Agency for International Development (USAID), deren internationale Aktivitäten fast vollständig eingestellt wurden und in der die systematische Vernichtung klassifizierter Dokumente angeordnet wurde – anstatt sie, wie vorgeschrieben, den National Archives zu übergeben.
Besonders brisant: Musk sicherte sich außerdem Zugang zum zentralen Zahlungssystem des US Treasury Departments, das jährlich Billionen Dollar unter anderem für Sozialleistungen, Gehälter, Dienstleistungen und Subventionen abwickelt. Der Zugriff erfolgte an einem Wochenende und nach anfänglicher Weigerung des zuständigen Abteilungsleiters, der daraufhin in den Ruhestand versetzt wurde. Musk selbst prahlte auf X über den Coup: »Very few in the bureaucracy actually work the weekend, so it’s like the opposing team just leaves the field for 2 days!«4 – eine Schlachtfeldrhetorik, die keineswegs an geordnete rechtsstaatliche Prozesse denken lässt.
Dieses Muster einer gewaltsamen Infiltration auf Ebene der Bundesverwaltung, ermöglicht nicht durch parlamentarische Beschlüsse, sondern durch schnelles Agieren, die Schockstarre der Überrumpelung und Kontrolle über technische Systeme, setzte sich fort. Behörden wie die Environmental Protection Agency (EPA), die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) und sogar der Geheimdienst CIA und das Verteidigungsministerium standen im Fokus eines radikalen Einsparungsgebots, unter dessen Deckmantel eine Säuberungsaktion durchgeführt wurde, die fast schon wie eine Kulturrevolution wirkt: Alle Erwähnungen von Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) müssen aus öffentlichen wie internen Dokumenten und Websites gelöscht werden, es existieren dazu Wörterlisten, nach denen gesucht und gefiltert werden solle5; das Pentagon löscht Zehntausende Fotos, die etwa Frauen und People of Color im Militärdienst oder kritische historische Inhalte der US-Militäraktivitäten dokumentieren6; wissenschaftliche Projekte, die Diversity-Maßnahmen umfassen oder etwa die Gebiete Klimaforschung, öffentliche Gesundheit, Reproduktions- und Sexualmedizin betreffen, werden vorzeitig eingestellt: Das Verbot von Diversity-Maßnahmen wirkt sich dadurch sogar auf die Aktivitäten internationaler Forschungspartner der USA aus.7
All diese Vorgänge stellen eine scheinbar beispiellose Entwicklung dar, die in Tempo und Methode einen Qualitätssprung im politischen Projekt Trumps markiert. Diese Entwicklung lässt sich am besten mit dem Wort Faschismus beschreiben. Während wir es in der Anfangsphase dieser Prozesse zunächst mit faschistoiden Kräften und Methoden zu tun haben, wird der weitere Verlauf zeigen, ob daraus sogar ein faschistisches System erwachsen wird. Dieser neue Faschismus sieht in vielen Hinsichten nicht exakt so aus wie seine historischen Vorbilder – doch gerade deshalb müssen die Kräfte, die ihn antreiben, frühzeitig als faschistisch erkannt werden.
Dabei geht es im Folgenden nicht ausschließlich um US-Politik. Dort manifestiert sich vielmehr ein internationaler und auch jenseits der Parteipolitik spürbarer Trend der letzten Jahre: Ultrarechte Ideologien lassen sich zunehmend auch in den sich radikalisierenden Weltbildern der Milieus der IT-Industrie (Tech-Communities) finden: Elon Musk unterstützte den Bundestagswahlkampf der AfD 2025. Peter Thiel, der ultralibertäre Silicon-Valley-Investor und Palantir-Mitgründer, installierte ein Netzwerk von Verbündeten in der US-Regierung für die zweite Amtszeit von Donald Trump.8
Mit dem Begriff »alternative Rechte« (Alt-Right, meist bezogen auf die USA) bzw. »neue Rechte« (spezifischer auf Deutschland gemünzt) beziehe ich mich im Folgenden auf die in den letzten Jahrzehnten erstarkten ultrarechten und rechtsextremen politischen Kräfte, die nationalistische, rassistische, antifeministische und autoritäre Ideologien als tiefgreifenden zivilisatorischen Antagonismus (»Kulturkampf«) vertreten und sich damit gegenüber klassischen konservativen Strömungen abgrenzen und radikalisieren. Diese Bewegungen umfassen sowohl parlamentarische, populistische als auch außerparlamentarische und aktivistische Gruppen und Strömungen.
Das vorliegende Buch zeigt, dass aktuell eine politische Synergie zwischen diesen neuen rechten Bewegungen und Tech-Eliten sichtbar wird und an Bedeutung gewinnt. Diese Verbindung stellt keinen zufälligen, vorübergehenden Opportunismus dar, sondern steht auf einer soliden ideengeschichtlichen und ideologischen Grundlage.
Den Dreh- und Angelpunkt bildet dabei das Thema künstliche Intelligenz (KI). KI-Technologie bildet nicht nur ein Kernsegment der aktuellen IT-Industrie, sondern ist seit Jahrzehnten mit ideologischen und pseudophilosophischen Denkfiguren verknüpft, in denen libertäre, elitistische und antiegalitäre Weltanschauungen dominieren – als Fortsetzung von Eugenik, White Supremacy und Rassismus.9
Im Folgenden werden diese teils philosophisch, teils unternehmerisch geprägten Denkweisen als Tech-Ideologien bezeichnet, um ihre verdeckte Machtdimension und politische Wirksamkeit besser sichtbar zu machen. In den letzten Jahrzehnten haben sich diese Ideologien radikalisiert und zunehmend in Richtung antidemokratischer Visionen und umstürzlerischer Projekte weiterentwickelt. In dieser radikalisierten Form verschmelzen sie mit der Alt-Right-Bewegung, der sie wesentliche theoretische Impulse verliehen haben.
Die Grundthese des folgenden Essays lautet also, dass das faschistoide Potential von Alt-Right-Politik aus ihrer Synergie mit elitistischen Tech-Ideologien erwächst. Das zentrale Kennzeichen der neuen faschistischen Kräfte besteht in dem Bestreben, die spezifischen Möglichkeiten von Datenanalyse- und KI-Technologie zu nutzen, um den Rechtsstaat und die freiheitliche demokratische Ordnung zu schwächen und durch ein schlankes, auf Automatisierung und Präemption (also algorithmische Vorhersage und Vorwegname) basierendes Staatswesen zu ersetzen.
Hierbei geht es nicht darum, einen deterministischen Zusammenhang zu behaupten, nach dem KI-Technologie zwangsläufig zu einem technokratischen Staatswesen oder gar Faschismus führt. Es geht vielmehr darum, aufzuzeigen, dass bestimmte technologische Logiken mit autoritären, menschenverachtenden und antidemokratischen Ideologien besonders kompatibel sind. Die Verbindung zwischen KI-Technologie und antirechtsstaatlichen, antidemokratischen Ideologien, die sowohl in Tech-Kreisen als auch der Alt-Right-Bewegung verbreitet sind, ist zentral für das Verständnis dieses neuen Faschismus.
Das vorliegende Buch diskutiert die ideologische und technische Affinität von KI und Faschismus auf mehreren Ebenen: auf der materiellen Ebene dessen, wie KI funktioniert (Kapitel 1) und wie sie unser Verständnis von »Wahrheit« verändert (Kapitel 2). Auf der Ebene der öffentlichen Vorstellungen von KI (Kapitel 3) sowie der in Tech-Kreisen verbreiteten Weltanschauungen (Kapitel 4), die beide in deutlicher Kontinuität zu eugenischen, antiegalitären und faschistischen Ideologien des 20. Jahrhunderts stehen (Kapitel 5). Nach einer Sichtung dieser grundlegenden und teils historischen Zusammenhänge geht es abschließend um die Radikalisierung von Tech-Ideologien hin zu einer faschistischen Politik in der Gegenwart und Zukunft (Kapitel 6).
Faschismus
Ziel dieses Buches ist es nicht, Faschismus zu definieren. Es ist müßig, rein begrifflich klären zu wollen, ob etwa Trump und sein Regime faschistisch sind. Auch wurde bereits kritisiert, dass es in eine Sackgasse führt, neue faschistoide Bewegungen in alte Definitionen und historische Beispiele für Faschismus zu zwängen.10
Manche haben mir geraten, das Wort »Faschismus« lieber nicht im Titel einer ansonsten als dringend notwendig erachteten kritischen Analyse der Entwicklungen in den USA und – etwas schwächer – auch in Europa zu erwähnen. Zu sehr sei es eine abgenutzte Kampfvokabel mit Tendenz zum Alarmismus. Zweifellos kann es ermüdend und diskussionslähmend wirken, schon wieder einen Nazivergleich vorgetragen zu bekommen. Und zweifellos ist es unheimlich und möglicherweise unbequem, sich gar mit der Möglichkeit einer neuen, geschichtsprägenden Rolle faschistoider Politiken in der nordamerikanisch-europäischen Gegenwart auseinandersetzen zu müssen.
Allerdings, wie Roberto Saviano in seinem Vorwort zu Umberto Ecos Essay Ur-Faschismus ausführt, wäre es ein gewaltiger Fehler, »den Faschismus als ein ausschließlich historisches Phänomen zu begreifen«.11 Um diesen Fehler nicht zu begehen, ist es angebracht, den Begriff aktiv zu verwenden und seine Anwendung auf gegenwärtige Ereignisse zu erproben – eben nicht als Rückführung der Gegenwart auf die Vergangenheit, sondern als Interpretationsangebot mit Blick auf die Zukunft. Ein neuer Faschismus im 21. Jahrhundert muss nicht so aussehen wie bei den Nazis – doch zu viele Menschen stellen sich das heute genauso vor.
Anstatt deshalb unter dem Begriff eine analytisch umrissene Staats- und Politikform oder eine spezifische historische Konfiguration zu verstehen, halte ich die folgenden drei Merkmale aktuell für herausstechend im Hinblick auf die politischen Kräfte und Methoden, die wir als Faschismus erkennen sollten:
Antidemokratisches Wirken: Faschistische Politik zielt darauf, den Rechtsstaat, die administrativen Abläufe und die parlamentarische und demokratische Ordnung zu zerstören. Insbesondere vertritt faschistische Politik nicht einfach eine weitere Position im Spektrum politischer Positionen (wie »rechtsaußen«), sondern sie verkörpert eine destruktive Haltung gegenüber der parlamentarischen Demokratie und dem Rechtsstaatsprinzip, die das System der widerstreitenden und miteinander in Verhandlung tretenden politischen Positionen komplett überwinden möchte. In der zynischen und nihilistischen Variante, die Trump vertritt, dient der destruktive Impuls der hemmungslosen (wirtschaftlichen) Selbstbereicherung der faschistischen Akteure und ihrer mitunter rein kapitalistisch motivierten Unterstützer.
Gewaltbereitschaft: Faschistisches Wirken ist gekennzeichnet durch persönliche Gewaltbereitschaft und Bereitschaft der Akteure, sich so gehässig wie möglich zu verhalten, sei es sprachlich, medial, physisch oder politisch. Dieses Gewaltpotential basiert auf einem hierarchischen Menschenbild und weltanschaulich tief verankerter Dehumanisierung – dazu gehören auch Rassismus, Sexismus und Antifeminismus. Das Leben scheint für Faschisten ein permanenter sozialer Kampf zu sein, in dem es gelte, sich durch Stärke zu behaupten und andere Menschen unterzuordnen, sie ihrer Menschenwürde zu berauben, sie auszubeuten oder ihnen sogar ein Existenzrecht abzusprechen.12 Faschismus bedeutet eine bestimmte psychische und charakterliche Disposition der Akteure, die für so lange Zeit geführten Kämpfe um Anerkennung, Integration und Gleichberechtigung von Minderheiten zugunsten eines Rechts des Stärkeren in den Wind zu schlagen. Zum Gewaltpotential des Faschismus gehört auch, breite Massen durch zynische Narrative zu täuschen, Ressentiments anzustacheln und immer tiefer gehende gesellschaftliche Spaltungen zu provozieren. Viel dieser Gewalt findet heute in einem Wechselspiel aus Online- und Offline-Welt statt.
Technologie als Machtinstrument: Zum Faschismus gehört auch die berechnende Indienstnahme neuester Technologie, um eigene Machtinteressen zu realisieren – oft in einem Zusammenspiel zwischen Industrie und Regime. Das war in den 1930er und 1940er Jahren bei den Nazis so, die zur Umsetzung der Logistik ihres Staats- und Vernichtungsapparats zum Großkunden des US-amerikanischen Computerherstellers IBM wurden13, und ist heute nicht anders. Ein spezifisches Kennzeichen des Faschismus gegenüber der allgemeineren Kategorie des Autoritarismus ist die Aneignung und Einhegung von Technologie als Machtinstrument. Faschismus ist eine zerstörerische Kraft, die auf der Bereitschaft dazu beruht, die für seine destruktiven politischen Ziele nötige Macht und Gewalt mit technologischen und logistischen Mitteln zu erreichen – und die Technologie dafür förmlich zu verehren.14 Im vorliegenden Fall ist diese Technologieverehrung gehüllt in einen als Solutionismus (von engl. solution für ›Lösung‹) bezeichneten Glauben an die Überlegenheit von Technologie als Instrument, um gesellschaftliche Probleme zu lösen.15 Dieses Narrativ schließt eine Unterordnung von Mensch, Kultur und Gesellschaft unter eine technologisch zu realisierende Logik von Effizienz, Profit und nationaler oder ethnischer Überlegenheit ein.
Hinsichtlich der Form politischer Bewegungen treten rechte Strömungen durch unterschiedliche Strategien und Methoden in Erscheinung:
Rechtspopulismus mobilisiert Massen, die alternative und neue Rechte unterwandert Diskurse, Parlamente und Institutionen, und rechtsextreme Aktionsgruppen setzen auf direkte Konfrontation durch oft physische Gewalt.
Auch wenn diese drei Bewegungsformen sich in ihrer Außendarstellung gegeneinander abgrenzen, bildet sich eine faschistische Dynamik genau dann, wenn sie faktisch in wechselseitiger Synergie und Steigerung operieren.
Während das Trump-Regime der ersten Amtszeit von zahlreichen Kommentatoren noch nicht als faschistisch qualifiziert wurde, hat sich rund um den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 ein intensiviertes Zusammenspiel dieser drei Bewegungsformen mit Trump als zentraler Bezugsfigur herausgebildet. Diese Dynamik hat das Potential, ein faschistisches Regime hervorzubringen, vor allem, weil über die Jahre bis zu seiner zweiten Amtszeit noch zwei weitere Voraussetzungen für dessen Realisierung erfüllt wurden:
Erstens haben einflussreiche wirtschaftliche Eliten begonnen, die Bewegung öffentlichkeitswirksam zu unterstützen. Das Silicon Valley, das sich während der ersten Amtszeit noch als liberale Blase gegen Trump scheinbar abgeschottet hatte, ist nun in weiten Teilen bereit, sich diesem Projekt anzuschließen. Immer mehr wurde über die letzten Jahre eine ideologische Sympathie von Alt-Right-Polit-Milieus, Silicon-Valley-CEOs und Venture Capitalists öffentlich zur Schau gestellt. Dadurch gewann Trumps Projekt bedeutend an Momentum.
Zweitens ist es der Bewegung gelungen, sich staatliche Infrastruktur anzueignen. Insbesondere durch das Agieren von Elon Musk und DOGE folgten auf die ideologische Mobilisierung nun konkrete Taten, die auf einen direkten Abbau rechtsstaatlicher Struktur gerichtet sind. In der Geschichte des Faschismus ist es nicht unbekannt, dass der Beginn solcher Regime die zentrale Koordination und Übernahme der Verwaltungsinfrastruktur umfasst, und zwar durch die Zentralisierung von Daten (die Nazis verwendeten dazu die IBM-Lochkartentechnologie, die in allen Bereichen des Reiches eingeführt wurde), die Einsetzung von politischen Loyalisten sowie die Entlassung und »Säuberung« von politisch Andersdenkenden und Unerwünschten in diesen Einrichtungen.
Durch das unberechenbare, parlamentarisch nicht legitimierte und schnelle Vorgehen Trumps in den ersten Monaten seiner zweiten Amtszeit wurde ein Theorem des Nazi-Staatsrechtlers Carl Schmitt (1888–1985) umgesetzt: »Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand verfügt« – wer also auf Ebene der Abläufe und Prozeduren Demokratie und Rechtsstaat aushebelt.
Diese Beobachtung unterstreicht die zentrale These dieses Buches: Ein bestimmtes Verständnis von diesem »Ausnahmezustand« – nämlich in der Gestalt sich vermeintlich überschlagender ›Disruption‹ durch technologische Innovation – ist fest in den Weltbildern von Tech-Eliten und -Communitys verankert. Die Idee der einschneidenden Auswirkung von Technologie auf Gesellschaft wird in den letzten Jahren von rechten Kräften politisch unterstützt und herbeigesehnt. Es ist möglich, dass das Gemeinwesen, das als Ergebnis dieser Einschnitte herauskommen wird, ein faschistisches ist.
1. Was ist KI? – technisch und historisch gesehen
Seit Beginn des Jahrzehnts wird im gesellschaftlichen Diskurs über KI gesprochen, als wäre damit eine eigenständige, höhere Entität gemeint – eine Technologie, die denkt, entscheidet und vielleicht sogar fühlt. Oft wird KI im Singular mit bestimmtem Artikel gebraucht – die künstliche Intelligenz hat etwas gesagt, geantwortet oder kann für die Lösung eines Problems gewissermaßen ›angerufen‹ werden.
Doch sagen diese Vorstellungen eigentlich mehr über uns Menschen als über KI-Technologie aus. Wie wir über KI sprechen, überhöht die technologische Realität von KI-Systemen, die tatsächlich weder denken, fühlen oder autonom agieren können noch in einem vollwertigen Sinne intelligent sind, wie wir es über uns Menschen sagen würden.
Die Faszination für den mechanischen Nachbau menschlicher Geistesfähigkeiten ist nicht neu. Schon in der Antike träumten Menschen von mechanischen Wesen, die Befehle ausführen. Von Hephaistos’ automatischen Dienern, über die Homer in der Ilias16 berichtet, bis zu sprechenden Puppen und Schachautomaten, die im 18. Jahrhundert gebaut und als Spektakel in ganz Europa vorgeführt wurden: Die Vorstellung, es könne eine Maschine geben, die wie Menschen denken, sprechen oder handeln kann, fasziniert die Menschheit schon seit langer Zeit.17
Während man zu Zeiten der Aufklärung vor allem von denkenden, sprechenden oder handelnden »Automaten« und »Maschinen« gesprochen hat, gibt es den Begriff der künstlichen Intelligenz als feststehenden Ausdruck erst seit dem Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, das 1956 von John McCarthy (1927–2011) und anderen Wissenschaftler:innen an der Dartmouth-Universität in New Hampshire, USA, veranstaltet wurde. Die Verwendung des Begriffs »artificial intelligence« im Titel der Veranstaltung hatte eine programmatische Wirkung und sollte sich als die Geburtsstunde eines Forschungsfeldes erweisen, auf das wir noch heute unter dieser Bezeichnung verweisen.
Schon vor der Dartmouth-Konferenz wurde dem Forschungsfeld KI der Weg geebnet, unter anderem durch das Werk von Alan Turing (1912–1954) aus den 1930er und 1940er Jahren. Auch die Entwicklung der Kybernetik durch Norbert Wiener (1894–1964) und andere seit den 1940er Jahren ist zu erwähnen, wie auch die Anfänge der Forschung zu neuronalen Netzen in derselben Zeit. All diese unterschiedlichen Forschungsstränge wurden ab Mitte der 1950er Jahre pauschal unter den Begriff der KI gefasst. Diese Bezeichnung machte das Feld erst richtig populär, wohl weil sie weniger technisch wirkt und eine unheimliche Vorstellung von Maschinen beschwört, die dem Menschen ebenbürtig sein könnten.
Anthropomorphisierung
Das Ziel der Dartmouth-Konferenz von 1956 bestand darin, die Frage zu beantworten, ob »das Lernen und die Intelligenz in all ihren Aspekten so präzise beschrieben werden können, dass man sie mittels Maschinen nachahmen könnte«.18 Dieser wissenschaftliche Anspruch legte den Grundstein für die spätere moderne KI-Forschung.





























