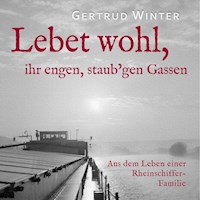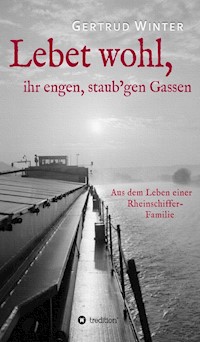
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als im Hungerwinter 1947 Gertrud und ihre Zwillingsschwester Else geboren werden, stehen die Eltern, das Schifferehepaar Anna und Philipp Vowinkel, am Wendepunkt ihres Lebens: Hinter ihnen liegen Schicksalsschläge, Armut, zwei Weltkriege. Die Ära des Wirtschaftswunders bricht an - ihre Kinder, mit denen sie an Bord eines Rheinschiffs leben, sollten es einmal besser haben. Stets begleitet von Philipps skurrilem Humor ist die Familie jedoch unerwarteten Strömungen und überraschenden Untiefen ausgesetzt. Als »Backfisch« bricht Gertrud, wie einst Anna, zu neuen Ufern auf, doch der Fluss des Lebens führt sie an ganz andere Gestade als ihre Mutter. Diese Reise durch das 20. Jahrhundert nimmt den Leser mit an die unterschiedlichsten Schauplätze: das Rheinschiff in Kriegs- und Friedenszeiten, die Dorf-»Idylle« der 50er-Jahre, ein bigottes katholisches Mädchenwohnheim, ein glamouröser Couture-Salon in den 60ern, eine großstädtische Studenten-WG um 1970… Ein facettenreiches und sehr persönliches Panorama deutscher Zeitgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
www.tredition.de
Für meine Geschwister Eva, Else und Philipp,
für meine Kinder Philipp und Julia
und für meine Enkel Erik, Anna und Milo
Gertrud Winter
LEBET WOHL,IHR ENGEN, STAUB’GEN GASSEN
Aus dem Leben einer Rheinschiffer-Familie
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2016 Gertrud Winter
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Umschlaggestaltung: Julia Arbeiter
Umschlagfoto: Mit freundlicher Genehmigung von Achim Multhaupt
www.achimmulthaupt.de
ISBN Paperback: 978-3-7323-5891-5
ISBN e-Book: 978-3-7323-5892-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
INHALT
Eisige Zeiten
Die Argo
Für Lebende gibt es nichts
Schifferkinder
Die Hineingerutschten
Der Herr Major
Dorfidyll
Zwergschule
Feiertag
Winter im Dorf
Zähne zusammenbeißen
Weinlese
Märchenschlösser und Ungeziefer
Kerb
Lehrjahre sind keine Herrenjahre
Kommen und Gehen
Theater
Fräuleinchen
Haute Couture
Zauberberg ohne Zauber
Aufbruch und Rückkehr
Meisterprüfung
Vom Rhein an die Isar und zurück
Zwischen zwei Welten
Amouröse Angelegenheiten
Nestbau
Schmerzlicher Abschied
Stirb und Werde
EISIGE ZEITEN
Seit Wochen konnte Philipp nun schon nicht arbeiten. Hoffnungslos festgefroren lag sein Kahn »Argo« zwischen vielen anderen Schiffen am Reed, dem Ankerplatz von Nierstein. Mühsam hatte sich das Zugschiff mit der Argo und einigen anderen Kähnen im Schlepptau noch seinen Weg durch das Treibeis gebahnt, als bereits gewaltige Eisschollen bedrohlich dröhnend an die Bordwände krachten. Kurz nachdem Schleppboot und Kähne den Niersteiner Hafen erreicht hatten, war der Rhein durch den strengen Dauerfrost unter einer dicken, undurchdringlichen Eisschicht erstarrt. Eisbrecher und Sprengungen konnten gegen die klirrende Kälte nun nichts mehr ausrichten. Philipps Frau Anna und die kleine Tochter Eva hätten derzeit ohnehin nicht mehr mitfahren können, denn Anna war hoch schwanger und erwartete täglich ihre Niederkunft.
Es war sicher kein guter Zeitpunkt, um Kinder in die Welt zu setzen. Denn obwohl der Zweite Weltkrieg schon fast zwei Jahre vorbei war, lag Deutschland noch immer in Schutt und Asche. Es herrschte große Hungersnot.
All diesen Widrigkeiten zum Trotz wurde ich am 20. Januar 1947, mittags um 12.10 Uhr geboren, eine Stunde und zehn Minuten vor meiner Zwillingsschwester. Sie wog 3300 Gramm und hatte blondes Haar. Ich dagegen hatte dunkle Haare und war etwas kleiner, aber dafür um 75 Gramm schwerer. Die Hebamme wunderte sich, wie wir es in diesen schlechten Zeiten zu diesem enormen Gewicht gebracht hatten. Unsere Mutter Anna hatte sich infolge dessen auch ungeheuer plagen müssen, bis wir endlich das Licht der Welt erblickten. Eva, unsere vier Jahre ältere Schwester, befürchtete, dass noch mehr Kinder hinterher kommen könnten. »Mein Papa hat gesagt, das gibt einen ganzen Korb voll!«, wandte sie sich besorgt an die Hebamme. Denn dass der Storch nun bereits zwei gebracht und auch noch in ihr Bett gelegt hatte, war schon mehr als genug. Eva hatte auch gleich eine Lösung des Problems parat: »Die Schwarzhaarige verkaufen wir!«
Die anwesenden Erwachsenen lachten über ihren Einfall. Klein-Eva aber konnte nicht verstehen, was an dem Kinder-Überschuss lustig sein sollte. Zumindest wurde zu ihrer Beruhigung die Blonde wenig später in den Wäschekorb und die Dunkle in die geöffnete Kommodenschublade gebettet.
Es war der kälteste Winter seit fünfzig Jahren, sodass das Wasser im Kessel auf dem Küchenherd jeden Morgen gefroren war. Eisblumen an den Fenstern verwehrten den Blick nach draußen. In der kleinen Mietwohnung in der Schiffergasse, die unser Vater mit seiner Familie bewohnte, solange der Schleppkahn in Nierstein vor Anker lag, war es bitterkalt. Heizmaterial gab es nur wenig. Aus Angst, wir könnten erfrieren, wechselte unsere Mutter uns die Stoffwindeln unter der Bettdecke. Unsere kleinen Fäustchen waren von der Kälte ganz blau. Das Holz reichte kaum, um das knapp bemessene Essen auf dem Herd gar zu kochen. Die Windeln mussten in einem großen Topf auf demselben Feuer ausgekocht und von Hand gewaschen werden. Seife oder Waschpulver war schwer zu beschaffen, und sie bei der Kälte an den Leinen über dem Küchenherd zu trocknen, dauerte sehr lange. Die Muttermilch war nicht gerade reichlich für zwei Säuglinge. Für Lebensmittelmarken, die damals ausgegeben wurden, gab es sehr knapp rationierte Grundnahrungsmittel und nur ganz selten Säuglingsnahrung. So fuhr unser Vater bei Minusgraden auf seinem alten Fahrrad im Umkreis von dreißig Kilometern umher, um auf dem Schwarzmarkt Schmuck, Zigaretten oder was man sonst an begehrenswerten Tauschobjekten über den Krieg gerettet hatte, gegen Milchpulver einzutauschen. Tauschhandel war streng verboten und deshalb nicht ungefährlich. Unsere Mutter lebte ständig in Angst, er würde verhaftet. Bereits im Krieg war er immer wieder den Nazis entkommen und jetzt musste sie fürchten, dass er wegen Schwarzhandel geschnappt werden könnte. Sie wagte nicht, daran zu denken, was dann mit ihr und den Kindern geschehen sollte.
Ebenfalls auf dem Schwarzmarkt – auf anderem Wege war nichts zu bekommen – hatte unser Vater einen gebrauchten, doppelt breiten Kinderwagen aufgetrieben. Als die Temperaturen wieder milder wurden, konnten unsere Eltern endlich mit uns hinausgehen. Mehr als einmal verwunderten sich Nachbarn oder Passanten: »Was, das sollen Zwillinge sein? Die eine ist ja blond und die andere dunkel!«
Dann machte sich unser Vater einen Spaß daraus, mit einem verschmitzten Lächeln zu behaupten: »Die Blonde ist vom Milchmann und die Dunkle vom Schornsteinfeger.«
Die Fragenden blickten ihn meist irritiert an. Nur wer ihn kannte, lachte, weil er wusste, dass er stets zu einem skurrilen Scherzchen aufgelegt war.
Das Schiff Argo gehörte nicht unserem Vater, sondern zwei Schwestern, die es von ihren Eltern, dem Ehepaar Vollmar, während des Krieges geerbt hatten. Das Schiff war vermutlich nach der griechischen Heldensage benannt, nach welcher die Argonauten auf dem Schiff Argo am Schwarzen Meer das Goldene Vlies – das Fell eines fliegenden und sprechenden goldenen Widders – eroberten. Die eine der beiden Schwestern, Änne, war eine junge Witwe mit drei kleinen Kindern. Ihr Mann war auf seinem eigenen Schiff im Dezember 1942, drei Tage bevor sein Sohn Peter geboren wurde, in einen der Laderäume gestürzt und an den Folgen gestorben. Ihre Schwester Gertrud war Studienrätin. Gezwungenermaßen blieb sie unverheiratet, denn während der Hitlerzeit musste sie sich den damaligen Gesetzen entsprechend zwischen Berufstätigkeit und Ehe entscheiden. Da Gertrud keine eigenen Kinder hatte, wollte sie gerne meine Taufpatin werden und so wurde ich auf ihren Namen getauft, meine Zwillingsschwester nach unserer Cousine Else.
Als der Rhein im Frühjahr 1947 aufgetaut und wieder befahrbar war, ging die ganze Familie zurück auf die Argo. Doch wir waren gerade ein paar Monate auf dem Schiff, da war unsere Mutter schon wieder schwanger. Am 1. April 1948 brachte sie, auch diesmal in Nierstein, den ersehnten Stammhalter zur Welt. Er wurde nach dem stolzen Vater Philipp getauft. Unsere Mutter bedauerte diese Entscheidung später: »Wenn ich Philipp rufe, kommen manchmal beide, meistens fühlt sich aber keiner angesprochen, weil jeder gerne glaubt, der andere sei gemeint!«
Nach der Geburt ging Anna mit ihren vier Kindern so bald wie möglich wieder auf das Schiff. Obwohl unsere Eltern viel zu tun hatten, weil das allgemeine Transportwesen durch die Kriegsschäden an Schienen und Straßen stark beeinträchtigt war, blieb ihre wirtschaftliche Situation durch die Inflation immer noch miserabel.
Die durch den Krieg seit Jahren andauernde Not erinnerte unseren Vater oft an seine Jugend. Wenn er sich zurück besann, hatte er mit wenigen Ausnahmen von Kindesbeinen an eigentlich nur schlechte Zeiten erlebt.
Die Entbehrungen seiner Kindheit waren vor allem in der schwierigen familiären Situation begründet. Obwohl sein Vater Anton Vowinkel 1858 in ein recht wohlhabendes Elternhaus in Nierstein hinein geboren worden war, hatte dieser nicht das Glück, der Erstgeborene zu sein – dann hätte er das elterliche Weingut geerbt. Deshalb diente er zunächst bei den Dragonern. Dort wurden nur die Söhne wohlhabender Familien aufgenommen, denn diese mussten ihr eigenes Pferd mitbringen. Nach dem Militärdienst entschloss Anton sich, Gärtner zu werden. Auf der Walz kam er weit herum. Bis nach England führte ihn sein Wanderleben. Aus Erfurt brachte er die Tomatenpflanze mit nach Nierstein. Zur Thronbesteigung Kaiser Wilhelms II. im Jahr 1888 pflanzte er in Nierstein in Anwesenheit heimischer Honoratioren und vieler Bürger auf dem Dorfplatz eine Linde, die dem Platz später seinen Namen gab. 1908, als Philipp vier Jahre alt war, stürzte Anton beim Beschneiden der Äste von einem Baum. Mit schweren inneren Verletzungen wurde er auf einem Pferdefuhrwerk in das zwanzig Kilometer entfernte Krankenhaus in Mainz gebracht. Als er dort ankam, war er bereits tot. Seine Frau Anna Maria war gerade mit dem fünften Kind schwanger. Die Witwenrente wurde erst einige Jahre später eingeführt, Kindergeld gab es noch lange nicht. Anna Maria bekam keinerlei finanzielle Unterstützung vom Staat und war praktisch mittellos.
Dabei hatte Anna Maria, geborene Gutzler aus Federsheim, in ihrer Kindheit und frühen Jugend schon viel bessere Zeiten erlebt, denn auch sie stammte aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus. Doch von ihrer Familie durfte sie keine Hilfe erwarten, denn sie hatte 1895 gegen den Willen ihrer Eltern mit 19 Jahren als Protestantin den katholischen Anton Vowinkel geheiratet. Der 18 Jahre ältere, gut aussehende Gärtnermeister hatte sie geschwängert. Dass Anna Maria schwanger war, war schon Schande genug, aber dass sie diesen Katholiken partout auch noch heiraten wollte, verzieh man ihr nicht. Sie wurde ohne Zögern von ihrer Familie verstoßen und enterbt. Es schien in sittenstrengen Zeiten gottgefälliger und ehrenvoller, seine schwangere Tochter aus dem Haus zu jagen, als ihr hilfreich unter die Arme zu greifen.
Wie sich die beiden kennen gelernt hatten, lässt sich nicht mehr feststellen. Es liegt aber nahe, dass Anton ursprünglich auf Anna Marias elterlichem Gut gearbeitet hatte und sie sich dabei heimlich näher gekommen waren.
Anna Marias unverheirateter, kinderloser Bruder lebte auf großem Fuß. Er fuhr mit sechs stolzen Rössern vor seiner Kutsche zu illustren Festen und gab das Geld mit vollen Händen am Spieltisch und für Jagdgesellschaften aus. Die Schwester aber wusste nicht, wie sie nun alleine ihre fünf Kinder satt bekommen sollte. In ihrer Not beschloss Anna Maria, Hebamme zu werden. Damals war es an der Tagesordnung, dass die Kinder zu Hause geboren wurden, und es waren recht viele. So konnte es passieren, dass Anna Maria, wenn sie gerade am Küchenherd stand und für ihre Kinder Essen kochte, eilig zu einer Geburt gerufen wurde. Sie kam oft erst am nächsten oder übernächsten Tag wieder zurück, je nachdem, wie lange sich die Geburt hinzog. Marie, die älteste, 1895 geborene Tochter, musste sich dann um ihre vier jüngeren Geschwister Lina, Philipp, Jakob und Anton kümmern. Oft genug war nichts zu essen da. Dann schlichen sie sich beim Nachbarn in den Stall und stahlen den aus Protest quiekenden Schweinen die gekochten Kartoffeln aus dem Trog. Den ganzen Sommer über mussten sie barfuß laufen, da jeder nur ein Paar Schuhe für den Winter besaß.
Philipps Mutter wollte nichts unversucht lassen, um an ihr Erbe oder zumindest an die ihr vorenthaltene Mitgift zu kommen. Mit der Unterstützung ihres Onkels prozessierte sie um ihr Erbe. Sie selbst ging dabei zwar leer aus, aber für jedes ihrer fünf Kinder erstritt sie 100 000 Mark, die mündelsicher auf einer Bank angelegt werden mussten. Das heißt, jedes Kind durfte erst nach seinem 21. Geburtstag über sein Geld verfügen.
Schon vor Philipps Schulzeit hatte sich sein späterer Lehrer, Rektor Dörrschuck, eingehend mit der Niersteiner Geschichte befasst und 1911 eine erste Chronik herausgegeben. Im Geschichtsunterricht erzählte er den Kindern gerne von den Leistungen ihren Vorfahren. Er versuchte auch Philipps Neugierde auf seine Ahnen zu wecken und referierte: »Philipp, deine Vorfahren waren sehr vermögende und einflussreiche Leute. Bereits im Jahre 1632 taucht in den Annalen von Nierstein zum ersten Mal der Name Vowinkel auf. Tilman Vowinkel war hier Gemeindeschreiber. Damals konnte das einfache Volk weder lesen noch schreiben. Nur Adeligen und Geistlichen war dieses Privileg vorbehalten. Von 1748 bis 1756 waren ein Johann Vowinkel und von 1772 bis 1776 ein Mathias Vowinkel Schultheiß von Nierstein. Sie waren nicht nur Bürgermeister, sondern ihnen oblag auch die Rechtsprechung. Dein Vorfahr Sebastian Vowinkel hat als Capitaine in der Armee unter den Fahnen Kaiser Napoleons so manche Schlacht geschlagen. Und später, von 1814 bis 1820, war auch er Bürgermeister von Nierstein. Dein Onkel Anton Vowinkel war von 1863 bis 1878 ebenfalls hier Bürgermeister. Zu diesem Zeitpunkt hatte Nierstein zirka 3000 Einwohner. Eine interessante Begebenheit ist auch, dass sich ein M. Vowinkel um 1830 für 92 Gulden und 38 Kreuzer vom Militärdienst freikaufte. Dieser Betrag war mehr als das, was der Reichste in der Umgebung an Steuerabgaben im ganzen Jahr bezahlen musste! Auch dein Großvater war offenbar wohlhabend genug, um von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.«
Doch Philipp wollte von all dem nichts wissen. Despektierlich gab er seinem Lehrer zur Antwort: »Da ist doch drauf geschissen, davon kann ich mir heut’ nichts mehr kaufen!«
Damit fing er sich eine kräftige Ohrfeige ein.
Als Philipp 1918 mit 14 Jahren die Volksschule verließ, gingen das Kaiserreich und der erste Weltkrieg gerade zu Ende. Im Deutschen Reich herrschten Arbeitslosigkeit, Hungersnot und Inflation. Fast die gesamte Wirtschaft lag danieder. Und damit nicht genug, die Siegermächte verlangten hohe Reparationszahlungen für den Schaden, der während des Krieges von den Deutschen in ihren Ländern angerichtet wurde. Die Mittel dazu versuchte die neue Regierung durch Drucken zusätzlichen Papiergeldes zu beschaffen. Die Menschen gingen dazu über, am Tag der Lohnauszahlung umgehend Lebensmittel zu kaufen, denn am nächsten Tag hatte das Geld weiter an Wert verloren. In dieser Situation war Philipp völlig ratlos, was aus ihm werden sollte. Für eine weiterbildende Schule war kein Geld da, Ausbildungsplätze waren rar und kosteten ebenfalls Geld. Ob Philipp jemals sein festgelegtes Erbe würde in Anspruch nehmen können, stand aufgrund der Inflation in den Sternen. Darauf konnte er in diesen unsicheren Zeiten nicht warten.
Inzwischen hatte Philipps Mutter einen Schiffer geheiratet und noch zwei Kinder geboren. Sein Stiefvater machte ihm schon bald klar, dass er ihn nicht durchfüttern werde und er schließlich von irgendetwas leben müsse. Da sah Philipp keine andere Möglichkeit, als selbst Schiffer zu werden, obwohl er nicht die geringste Lust dazu hatte. Auch seine Mutter war von dieser Idee nicht begeistert. Sie fand, dass er doch so ein zarter Junge sei und den körperlichen Anstrengungen womöglich nicht gewachsen. Aber sein Stiefvater sagte spöttisch: »Lass den nur gehen, in zwei Wochen ist der sowieso wieder zu Hause!«
Diese Bemerkung forderte Philipps Trotz geradezu heraus. Er biss die Zähne zusammen und begann, wenn auch widerwillig, eine Ausbildung als Schiffer. Am 21. Februar 1919 bekam er sein erstes Dienstbuch als Schiffsjunge vom Oppenheimer Kreisamt ausgestellt. Von nun an musste er alle paar Monate das Schiff wechseln. In seinem Dienstbuch wurde jedes Mal vom Schiffsführer der Name des Schiffes, die Strecken und die Dauer der Fahrten eingetragen sowie ein Führungszeugnis ausgestellt. Zur Bootsmannprüfung verlangte man von Philipp nach drei Jahren Ausbildung auch Grundfertigkeiten in verschiedenen handwerklichen Bereichen. Um Reparaturen am Schiff selbst vornehmen zu können, musste er Schlosser-, Schreiner- und Zimmermannskenntnisse erwerben. Philipp wurde auch ein Könner im Umgang mit Hammer, Stoßeisen und Stahlbürste, um die Rostnarben in der Schiffswand zu entfernen. Jeder Schiffmann und Matrose musste auch grundlegende Maler- und Lackiererfertigkeiten beherrschen, um die Innen- und Außenwände mit Rostschutz, Grund- und Deckfarbe zu streichen. Schutzanstrich und Reinigungsarbeiten sind besonders wichtig, denn der Schiffsrumpf ist ständig innen und außen der Korrosion durch Wind, Wasser sowie durch Eisen schädigende Ladungen von Erzen, Düngemitteln, Salz oder Kohle ausgesetzt. Selbstverständlich musste er auch Tauwerksarbeiten wie Knoten und Spleißen an Hanf- und Drahtseilen erlernen, damit die Taue stets in Ordnung waren. Das Schleppboot musste während der Fahrt sicher mit den Kähnen verzurrt sein und beim Anlegen im Hafen Wind und Wetter standhalten. Außerdem lernte Philipp, das Ruder zu führen, die Flaggensignale an den gefährlichen Engstellen auf dem Rhein zu deuten und am Abend die Positionslaternen an Deck korrekt anzubringen.
Eines war bei seiner Ausbildung jedoch nicht vorgesehen, nämlich, dass er schwimmen lernte. Die meisten seiner Kollegen konnten es auch nicht. Dahinter steckte eine raffinierte Überlegung: Bei einer Havarie ließ eine Besatzung, die nicht schwimmen konnte, das Schiff nicht vorschnell im Stich, sondern sie kämpfte um das Schiff, um zu überleben. Philipp hatte eine solche Bedrohung tatsächlich einmal miterlebt. Eine Kollision mit einem anderen Schiff im aufkommenden Nebel schlug ein Loch in die Seitenwand. Das Wasser spritzte mit voller Wucht in den Laderaum. Der Kapitän, ein alter Fuchs, wusste sich zu helfen. Er schrie nach einer Speckseite und Holzkeilen. Philipp sauste mit pochendem Herzen in Richtung Kapitänskajüte. Die Frau des Kapitäns hatte für solche Notfälle immer eine Speckseite im Vorrat. Sie kam ihm schon damit entgegen. Philipp und ein Matrose pressten die Speckseite mit aller Kraft gegen die Leckstelle und der Kapitän befestigte sie geschickt mit einigen Holzkeilen, so dass kein Wasser mehr in den Laderaum eindringen konnte. Sie hatten Glück, dass das Loch nicht größer als die Speckseite war. Wäre das beschädigte Schiff auf diese Weise nicht zu retten gewesen, hätte die Besatzung es eilig mit dem Nachen, einem kleinen Beiboot, verlassen dürfen. Doch mit dieser Schweinebauchdichtung erreichten sie, nachdem die Sicht wieder klar war, sicher die nächste Werft, auf der das Leck repariert werden konnte.
Im Oktober 1923 wurde in Deutschland eine neue Währung, die Rentenmark eingeführt, die dann 1924 durch die Reichsmark abgelöst wurde. Viele hatten dabei ihr gesamtes Barvermögen verloren. Jahrelang hatten Philipp und seine Geschwister in Armut gelebt und auf ihr Erbe gewartet. Jetzt, da Philipp mit 21 Jahren die Volljährigkeit erreicht hatte, war es durch die Inflation wertlos geworden. Auch die Weltwirtschaftskrise warf schon ihre Schatten voraus, die dann durch den Börsenkrach 1929 in New York ihren Höhepunkt erreichte. Die Folge war weltweite Massenarbeitslosigkeit und Hungersnot.
Philipp hatte als Matrose auf dem Schiff sein karges Auskommen. Doch diese wirtschaftliche Katastrophe weckte bei ihm großes Interesse für die Ideen des Kommunismus. Er las die Werke von Karl Marx, Friedrich Engels und Lenin und ging, sofern er es einrichten konnte, eifrig zu Versammlungen. Mit der Zeit erschienen ihm die Ziele der Kommunisten allerdings zu radikal und er wandte sich den Sozialdemokraten zu. Legte das Schiff, auf dem er gerade war, in Nierstein an, oder hatte er zwischen dem Wechsel der Schiffe ein paar Tage oder Wochen Zeit, dann nutzte er die Gelegenheit, um nach Hause zu gehen und seiner Mutter den Großteil seines schmalen Verdienstes abzuliefern und sich mit seinen Parteigenossen zu treffen. Ihre Zusammenkünfte wurden nun immer häufiger und auch gewaltsam von den Nazis gestört und auseinander getrieben. Besonders verwerflich fand Philipp, dass in diesen Jahren bei groß angelegten Feldgottesdiensten emsig Waffen und Nazifahnen geweiht wurden und der Pfarrer von der Kanzel herab für die menschenverachtenden, nationalsozialistischen Ideen warb. Nierstein wurde eine Hochburg der Nazis. Die NSDAP kam bei der Reichstagswahl im Juli 1932 auf 59,8%. Zwischen den beiden Reichstagswahlen von Juli bis November taten Philipp und seine Parteigenossen ihr Möglichstes, um sich zu wehren und die Menschen aufzuklären. Sie verteilten Flugblätter. Doch diese Aktionen wurden immer gefährlicher, so dass Philipp dazu überging, die Flugblätter in den Gummireifen seines Fahrrades zu transportieren. Dass die NSDAP bei der darauf folgenden Wahl im November 1932 in Nierstein »nur« noch 51,2% der Stimmen erzielte, war für Philipp ein schwacher Trost.
Unter dem Druck der Nazis wurde im Mai 1933 der Ortsverein der SPD aufgelöst, nachdem schon etliche führende Niersteiner SPD-Genossen und Nazigegner im Konzentrationslager in Osthofen inhaftiert worden waren.
In den Zeitungen wurde ständig zum Boykott gegen jüdische Geschäfte aufgerufen und ihre Kunden als Volksverräter beschimpft. In der Nähe der Geschäfte postierten sich Braunhemden als Beobachter. Philipp ließ sich dadurch nicht einschüchtern. Als er in Nierstein ein jüdisches Tabakgeschäft betreten wollte, baute sich ein Spitzel gebieterisch vor ihm auf und fragte barsch, ob er nicht wisse, dass es verboten sei, bei Juden einzukaufen. Philipp konnte seinen Zorn kaum zurückhalten. Er schob ihn beiseite und ließ ihn, ebenso barsch, wissen, dass er bisher hier eingekauft habe und gedenke, es auch weiterhin zu tun. Die Geschäftsinhaberin, die diesen Vorgang voller Angst vom Fenster aus beobachtet hatte, brach in Tränen aus, als er den Laden betrat. Sie sagte, es würde sich kaum mehr jemand in ihr Geschäft wagen. Vor Rührung schenkte sie ihm an diesem Tag den Tabak. Nachdem das Tabakgeschäft geschlossen worden und der Besitz der jüdischen Familie zwangsweise in »arisches« Eigentum übergegangen war, verließ die Familie 1938 Nierstein.
Seit diesen ersten Repressalien nach der Machtergreifung Hitlers ließ Philipp sich immer seltener in seinem Heimatdorf blicken, aus Furcht, es könnte ihm ergehen wie einigen seiner Parteifreunde, die morgens in aller Frühe von der Gestapo abgeholt worden waren. In anderen Städten, an denen das Schiff anlegte, ließ er es sich jedoch nicht nehmen, mit seinen Freunden und Kollegen auch mal einen über den Durst zu trinken. So erreichte ihn in dieser Zeit einmal eine Anzeige aus Straßburg. »Wegen allzu lauter Heiterkeit und Hüpfen auf der Straße« wurde er zu einem saftigen Bußgeld verdonnert.
Hie und da lernte er bei diesen Gelegenheiten auch hübsche Mädchen kennen, aber die Richtige war bisher nicht dabei.
Die einsamen Stunden in seiner Freizeit auf dem Schiff nutzte er gerne zum Lesen. Weil neue Bücher für ihn zu teuer waren, ging er, wenn er davon erfuhr und er es einrichten konnte, zu Wohnungsauflösungen oder Auktionen, um Bücher über Politik, Philosophie, Weltgeschichte und Romane von namhaften Schriftstellern zu ersteigern. Den größten Teil seiner Sammlung lagerte er, nachdem er sie gelesen hatte, in Nierstein bei seinen Eltern. Durch die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 machte sich Angst und Unsicherheit in der Bevölkerung breit. Als Philipp zufällig am darauf folgenden Wochenende nach Hause kam, saß seine Mutter mit einem Stapel Bücher vor dem Küchenherd und heizte ihn emsig damit ein. Als er die Situation erfasste, wurde er fuchsteufelswild und schrie: »Dass du dich von dem hysterischen Nazipack einschüchtern lässt! Ich verbiete dir, in Zukunft auch nur eines meiner Bücher anzurühren!«
Seine Mutter ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und gab trocken zurück: »Dann musst du sie eben in Sicherheit bringen. Ich will keinen Ärger haben!«
Viele Bücher gab es da nicht mehr in Sicherheit zu bringen, die meisten hatte sie bereits verbrannt.
Die ganze politische Entwicklung wurde für Philipp immer unerträglicher. Bei einem seiner Besuche in Nierstein forderte ein Nazi, er solle gefälligst den Arm zum Hitlergruß heben. Philipp hatte nur ein »Leck mich am Arsch!« für ihn übrig, drehte sich um und ging. Er wusste durchaus, dass er gefährlich lebte, aber es widerstrebte ihm, den Arm zu diesem anbiedernden, in seinen Augen schwachsinnigen Hitlergruß zu heben.
Inzwischen hatte sich Philipp auf der Hochzeit seines jüngsten Bruders Anton, der 1932 Lisa Baumgärtner aus dem nahe gelegenen Dorf Ludwigshöhe geheiratet hatte, Hals über Kopf in deren schöne Schwester Anna verliebt. Anna fühlte sich auch von Philipp angezogen. Wie gerne hatte sie schon in früher Jugend am Rheinufer gesessen, versonnen den Schiffen nachgeschaut und sich ausgemalt, wie schön es wäre, mit einem Mann auf einem Schiff verheiratet zu sein, um so ihrer tristen Jugend zu entfliehen und in die weite Welt zu kommen. Sie sah ihren Kindheitstraum näher rücken.
Anna war, als sie Philipp kennen lernte, schon einige Zeit Haushälterin in Laubenheim bei einer jüdischen Familie. Helene, die Tochter des Hauses, studierte Gesang in Berlin. Ihre Familie führte ein großes Haus. Berühmte Künstler, vor allem Musiker und Dirigenten, folgten ihren Einladungen. An den Dirigenten Otto Klemperer erinnerte sich Anna auch später noch gut, denn er bedankte sich einmal sehr freundlich persönlich bei ihr und lobte die üppige Torte, die sie gebacken hatte, kunstvoll verziert mit einem Notenschlüssel.
Schon bald nachdem die Nazis 1933 die Macht ergriffen hatten, war die hochbegabte Tochter gezwungen, ihr Studium aufzugeben, weil sie keinen Arier-Nachweis erbringen konnte. Die Familie litt sehr unter den Anfeindungen. Vor allem der Hausherr, Doktor Feist, war vor der Naziherrschaft ein beliebter und angesehener Arzt gewesen, und nun bekam er Berufsverbot. Er musste seine Praxis schließen. Damit der Familie weitere Demütigungen und die damit verbundene Aufregung erspart blieb, beeilte sich Anna, am frühen Morgen als Erstes mit einem Eimer Wasser und einer Bürste die Naziparolen, die immer öfter in der Nacht an die Gartenmauer geschmiert wurden, abzuschrubben.
Im Spätsommer 1935 wurde ein Gesetz erlassen, das am 1. Januar 1936 in Kraft treten sollte. Paragraph 3 des »Gesetzes zum Schutz des Blutes und der deutschen Ehre«, verbot allen Juden, »weibliche Staatsangehörige deutschen Blutes unter 45 Jahren« in ihren Haushalten zu beschäftigen. Anna hatte bisher gerne bei der Familie Feist gearbeitet, obwohl sie von früh bis spät schuften musste. Aber jetzt blieb ihr nichts anderes übrig, als sich eine neue Arbeitsstelle zu suchen, sonst hätte sie sich strafbar gemacht.
Später, während des Krieges, hielt Anna immer noch Kontakt zu ihren früheren Arbeitgebern in Laubenheim. Vor Gram erkrankte der Arzt schon bald schwer und starb kurze Zeit später.
Juden hatten keinerlei Rechte und auch kein Einkommen mehr und schon gar keinen Anspruch auf irgendeine Unterstützung. Im Gegenteil, sie wurden schamlos ausgebeutet und mussten noch dankbar sein, wenn sie nicht denunziert und eingesperrt wurden. Zusätzlich wurden sie sogar für die Schäden, die die Nazis bei den Randalen in der Reichskristallnacht angerichtet hatten, zur Kasse gebeten. Anna brachte ihren früheren Arbeitgebern oft etwas zu Essen mit. Die Witwe des Arztes bot Anna in ihrer Not ihr silbernes Tafelbesteck zum Kauf an. Anna hätte ihr gerne geholfen, aber sie lehnte es ab, weil sie nicht genug Geld hatte, um es angemessen bezahlen zu können. Die Frau des Arztes bedauerte es: »Dir hätte ich es gegönnt, bevor es die Nazis beschlagnahmen, denn du bist die einzige, die es verdient hätte!«
Im Park neben der Ruine ihrer ausgebombten Villa, konnte sich die Tochter, nachdem auch ihre Mutter gestorben war, nach dem Krieg nur die kleine Wohnung ihres früheren Chauffeurs herrichten. Mit Sprachunterricht hielt sie sich für den Rest ihres Lebens über Wasser.
Am 17. August 1935 heuerte Philipp auf dem Schleppkahn »Argo« an. Das unmotorisierte Schiff gehörte dem sympathischen, älteren Ehepaar Vollmar, das sich bald zur Ruhe setzen wollte. Anna fand einen neuen Arbeitsplatz in Bingen in einer Konditorei. Die Arbeit dort war hart, das Essen knapp, die Behandlung und Bezahlung miserabel. Der einzige Lichtblick war, dass Bingen direkt am Rhein lag. Anna hoffte, sich nun öfter mit Philipp treffen zu können, wenn er mit dem Schiff in Bingen am Rheinufer anlegte. Doch ausgerechnet jetzt, da Anna in Bingen arbeitete, sah sie Philipp oft wochenlang nicht, denn die Argo pendelte meist mit Fracht zwischen Duisburg und Rotterdam. Auch wenn es eine Ladung nach Mainz, Frankfurt, Ludwigshafen oder Speyer hatte, war es häufig so, dass es nicht in Bingen anlegte. Deswegen war es manchmal schwierig für Philipp, Anna zu besuchen. Ihr blieb wieder nichts anderes übrig, als in ihrer knappen Freizeit am Rheinufer sehnsuchtsvoll den vorbeifahrenden Schiffen nach zu schauen, in der Hoffnung, dass die Argo dabei wäre, um Philipp wenigstens zuwinken zu können.
Anna und Philipp kannten sich jetzt schon vier Jahre. Sie beschlossen zu heiraten. Anna war glücklich, endlich sollte sich ihr Kindheitstraum erfüllen. Sie fuhr zu ihrer Mutter nach Ludwigshöhe, um freudig von ihrer Entscheidung zu berichten. Doch ihre Mutter reagierte ablehnend. »Was willst du denn mit dem, der geht doch sonntags nicht in die Kirche, der kennt keinen Gott und kein Gebot und wenn der sich weiter so mit den Nazis anlegt, schnappt ihn die SS sowieso bald!« sagte sie in einem Atemzug. Das war Anna zu viel, sie ging wortlos. Sie wollte sich beim Bürgermeister nur noch ihre Geburtsurkunde und den Arier-Nachweis für das Aufgebot holen und sich dann hier nie wieder blicken lassen.
Der Bürgermeister fragte freundlich: »Ei Mädsche, wann bisde gebore?«
»Am 1. Juli 1911«, gab Anna zur Antwort.
Der Bürgermeister sah sie mit großen Augen an und sagte verwundert: »Bei mir steht aber was anderes, nämlich der 1. Juni 1911, und das ist amtlich!«
Anna war verwirrt. Sie konnte sich erinnern, dass ihre bereits verstorbene Großmutter und ihre Mutter sich früher manchmal wegen ihres Geburtsdatums gestritten hatten. Annas Mutter behauptete aber steif und fest, es sei der 1. Juli gewesen. Anna dachte, meine Mutter muss es ja wissen. Sie erklärte sich diese Verwechslung so, dass ihr Vater womöglich die Anmeldung ihrer Geburt erst später abgegeben hatte und sich dann nicht mehr so sicher war.
Von nun an gedachte Anna ihres Geburtstages am »amtlichen« 1. Juni und nahm sich vor, sollte sie je Kinder bekommen, sich den Zeitpunkt ihrer Geburt genau zu merken.
Später erfuhr Anna, dass ihre Eltern erst am 24. September 1910 geheiratet hatten, und so vermutete sie, dass ihre Mutter mit der Verschiebung des Geburtstermins vielleicht vertuschen wollte, dass Anna unehelich gezeugt worden war. Diese Erklärung erscheint aber fragwürdig in Anbetracht dessen, dass Annas Eltern bereits ihre Tochter Lisa hatten, die vier Jahre vor ihrer Hochzeit auf die Welt gekommen war.
Auch Philipp ging zu seiner Mutter, um ihr seine Heiratspläne mitzuteilen. Diese war genauso wenig begeistert wie Annas Mutter. »Die ist doch viel zu jung für dich«, sagte sie kurz angebunden.
Doch Philipp ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und gab knapp zu Antwort: »Die wird von selbst alt!«
Er wunderte sich, dass seine Mutter nichts anderes fand, an dem sie Anstoß nehmen konnte, als den Altersunterschied, wo Anna doch nur sieben Jahre jünger war als er, während seine Mutter 18 Jahre jünger gewesen war als sein Vater. Seiner Mutter ging es wohl eher ums Geld, denn bisher hatte er brav bei ihr einen Teil seines Verdienstes abgeliefert, womit es nach der Heirat wohl ein Ende haben würde.
Das alles waren also keine guten Voraussetzungen für ein fröhliches Hochzeitsfest, deshalb zogen Anna und Philipp am 4. April 1936 heimlich ihre Sonntagskleider an und gingen in Nierstein auf das Standesamt und in die Kirche. Sie hatten noch keine Trauzeugen, aber das ließ sich leicht regeln. Auf dem Weg dorthin – man kannte im Dorf die meisten Leute – fragten sie den Erstbesten, der ihnen auf der Straße begegnete, ob er ihr Trauzeuge sein wolle. »Aber mit dem größten Vergnügen!«, antwortete er, wohl in der Hoffnung auf ein Freibier. Ein weiterer Trauzeuge fehlte noch. Vor dem Rathaus fegte ein Mann die Straße. Sie sprachen ihn mit derselben Bitte an. Ohne zu Zögern stellte er seinen Besen an die Wand und folgte ihnen. Nach der Trauung wollten Anna und Philipp ihr Glück mit jemandem teilen. Sie überraschten Philipps Lieblingsschwester Marie, die längst schon verheiratet war und drei fast erwachsene Kinder hatte. Marie wunderte sich, wieso sie mitten unter der Woche im Sonntagsstaat daher kamen. Philipp verkündete stolz: »Ich bin jetzt Mann!«
Marie kannte seine ständige Bereitschaft zum Scherzen und wollte nicht darauf hereinfallen: »Ach geh, du spinnst doch, das glaub ich dir nicht!«
Nachdem Marie begriffen hatte, dass es sein Ernst war, gratulierte sie ihnen herzlich und freute sich mit ihnen. Die frisch Vermählten wollten sich aber nicht lange bei ihr aufhalten, denn Philipp war das Pflaster in Nierstein zu heiß geworden. Seine Verachtung für die Nazis konnte er nur selten für sich behalten. Er musste immer damit rechnen, dass ihm der eine oder andere Wichtigtuer nachstellte. Nicht mal vor seinem alten Lehrer hatten die Nazis halt gemacht, weil ihnen seine politische Gesinnung nicht passte. Sie hatten den alten Mann aus seinem Haus gezerrt und vorübergehend nach Osthofen ins Konzentrationslager gesteckt.
Anna hatte ihre ungeliebte Arbeit in Bingen gekündigt und ging voll freudiger Erwartung mit Philipp auf das Schiff »Argo«. Endlich konnten die beiden diese penetrante, allgegenwärtige Nazibeflaggung, die Aufmärsche und Propaganda – wenigstens, solange sie auf dem Schiff waren – hinter sich lassen.
DIE ARGO
Das alte Schifferehepaar Vollmar hieß Anna im Frühjahr 1936 auf der Argo herzlich willkommen. Im Bug des Schiffes bezog das frisch vermählte Paar die kleine Wohnung für das Personal, in der Philipp bisher schon gewohnt hatte. Anna fand es herrlich auf dem Schiff. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie ein Gefühl von Glück, Freiheit und Sicherheit und keine Vorgesetzten, die von früh bis spät und sogar am Sonntag ihre Arbeitskraft ausbeuteten. Sie, die bis zu ihrer Arbeit in Laubenheim kaum aus ihrem 350-Seelen-Dorf Ludwigshöhe herausgekommen war, genoss es, den ganzen Tag gemächlich die unterschiedlichsten Landschaften an sich vorüber ziehen zu sehen. Hauptsächlich waren sie auf dem Rhein zwischen Rotterdam und Basel unterwegs, manchmal befuhren sie aber auch den Main, den Neckar und die Mosel, je nachdem, was sie geladen hatten und wohin die Fracht gehen sollte. Die Städte mit ihren Kathedralen, die Dörfer, die sich malerisch an die Hänge zwischen die Weinberge schmiegten und die Burgen auf den hohen Felsen des Mittelrheins – von diesem Anblick, der all ihre Vorstellungen übertraf, konnte sie nicht genug bekommen.
Es war der schönste Frühling und Sommer ihres Lebens. In der Natur gab es unzählige Dinge zu beobachten. Es war beeindruckend zu sehen, wie das Licht sich im Wasser brach, es in den unterschiedlichsten Blau- und Grüntönen erstrahlen und, vom Wind aufgeraut, wie tausend Diamanten glitzern ließ. Anna genoss es, dem Gesang der Vögel im Morgengrauen zu lauschen, die mit tausend Stimmen jubilierend den Sonnenaufgang begrüßten, während allmählich der weiße Nebel über dem Wasser aufstieg, die Anker gelichtet wurden und der Schleppzug sich von neuem in Bewegung setzte. Sie lernte auch bald die Besatzungen anderer Kähne kennen, die mit ihnen entweder nebeneinander oder hintereinander im Schleppzug zusammengezurrt waren. Von einem Schleppboot konnten im günstigsten Fall bis zu zehn Kähne gezogen werden.
Der Hafen in Duisburg war schon sehr groß und unübersichtlich, aber als Anna das erste Mal nach Rotterdam kam, war sie von dem Ausmaß dieses größten europäischen Hafens überwältigt. Schiffe aller Art, soweit das Auge reichte. Was für ein geschäftiges Treiben! Fünfzehn Kähne verschiedener Nationalitäten lagen Seite an Seite. Die Argo lag außen, deshalb musste die Besatzung über die anderen Schiffe steigen, um an Land zu kommen.
Anna und Philipp waren von Rotterdam begeistert. Sie schlenderten über die bunten Flohmärkte, an den Grachten entlang und vorbei an schmucken Häusern, mit ihren kurzen, geklöppelten Spitzengardinen an den Fenstern, so dass sie manchmal nicht wussten, ob sie in das Schaufenster eines Antiquitätenladens sahen oder in ein Wohnzimmer.
Wie lange sie von Rotterdam bis Basel brauchten, hing davon ab, ob und wie oft sie das Schleppboot und die Fracht wechseln mussten. Der Schleppzug brauchte zu Berg eine Woche bis zehn Tage. Zu Tal – durch die Strömung begünstigt – schafften sie es, wenn alles gut lief, in drei, vier Tagen.
Aus dem Abendrot und der Wolkenbildung konnte Anna schon bald so geübt wie die Schiffer ihre Schlüsse ziehen, welches Wetter am nächsten Tag zu erwarten war. Jeder Abend hatte eine andere Stimmung. In Ruhe zu beobachten, wie die Sonne ihre gleißend gelbe bis tiefrote Spur über das dunkle, ruhige Wasser zog, war für sie immer wieder überwältigend. Bei Sonnenuntergang musste geankert werden. Das platschende Geräusch des Ankers, wenn er schwer ins Wasser stürzte und polternd und klirrend die dicke Kette aus der Öffnung des eisernen Schiffsrumpfs hinter sich herzog, war ihr längst vertraut. Dieses Geräusch bedeutete Feierabend. Ankerten sie in der Nähe eines Hafens, trafen sich Philipp und Anna in seiner jeweiligen Stammkneipe mit Freunden und Kollegen. Dort tauschte man in geselliger Runde Neuigkeiten aus und diskutierte mit Gleichgesinnten hinter vorgehaltener Hand die politische Lage. Die meisten Schiffer gaben diese Stammkneipen oder den in Hafennähe gelegenen Tante-Emma-Laden als Postaderesse an.
Annas Neugier und Abenteuerlust wurde immer wieder aufs Neue vom bunten Leben und Treiben in den Städten, die das Rheinufer säumten, geweckt. Wenn die beiden mit dem Schiff nahe einer Stadt anlegten und es ihre Zeit zuließ, war Anna kaum zu halten. Sie wollte alles kennen lernen und besichtigen. Die allgegenwärtigen Nazisymbole und die Propaganda waren das Einzige, was sie bei diesen Landausflügen störte.
Einmal machten sie nahe Düsseldorf Halt. Philipp schlenderte mit ihr über die Königsallee, um ihr all den Luxus zu zeigen, den die Stadt bot. Anna war überwältigt von der Vielfalt und Eleganz der Auslagen in den Schaufenstern. Während sie sich darüber verwunderte, wer sich denn so etwas leisten könne, fiel ihr Blick in das Schaufenster eines Hutgeschäftes. Dort entdeckte sie einen weinroten Velours-Hut mit einer breiten Krempe. Hüte faszinierten sie, denn sie wäre für ihr Leben gerne Modistin geworden. Aber sie durfte keine Ausbildung machen, weil ihre Mutter das Lehrgeld nicht hätte zahlen können. Anna musste mit dem Wenigen, was sie bis zu ihrer Hochzeit verdiente, ihre Mutter und die Geschwister unterstützen. Sie ging weiter, aber dieser Hut ließ sie nicht los. »Ich habe gerade einen wunderschönen roten Hut gesehen, den muss ich unbedingt noch einmal genauer betrachten«, sagte sie zu Philipp.
»Wofür brauchst du denn einen roten Hut?«
»Ich will ihn ja nur anschauen!«, rief sie und machte kehrt.
Vor dem Schaufenster überraschte Philipp sie mit einem Angebot: »Du bekommst den Hut.« und nach einer kurzen Pause fügte er hinzu, »aber nur, wenn du ein Glas Sauermilch trinkst!« Denn er wusste, dass Anna Sauermilch, Buttermilch, Quark und Käse verabscheute. So glaubte er, um den Kauf herum zu kommen, ohne als Geizhals dazustehen. Da kannte er seine Anna aber schlecht. Sie steuerte entschlossen das nächste Milchgeschäft an, verlangte ein Glas Sauermilch und kippte es mit Todesverachtung in einem Zug hinunter. Philipp war verblüfft, ihm blieb nichts anders übrig, als sein Versprechen zu halten. Anna probierte mit Begeisterung den sündhaft teuren Hut. Er stand ihr ganz ausgezeichnet und wurde ihr Lieblingshut, den sie ihr Leben lang in Ehren hielt. Später zog sie manchmal mit einem verschmitzten Lächeln den Hut aus der Schachtel und ergötzte sich noch einmal in Erinnerung an Philipps verdutzten Gesichtsausdruck ob seiner misslungenen Hinterlist. Philipp sollte diese List noch bereuen, denn Sauermilch mit Bratkartoffeln wurden in dem nahenden Krieg eine wahre Delikatesse, die auch Anna in Zukunft zu schätzen wusste und die er von nun an mit ihr teilen musste.
Manchmal führte er Anna ins Varieté, die Operette oder in die Oper, aber am liebsten gingen sie ins Kino. Der Tonfilm hatte schon Ende der 20er Jahre Einzug gehalten. Das Kino zog beide in seinen Bann, und sie hätten währenddessen so wunderbar die bedrückende Realität vergessen können, wäre da nicht vor dem Film die Wochenschau mit ihrer alles überschattenden Nazipropaganda gewesen. Philipp verehrte Charlie Chaplin und etliche andere Stars jener Zeit. Gerne wäre er selbst Schauspieler geworden, aber er wusste gar nicht, wie er es hätte in die Tat umsetzten sollen.
Sogar in das ferne Amsterdam brachten sie manchmal eine Fracht. Auf ihrem Weg dorthin zogen sie im Frühling vorbei an malerischen Windmühlen. Ihr Blick schweifte über das flache Land mit seinen endlosen bunten Blumenfeldern. Philipp ließ es sich nicht nehmen, Anna die hübschen mittelalterlichen Fassaden und die Grachten mit ihren Zugbrücken zu zeigen, die auch schon etlichen berühmten Malern als Motiv gedient hatten.
Ein gutes, originelles Speiselokal mit dem Namen »Fünf Fliegen« hatte es ihnen angetan. Es hatte seinen Namen wohl daher, weil es sich über fünf kleine, alte, nebeneinander liegende Häuschen erstreckte. Es war rustikal ausgestattet, aber sehr gepflegt. Immer, wenn sie in Amsterdam waren, führte sie ihr Weg dorthin, um zu speisen.
Philipp zeigte sich bei diesen herrlichen Ausflügen manchmal äußerst spendabel, und er verband auch nie mehr eine Auflage mit seinen Geschenken. Einmal kaufte er von seinen Ersparnissen Anna zu ihrer Überraschung eine funkelnde Brillantbrosche. Bei einem späteren Besuch beschenkte er sie mit einem Paar wunderschöner antiker Ohrringe, bestehend aus geschnitzten Elfenbein-Reliefs, so genannten Gemmen, in einer filigranen Goldfassung.
Anna verfolgte mit großem Interesse das Leben und die Arbeit auf dem Schiff. Zu arbeiten war sie von Kindheit an gewöhnt und das Nichtstun lag ihr auf Dauer nicht. Sie lernte schnell, rechtzeitig ihre trockene Wäsche von der Leine zu holen, bevor beim Entladen der Kohlen oder Eisenerz im Hafen von Duisburg eine schwarze Dunstglocke das Schiff einhüllte. Nach dem Be- und Entladen von staubigen Gütern legte sie selbstverständlich mit Hand an beim Reinigen der Gangborde und Laderäume. Bei aufkommendem Regen half sie, eilig die Ladeluken mit den schweren Holzplanken abzudecken. Sie hielt sich oft bei Philipp im Steuerhaus auf, lernte von ihm, wie man das Ruder führt und sie beobachtete aufmerksam die Verkehrsregeln der Rheinschifffahrt. Sie war sehr gelehrig. Philipp erklärte ihr die Bedeutung der Wahrschauposten, die mit Flaggensignalen an den zahlreichen Kurven des Rheins den Schiffsverkehr regelten. Besonders aufmerksam verfolgte sie die Signale an den gefährlichen Stellen vom Binger Mäuseturm bis St. Goar. Eine rote Flagge zeigte die Talfahrt eines einzelnen Schiffes an, eine weiße einen Schleppzug, mit beiden Farben wurde ein Floß angezeigt, was eher selten vorkam. Vor den engen Kurven mussten dann die Bergfahrer anhalten und die Talfahrer vorbei lassen. Obwohl aus Sicherheitsgründen das Schleppboot verpflichtet war, zwischen Bingen und Kaub einen Lotsen mitzunehmen, war ihr an diesen zahlreichen, landschaftlich zwar sehr reizvollen, aber engen Krümmungen des Rheins immer ein wenig mulmig. Das viel sicherere Radarsystem und Echolot, dank derer die Schiffe heute auch bei Nacht und Nebel fahren können, gab es damals noch lange nicht.
Philipp schärfte Anna ein, dass das Schiff, um nicht auf Grund zu laufen, unbedingt zwischen den beiden Bojen bleiben muss, die die Fahrrinne markieren. Er führte sie auch in die Geheimnisse der Pegelstände ein. Er erklärte ihr, dass es vor allem wichtig sei, die Pegelstände bei extremem Hochwasser und auch bei stark fallendem Wasser im Auge zu behalten. Bei Niedrigwasser müsse man gegebenenfalls weniger Ladung aufnehmen, um an den flacheren Stellen, wie zum Beispiel am Binger Loch, nicht auf Grund zu laufen. An den landschaftlich lieblicheren Stellen ihrer alten Heimat nutzten sie ihre gemeinsame Freizeit, um mit dem Paddelboot die Arme des Altrheins zu erkunden. Aber zu bestimmten Zeiten im Sommer nahmen sie Abstand von diesem Vergnügen, wenn nämlich Myriaden von Stechmücken sich aus den sumpfigen Wiesen am Rheinufer erhoben und über jedes Lebewesen herfielen, das Blut in den Adern hatte.
Den beiden blieben nur zwei relativ unbeschwerte Jahre. Sie waren froh auf dem Schiff zu sein, um nicht so leicht ins Blickfeld der Nazis zu geraten.
Philipp hörte heimlich im Rundfunk so genannte Feindsender. So ließ er sich von keiner Nazipropaganda täuschen. Sie sprachen darüber und ihnen graute vor dem, was sich da zusammenbraute. Mit zunehmender Bestürzung verfolgten sie auf Landgängen in den Häfen und Städten die politische Entwicklung, bis hin zu den schrecklichen Ereignissen, die mit dem 9. November 1938 als Reichskristallnacht in die unrühmliche deutsche Geschichte eingingen. Nach dem Niederbrennen der Synagogen und Plünderungen und Verwüstungen jüdischer Geschäfte wurden im ganzen deutschen Reich dreißigtausend jüdische Männer verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt. Nur einige Tausend Männer wurden danach mit der Auflage, umgehend das Land zu verlassen, wieder auf freien Fuß gesetzt.
Die bedrohten, allein gelassenen jüdischen Mütter schickten in ihrer Verzweiflung ihre zum Teil noch sehr kleinen Kinder zu Tausenden mutterseelenallein in Zügen ins Ausland, in der Hoffnung, sie eines Tages wieder zu finden und dass sich inzwischen Menschen ihrer erbarmten und ihnen helfen würden, diesen Wahnsinn zu überleben. Nachdem ihr Vermögen beschlagnahmt war, verließen immer mehr Juden, die es sich noch leisten konnten und die auch seelisch in der Lage waren, sich von ihrer Heimat zu trennen, das Land.
Überall wurde mobil gemacht, das blieb Philipp und Anna auch auf dem Schiff nicht verborgen. Philipp war inzwischen seinem Schicksal fast dankbar, Schiffer geworden zu sein. Denn als solcher wurde er nicht zum Militärdienst eingezogen, da er durch den Transport von Lebensmitteln und Industriegütern zur allgemeinen Versorgung beitragen musste.
Mit dem Einzug deutscher Truppen in Polen begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg.
Zu diesem Zeitpunkt gingen die Schiffseigner der Argo, die Eheleute Vollmar, aus Alters- und gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand. Sie zogen sich in ihr Haus in Beuel bei Bonn zurück.
Am 20. Januar 1940 wurde dann Philipp alleiniger Schiffsführer und zog mit Anna in die am hinteren Ende gelegene, geräumigere Wohnung beim Steuerhaus. Anna gefiel diese Wohnung sehr. Sie hatte noch das Flair des Jugendstils, denn das Schiff war um die Jahrhundertwende gebaut worden. Die Wohnküche reichte über die gesamte Breite des Schiffes und hatte zu beiden Seiten eine Türe nach draußen. Alle Schränke und eine Sitzbank mit Truhe waren eingebaut und die Wände mit Holz vertäfelt. Das Wohnzimmer und die Schlafzimmer lagen einige Stufen tiefer als die Wohnküche. Die Zwischentüren hatten im Jugendstil geschliffene Glasscheiben mit Blumenornamenten, die mit Messingleisten gehalten wurden, auch die Türklinken waren aus Messing. Ebenso waren in der Wohnküche die Griffschiene um den schwarzen Kohleherd, der eingelassene Warmwasserbehälter auf der Herdplatte, sowie die Wasserpumpe am Spülbecken aus poliertem Messing. Auf der Treppe zu den Schlafzimmern lag ein roter Teppich, auch er war mit Messingleisten befestigt. Eine Petroleumlampe mit einem Schirm, an dem Glasperlenschnüre hingen, stand auf dem Tisch. An der Wand hingen abnehmbare Petroleumlampen aus Messing mit Glaszylinder, denn auf dem Schiff gab es keine Elektrizität. Ein großer Tank für Trinkwasser musste immer wieder bei Bedarf im nächsten Hafen aufgefüllt werden.
Philipp hatte sich nun im Hafen mit all den dazugehörigen Formalitäten selbst darum zu kümmern, dass sie ca. 1000 Tonnen neue Fracht, ein passendes Schleppboot sowie einen Anlegeplatz zum Be- und Entladen bekamen. Neues Personal war nicht aufzutreiben, denn fast alle Männer im wehrpflichtigen Alter hatten sich freiwillig zum Militär gemeldet oder wurden eingezogen. So musste Anna den zweiten Mann auf den Schiff ersetzten. Wie gut, dass sie bisher immer mitgeholfen hatte, wo Not am Mann war, weshalb sie mittlerweile die wichtigsten Handgriffe beherrschte. Wer sonst sollte das Ruder führen und das Schiff beidrehen, wenn Philipp beim Anlegemanöver das Tau über den Poller an Land warf und mit fachgerechten Knoten festmachte?
Philipp wusste, dass Anna Tiere sehr liebte. Er las zufällig eine Anzeige in der Zeitung, es seien junge reinrassige Hundewelpen mit Stammbaum zu verkaufen. Damit wollte er Anna in diesen trostlosen Zeiten eine Freude machen und sie überraschen. Sie lagen zufällig mit dem Schiff in der Nähe von Köln. Er machte sich auf den Weg und fand in einem sehr vornehmen Wohnviertel die in der Zeitung angegebene Adresse. Die Frau betrachtete ihn misstrauisch, weil er auf sie offenbar einen eher abgerissenen Eindruck machte, denn er hatte sich nicht eigens für sie in seinen Sonntagsstaat geworfen. Nur zögerlich zeigte sie ihm die jungen Welpen. Sie betonte, sie wolle ihre Hunde nur an Leute verkaufen, bei denen es ihnen auch wirklich gut gehe. Nachdem Philipp ihr glaubhaft versichert hatte, dass der Hund bei ihm im Bett schlafen dürfe, verkaufte sie ihm den Hund. Seine Überraschung war ihm gelungen. Anna freute sich riesig über den entzückenden kleinen Affenpinscher mit schwarzem Fell und gab ihm den Namen »Hexe«, der gut zu seinem quirligen Temperament passte.
Der Krieg war in vollem Gange. Rotterdam war durch die deutsche Bombardierung im Mai 1940 bereits zu großen Teilen zerstört. Die Lebensmittelversorgung wurde immer schlechter. In den noch vorhandenen Geschäften gab es fast nichts mehr zu kaufen. An lange Menschenschlangen, die eine Sonderration vermuten ließen, brauchten sich Philipp und Anna erst gar nicht anzustellen, denn bei der Ausgabe war mit Sicherheit ein Schild angebracht mit der Aufschrift »Zigeuner und sonstiges fahrendes Volk sind ausgeschlossen!« Philipp pflegte in solchen Fällen zu sagen: »Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner!« Hatten sie eine Ladung mit Mehlsäcken, Mais, Getreide, Reis, Kartoffeln oder, was immer seltener vorkam, Kaffeebohnen, dann war der eine oder andere Sack beschädigt und verlor ein wenig von seinem Inhalt, der heimlich zur Seite geschafft wurde. Was sie von diesen Schätzen nicht selbst brauchten, konnten sie gegen Fleisch oder andere Mangelware eintauschen. Manchmal transportierten sie wochenlang nur Kies, Sand oder Schrott. Kohle wurde allmählich auch zu einem beliebten Tauschobjekt. War kein Fleisch aufzutreiben, angelten sie sich heimlich auch mal einen Fisch aus dem Rhein.
Zum Glück hatten sie sich, als die Zeiten noch etwas besser waren, ein paar Hühner und einen Hahn angeschafft. Sie bekamen im Herf, dem Abstellraum unter Deck, in dem die Werkzeuge, Taue, eingetrocknete Farbtöpfe – frische Farbe gab es schon lange nicht mehr – und sonstiges Gerümpel lagerte, ihren abgetrennten Stall. Bei schönem Wetter wurden sie an Deck gebracht, in einen Käfig, den Philipp aus Holzlatten und Maschendraht gebaut hatte. So bekamen die beiden wenigstens jeden Tag ein paar frische Eier, die sich auch gegen etwas anderes tauschen ließen. Schickten sich die Hühner an zu brüten, durfte eine Henne auf den Eiern sitzen bleiben, um für den Nachwuchs zu sorgen. Anna ließ es schweren Herzens zu, dass an hohen Sonn- und Feiertagen auch mal ein Huhn aus dem Bestand in den Bratentopf wanderte.
Die Ereignisse überschlugen sich. Von der Front wurden nur triumphale Siege im Rundfunk gemeldet. Anna und Philipp zählten in etlichen Städten, hauptsächlich in Frankfurt am Main, auch Juden zu ihrem Bekannten- und Freundeskreis. Mit dem Reichsbürgergesetz von 1941 verschärfte sich die Situation der jüdischen Bevölkerung noch drastischer. Es wurden immer mehr Juden enteignet und in Konzentrationslager deportiert. Durch den gelben Judenstern auf der Kleidung waren sie für Jedermann auch aus der Ferne zu erkennen. Sie konnten nur noch im Untergrund ums Überleben kämpfen. Etlichen wurde nicht nur ihr Vermögen weggenommen, sondern auch ihre Papiere, um sie zu schikanieren und die Ausreise auf legalem Wege zu verhindern. Immer öfter wurde an Philipp die verzweifelte Bitte herangetragen, ob er nicht den einen oder anderen mit nach Holland nehmen könne. Sie erhofften sich, von dort weiter zu kommen und vielleicht ein rettendes Schiff nach Amerika zu erwischen. Was sollte er tun? Er würde Annas und sein Leben aufs Spiel setzen. Aber konnten sie ruhigen Gewissens ihre Hilfe verweigern? Dann würden sie sich an diesem mörderischen Wahnsinn mitschuldig machen. Sie waren sich bald einig, dass sie, sobald sich eine Gelegenheit bieten würde, helfen wollten. So einfach war das aber nicht. Es gab einiges zu bedenken. Sie konnten ihre Mithilfe bei einer Flucht nach Holland nicht von langer Hand planen, denn man konnte sich die Fracht und den Zielhafen nicht aussuchen, und Aufträge ins Ausland wurden immer rarer. Eine Fracht für eine Teilstrecke, z.B. von Frankfurt nach Duisburg, hätte wenig Sinn gehabt, denn sie wussten ja nicht, ob sie überhaupt von dort eine weitere Fracht nach Holland bekämen, und wem konnte man in diesen Tagen noch trauen, um die Flüchtlinge gegebenen falls an ein anderes Schiff weiter zu leiten? Diese Tatsache würde die Gefahr einer Entdeckung extrem erhöhen. Selbst bei einer passenden Fracht direkt nach Rotterdam hätte es bis zur Ankunft einige Tage gedauert. Im Main waren etliche zeitraubende Schleusen zu überwinden, was auch jedes Mal das Risiko einer Kontrolle mit sich brachte. Zusätzlich waren sie auch von dem Schleppboot abhängig. Sie konnten ja nicht ohne weiteres anhalten, wo sie wollten. Nur bei Anbruch der Dunkelheit wurden die Fahrt unterbrochen und die Anker gesetzt, um im Morgengrauen wieder weiter zu fahren. Außerdem waren noch andere Kähne mit im Schleppzug. Es war also höchste Vorsicht geboten. Sollten sie dieses große Risiko auf sich nehmen?
Doch es gab etliche verfolgte Juden, die mit Ungeduld auf den Bescheid warteten, mitgenommen zu werden. Mit jedem Tag Verzögerung wurde die Situation für sie noch lebensbedrohlicher. Als Philipp endlich eine geeignete Fracht hatte, gab er einem Informanten im Hafen Bescheid, der die Ausreisewilligen verständigte, denn Philipp wusste ja nicht, ob sie überhaupt noch in Freiheit waren. Die Flüchtlinge sollten sich in der Nacht nur mit dem, was sie tragen konnten, an einer bestimmten Stelle einfinden, damit Philipp sie im Schutze der Dunkelheit mit dem Nachen abholen und auf das Schiff bringen konnte. Im Abstellraum hinter einem Bretterverschlag zwischen dem Werkzeugregal, Tauen und dem Hühnerstall war das Versteck, in dem die Flüchtenden untergebracht werden sollten. Philipp und Anna teilten mit ihnen ab sofort das, was sie gerade zu Essen hatten. Die »blinden Passagiere« durften das Versteck nur während der Fahrt auf freier Strecke verlassen. Selbst da musste immer jemand aufpassen, ob sich eine Nazi-Patrouille nähert. Kamen sie in die Nähe einer Stadt oder eines Hafens, wuchs die Gefahr einer spontanen Durchsuchung. Vor der holländischen Grenze wurde strengstens kontrolliert. Eine extrem brenzlige Situation blieb Philipp besonders in Erinnerung: Mehrere Uniformierte bestiegen den Kahn und durchsuchten ihn akribisch. Der Chef der Nazitruppe, ein besonders penetranter Wichtigtuer, nahm sich das Herf vor. Philipp blieb – äußerlich ruhig – in ihrer Nähe. Der Kontrolleur kam dem Bretterverschlag vor dem Versteck gefährlich nahe. Die Hühner gackerten aufgescheucht in ihrem Käfig. Philipp rutschte das Herz schon fast in die Hose, als plötzlich der Kontrolleur mit der Petroleumlampe vor den Brettern herumfuchtelte und angewidert fragte: »Was ist denn das da auf den Brettern?«
»Was meinen Sie denn?«
Er fauchte ungeduldig: »Na, die dunklen Dinger da!«
»Wanzen!«, antwortete Philipp geistesgegenwärtig.
Der Gestapo-Mann drehte sich wie von der Tarantel gestochen auf dem Absatz herum, trommelte eilig seine Mannschaft zusammen und verließ das Schiff. Nicht auszudenken, hätte der Kontrolleur das vermeintliche Ungeziefer als Farbspritzer entlarvt und den Verschlag untersucht. Sie wären alle im Konzentrationslager geendet. Bei Nacht und Nebel brachte Philipp die Flüchtlinge mit dem Nachen in Rotterdam an Land. Ob sie ihr Ziel erreichten, haben Anna und Philipp nie erfahren.
FÜR LEBENDE GIBT ES NICHTS
Während des Krieges trieben oft Leichen auf dem Wasser, Menschen, die entweder bei Bombenangriffen auf Städte, Häfen und Industrieanlagen nahe dem Rheinufer oder durch Unfälle auf den Schiffen ums Leben gekommen waren. Philipp sah es als seine Pflicht an, diesen Toten zu ihrer letzten Ruhe zu verhelfen. Als er wieder einmal eine Leiche auf dem Wasser treiben sah, während er auf eine neue Fracht wartete, sprang er in den Nachen, um sie mit einem Haken ans Ufer zu ziehen. Ein Passant half ihm, den Toten aus dem Wasser zu holen. Sie trauten ihren Augen nicht, denn unter der Jacke des leblosen Mannes bewegte sich etwas. Es sah aus wie ein heftiger Herzschlag. Während sie noch rätselten was das sein könnte, streckte ein Aal seinen Kopf aus dem Revers des Toten. Der Passant zog kurzerhand den Aal aus der Jacke hervor. »Den nehme ich mit, dann haben wir endlich mal wieder was zu essen, und es kann ja keiner wissen, woher der stammt!« sagte er etwas verlegen. Philipp war der Appetit auf Aal für lange Zeit vergangen.
Eines Tages beobachtete er eine junge Frau, die direkt auf die Brücke zueilte und dort entschlossen Hut, Mantel und Schuhe ablegte. Er ahnte, dass das Fräulein sicher nicht nur aufs Wasser schauen wollte. Kurzer Hand schnappte er seinen Rettungsring, an dem ein Seil befestigt war und sprang behände in den Nachen. Im selben Moment sprang auch die junge Frau mit einem Satz über das Brückengeländer ins Wasser. Philipp ruderte mit kräftigen Schlägen der Ertrinkenden entgegen. Glücklicherweise half ihm die Strömung dabei, sie schnell zu erreichen. Obwohl sie die Absicht hatte zu sterben, wehrte sich ihr Körper in Panik wild schlagend gegen den nahen Tod. Philipp bekam sie noch zu fassen und zog sie mit Mühe aus dem Wasser, dabei musste er die Balance halten, um nicht zu kentern. Er durfte auf gar keinen Fall selbst ins Wasser fallen, denn schwimmen konnte er immer noch nicht. Als er sie endlich im Nachen hatte, fragte er verwundert: »Wie kann ein so schönes, junges Mädchen ins Wasser gehen?«. Eine Antwort erwartete er von der triefenden, hustenden und Wasser spuckenden Frau nicht. Schaulustige, die den Vorgang beobachtet hatten, eilten herbei und kümmerten sich um sie. Philipp ging auf das zuständige Amt und hoffte, dort wieder die dreißig Reichsmark zu erhalten, die er sonst für eine Bergung bekam. Der Beamte sagte lapidar: »Für Lebende gibt es nichts!«
Philipp fragte ironisch: »Soll das heißen, dass ich das nächste Mal warten muss, bis der Tod eingetreten ist?«
Im Frühsommer 1942 war sich Anna ziemlich sicher, dass sie schwanger war. Es wurde in den nächsten Monaten immer gefährlicher für sie, mit dem dicker werdenden Bauch die Leiter auf und ab zu klettern um die Laderäume nach dem Entladen auszufegen. Bei schönem Wetter blieb ihnen das Abdecken der Ladung erspart. Zog aber während der Fahrt schlechtes Wetter auf und hatten sie Saatgut, Raps, Mehl oder etwas Anderes geladen, das unbedingt vor Nässe geschützt werden musste, wurde es für Anna immer beschwerlicher, die schweren Planken zu bewegen, um die Ladung abzudecken. Meistens tauschte sie dann mit Philipp den Platz im Steuerhaus. Sie übernahm das Ruder, während er diese schwere Arbeit erledigte.
Als der Geburtstermin immer näher rückte, stellten die Schiffseigner einen Antrag für einen Hilfsmatrosen. Da aber alle gesunden Männer im Krieg an der Front oder sonst wie im Einsatz waren, wurde ihnen ein junger französischer Zwangsarbeiter zugeteilt. Auguste war ein stiller, sympathischer junger Mann. Anna und Philipp lernten von ihm ein wenig Französisch und er von ihnen Deutsch, sonst hätten sie sich nicht verständigen können. Sie teilten mit ihm das Wenige, was sie zum Essen auftreiben konnten.
Eigentlich freuten sich die beiden auf ihr Kind, aber sie hatten Angst vor der Zukunft. Philipp versuchte, sich und Anna mit den Worten zu trösten: »Wo die Not am größten, ist Gott am nächsten!«
»Was ist das für ein unbarmherziger Gott, der so viel Leid und Elend über die Menschen kommen lässt, nur damit sie ihm näher rücken?«, fragte Anna nachdenklich.
In Nierstein ging Anna von Bord und begab sich zur Geburt ihres ersten Kindes in die Obhut ihrer Schwiegermutter, die immer noch ihrem Hebammenberuf nachging. Am 22. Januar 1943 brachte Anna ein Mädchen zur Welt. Der Säugling wurde Eva und mit zweitem Namen nach ihrer Großmutter Anna Maria getauft.
Da Anna kein gutes Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter hatte, ging sie mit der kleinen Eva so schnell wie möglich wieder auf das Schiff zurück. Es war das letzte Enkelkind, dem die Großmutter auf die Welt half, denn im selben Jahr verstarb sie im 67. Lebensjahr.
Die Nazipropaganda vermeldete immer noch Siege, obwohl es schon Tausende toter Zivilisten und große Verluste an allen Fronten gab. Immerzu wurden Durchhalteparolen für den »Endsieg« ausgegeben.
Die Städte an Rhein, Main und Neckar boten ein immer trostloseres Bild. Von den einstmals prächtigen Bauwerken, die Anna so gerne bewundert hatte, ragten oft nur noch die traurigen Überreste der Außenmauern zwischen den Schutthaufen in die Höhe. Die Bombenangriffe der Alliierten wurden immer häufiger. Die Engländer bombardierten die Städte meist bei Nacht, die Amerikaner kamen am Tag.
Philipp und Anna hatten das Pech, sowohl im August 1942, als auch bei dem noch viel schlimmeren Bombenangriff vom 27. Februar 1945 im Hafen von Mainz zu liegen, als kaum ein Stein auf dem anderen blieb. Auch als der Bombenteppich am 6. März 1945 über Köln niederging, lagen sie dort im Hafen. Ebenso waren sie Zeuge, als Frankfurt und etliche andere Städte und Industrieanlagen vernichtet wurden.