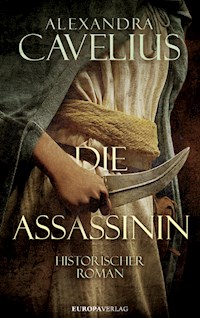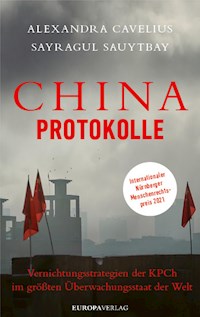12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Leila überlebte einen Alptraum: zwei Jahre Vergewaltigungslager in Bosnien. Alexandra Cavelius erzählt jetzt ihre Geschichte. Der aufwühlende Bericht zeichnet auf schonungslose Weise den Leidensweg des Mädchens nach, das nach dem Ausbruch des Krieges als 15-Jährige in ein Konzentrationslager kam und dort misshandelt und vergewaltigt wurde. Er schildert ihre abenteuerliche Flucht und wie sie heute mit ihrem Schicksal lebt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Leila wächst in einer idyllischen Kleinstadt in der Nähe von Sarajevo auf. Sie hört Popmusik und liest gerne Liebesromane, später will sie einmal Wirtschaftswissenschaften studieren. Leila führt ein ganz normales Leben, bis der Ausbruch des Krieges in Bosnien mit all seinen Schrecken über sie hereinbricht. Sie wird in mehrere Lager verschleppt, gefoltert und systematisch vergewaltigt. Doch ihr Uberlebenswille ist stark und ihr gelingt die Flucht. Sie zieht mit einer serbischen Feldküche nahe der Front durch den Krieg, bis sie schließlich zu ihrer Mutter zurückfindet.
Die Autorin
Alexandra Cavelius arbeitete nach einem Volontariat in einer Presseagentur als Redakteurin für eine Tageszeitung. Seit mehreren Jahren ist sie als freie Journalistin und Sachbuchautorin tätig und publiziert in renommierten Zeitschriften- und Buchverlagen.
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,Speicherung oder Übertragungkönnen zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Die meisten Personen- und Ortsnamen in diesemBuch sind aus Gründen der Sicherheit geändertworden.
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Juli 20015. Auflage 2013© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2007© 2000 by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, MünchenUmschlagkonzept: Lohmüller Werbeagentur GmbH & Co. KG, BerlinUmschlaggestaltung: Jorge SchmidtTitelabbildung: © Julia Krüger
eBook-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
Printed in GermanyeBook ISBN 978-3-843-70757-2
Die Kronzeugin
Geboren in B.
Kindheit
Schulzeit
Jugendzeit
Erste Schwärmereien
Auf in die Krajina
Kriegsausbruch
Der Verrat
Zerina
Die Putenfarm
Die Festung
Die schwarze Legion
Zwei Bordelle
Der Befreier
Flucht in die serbische Feldküche
In Ravnica
In Kostanica
Der Heiratsantrag
Kriegsende
Die Hochzeitsfeier
Die Schwangerschaft
Erstes Gespräch mit der Mutter
Zorans Geburt
Treffen mit der Mutter
Besuch in B.
Zorans erster Geburtstag
Zu Hause
Therapie
Weiterleben
Verliebt
Ratko und Ibrahim
Liebe
Nachwort
Warum mußte ich dich erblicken,dich, so zittrig, so zärtlich wie ein Tautropfennun friert mein müdes Herz,und meine trüben Augen tragen den Schmerz.
Hast du ein Herz wie ein Eisberg,du imaginäre Frau, die ich bewundere,um alle Menschen zu quälen oder nurdiejenigen, die für dich leben?
Früher habe ich innig das Leben geliebt,stürmisch gelebt wie auch viele andere,und nun ist für mich nichts mehr wichtig,weil du mein Leben wie ein Glas Wasserausgeschüttet hast.
Meine Tage vergehen so langsam, so leise, meineLiebste, und du bist so weit weg, und doch so nah,neben meinem Herz, im Tiefsten meiner Seele.Ich wünsche mir so schmerzlich, dich wiederzusehen,deine Stimme zu hören.Aber es läßt sich nicht ändern: Du bist so weit wegvon mir.
Ratko für Leila
Die Kronzeugin
»Für die anderen Menschen hat der Krieg aufgehört. Für uns hat er erst angefangen«, sagt meine Mutter immer. Seit dem Ende der Kämpfe bestimmen Krankheit, Arbeitslosigkeit und Armut unseren Alltag. Es bleibt wenig Zeit zum Träumen. Meine Familie kämpft ums Überleben. Eigentlich müßte ich mich dringend um einen Job bemühen, aber das habe ich vorerst hintangestellt. Mein derzeitiges Leben ist ganz auf meine Aussage vor dem Obersten Gerichtshof ausgerichtet. Vermutlich im Frühling 2000 werde ich als Kronzeugin in Den Haag auftreten. Das Reden über all die schrecklichen Ereignisse, die hinter mir liegen, habe ich mühselig erlernt. Ich hatte bereits mehrere Male Besuch von Inspektoren, Staatsanwälten und Richtern. Man stellte mir viele Fragen und klärte mich über den Ablauf vor Gericht auf.
An jede Einzelheit, jede kleine Bewegung, jede Minute müßte ich mich erinnern. Ich muß wissen, zu welchem Zeitpunkt sich welcher Gegenstand wo befand. Ich will mich bemühen. Selbst wenn mir davor graut. Hoffentlich versagt mir nicht die Stimme. Und hoffentlich läßt mich mein Gedächtnis in der Aufregung nicht im Stich. Sonst schiebt mich der Richter als unglaubwürdige Zeugin ab. Nach all den Befragungen kehren die Alpträume wieder zurück. Nachts wache ich oft schreiend auf. Ich habe mit einer Therapeutin darüber gesprochen. Sie meinte, daß ich jetzt alles verarbeiten und langsam wieder in einen gesunden Zustand zurückkehren würde. Das wäre ein schmerzhafter Prozeß.
Angst meinen Vergewaltigern gegenüberzustehen habe ich nicht. Nach allem, was mir zugestoßen ist, fürchte ich außer dem Tod nichts mehr. Ich lebe für diesen Tag vor Gericht! Die Wahrheit darf nicht vergessen werden. Ich glaube an Gerechtigkeit. Und ich verlange, daß diese Männer bestraft werden. Man sagt, daß Gott alles sähe. Auch wenn er sich manchmal Zeit lasse.
Vergeben kann ich genausowenig wie vergessen. Das ist etwas, was einen ständig begleitet. Morgens, wenn man aufsteht, und abends, wenn man zu Bett geht. Nur wenn ich mit meinem Kind spiele, versinkt die Welt um mich herum. Lange Zeit verspürte ich schreckliche Mordgelüste. Ich wollte jeden einzelnen meiner Folterknechte aufsuchen und abstechen. Doch damals war ich wahnsinnig. Heute würde ich mich stolz wie eine Heldin vor sie hinstellen: »Seht her! Ich habe überlebt.« Und ich will weiterleben – trotz allem.
Geboren in B.
Der Aschenbecher ist randvoll. Daneben türmt sich Schokoladen- und Bonbonpapier. »Nervennahrung« nennt meine Mutter dieses Zeug. Vierundzwanzig Jahre alt bin ich und fühle mich doch oft wie eine Großmutter. Es ist lange her, daß ich als normales Mädchen ein normales Leben geführt habe. Meine Vergangenheit sieht man mir nicht an. Manche Leute behaupten sogar, daß ich schön wie Schneewittchen sei. Weiße Haut, schwarze Haare und Augen wie Kohle. Groß und schlank. Wie oft habe ich mir gewünscht, häßlich zu sein. Vielleicht wäre mir manches erspart geblieben. Wer mich genauer betrachtet, entdeckt meine vom Rheuma geschwollenen Gelenke und die verfaulten Zahnstummel, die ich zu verbergen versuche.
Das sind die äußeren Spuren meiner gestohlenen Jugend. Verlorene Jahre, in denen ich mich von fauligen Abfällen ernährte und mit menschlichen Bestien zusammengesperrt war. Ein Leben wie ein Herumirren in einem Alptraum. Meine Familie hatte ich zuletzt mit vierzehn gesehen. Bis zu unserer ersten Wiederbegegnung vergingen noch fünf Jahre. Erst an einer alten Operationsnarbe am Hals erkannte mich meine Mutter wieder.
Meine Kindheit liegt weit zurück, so weit, daß ich mich heute kaum noch daran erinnern kann. Geboren wurde ich an einem sonnigen Tag am 17. September 1976 in B. Das ist eine Kleinstadt mit zweitausend Einwohnern, etwa zwei Fahrstunden von Sarajevo entfernt. »3300 Kilogramm, 52 Zentimeter, kerngesund und putzmunter«, schrieb Mama in Schnörkelschrift in mein Babyalbum. Sie war damals einundzwanzig, Papa sechsundzwanzig.
Um uns herum gibt es nur Berge, Wälder und sonst nichts. Die Winter sind lang und eisig. Besonders begeistert war ich von dieser Gegend nie. Ich wollte immer lieber sehen, was hinter den Hügeln liegt. Das Ländliche an B. liebe ich, aber ich hasse es, wenn die Leute ständig die Nase in die Angelegenheiten der anderen stecken. Hier kennt jeder jeden. In Sarajevo könnte man in Unterhosen herumlaufen, und keiner würde darauf achten. In B. hingegen würde die ganze Stadt zur Hexenjagd aufrufen. Ich wollte immer weg von hier. Deshalb habe ich nach der achten Klasse Grundschule die erste Möglichkeit genutzt und meine Koffer gepackt. Damals hatte ich große Pläne. Ich wollte bei meinen Verwandten in der Krajina die Handelsschule besuchen und dort später studieren. Leider kam alles völlig anders.
Kindheit
Meine Kindheit war normal. Zumindest normal für diesen Ort. Die meisten Männer hier trinken. Man behauptet, daß das an der harten Arbeit im Bergbau und der düsteren Gegend liegt. Mein Vater hat auch getrunken. Meiner Meinung nach sogar am schlimmsten von allen. An meine ersten fünf Lebensjahre kann ich mich nur noch bruchstückhaft erinnern. Papa arbeitete damals als Schreiner. Mama war Hausfrau. Mit zwei anderen Familien lebten wir auf einer steilen Anhöhe. Eine Stunde brauchte man von dieser Einöde zu Fuß bis in die Stadt. Autos waren für uns unbezahlbare Luxusgüter. Außer ein paar Wölfen, vielen Bäumen und einem großen Wohnhaus, das im Krieg zu einer Kaserne umfunktioniert wurde, gab es nichts Aufregendes. Mama erlaubte mir nie, draußen alleine zu spielen. »Das Gelände ist zu gefährlich«, ermahnte sie mich. Doch kaum war sie mal einen Augenblick unaufmerksam, entwischte ich mit den anderen Kindern zu unserem Lieblingsfelsen. Meiner Mutter fiel ein Stein vom Herzen, als wir endlich am Stadtrand von B. eine Wohnung in einem kleinen Block fanden.
Statt auf dem Berg lebten wir nun in einer engen Schlucht, durch die sich ein Fluß schlängelte. Eine Brücke führte zu unserem Haus. Wir zogen in den zweiten Stock. Zwei Räume, Küche und ein Bad. Mama richtete alles sehr liebevoll mit Häkeldeckchen, Blumen und Ölbildern ein. Als ich viereinhalb war, kam mein Bruder Emir zur Welt. Wir teilten uns ein Zimmer. Nachts kroch ich aber meist zu Mama unter die Bettdecke.
Kaum konnte der Kleine laufen, beklebten wir unser Zimmer mit Tierpostern und drückten unsere bemalten Hände auf die Wände. Mein Bruder bemühte sich eifrig, mir alles nachzumachen. Deshalb sahen unsere Zimmerhälften auch später noch sehr ähnlich aus. Bis auf kleinere Reibereien verstand ich mich mit Emir prima. Er war mein geliebtes Knuddelbaby. Erst in letzter Zeit hat sich unser Verhältnis ein bißchen getrübt. Emir beschwert sich öfter: »Leila kann machen, was sie will. Aber ich werde immer sofort ausgeschimpft.« Mein Bruder ist eifersüchtig, weil meine Mutter sich seit meiner Heimkehr besonders liebevoll um mich kümmert. Er reagiert so sauer, weil sie schon während des Krieges die Familie vernachlässigt hat. Tagein und tagaus hatte Mama nach mir gesucht. Und das jahrelang.
Mit der neuen Wohnung am Stadtrand wuchsen die Probleme zwischen meinen Eltern. Während Vater jede freie Minute in irgendeiner Kneipe verbrachte, übernahm unsere zart gebaute Mutter einen Job im Sägewerk. Uber die harte Arbeit hat sie sich nie beklagt. Selbst wenn wir in dieser Zeit nicht besonders wohlhabend waren, hat es uns Kindern an nichts gefehlt. Das erste hübsche Kleid, das nach B. geliefert wurde, bekam immer ich geschenkt. Tagsüber kümmerte sich eine Bekannte um Emir und mich. Tante Marinka war spindeldürr und trug eine Brille. Täglich bürstete sie mein langes schwarzes Haar und las mir mein Lieblingsmärchen »Aschenputtel« vor.
Für die anderen Kinder war es bestimmt schlimm, wenn sie mich auftauchen sahen. Denn ich wollte immer die Chefin sein. Ich weiß noch, wie wir im Winter hinter unserem Haus an einem gefrorenen Wasserfall Eiskönigin spielten. Dort war es für uns wie in einem Schloß. Selbstverständlich war ich die Königin, und die anderen mußten mir die Eiszapfen bringen. Während wir draußen Stühle aus Moos flochten oder auf dem Schlitten die Berge herunterrodelten, schleppte Mama Balken, stapelte Bretter oder legte Parkettböden. Nichts war ihr wichtiger, als daß es uns gutging. Und das hat sie, trotz meines Vaters, auch geschafft. Sie war immer wie ein Licht, das selbst den dunkelsten Raum noch erhellte.
In den allerschlimmsten Zeiten vertrank Papa beide Löhne. In solchen Fällen nahm Mama auch mal einen Kredit auf und veranstaltete trotz der Not eine kleine Party mit Süßigkeiten für uns. Sie war nie streng mit uns. Wenn mein Vater im Morgengrauen besoffen nach Hause schwankte, hörte man ihn schon von weitem auf der Brücke grölen: »O ja, deinetwegen bin ich jede Nacht blau. Mein Schätzchen, ich komm in deine Wohnung …« Seine Stimme versetzte uns in Alarmbereitschaft. Mama wimmerte vor Angst. Es kam vor, daß Papa sie kurz darauf krankenhausreif prügelte. In solchen Situationen verhielten Emir und ich uns bereits wie ein eingespieltes Team. Während der Kleine sich unter seiner Bettdecke versteckte, streifte ich mir schnell eine Hose über. Dann schlich ich aus dem Haus und rannte zur zwei Kilometer entfernten Polizeistation. Dort verzogen die Beamten bereits gelangweilt die Gesichter, wenn ich keuchend die Tür aufstieß. Trotzdem begleitete mich ein Uniformierter nach Hause und hielt meinem Papa eine Moralpredigt.
Oft kauerte er heulend wie ein kleiner Junge am Boden und jammerte. »Ich weiß einfach nicht, wie ich das tun konnte.« An seinem schwarzen Schnurrbart klebte der Rotz. Papa war ein komischer Mann. Er schenkte mir einen Pelzmantel und nahm ihn mir zwei Wochen später wieder weg. »Du bist noch zu jung dafür«, erklärte er augenzwinkernd und küßte mich auf die Wange. Er schwang herzzerreißende Reden über Liebe und Fairneß. Und wir lauschten ihm hingerissen. Voller Bewunderung kniete er vor seiner Frau und dankte ihr: »Wie oft bin ich gestorben, und du hast mich wieder zum Leben erweckt.« Dabei roch er komisch aus dem Mund.
Einmal kam Mama abgearbeitet von der Nachtschicht. Als die Arme ihre Handtasche an der Garderobe abstellen wollte, schnappte mein Vater sie am Handgelenk und drosch auf sie ein. »Wo hast du gesteckt, du alte Schlampe?« brüllte er los. Er war immer übertrieben eifersüchtig auf seine hübsche Frau. Dabei war Papa derjenige, der fremdging. Selbst wenn der Lärm in unserer Wohnung unüberhörbar wurde, war von den Nachbarn keine Hilfe zu erwarten. Hinter verschlossenen Türen schlugen sie sich mit denselben Problemen herum. Nach einer Weile gelang es Mama, sich von dem Tobenden loszureißen und die Treppe herunterzuflüchten. Der Flur war mit Blut bespritzt. Unbemerkt folgte ich ihr, und gemeinsam hetzten wir zur Polizeistation. Als wir mit einem Beamten in unser Haus zurückkehrten, hatte mein Vater alle Kampfspuren bereits beseitigt. Das Blut war weggewischt, und die umgestürzten Möbel standen wieder an ihrem Platz. Im Aschenbecher lag sogar eine Zigarette mit Lippenstiftspuren. Solche Einfälle waren typisch für ihn. Noch unzählige Male sind wir nachts aufgestanden und streichelten der am Boden liegenden Mama über das blutverklebte Haar. Schnarchend lag unser Vater daneben. Am nächsten Tag schrieb er ihr auf einen Zettel: »Ohne dich wäre meine Seele eine nackte Wüste.«
Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich mir als Kind eine glückliche Familie gewünscht habe. Um Papa zu beeindrucken, nahm ich an verschiedenen Gesangs- und Theateraufführungen teil. Meine Mutter hatte mich für diese Anlässe stets besonders hübsch hergerichtet. Bald war ich in der Stadt für meine Auftritte bekannt. Jedesmal suchte ich voller Hoffnung mit den Augen die Sitzreihen der Besucher ab. Aber Vater war nie darunter. Innerlich verteidigte ich sein Verhalten: »Er ist krank. In Wirklichkeit ist er ein guter Mensch.« Als ich vor zwei Jahren aus der Gefangenschaft zurückkehrte, wollte er mich nicht Wiedersehen. Seitdem wechsle ich die Straßenseite, wenn ich ihm zufällig begegne. Fremden gegenüber erzähle ich heute, daß mein Vater bereits sehr früh verstorben ist.
Gegen mich erhob Papa nur ein einziges Mal die Hand. Einmal deckte ich den Tisch für Mama, Emir und mich, da polterte er unerwartet in die Wohnung und verlangte etwas zu essen. Erst am Tage vorher hatte er Milchtüten und Reis in einem Wutanfall aus dem Fenster geschmissen. Wir hatten aber Hunger. »Nein. Du bekommst nichts«, schrie ich ihn deshalb an. Im nächsten Moment verpaßte er mir so eine Ohrfeige, daß ich auf den Po fiel. Kurz darauf wollte er meinen Bruder im Suff mit einem Stuhl schlagen. »Ich schaffe das nicht mehr alleine«, klagte Mama. Für zwei Jahre schickte sie den Kleinen zu meinen heißgeliebten Großeltern nach K. in die Krajina. Das war etwa zweihundert Kilometer von uns entfernt.
Die Trennung von Emir war schrecklich für mich. Als ob man ein Körperteil von mir abgetrennt hätte. Mein einziger Verbündeter war weg! Mit den anderen Kindern redete ich nicht über die Probleme zu Hause. Zu sehr schämten sich alle für ihre Väter. Um die Tage mit dem Säufer leichter ertragen zu können, fieberte ich in Gedanken fortwährend auf die großen Ferien hin. Dann war endlich Sommer! Mama und ich reisten gemeinsam im Bus nach K. In dieser kleinen Stadt fühlte ich mich wie im Paradies.
Schulzeit
Aufgeregt zählte ich die Tage, bis ich eingeschult wurde. Als ich sieben war, ging es schließlich los. Da es keinen Bus gab, lief ich mit den vielen anderen Kindern zur Schule. Mir bereitete der Unterricht so viel Spaß, daß ich zu Hause immer drei bis vier Lektionen im voraus lernte. Mama schärfte mir ein, wie wichtig die Ausbildung für eine Frau wäre: »Du siehst, was aus mir geworden ist. Du sollst in der Zukunft von keinem Mann abhängig sein.« Bald war ich eine der Besten in der Schule. Sogar mein Foto stellte man im Schaukasten aus. Trotzdem war ich keine Streberin. Meistens streckte ich in der vorderen Bankreihe am Fenster die Füße aus, blickte in den Park und träumte vor mich hin. Dabei malte ich mir aus, wie ich als elegante Dame in einer amerikanischen Fernsehserie mitspielen oder als Pop-Sängerin mit rauschendem Applaus gefeiert würde. »Deine Phantasie hat dich vor dem Tod gerettet«, behaupteten die Therapeutinnen später.
Wir waren eine gemischte Klasse. Kroaten saßen neben Serben oder Muslimen wie mir. Alles, was ich über den Islam wußte, war, daß Moslems kein Schweinefleisch essen sollten. Früher habe ich die Gegensätze zwischen den Religionen nicht bemerkt. Man sah den Leuten schließlich nicht an der Nasenspitze an, ob sie orthodox, muslimisch oder sonst was waren. Kopfbedeckung und lange Gewänder trugen meist nur die älteren Frauen in B. Katholiken besuchten die Kirche und Moslems die Moschee. Für mich war beides das gleiche. Der Rest – so wie ich – blieb lieber draußen und spielte. Nur die einfachen Leute vom Land achteten schon vor dem Krieg streng darauf, welcher Name welche Religionszugehörigkeit verriet. Mich interessiert das bis heute nicht.
Religion bedeutete mir nie besonders viel. Trotzdem würde ich mich als Gläubige bezeichnen. Ich bin nämlich der Ansicht, daß Gott oder irgendeine andere höhere Macht existiert. Wenn ich mich abends ins Bett legte, betete ich auch immer: »Lieber Gott, ich bitte dich, daß du mir morgen wieder einen schönen Tag schenkst.« Ohne meinen Glauben hätte ich den ganzen Wahnsinn wahrscheinlich nicht überstanden.
Genausowenig wie die Religion war Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen für mich ein Thema. Ich weiß noch, wie wir schwatzend mit einer kleinen Gruppe älterer Frauen bei uns in der Küche zusammenhockten. Da kam ein zehnjähriger Junge herein. Hektisch rafften die alten Frauen ihre Röcke und sprangen auf, um dem Knirps einen Platz frei zu machen. So was sah ich nicht ein. Wenn kein Platz mehr frei war, konnte es sich der Herr meinetwegen auf dem Boden gemütlich machen.
Für diese Gegend hier hatte mich meine Mutter ungewöhnlich fortschrittlich erzogen. Sie unterschied sich schon immer von den anderen. Während sich ihre Bekannten über Stricken und Kochen unterhielten, blätterte Mama lieber in Zeitschriften. Sie lackierte sich die Nägel, toupierte ihre Haare und zog sich schick an. Das bot natürlich reichlich Anlaß zum Tratsch. Im Sommer kaufte Mama mir Miniröcke. Spazierte ich mit den anderen Mädchen von der Schule nach Hause, drehten sich manche nach mir um und stöhnten: »Um Gottes willen, wie läuft die denn rum?«
Außer mir hatte meine Mutter niemanden, mit dem sie über ihre Gefühle reden konnte. Ihre sieben Geschwister und Eltern lebten zu weit weg, in der Krajina. Deshalb war ich schon als Kind mehr ihre Freundin als ihre Tochter. Eines Tages sank Mama zwischen meine Malsachen auf den Boden und fing an zu weinen. Ich kritzelte gerade meinen Block mit dem Maskottchen der Olympischen Spiele voll. »Was hast du?« wollte ich wissen. Schluchzend sagte sie mir: »Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Mit diesem Mann kann ich nicht mehr Zusammenleben. Das bringt mich noch um. Ich muß mich scheiden lassen. Was denkst du darüber?« Zum ersten Mal hörte ich das Wort »Scheidung«. Ich war gerade zehn. Mama mußte mir erst mal erklären, was damit genau gemeint war. Als ich es kapiert hatte, erwiderte ich ihr: »Wenn so was möglich ist, dann mach’ das. Das ist die einzige Rettung.« Drohend fügte ich hinzu: »Wenn du dich nicht scheiden läßt, dann verlassen wir dich.« Mein Bruder war zwischenzeitlich wieder nach Hause zurückgekehrt.
Als meine Mutter sich endlich zu einer Entscheidung durchgerungen hatte, unterstützten ihre Bekannten sie: »Du solltest diesen Kerl so schnell wie möglich vor die Tür setzen.« Diese klugen Ratgeber kehrten Mama allerdings den Rücken, als sie sich tatsächlich nach vierzehn Ehejahren von dem Säufer trennte. Zu jener Zeit war es sehr ungewöhnlich, daß eine Frau sich von ihrem Mann scheiden ließ – und nicht umgekehrt.
»Wie soll ich ohne dich leben?« explodierte der Vater. Und weil er kein Mann großer Worte war, reagierte er sofort wieder handgreiflich. Leider besaß man in B. eine seltsame Vorstellung von Gerechtigkeit. Die Richter beschlossen, daß Vater so lange in unserer Wohnung bleiben dürfte, bis Mama eine andere Unterkunft für ihn gefunden hätte. Der alte Säufer stellte sich aber bei den Vorstellungsgesprächen bewußt so dämlich an, daß ihn kein Vermieter freiwillig aufnehmen wollte.
Jugendzeit
Immer wieder lauerte Papa meiner Mutter auf und nahm ihr das ganze Geld weg. Glücklicherweise stand dann Goran, ein alter Freund des Hauses, am nächsten Tag mit vollen Tüten vor der Tür. Er war das ganze Gegenteil von meinem Vater. Ein rundlicher, etwas kleinerer und unglaublich herzensguter Mensch. Der 38jährige arbeitete als Maschinentechniker im Bergwerk. Ihn interessierte das Gerede der Leute nicht.
»Soll ich diesen Mann heiraten?« wollte meine Mutter eines Tages von mir wissen. Ich war platt, denn Mama hatte eigentlich die Nase gestrichen voll von all den Kerlen. »Goran? Der ist viel zu nett, um mein Vater zu sein«, schoß es mir durch den Kopf. »Wen sonst, wenn nicht den!« bestärkte ich sie. Doch innerlich trauerte ich ein wenig um meinen Vater. Goran selbst war seit längerer Zeit geschieden. »Ihr könnt für einige Monate bei meinen Eltern im Haus unterschlüpfen«, bot er uns an. Unser zukünftiger Stiefvater wollte dort zwei Zimmer für Mama, meinen Bruder und mich freiräumen. Da überlegten wir nicht lange.
Als sich die Heiratspläne meiner Mutter wie ein Lauffeuer verbreitet hatten, jaulte der ganze Ort vor Entsetzen auf. Eine muslimische Frau liebte einen kroatischen Mann. Das war zuviel des Guten. Nach B. war noch nicht vorgedrungen, daß gemischte Ehen in größeren Städten ganz alltäglich waren. Von einem Tag auf den anderen wendeten sich in der Schule alle Kinder von mir ab. Selbst Munevera und Nataša, meine besten Freundinnen, wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Sobald mich die beiden auf dem Pausenhof entdeckten, machten sie sich schnell aus dem Staub. Nach Hause mußte ich ab sofort auch immer alleine gehen. In diesem Moment habe ich zum ersten Mal begriffen, daß die Religionen Unterschiede zwischen den Menschen machen. In meiner Verzweiflung suchte ich sogar Zuflucht in einer Moschee. Allerdings fühlte ich mich dort genauso einsam wie draußen auf der Straße. Wahrscheinlich lag das daran, daß ich kein einziges Gebet kannte.
»Beeilt euch! Vir müssen raus aus der Wohnung, bevor euer Vater Wind von der Sache bekommt«, trieb Mama uns zur Eile an. Die Taschen waren bereits gepackt. Doch da tauchte Papa plötzlich wieder wie eine tückische Krankheit auf. Diesmal verletzte er Mama in seinem Rausch so sehr, daß sie für vier Monate ihr Gedächtnis verlor. Goran transportierte die Halbtote im Auto zu unserer neuen Bleibe. Als Mama aus der Bewußtlosigkeit erwachte, war sie total apathisch. Die einfachsten Dinge, wie Kochen oder Waschen, konnte sie nicht mehr ausführen. »Mama!« flehte ich sie an, »wach auf!« Doch sie hatte sogar meinen Namen vergessen.
Das war ein harter Schlag für mich. Sicherlich wäre es schlimm um mich bestellt gewesen, wenn Goran und der Rest seiner Verwandtschaft sich nicht aufopfernd um mich gekümmert hätten. Auf diese Weise begann, trotz der Krankheit meiner Mutter, die schönste Zeit in meinem Leben. Mit einemmal konnte ich mir vorstellen, was es bedeutete, einen Vater zu haben. Außerdem waren Kinder zum Glück nicht so nachtragend wie Erwachsene. Nach zwei Monaten hatten auch meine Freundinnen ihren Bann über mich wieder aufgehoben.
Unser Häuschen befand sich etwas abgelegen, nahe bei einem Steinbruch, wo ein kleiner Bach floß. Emir und ich tobten draußen herum. Kaum hatte sich Mama erholt, wiederholte sie unentwegt: »Dieser Mann ist ein Geschenk des Himmels.« Sie war inzwischen sechsunddreißig und strahlte vor Glück, als sie sich im schlichten weißen Hochzeitskostüm vor uns drehte. Aus gegebenem Anlaß feierten wir nur im kleinen Kreis. Mamas Freude war allerdings ein wenig getrübt. Ständig sorgte sie sich darum, wie ihre Eltern und Geschwister in K. diese zweite Hochzeit aufnehmen würden. Sie hatte ja auch ihren Eltern jahrelang verheimlicht, daß ihr Mann Alkoholiker war. So peinlich war ihr das gewesen.
»Vielleicht wollen sie jetzt nichts mehr von uns wissen«, versuchte Mama uns gefaßt beizubringen. Das traf Emir und mich hart. Vir liebten unsere Großeltern mehr als alles andere auf der Welt. Den Kummer hätten wir uns jedoch ersparen können. Denn gleich zwei Tage nach der Hochzeit reiste unser Opa mit dem Bus an, um seinen neuen Schwiegersohn kennenzulernen. Er blieb zwei Wochen und verabschiedete sich fröhlich von Mama: »Du hättest dich schon viel früher scheiden lassen sollen.«
Endlich flog Papa aus unserer Wohnung raus, weil er seit Monaten keine Miete und keinen Strom gezahlt hatte. Kurz darauf zog unsere frischgebackene Familie dort wieder ein. Mit der Hochzeit krempelte sich unser ganzes Leben um. Mittlerweile hatte Mama eine körperlich weniger anstrengende Arbeit in der Holzverarbeitung gefunden. Ich bemerkte auch schnell die Vorteile einer gemischten Ehe. Ab sofort gab es Hunderte verschiedene Festtage, die man miteinander begehen konnte. Wir feierten Weihnachten genauso wie das muslimische Neujahr. Gingen uns versehentlich mal die Feiertage aus, fanden wir todsicher einen anderen Anlaß für eine Party.
Die Tische bogen sich bei jedem Fest unter Kuchen und anderen Leckereien. Unter den Gästen waren meist einige Arbeitskollegen meiner Eltern und Gorans gesamter Familienclan. Besonders freute ich mich über meine Verwandten aus K. Da ich mich zu dieser Zeit für die Tollste hielt, wollte ich alle Gäste mit meinen Showeinlagen beeindrucken. Meistens schenkte man mir den erhofften Beifall. Erntete jedoch ein anderes Kind mehr Sympathien, kam es schon mal vor, daß ich unter dem Gelächter der Erwachsenen türenschlagend das Zimmer verließ.
Unser Stiefvater verwöhnte uns. Er schenkte mir sogar Puma-Sportschuhe, die ich mir seit Jahren heftig herbeigesehnt hatte. Einen Wunsch allerdings verweigerte er Emir und mir. »Kannst du nicht unseren Vater verprügeln? Dann läßt er Mama endlich in Ruhe!« versuchten wir ihn anzustacheln. Doch in seiner besonnenen Art entgegnete Goran: »Später würdet ihr es mir nachtragen, daß ich diesen Mann geschlagen habe. Er ist schließlich euer Vater.« Wahrscheinlich hatte er recht. Glücklicherweise stellte Papa seine Prügeleien von selbst ein, als meine Schwester Gorana geboren wurde. Endlich hatte er kapiert, daß es kein Zurück mehr gab. Ich war zwölf Jahre alt.
Erste Schwärmereien
Es begann die Zeit, in der unsere Mädchen-Clique Jungen gleichzeitig blöd und faszinierend fand. Mit meinem kleinen Bruder hatte ich mit Eintritt in die Pubertät nicht mehr so viel zu tun. Er war mit seinen acht Jahren eben noch ein Baby. Vir gingen uns, so gut es möglich war, aus dem Weg. Wollte ich alleine sein oder mich umziehen, verließ er ohne Aufmucken das Zimmer. Unsere Tierposter hatten Emir und ich mittlerweile gegen Bilder von Michael Jackson oder Madonna ausgetauscht.
Nach der Schule zappten wir zwischen den Fernsehprogrammen hin und her. Ich liebte damals Soap-Operas und Action-Filme. Außerdem schwärmte ich für Liebesromane von Danielle Steele. Darin drehte es sich meist um Liebe, Leidenschaft, Verrat und Tod in gefährlichen Zeiten. Im Mittelpunkt stand meist ein armes Mädchen, das nach schrecklichen Verwicklungen ihren Märchenprinz kennenlernte.
Als angehender Teenager war ich ziemlich eitel. Ich sang vor dem Spiegel, zog mich alle zwei Minuten um und band mir den Schmuck vom Weihnachtsbaum um den Kopf. Im Sommer riet mir Mama immer: »Binde dir doch die Haare hoch.« Doch lieber wollte ich mich zu Tode schwitzen, als diese Pracht zu verstecken. An Selbstbewußtsein hat es mir wirklich nicht gemangelt. Ich fühlte mich unbesiegbar. Gemeinsam mit Nataša und Munevera schminkte ich mich heimlich. Wir quatschten über irgendwelche Sänger und Kino-Stars, probierten neue Schrittkombinationen aus und bemühten uns, so auszusehen wie unsere Idole.