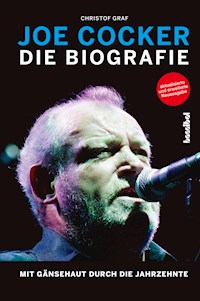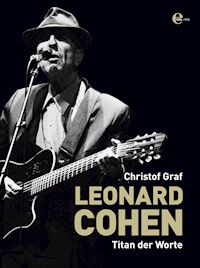
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
2008 wurde Leonard Cohen in die "Rock'n'Roll Hall Of Fame" aufgenommen. Überraschend kündigte er damals, nach 15-jähriger Bühnenpause, sein Comeback an. Zwei Jahre und fast 200 Konzerte später haben ihn über zwei Millionen Menschen weltweit live erlebt. 2010 wurde Cohen für sein Lebenswerk mit einem Grammy geehrt. In dieser Biografie lässt Christof Graf, der sich seit 30 Jahren intensiv mit Leonard Cohen beschäftigt, die Legende ausführlich zu Wort kommen. Das Buch beschreibt dessen erste literarische Gehversuche, schildert Cohens Weg vom Underground-Literaten zum Rock-Poeten, handelt von Depressionen, Drogenexzessen, Trips nach Indien und Klosteraufenthalten und lässt teilhaben an der umjubelten Comeback-Welttournee des ""Titans der Worte"" - eine Fundgrube für Fans und all jene, die dem Menschen und Künstler Leonard Cohen näherkommen wollen. Inklusive zahlreicher unveröffentlichter Fotos und ausführlicher Diskografie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 715
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Christof Graf
Leonard Cohen
Titan der Worte
© 2010 Edel Germany GmbH, Hamburg
www.edel.de
1. Auflage 2010
Projektkoordination: Dr. Marten Brandt
Lektorat: Dr. Wilfried Baatz, Magnus Enxing
Titelfoto: Prof. Dr. Christof Graf
Covergestaltung: Groothuis, Lohfert, Consorten, Hamburg | www.glcons.de
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
eISBN 978-3-8419-0028-9
Christof Graf
Leonard Cohen
Titan der Worte
Für Victoria und Isabella,
die Gräfinnen des Tages
Inhalt
Prolog
Das Interview, das nie stattgefunden hat
»I’m A Hotel« – Leonard Cohen beim Montreux Jazz Festival 2008
I. Akt
Kindheit, Jugend und erste literarische Gehversuche
Cohens Elternhaus: der frühe Tod des Vaters, die Liebe zur Mutter / Jüdische Erziehung / Mit Banjo und Mundharmonika bei den Buckskin Boys / Literarische Ziehväter / »Ritterschlag« an der McGill University / Das Plattendebüt: Six Montreal Poets /Jazz und Poesie in den Clubs von Montreal und die »Londoner Erfahrung«: 3 Seiten Tagespensum / Vom Underground-Literaten zum Rock-Poeten / Hydra, Marianne und die Erkenntnis der Unruhe (1960–1964) / Castro, Kuba und der einzige Tourist in Havanna (1961) / Leonard Cohens subversive Phantasien – Weltablehnung, Selbstvernichtung, sexuelle Transzendenz und politische Verweigerung (1956–1973) / Marihuana, LSD und erste Drogenräusche / Ladies And Gentlemen, Mr. Leonard Cohen (1964–1966) / Suzanne und die Geschichte weiblicher Inspiration (1966) / Das Chelsea Hotel in New York, eine kleine Liebesgeschichte mit Janis Joplin, Drogenexzesse, Nico, Cohens Hinwendung zur Musik (1966) / Von der Literatur zur Musik – Cohens erste Auftritte als Singer/Songwriter (1966/67)
II. Akt
Vom Underground-Literaten zum Rock-Poeten
The Songs of Leonard Cohen – Die ersten zwei Platten, Unsicherheit, Depressionen, Drogen, Selbsterfahrung. Und: Cohens Freundschaft mit dem Zen-Mönch Roshi (1968/69) / Cohen als Soundtrack-Lieferant für Robert Altmans Film McCabe & Mrs. Miller / Cohens erste Konzerte in Europa – Hitlergrüße in Frankfurt, mit weißen Pferden auf Frankreichs Bühnen, Schlagzeilen auf der Isle Of Wight (1970) / Songs Of Love And Hate und die Bilanz der ersten Welttournee (1971/72) / Live Songs, Cohen im Yom-Kippur-Krieg und Gerüchte über Konzerte in Irrenhäusern (1973/74) / New Skin For The Old Ceremony, mit Tony Palmer im Schatten Frank Zappas und der Start der ersten großen US-Tournee (1974) / Paul Williams im Gespräch mit und über Cohen (1974/1994) / Cohen on the road, Frauentourismus auf Hydra, über Bob Dylan und die Ansichten eines unabhängigen Kanadas (1975/76) / The Lost Album (in Zusammenarbeit mit John Lissauer) / Death Of A Ladies’ Man – Trinkgelage mit Wein, Revolvern und Phil Spector, Studio-Sessions mit Allen Ginsberg und Bob Dylan, eine abgesagte Welttournee, der endgültige Bruch mit Suzanne und das beste, autobiographischste und meistignorierte Buch Cohens (1977) / Recent Songs als Grabgesänge für Cohens Mutter, die Erkenntnisse aus seinen Zen-Studien und eine fast zweijährige Welttournee (1979/80) / Der »Dekadensprung« einer Welttournee, erste Auftritte in Australien, das Filmporträt The Songs Of Leonard Cohen und ein Demo-Tape für ein nie veröffentlichtes Live-Album (1980) / Rückzug auf Hydra, die Arbeit an einer Rock-Oper, die Filmliebe zu einem Hotelgeist und der doppelte Boden einer religiösen Besinnung (1981–1983) / Das Buch der Gnade, das Beziehen der Various Positions, die darauffolgende Welttournee, das Comeback in den 80ern und die Freundschaft mit Dominique Isserman (1984/1985) / Auf dem Weg zur Kultfigur, Schützenhilfe durch Jennifer Warnes’ »Famous Blue Raincoat« / Sturz in weitere Depressionen und Geschichten von ganz anderen Pharmazeutika (1986/87)
III. Akt
Zen, Poesie und Indien
I’m Your Man, die »Rückkehr der Ankunft« und die »Manifestation des Kults«: Chartserfolge und eine weitere Welttournee (1988/89) / Songwriting, Schicksalsschläge und mit Don Was in »Elvis’ Rolls Royce« (1990) / I’m Your Fan – das Ende vom Anfang einer zur Kultfigur gewordenen Legende / Kurt Cobains »Pennyroyal Tea« mit Cohen / Der Einzug in die »Juno Hall Of Fame« und Cohens »Hand an der Wiege« mit Lebensgefährtin Rebecca De Mornay (1991) / The Future (1992) / »Ausgewählte Gedichte« zum Start einer weiteren triumphalen Welttournee, der ewige Kampf mit den Journalisten und die Amnesie-Theorie (1993) / Das Bootleg-Dilemma von Zürich, das 94er Album Cohen Live In Concert, das Ende eines Kapitels mit 60 Jahren / Soundtrack zum Oliver-Stone-Film Natural Born Killers (1994) / Zen, Frauen und die nie geschriebene Geschichte eines »Partisanen der Liebe« (1995) Aufstieg zum Tower Of Song ( 1995) Neun Klosterjahre – Zen & Poesie / More Best Of Leonard Cohen – Cohens Sohn Adam im Gespräch (1998) und das tibetanische Buch des Todes / Ein Trip nach Indien (1999)
IV. Akt
Mehr als »Zehn Neue Songs«
Field Commander Cohen (1979) und Erste neue Songs in Montreal (2000) / Ten New Songs und vier Jahreszeiten in Berlin (2001) / Wim Winders Land Of Plenty und Leonard Cohens Vision von Amerika (2001) / Erste Gerüchte um weitere Kinder und Vaterschaften (2002) / »Dear Heather« und weitere Liasonen und Liebesgeschichten (2004) / Die sanfte Rückkehr mit Lebensgefährtin Anjani Thomas (2005/2006) / Von neuen Bootlegs und ca. 2000 Coverversionen / Die Kollaboration mit U2 bei »I’m Your Man« / Cohens ganz persönliche Finanzkrise (2005–2007) / The Book Of Longing (2006) / Cohen auf der Buchmesse in Montreal und der Tod von Irving Layton (2006) / Cohen besucht ein Bob Dylan-Konzert / Montreux Jazz Festival (2008) »Stimmen in Lörrach« und »Hippies in Glastonbury« (2008) / Anekdoten von der Welttournee 2008 / 2009 / 2010. Cohen in Deutschland (2008 / 2009) / »Cohen goes Down Under« in Australien 2009 / Erste offizielle DVD-Veröffentlichung: Live in London (2009) / Cohens Zusammenbruch in Valencia / Friedfertiger Kreuzzug ins Heilige Land – Vor 40000 Fans in Tel Aviv wie ein Messias gefeiert / Cohen wird 75 Jahre alt / 39 Jahre nach dem Isle Of Wight-Auftritt erscheint der dazugehörige Film (2009) / Tourneefinale in November 2009 / Ideen für ein neues Album und Tourneedaten für die Fortführung der Welttournee im dritten Jahr (2010). Cohen tritt erstmals in Moskau auf (2010).
V. Akt … to be continued
Danksagungen
Anhang
Prolog Das Interview, das nie stattgefunden hat
»Mir gefällt die Vorstellung, dass man ein Lied schreibt, das dann seines Weges geht und niemand mehr weiß, wer es geschrieben hat«, äußerte Leonard Cohen einmal in einem Interview. »Das Lied geht durch die Welt und verändert sich, und dann hört man es 300 Jahre später wieder, wenn ein paar Frauen ihre Kleider am Ufer eines Flusses oder eines Sees waschen und eine von ihnen diese Melodie summt.«
An diese Worte Cohens erinnerte ich mich, als ich am 7. Juli 2008 an der Riviera-Pays-d’Enhaut am Ufer des Lac Léman, des Genfer Sees, saß und mich auf den lang ersehnten Konzertauftritt von Leonard Cohen beim 42. Jazzfestival in Montreux einstimmte. Irgendwie hatte ich das nicht zu unterdrückende Gefühl, ein weiteres Buch über Leonard Cohen schreiben, dem Leben Leonard Cohens, das ich mit meinen bisherigen vier Veröffentlichungen nachgezeichnet hatte, mit einem fünften Buch weiter nachspüren zu müssen. Ein Buch, das nicht zuletzt die Jahre 1995 bis 2010 und die vielen Begebenheiten dazwischen zum Inhalt haben sollte. Ein Buch, das noch einen, vielleicht zwei weitere Akte zum Inhalt haben sollte. Und damit schließlich ein Buch, das Leben und Werk der 75-jährigen Rockpoeten-Legende und damit eines Künstlers, wie es ihn wahrscheinlich nie wieder geben wird, dokumentiert. In gewisser Hinsicht war es, als wäre ich genötigt, es tun, und das war auch der Grund, der mich 2008 zum Jazzfestival nach Montreux führte.
Zuvor hatte ich Leonard Cohen beim Auftakt seiner Europatournee am 13. Juni 2008 in Dublin erlebt, war Ende Juni zum Glastonbury-Festival gepilgert, und in der zweiten Juliwoche letztlich hatte es mich dann nach Montreux gezogen. Im Anschluss daran hatte ich bis November 2009 noch circa zehn weitere Konzerte der Welttournee 2008/2009 besucht.
Bisher waren es seit Ende der 70er-Jahre bis zum Jahr 2006 immer Begegnungen der besonderen Art mit dem Künstler gewesen, die mich dazu anregten, die Wirkung dieser Zusammenkünfte in Buchform festzuhalten. Zumeist hatten sie Gespräche und Kontakte mit Leonard Cohen zur Grundlage, die aus Anlass von Plattenveröffentlichungen, Konzerttourneen, Fernsehsendungen o. Ä. stattfanden. Nicht selten wurden diese Treffen durch das ehemalige Management, die Tourneeveranstalter oder die Plattenfirmen unterstützt. Doch dieses Mal war alles anders. Meine Anfragen für ein Interview mit Leonard Cohen wurden negativ beschieden. Die Plattenfirma Columbia / Sony Music Entertainment versuchte zwar alles, doch war sie nicht erfolgreich in ihren Bemühungen, mich zu unterstützen. Zum neuen Management nahm ich viel zu spät Kontakt auf, und einfach so aufzutauchen und zu sagen: »Hi Leonard, wie geht’s, lass uns doch mal wieder reden«, wollte ich dem Musiker auch nicht zumuten. Schließlich wusste ich nicht, wie er reagieren würde. Würde er es mögen, sich noch an mich erinnern? Ja, okay, ich hatte seine private E-Mail-Adresse, doch die wollte ich nur als letzte Reißleine aktivieren. Irgendwann beschloss ich, es einfach laufen zu lassen, es würde schon klappen. Also machte ich mich frühmorgens am 7. Juli 2008 auf den Weg zum 42 . Montreux Jazz Festival und erreichte den Ort irgendwann am Nachmittag – natürlich nicht, ohne vorher mehrfach E-Mails an das neue Management geschickt zu haben, mit der dringlichen Bitte, einem alten Bekannten Leonard Cohens vielleicht doch einen Gesprächstermin oder wenigstens ein kurzes Treffen zu ermöglichen. Doch das einzig positive Feedback, das ich bekam, war die Erlaubnis, beim Konzert als einer von zwölf akkreditierten Journalisten von dem von vielen Medien lang ersehnten Konzert Fotoaufnahmen machen zu dürfen.
Als ich an diesem Montagnachmittag am Ufer des Lac Léman saß, spiegelten sich die 2000 Meter hohen Berggipfel des Mont-Blanc-Massivs in den Wellen. Dann streifte mein Blick ein altehrwürdiges Gebäude inmitten der Häuserfassaden, das man erblickt, sobald man vom bronzenen Freddie Mercury aus auf die rechte Uferseite schaut. Es war das Le Montreux Palace. Den Queen-Frontmann links liegen lassend, machte ich mich sofort in Richtung rechte Uferseite auf, bahnte mir zielorientiert durch die Ufergassen mit ihren unzähligen Festivalständen und Souvenirs den Weg, um schließlich in die Grand Rue 100 hinaufzusteigen. Vom davor gelegenen kleinen Parkgrün auf der gegenüberliegenden Straßenseite aus konnte man auf die gleichermaßen beeindruckende wie prachtvolle Hotelfassade blicken. Angesichts der vielen Fenster fühlte ich mich plötzlich beobachtet. Über die 42 Jahre Festivalgeschichte hätten diese Zimmer sicher so manche Geschichte zu erzählen. Und aus einem dieser Zimmer würde irgendwann wohl auch Leonard Cohen seinen Fuß setzen, sollte er bereits aus Aarhus, Dänemark, angereist sein, wo er am 6. Juli ein Konzert gegeben hatte.
Vor dem Hotel herrschte reges Treiben. Limousinen, ein Nightliner und VIP-Charterfahrzeuge fuhren in der Einfahrt vor. Fünf Stunden später, um 20 Uhr, würde »A Blues Night with Gary Moore, Otis Taylor, Buddy Guy und John Mayall & The Bluesbreakers« im gerade einmal 200 Meter entfernten Auditorium Stravinski beginnen, und einige dieser Limousinen schienen wohl auch für den dazugehörigen Tross bereitzustehen. Die Szenerie sog mich in den Eingangsbereich des Grand Hotels: Hohe Räume, weiß-braun geäderter Marmor und adrett gekleidetes Personal strahlten die Atmosphäre schwerer Eleganz aus.
Hotels wie das Fairmont Le Montreux Palace sind nicht mit anderen Hotels vergleichbar. Sie erinnern an das Ritz-Carlton in Montreal oder das George V in Paris, während ihnen zugleich etwas Abgehalftertes eines Peace Hotels in Shanghai bei gleichzeitiger Pracht eines Raffles in Singapur anhaftet. Es ist eines dieser gewissen Hotels, das man im Leopardenfell-Anzug und roten Cowboystiefeln, mit einem Pinguin unterm Arm und drei Nutten in Rot, Blond und Schwarz im Schlepptau betreten kann, ohne dass der Concierge auch nur mit der Augenbraue zuckt, sofern man das alles nonchalant und weltgewandt zu zelebrieren weiß. Es ist eines jener Hotels, dem man schon von außen ansieht, dass es die Geschichten derer, die hier über Jahrhunderte gewohnt haben, in sich aufgenommen und zu seinen eigenen gemacht hat. Zu diesen Geschichten gehört auch die von Leonard Cohen, der nach 1976, 1985 und 1993 im Jahr 2008 bereits zum vierten Mal hier residierte.
Ich genoss die Atmosphäre und schritt den roten schweren Teppichboden auf den weißen Marmorstufen ins erste Obergeschoss hinauf in Richtung Rezeption. Warum und wozu, hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht zu sagen gewusst. Weder war ich verabredet, noch residierte ich in dieser Luxusherberge. Mit den ersten Stufen, die ich aufstieg, glitt meine linke Hand über das glänzende Holz des Geländers. Wie viele und vor allem wessen Hände haben dieses Holz nicht alle gefühlt? Einige Stufen weiter oben konnte ich diese Frage zum Teil schon beantworten. Leonard Cohens Hände waren es ganz bestimmt, stand der doch immerhin auf der obersten Stufe und schaute mir entgegen. Mir blieb das Herz stehen, und ich vergewisserte mich mit einem zweiten Blick, dass der Mann im eleganten, wenn auch nicht ganz zeitgemäß wirkenden schwarzen Zweireiher, mit schwarzen Schuhen, grauem Hemd und einem Fedora-Hut tatsächlich Leonard Cohen war.
Automatisch ging ich die Treppenstufen freundlich lächelnd weiter hinauf und auf ihn zu. Tausendundein Gedanke schossen mir gleichzeitig durch den Kopf. Kennt er mich (noch), oder kennt er mich nicht (mehr)? Weiß er von meinen tausendundeiner Interviewanfragen? Und vor allem: Was werde ich sagen, wenn er Kenntnis davon hat? Frage ich ein tausendundzweites Mal? Frage ich ihn direkt? Frage ich gar nichts? Gehe ich gar wortlos an ihm vorüber? – Um Gottes willen, letzteres will ich auf gar keinen Fall, schoss es mir noch gerade so durch den Kopf. Dann befand ich mich auf gleicher Höhe sowohl mit Fedora-Hut als auch mit Leonard Cohen.
»Hello, Christof, it’s good to see you again. How are you?« – Ich war überwältigt. »Hello, Leonard, good to see you. Hope you’re well. You’re looking great.« Die Frage nach der Erinnerung an meine Person war beantwortet, ein warmer Händedruck des 73-jährigen Rockpoeten unterstrich ein herzliches Wiedersehensritual. Was ich hier tue, seit wann ich hier sei, wie lange ich bliebe und ob ich auch hier im Grande Palace wohne, fragte er höflich, ohne neugierig zu wirken. Dann nahm er mich wie zum Schutz zur Seite, weil vorbeiströmende Gäste die Treppe hinuntergehen wollten, und meinte, wenn ich länger bliebe, würde man sich noch öfter sehen, und entschuldigte sich für den Moment, da er nur warte, bis man ihn abhole. Als er schließlich Roscoe Beck, seinen musikalischen Leiter und Tourbassisten, und Sharon Robinson, Co-Produzentin und Sängerin seiner Band, im Foyer des Erdgeschosses ausmachte, verabschiedete er sich und schritt die Stufen, die ich ein paar Minuten zuvor erklommen hatte, elegant mit einer Hand in der rechten Hosentasche hinunter, während er zuvor noch kurz den Fedora zum Gruße lüftete.
Mein Gespräch hatte unerwartet stattgefunden, und die Frage nach meinem Aufenthaltsort wollte ich plötzlich schnell beantwortet haben und fragte nach einem Zimmer im Hotel. Fünf Minuten später begleitete mich ein Page mit dem Aufzug ins nächste Stockwerk, über einen endlos lang wirkenden Flur, vorbei an zwei attraktiven Zimmermädchen bis aufs Zimmer Nr. 123. Ich reichte dem Pagen ein Trinkgeld und schloss hinter ihm die Tür. Auf dem Sideboard entdeckte ich ein Willkommensschreiben »Au nom de la Municipal de Montreux« adressiert an das »Member of the Leonard Cohen Band«. Ich war ein wenig irritiert, glücklich und überrascht zugleich, erinnerte mich jedoch der Aussage des Rezeptionisten, der meinte, während des Festivals sei das Hotel ausschließlich für Künstler und VIPs reserviert, und nur bei kurzfristigen Stornierungen seien noch Zimmer zu haben, womit klar war, warum ich noch ein Zimmer und ausgerechnet dieses bekommen habe: Cohens Tourmanagement hatte offensichtlich ein Zimmer mehr gebucht als nötig.
Mein Gespräch, mein Interview hatte ich bereits gehabt – auch ohne Aufnahmegerät, offizielle Bestätigung und Foto- oder Filmkamera. Die ganze Zeit über war es genau das, was nicht zustande kam oder kommen sollte, und der Musiker selbst wusste von alldem scheinbar nichts. Offizielle Interviews hatte er zum damaligen Zeitpunkt weltweit keine gegeben. Erst ab Herbst 2008 und bis ins Frühjahr 2009 hinein erschienen einige wenige. Eines dieser Gespräche war das von Brian D. Johnson mit Leonard Cohen, das u. a. in der deutschen Ausgabe des Rolling Stone im Oktober wie auch in der englischen Dezember-Nummer von Uncut erschien. Im Februar 2009 sprachen die New York Times anlässlich Cohens US-Konzerttour 2009 und The Global and Mail in Toronto mit dem »Titan der Worte«. Im März durfte dann die CBS noch einmal in Cohens Haus in Montreal mit ihm sprechen und drehen. Aber alle Gespräche, mit Ausnahme der jeweiligen Einstiege, Intros oder Prologe offerieren Ähnliches, teils bereits Bekanntes und bisweilen Identisches. Sie alle kommen auf Cohens jahrelange Bühnenabstinenz, seine Zen-Studien, sein Gesamtwerk zu sprechen, machen seine Frauen, seine Religion und seine Stimme zum Thema und zitieren nicht selten bereits Gesagtes und unzählig Wiederholtes.
Mit diesem Gedanken begab ich mich abermals in die Hotelhalle, an den Ort jener Szene, die mich an den Film I am a Hotel aus dem Jahr 1983 erinnerte. I am a Hotel ist ein 30-minütiger Kurzfilm, für den Cohen einen Filmpreis, die Goldene Rose von Montreux, verliehen bekam. Neben seinen Liedern spielte er auch selbst eine zentrale Rolle – die eines Geistes in einem altehrwürdigen luxuriösen Hotel. In der Lobby angekommen, stand er wieder da, oder noch immer: der Geist mit dem Fedora-Hut im Gespräch mit Sharon Robinson. Cohen nickte mir zu und erklärte, er sei zu einem Essen mit Claude Nobs eingeladen, auf den er noch immer wartete. Das Interview, das nie stattgefunden hat, erfuhr seine Fortsetzung:
Hast du diesen Hut eigentlich schon immer getragen?
Den Fedora trage ich schon lange. Diesen z. B. habe ich in einem Hutgeschäft erstanden, in der Straße, in der meine Tochter ihren Antiquitätenladen betreibt. Nur unmittelbar nach dem 11. September 2001 tauschte ich ihn kurzzeitig gegen eine gewöhnliche Mütze. Direkt nach dem Anschlag fühlte ich mich mit einem solchen Hut etwas overdressed.
Besitzt du dein Haus in Montreal noch? Oder lebst du nur noch in Los Angeles?
Hin und wieder besuche ich Montreal noch. Meine Kinder sind dort aufgewachsen, mein Enkelkind kommt oft dorthin. Ein Haus in Montreal zu haben bedeutet, ihm eine Menge Zuwendung und Pflege zukommen zu lassen. Es frieren sehr leicht die Rohre ein. Manchmal denke ich, ich bin nicht lange genug dort, um zu rechtfertigen, dass ich dieses Haus behalte. Aber das geht schnell wieder vorbei, wenn ich vor Ort bin.
Wie geht’s auf der Tournee?
Es ist ziemlich schwierig, einem alten Hund neue Tricks beizubringen. Ich bin sehr dankbar. Auch für die tollen Musiker, die mit von der Partie sind, ein gastfreundliches Publikum. Es gibt immer Komponenten, die man nicht in der Hand hat.
Welche Komponenten sind das?
Eine Art Gnade, Glück, eine Art Geist, der über dem Ganzen liegen muss. Es sind Dinge, die man benötigt, aber nicht beeinflussen kann. Der Geist muss einfach da sein. Es ist tatsächlich dieser mysteriöse Geist, auf den du keinen Einfluss hast und der dann für einen unvergesslichen Abend sorgt. Bisher hatten wir oft diese Gnade, einen solchen Abend zu erleben. Ich bin einfach glücklich, dass es so gut läuft. Man weiß nie, was passieren wird. Ob man in der Lage sein wird, die Person zu sein, die man gern wäre, und ob das Publikum freundlich ist zu dir. Es gibt so viele Unbekannte in diesem Spiel, selbst wenn es gut läuft …
Dann erscheint Claude Nobs und holt Cohen mitsamt Freunden ab. Zurück auf meinem Zimmer checke ich meine E-Mails und lese auch die von Leonards neuem Manager. Mich überfiel das Gefühl einer milden Genugtuung. Entspannt verließ ich das Hotel, ging hinunter zum See und schlenderte bis zu später Stunde durch die Festivalszenerie und freute mich auf das Konzert am darauffolgenden Abend. Den jetzigen ließ ich bei meiner Rückkehr in einem herrlich gemütlichen Sessel in der Lobby ausklingen. Im gegenüberliegenden »Salon De Bridge« saß ein Mann. Ein Mann mit Fedora-Hut.
Wo stehst du derzeit im Leben? Ist diese Tournee der finale Akt deiner Karriere, wenn ich das mal so fragen darf? Bei unserem letzten Gespräch im Jahr 2001 in Berlin hast du Tennessee Williams anlässlich dieser Frage zitiert und gesagt: ›Das Leben ist ein ziemlich gut geschriebenes Stück, bis auf den dritten Akt.‹
Der Beginn des dritten Aktes ist noch sehr gut geschrieben. Aber das Ende ist ungewiss. Wenn der Held stirbt, was natürlich bedeutet, dass man sich selbst als die zentrale Figur des Dramas sieht, kann die Story sehr kompliziert werden. Mein Freund Irving Layton sagte über den Tod: ›Ich bin nicht besorgt über den Tod, sondern vielmehr über das Vorspiel.
Und bist du selbst besorgt?
Ja klar, so wie jeder.
Hast du Angst?
Ach, weißt du, ich habe eigentlich immer irgendwie vor etwas Angst. Das Lebenskonzept, Angst zu haben, passt zu mir. Schon immer. Der Begriff Karriere ist übrigens unzulänglich. Er beschreibt viel eher die Bescheidenheit dessen, was wirklich war. Damals druckten wir unsere eigenen Auflagen, und wenn wir 200 Bücher verkauften, war das schon ein Bestseller. Es war mehr eine Art Berufung, weniger eine Karriere. Irgendwann aber musste ich mir überlegen, wovon ich leben sollte und konnte. Ich hatte zwar einige Romane geschrieben, die auch ganz gut ankamen, aber summa summarum habe ich damals vielleicht insgesamt nicht mehr als 3000 Exemplare verkauft. Mehr nicht. Ich musste also wirklich etwas tun. Und das Einzige, was ich wirklich konnte, war Gitarre spielen. Also machte ich mich auf nach Nashville. Ich liebe Countrymusik. Und ich dachte, ich könnte dort vielleicht einen Job bekommen und Gitarre spielen. Vorher war ich lange Zeit in Griechenland gewesen und hatte nicht mitbekommen, was in der Musikszene passiert war, zum Beispiel in New York. Ich hatte die Renaissance der Folkmusik nicht mitbekommen – Judy Collins, Joan Baez, Bob Dylan. Alles tolle Künstler. Aber seinerzeit hatte ich noch nie von ihnen gehört. Ich hatte auch schon Lieder geschrieben, aber nie hätte ich gedacht, dass es einen Markt dafür gibt.
Und wie empfindest du diesen Markt heute?
Ich hatte von mir immer die Vorstellung, als gäbe es einen kleinen Garten zu kultivieren. Nie hätte ich gedacht, ich könnte einer der ganz Großen werden. Das hatte entscheidend damit zu tun, sich selbst zu erforschen, ohne sich in sich selbst zu verlieren. Ich mag dieses In-sich-gehen eigentlich nicht so gern, dabei meine ich die Stimmung, die damit häufig beschrieben wird. Das Zeugnis, das man selbst ablegen kann, muss durch Tradition und harte Arbeit gefiltert werden, das kann interessant sein. Das meine ich mit dem Bild vom kleinen Garten. Also begann ich über Dinge zu schreiben, von denen ich glaubte, dass ich etwas über sie weiß, oder von denen, über die ich gern etwas mehr wissen wollte. So fing alles an. Ich war sehr von Musik beeinflusst, die Frauenstimmen im Hintergrund einsetzte, der Musik der 50 er-Jahre. Das war die Musik, die ich kannte. Und das war auch die Art von Musik, die ich machen wollte. Zudem klang meine Stimme allein auch nicht gut genug. Ich wollte meine Musik, meine Lieder einfach etwas mildern, versüßen, mit Frauenstimmen verschönern.
Eine solche riss die Gedanken unvermittelt auseinander, und das Gespräch wurde beendet. Wir verabschiedeten uns. Danach schrieb ich noch einmal an Robert Kory, um vielleicht doch eine offizielle Gesprächslizenz zu erhalten.
Auf der »Terrasse du Petit Palais et La Coupole« wurde das Frühstücksbuffet aufgebaut. Gegen Mittag erschien Sharon Robinson dort, ich traf einige befreundete Journalisten vom französischen Sender TVMonde5. Und die erzählten mir, dass sie gleich ein Interview mit Sharon Robinson hätten, viel lieber aber mit Leonard Cohen sprächen, dieser aber keine Interviews gebe. Ich fragte, ob ich dabei sein dürfe und vielleicht ein paar Fotos machen könne. Das sei kein Problem, sofern es Sharon und die Aufnahme nicht störe, bekam ich zur Antwort. Mit Blick auf den See, direkt neben der Pianobar, etwa sechseinhalb Stunden vor dem Konzert begann um 13.30 Uhr das Gespräch. »No Interviews with Leonard« hieß es noch einmal seitens der PR-Frau des Festivals. »Leonards Stimme soll geschont werden. Leonard soll sich (nur) auf seine Konzerte konzentrieren. Es gibt erstmals einen geschlossenen Backstagebereich. Keine Gäste vor, keine Gäste nach dem Konzert. Leonard empfängt niemanden.« Immerhin durfte die Presse aber mit Sharon Robinson sprechen.
Die schrieb für Cohen die Musik seines Comeback-Albums Ten New Songs (2001), Teile von Dear Heather (2004) und war an Cohen-Klassikern wie »Everybody Knows« beteiligt.
Eine Stunde später, nachdem alle Journalisten gegangen waren, erblickte ich wieder einmal den Fedora-Hut in der Lobby. Ich dachte nur, mein Gott, wenn es wieder Leonard Cohen ist, müsste er sich aber bald zum Soundcheck für den abendlichen Auftritt im Auditorium Stravinski aufmachen, der für 16 Uhr angesetzt war. Zeit für einen Gedankenaustausch blieb aber dennoch.
Ist Sharon Robinson – wie so viele Frauen – eine Quelle der Stärke oder doch eher eine Quelle der Schwäche?
Ach, das ist die eine Frage von Waffengleichheit. Einer ist immer der Stärkere. Der Umgang mit Frauen kann mitunter die herausragende Interaktion bilden, in die menschliche Wesen geraten können: Liebe. Wir haben das Gefühl, ohne Liebe nicht leben zu können. Ohne Liebe hat das Leben ziemlich wenig Bedeutung. Also werden wir in diese Arena geladen, wenngleich sie höchst gefährlich ist. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, etwas falsch zu machen, gedemütigt zu werden. Hier gibt es keine festen Lektionen, die man lernen könnte, um sich darauf vorzubereiten. Das Herz öffnet sich schließlich immer wieder. Mal wird es härter, mal weicher. Wir erleben sowohl Freude als auch Traurigkeit. Aber so etwas wie ein Jackpot existiert nicht. Nach einer gewissen Zeit ist die Zahl der Niederlagen, die man erlebt hat, recht groß, bemerkenswert groß, und die, die trotz der Niederlagen fähig sind, in dauerhaften Beziehungen zu leben, sind die wirklich Glücklichen. Manche verschließen sich auch für immer. Zu bestimmten Zeiten muss man sich auch verschließen, um sich neu zu ordnen.
Hast du es je bereut, dass Frauen so viel Macht über dich hatten?
So habe ich das nie gesehen. Ich habe es immer als sehr beglückend empfunden, und manchmal war mir dieser Umstand ehrlich gesagt auch egal. Man durchläuft ganze Kreisläufe von Erfahrungen. Die meisten Menschen haben eine Frau oder einen Mann im Herzen. Und es gibt ein paar, die haben niemanden, die kennen das Gefühl nicht. Eine Vielzahl aber ergibt sich einer Emotion oder einem Menschen.
Hast du jemals das Gefühl gehabt, bereuen zu müssen, keine lebenslange Beziehung eingegangen zu sein?
Ich lese mein Leben nicht wie eine Geschichte, die geschrieben wurde und die ich nun im Nachhinein lese. Ich bin kein sentimentaler Mensch. Nein, ich bereue nichts, lasse mein Leben nicht ständig Revue passieren. Vielleicht weil ich mit einem gesunden Maß an Amnesiefähigkeit gesegnet bin. Ich bin froh, mich hin und wieder in diesem Zustand zu befinden. Bisweilen vergesse einige Teile meines Lebens wieder, an manche erinnere ich mich einfach nicht mehr. Natürlich ist alles sehr tief in mir eingegraben. Und von dort wird es auch irgendwann wieder hervorkommen, wenn es notwendig ist, aber ich lebe mein Leben nicht dauernd noch einmal.
Du hast oft über Depressionen mit klinischen Merkmalen gesprochen. Waren Depressionen ein wichtiger Bestandteil deiner Kreativität?
Depressionen waren seit jeher ein bedingendes Element in jedem Prozess meines Lebens, waren zentrale Aktivität. Die zentrale Aktivität meiner Tage und Nächte bestand darin, mich mit Depressionen und Angst und Traurigkeit auseinanderzusetzen. Angst, Ärger, Wut – all diese Gefühle bestimmten mein Leben. Mittlerweile habe ich die Depressionen im Griff. Der Körper fängt irgendwann an, Nachrichten zu schicken. Ich weiß nicht, ob es eine Art des Nachdenkens ist, es kommt immer darauf an, in welcher Situation du dich gerade befindest. Mal hier ein kleiner Schmerz, mal da ein anderer Hinweis. Das erinnert einen daran, dass das hier nicht ewig sein wird. Ich denke nicht viel darüber nach. Mein Freund Irving Layton, den ich gestern schon erwähnt habe, hat darüber sehr viel geschrieben. Wenn ich sein Werk heute lese, denke ich, er hat erreicht, was er erreichen wollte. Er ist zu einem deutlich erweiterten Leben gelangt. Oft hat er darüber nachgedacht, ich hingegen nie. Ich weiß, dass ich sterben werde. Man kann sich darauf nicht vorbereiten wie auf andere Dinge, und dennoch gibt es immerhin diese gewisse Art von freiem Willen. Es ist sicher besser, sich darauf vorzubereiten. Wie das letztendlich aussieht, lässt sich jedoch nicht vorhersagen. Doch schließlich verfügen wir über sehr viele Methoden spiritueller Art, sich auf das Ende vorzubereiten. Darauf kann man sich einlassen, man kann sich daran orientieren. Die Methoden, die einem zusagen, kann man annehmen. Selbstverständlich kann es keine Garantie geben, dass es funktioniert. Niemand weiß, was im nächsten Moment passieren wird. Die Angst vor den Bedingungen deines Ablebens, wie viel Schmerz du haben wirst, was der Tod aus denen macht, die du zurücklassen wirst, ist größer. Aber man kann nicht viel beeinflussen. So ist es doch das Beste, diese Besorgnisse in Teile des Bewusstseins zu verdrängen, wo sie hingehören und von wo sie nicht die eigentlichen Aktivitäten, mit denen man sich sonst beschäftigt, zersetzen können. Wir müssen unser Leben leben, als ob es nicht zu ändern wäre, als ob es nicht jederzeit zu Ende sein könnte. Wir müssen uns bestimmten Illusionen hingeben.
Wie wichtig war es eigentlich, finanziell noch einmal auf die Beine zu kommen?
Ja, eine Frage des finanziellen Überlebens hat es auch gegeben. Ich musste ein Einkommen haben. Also habe ich etwas in Bewegung gesetzt und war froh, überhaupt in der Lage gewesen zu sein, etwas zuwege bringen zu können. Zu meinem großen Glück hat es sich gelohnt.
Ist diese Welttournee nun schon dein dritter Akt?
Vielleicht stellt sie den Anfang des dritten Akts dar. Vor ein paar Jahren habe ich ein Konzert von der damals 82-jährigen Alberta Hunter gesehen und gedacht, wie es wohl sein würde, wenn ich im Alter von 82 Jahren auf der Bühne stünde. Bis heute kann ich mich an diesem Gedanken erfreuen.
Gibt es womöglich noch einen vierten Akt?
Das überlassen wir besser den Theologen. Ich fürchte mich vor dem Tod ein- bis zweimal im Jahr. Dann bekomme ich die totale Panik, und mir wird klar, dass ich unaufhaltsam dem Tod entgegengehe. Damit kann ich nicht umgehen. Wenn mir jemand garantieren könnte, dass das Vorspiel nicht so unangenehm wird, dann könnte ich mich sogar darauf freuen.
Dann bricht Leonard Cohen auf, durchschreitet im Anzug und mit Fedora die Lobby, verlässt den Eingangsbereich des Hotels und läuft die paar Meter in Richtung Backstagebereich des Stravinski Auditoriums. Bevor er durch den Hintereingang tritt, gibt er einigen Fans geduldig Autogramme. Kurze Zeit später hört man die Band »Dance Me To The End Of Love« proben.
Als ich am Morgen nach dem Konzert die »Brasserie du Palace« betrat, um zu frühstücken, saß die gesamte Band um einen großen Tisch und tat selbiges. Cohen trug an diesem Morgen den schwarzen Anzug, nicht aber das graue, sondern ein weißes Hemd mit schwarzer Krawatte. An diesem Morgen wirkte er auf mich sehr privat. Einer jungen Künstlerin, die ihm ihre Werke zeigte, signierte er einige Devotionalien, die sie ihm zur Unterschrift vorlegte. Ich nickte ihm an diesem Morgen nur zu, als sich unsere Blicke kreuzten, wünschte »Guten Morgen«, und er nickte und grüßte lächelnd zurück. Man spürte die Aufbruchstimmung. Die Band bemächtigte sich dann bald der bereits gepackten Taschen und machte sich mit ihrem »Field Commander« auf. Der Nightliner, der die Crew nach Lyon bringen sollte, wo man am Abend das nächste Konzert geben würde, wartete schon mit laufendem Motor. Leonard Cohen setzte sich den Fedora auf.
Prof. Dr. Christof Graf,
Montreux, im Juli 2008
I. Akt Kindheit, Jugend und erste literarische Gehversuche
Der Tag vor dem Sabbat ist für Juden von besonderer Bedeutung. Kinder, die an einem Freitag geboren werden, erfahren eine besondere Aufmerksamkeit. Der Geburtstag von Leonard Cohen, der am 21. September 1934 im kanadischen Montreal das Licht der Welt erblickte, fiel auf einen Freitag. Cohen selbst war zwar nie eine solche Frömmigkeit eigen, wie es vielleicht im Sinne seines »wohlbehüteten jüdischen Elternhauses mit Traditionspflege« gewesen wäre; dennoch hat nicht allein das Gedankengut seiner Väter sein Denken und Wirken wesentlich geprägt, sondern auch die Bedeutung seines Familiennamens, der mit »Priester« zu übersetzen ist. In der Geschichte der Juden spielt der Name Cohen eine wichtige Rolle, weil er einen der Stämme Israels bezeichnet und zwar den Priesterstamm.
»Mir ist oft bewusst geworden, wie sehr sich meine Familie um ihre Traditionen kümmerte. Sie war sich darüber im Klaren, dass sie aufgrund ihres Namens etwas zu repräsentieren hatte. Meine Familie nahm die Bedeutung des Namens ›Cohen‹ sehr ernst und lebte in dem Bewusstsein, einer Kaste von Priestern anzugehören. Von meiner Familie weiß ich, dass sie für die Bestimmung lebte, Verantwortung für die Gemeinschaft zu tragen. Sie gründete Synagogen, Krankenhäuser und Zeitungen. Mit diesem Gedankenerbe wuchs ich auf.«
Die Wurzeln des kanadischen Stammbaums der Familie Leonard Cohens lassen sich bis ins Jahr 1869 zurückverfolgen. Damals wanderten die Vorfahren von Leonards Vater, Nathan Bernhard Cohen (geboren 1887), aus einem Teil Polens, der heute zu Russland gehört, nach Nordamerika aus. Die Familie von Leonards Mutter, Masha Klinitsky-Klein (geboren 1907), emigrierte in den 20er-Jahren aus Litauen.
Aus Leonard Cohens Erinnerungen ergibt sich ein recht konservatives Bild seiner Familie. »Als ich noch nicht bekannt war, mokierte sich meine Familie darüber, dass ich Schriftsteller werden wollte. Aber da mein Vater starb, als ich neun Jahre alt war, gab es niemanden, der mir in meinem Bestreben ernsthaft widersprechen konnte. Heute, glaube ich, wären mein Vater und ich uns sehr nahe. Früher hätte er Schwierigkeiten damit gehabt, mich mit der Gitarre in irgendwelchen Clubs zu sehen.«
Leonards Vater war tatsächlich stark in der Tradition verwurzelt. Leonards Urgroßvater Lazarus war Lehrer an der Rabbiner-Schule in der einstigen europäischen Heimat, und dessen Bruder Hirsch hatte es gar zum Oberrabbiner der jüdischen Gemeinde in Kanada gebracht. Zwar hatten beide – ebenso wie später Leonards Großvater Lyon, der von Beruf Kaufmann war – auch schriftstellerische Ambitionen, doch dominierte bei den Cohens stets die Pflege der Tradition. Im Kern hieß das: Der Erhalt des gesellschaftlichen und geschäftlichen Status quo stand im Vordergrund. »L. Cohen und Sohn« wurde auf diese Weise bald zu einem Markenzeichen, das für die Entwicklung von der Textilkaufmanns- zur Textilgroßhändler-Familie stand, die bei allen hohes Ansehen genoss.
Mit Achtung spricht Leonard Cohen auch heute noch von seinem Vater, der bemüht war, dem Sohn seine eigenen Wertvorstellungen zu vermitteln und ihm eine Ausbildung im edwardianischen Stil angedeihen zu lassen. Allerdings stammt das meiste, was Leonard über seinen Vater weiß, aus Erzählungen seiner vier Jahre älteren Schwester Esther und seiner Mutter, die den Vater, der in Leonards Kindheitsjahren häufig krank war, zu Hause gepflegt hatte: »Mein Vater war oft im Krankenhaus. Sein Tod kam nicht überraschend. Er war schwach und starb. Vielleicht habe ich ein kaltes Herz, wenn ich sage, dass ich geweint habe, als mein Hund starb, beim Tod meines Vaters jedoch irgendwie das Gefühl hatte, das müsste so sein.
Die große Leidenschaft meines Vaters war das Filmen. In seiner Freizeit hielt er mit seiner Kamera das Familienleben fest und schnitt die Filme selbst zusammen, um sie regelmäßig vorzuführen. Nachdem er gestorben war, fand ich die Filme in einem Kellerschrank meines Elternhauses. So erfuhr ich vieles, was man sonst eigentlich vergisst und aufgrund von Erzählungen nicht so bildhaft wahrnimmt«, erinnerte sich Leonard Cohen später in der von D. Brittain und Don Owen 1964 gedrehten und 1965 vom National Film Board of Canada veröffentlichten Dokumentation Ladies and Gentlemen … Mr. Leonard Cohen.
Cohens charismatische Erscheinung, auf der Bühne wie auch privat, scheint auf eine Veranlagung in der Familie zurückzugehen. Seinen Vater, der Mitglied der Royal Canadian Legion war und im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte, beschreibt er als einen äußerst korrekten, stolzen und pflichtbewussten Mann. »Ich habe nicht viele Erinnerungen an meinen Vater. Aber ich entsinne mich noch sehr gut seines Stils – seiner Art, sich zu kleiden, wenn er mit meiner Mutter zu gesellschaftlichen Anlässen ging oder offiziellen Einladungen folgte. Dann trug er Monokel, militärische Ehrenabzeichen und Gamaschen und achtete darauf, dass alles elegant saß.« Zugleich beschreibt Cohen seinen Vater als einen warmherzigen Mann. Und immer wieder betont der Musiker die Souveränität und Belesenheit seines Vaters: »Als er noch gesund war, las er meiner Schwester und mir am Abend oft aus Büchern vor. Mein Vater war immer gut angezogen. Und daher war ich es gewohnt, auch gut angezogen zu sein. Ich bin mit Anzügen groß geworden. Den Jeans habe ich auch einmal eine Chance gegeben, aber ich habe mich darin nie wohl gefühlt. Irgendwann habe ich akzeptiert, dass ich mich im Anzug am behaglichsten fühle.« Viel mehr will das Erinnerungsvermögen Leonard Cohens nicht her- oder er selbst nicht preisgeben. Spricht man ihn auf vergangene Tage an, verweist er gern auf seine »Amnesie« – vielleicht die beste Strategie, den immer wiederkehrenden Fragen der Journalisten zu begegnen.
»Ich bin wirklich sehr glücklich darüber, dass es einiges in meinem Leben gibt, an das ich mich heute nicht mehr erinnern kann. Zum Beispiel erinnere ich mich noch sehr gut an die Arbeit an den Alben, die ich in den 80er-Jahren veröffentlicht habe. Aber von gewissen Dingen in meinem Leben davor weiß ich nichts mehr. Meine Erinnerung ist weg.«
In einem Interview mit Christian Fevret aus dem Jahr 1991 äußerte Leonard Cohen sich über den Verlust seiner Erinnerungen, er spüre »weder ihr Gewicht noch ihren Reichtum. Ich erinnere mich zwar noch daran, wie damals die Sonne auf- und unterging, aber in der Vergangenheit lebe ich einfach nicht mehr«, beschrieb er später sein Verhältnis zur Vergangenheit. »Heute denke ich kaum noch an meine Kindheit und glaube nicht, dass sie zur Erklärung meines Lebens herangezogen werden kann.« Damit erstickte der mittlerweile über 75-jährige Cohen sämtliche Versuche, den Sozialisationsprozess eines heranwachsenden Kindes zur späteren Persönlichkeitsanalyse heranzuziehen.
Seine Lebensauffassung lautet: »Man muss wiedergeboren werden, um zu überleben. Bei dieser Auffassung geht es mir um die Überwindung jeglicher Sozialisationsfaktoren, die ebenso in vorteilhaften wie in nachteiligen Situationen Wirkung zeigen können.« Fevret gegenüber beschrieb er dies in den 90ern mit den Worten: »Man kann sich seiner Vergangenheit nicht als Alibi bedienen. Im Orient nennt man das ›Aufwachen‹, im Okzident ist es das ›Wiedergeborenwerden‹.« Dem Terminus der »Vergangenheit« begegnet Cohen grundsätzlich skeptisch. »Den Begriff Vergangenheit benutze ich äußerst ungern, weil ich das Gefühl habe, keine Vergangenheit zu besitzen. Seit Mitte der 80er-Jahre beziehe ich mich nicht mehr auf Vergangenes und denke auch nicht darüber nach.« Äußerungen, die sich, selbst wenn man auf das spekulative Moment der Interpretation verzichtet, in Cohens musikalischen und literarischen Werken widerspiegeln. »Ich finde die Gespräche über meine Vergangenheit zuweilen sehr interessant, weil ich mir dann vorkomme, als müsste ich über etwas sprechen, von dem ich gar nicht mehr viel weiß.«
Der frühe Tod des Vaters im Januar 1944 war für den jungen Leonard prägend. Für seine Kunst wurde er zum Bezugspunkt, für sein Leben Grund zur Suche nach einem Vorbild und Lehrer, wie er ihn später zunächst in der Person Roshis, dem japanischen Zen-Meister, und dann in der Person Ramesh Balsekars, einem indischen Guru, fand. Der Tag der Beerdigung von Cohens Vater fiel zusammen mit dem Geburtstag von Cohens Schwester Esther, der er an diesem Tag außerordentlich nahekam. An diesem Tag vergrub Leonard eine Frackschleife seines Vaters im Garten der Eltern – seine private Trauerfeier. Ein Ritual, das er immer wieder erwähnt, wenn es um Erinnerungen an seine Kindheit geht. Ein Ritual, das mehr als nur symbolische Kraft hat. Als er die Schleife viel später wieder ausgraben wollte, fand er sie nicht mehr. »Manchmal verbinde ich das Graben mit dem Suchen nach den geeigneten Worten dafür, was ich auszudrücken versuche. Die ersten Zeilen, die ich für bedeutsam hielt, dichtete ich, als mein Vater starb«, beschreibt er die Szene mit der Schleife auch in Lian Lunsons Film I’m Your Man aus dem Jahr 2005: »Das war die einzige Art, wie ich mit dieser Begebenheit umgehen konnte, das so geheimnisvoll und seltsamerweise nicht so niederschmetternd war. Der Tod meines Vaters schien irgendwie in Ordnung zu sein. Er schien Teil von Ereignissen zu sein, die sich nicht aufhalten, ablehnen oder beurteilen ließen. Wahrscheinlich war es eine Art von Gebet, das ihn begleiten sollte, durch welche Welten auch immer.«
Durch den frühen Todes seines Vaters entwickelten Leonard und seine Mutter ein sehr vertrautes Verhältnis. Masha Cohen, 19 Jahre jünger als ihr Gatte und ausgebildete Krankenpflegerin, ließ ihren beiden Kindern viele Freiheiten und erzog sie dennoch im Sinne ihres eigenen jüdischen Glaubens, der von einer römisch-katholischen Religionsauffassung beeinflusst war. Vermutlich wurde schon zu dieser Zeit der Grundstein dafür gelegt, dass Leonard Cohen sich später eingehend mit den Mythologien der verschiedenen Religionen befasste. Auch die Zweisprachigkeit Montreals wirkte sich auf den Künstler aus. Sie erlaubte ihm den Zugang gleichermaßen zur französischen wie englischen Literatur. Hinzu kam sein Studium der Heiligen Schrift in hebräischer Sprache, das er begann, als er im Alter von sechs Jahren lesen lernte.
Doch zunächst stand er unter dem Einfluss der alleinerziehenden Mutter, die mit 36 Jahren ihren Mann verlor und Jahre später eine zweite, eher unglückliche Ehe einging. An seine Mutter erinnert sich Cohen auf eine andere Art und Weise als an seinen Vater. Mit dem Gedanken an sie verbindet er nicht einzelne Ereignisse, sondern das Bild einer herzlichen Frau, der es nach dem Tod des Gatten nur darum ging, ihren Kindern den rechten Weg zu weisen.
Will man sich mit Leonard Cohen auseinandersetzen, benötigt man ähnlich große Geduld, wie er sie damals wohl beim Anhören der Geschichten seiner Mutter aufbringen musste. »Anfangs konnte ich ihren Gedankensprüngen nie folgen. Ich wurde ungeduldig und drängte zum Ende der Geschichte, noch bevor sie begonnen hatte. Als ich älter wurde, war ich von ihren Erzählungen fasziniert, weil sich diese einst so schwer verständlichen Geschichten auf einmal zu einem wunderbaren Ganzen fügten. Es wurde mir klar, was mir vorher nie eingeleuchtet hatte: Jeder erzählt seine Geschichte denen, die ihm nahestehen. Jeder hat seine Geschichte, und sie verändert sich von Tag zu Tag. Die Zeit verändert sie, wie Runzeln, die sich auf unserem Gesicht zeigen, wie unser Haar, das ergraut, und wie unseren Körper, der zu welken beginnt. Die Geschichte verändert sich und nimmt diese Merkmale auf. Erst dadurch wird sie interessant und zu unserer eigenen.«
Finanzielle Probleme hatte Cohens Mutter nicht, konnte sie im Notfall doch noch immer in ihrem erlernten Beruf arbeiten. Trotzdem bedeutete es für sie eine gewaltige Umstellung, die Rolle der Frau eines angesehenen Mannes gegen die seiner Witwe einzutauschen, zumal sie die Stellung einer »Cohen« nie innegehabt hatte. Diesbezügliche Bemerkungen der Verwandtschaft versuchte Masha Cohen von ihren Kindern fernzuhalten. Wie Leonard Cohen diese Empfindungen verarbeitet hat, lässt sich in seinem ersten Roman The Favourite Game und in seinem ersten Gedichtband Let Us Compare Mythologies nachlesen, in denen er mit der für ihn typischen Liebe zum Detail davon erzählt.
Was aber eine jüdische Erziehung ausmacht, ist nicht nur das Heim, das als kleiner Tempel angesehen wird, sondern auch und vor allem die Einführung der Kinder in die Religion des auserwählten Volks. Auch andere pädagogische Instanzen spielen eine Rolle. Neben der öffentlichen Roslyn School besuchte der junge Leonard auch die Hebrew School in Montreal, um die Lehren des Judentums kennenzulernen. Diese Einweisung findet ihren Abschluss mit dem wichtigsten Ereignis im Leben eines jeden Juden, der Bar-Mizwa, der in etwa der christlichen Konfirmation entsprechenden Feier der religiösen Mündigkeit, die jeder männliche Jude mit Vollendung des 13. Lebensjahres erreicht und die den Übergang vom Kind zum Mann bedeutet. Diese fand für Leonard 1947 kurz vor seiner Einschulung in die Westmount High School 1948 statt. »Die Lieder, alte russisch-jüdische Wiegenlieder, gesungen mit einer zarten, eindringlichen Stimme, die in meinem Kopf Bilder von Geborgenheit hervorriefen, habe ich noch heute im Ohr. Was mich noch im Nachhinein sehr beeindruckt, ist das Gefühl meiner Mutter für Rhythmus und Melodie und dass sie nach so vielen Jahren immer noch Lieder sang, die man ihr selbst als Kind vorgesungen hatte.«
Neben seiner Mutter spielte auch deren Vater, Rabbi Solomon Klinitsky-Klein, eine wichtige Rolle für den Sozialisationsprozess seines Enkels. Ihm und seiner Großmutter väterlicherseits, Mrs. Lyon Cohen, widmete Leonard seinen 1961 erschienenen Gedichtband The Spice-Box of Earth. Sein Großvater Solomon hingegen vermittelte dem jungen Leonard die nicht immer ohne Grausamkeit und Härte auskommenden Geschichten des Alten Testaments. Die Konfrontation mit den Bildern der Bibel, die Inhalt der Wiegenlieder seiner Mutter gewesen waren, verarbeitete Cohen in seinem Werk ebenso wie die äußere Realität, mit der er konfrontiert wurde, etwa den nach Kanada dringenden Berichten über die Leiden, die das Naziregime den Juden zugefügte hatte. »Als die ersten Berichte mit den schrecklichen Nachrichten über die Geschehnisse in Deutschland nach Kanada drangen, war ich etwa zehn Jahre alt und konnte also schon lesen. Ich war sehr erschüttert.«
1945, im Alter von elf Jahren, stieß Leonard in einer Zeitung auf Fotos von Konzentrationslagern; für ihn war es »der Moment, in dem meine wahre Erziehung begann«. Was ihn jedoch vollends erwachsen werden ließ, war seine eigene Geschichte, auf die er in dem Roman The Favourite Game anspielt, indem er dessen Hauptfigur Breavman auf die von einem naiven jungen Mädchen gestellte Frage, wie es sei, ohne Vater aufzuwachsen, antworten lässt: »Du wirst schneller erwachsen.« Später, als man Cohen als den großen Melancholiker und Mystiker der Beatgeneration bezeichnete, hatte er sich mit den Themen Trauer, Verlust und Tod bereits eingehend auseinandergesetzt, schließlich hatte er schon früh seinen Vater verloren. Und »Verlust ist die Mutter der Dichtung« gab er in diesem Roman preis. »All diese Gefühle bestimmten mein Leben. Es war nie ein Luxus zu schreiben, es war eine Notwendigkeit. Aber ich wollte nie irgendetwas schreiben, sondern etwas, das sich von dem unterschied, was andere schrieben. Ich wollte mich nicht auf Phrasen einlassen. Man muss einfach nur die Phrasen, die manchmal leicht herunterzuschreiben sind, weglassen, damit es gut wird. Man muss sich von all den Restriktionen trennen, die sich durch Themen, die Politik oder Geschlechter etc. ergeben. In diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, ist es sehr schwer zu schreiben. Sehr schwer, ohne Phrasen zu schreiben. Ohne die vielen Allgemeinplätze zu verwenden, die schon zu oft zu vielen bereits festgelegten Themen verwendet worden sind. Sie haben natürlich alle ihre Berechtigung. Aber Schreiben unter solchen Bedingungen ist schwierig. Die billigen Phrasen verstopfen den Kanal.
Es ist wie eine Tyrannei. Eine Tyrannei von vorgegebenen Haltungen. Eine Tyrannei, die einem vorschreibt, welche Haltung man einzunehmen hat. Diese Ideen überfluten uns geradezu, sind wie Heuschrecken in der Luft. Für einen Autor in der heutigen Zeit ist es sehr schwer, festzustellen, wo man steht, was man schreiben soll, welche Haltung die richtige ist. Ich muss meine Verse schreiben. Dann überprüfe ich zunächst, ob ich in ihnen nicht eine Phrase verwendet habe. Und wenn ich eine gefunden habe, muss ich sie wieder verwerfen. Doch werfe ich sie nicht weg, bevor ich nicht daran gearbeitet und herausgefunden habe, was ich eigentlich sagen, welche Haltung ich einnehmen wollte. Ich arbeite so lange an meinen Versen und verwerfe sie auch wieder, bis ich merke, dass ich nichts Phrasenartiges geschrieben habe. Manchmal bin ich vom Ergebnis selbst überrascht.«
Leonard Cohens Werk und Philosophie sind das Resultat einer ständigen Selbstbefragung. Stets ist er auf der Suche nach Helden, die er in Liedern und Gedichten zu beschreiben versucht. Helden wie in den biblischen Geschichten, die ihm seine Mutter Masha in seiner Kindheit vor dem Einschlafen erzählte? Gehörte damals etwa auch Gott zu seinen »Helden«?
»Von Gott hat man mir nicht viel erzählt, obwohl er in den Geschichten und Gebeten vorkam. Ernst zu nehmender war das, was sich hinter diesen Geschichten verbarg: Familie, Treue, Loyalität gegenüber der Vergangenheit, die diese Geschichten mit der Gegenwart verbinden. Damals waren das für mich sehr mystische Dinge.«
Aber auch den Mythologien der Menschheit galt seit jeher Cohens besonderes Interesse. Mythologien sind es, die für ihn neben seinen »Helden« Religiosität ausmachen, egal aus welcher Kultur sie kommen. »Wenn man unter einem religiösen Menschen jemanden versteht, der seine göttliche Herkunft ergründen will, dann bin ich zweifellos religiös«, gestand er in einem ausführlichen Gespräch über sein Judentum mit Ascher Ben-Shmuel und Ilan de Beer, das 1976 in der Süddeutschen Wochenzeitung erschien. »Insgesamt bin ich aber doch eher von der Sensitivität der Bibel beeinflusst, von ihrem prophetischen Gehalt, von den Propheten und vom Hohelied Salomos. Mich beeindrucken auch der lyrische Gehalt der Bibel und der Gerechtigkeitssinn, der sie auszeichnet. Im Grunde beeinflusst mich alles – ja, oft wirkt die Umwelt sogar zu stark auf mich ein.«
In vielen seiner Songtexte, zum Beispiel in »Who By Fire«, das an das Jom-Kippur-Gebet »mich bacharev, umi bamajim« erinnert, greift Cohen auf religiöse Motive zurück, was er jedoch nicht unbedingt als »typisch jüdisch« betrachtet wissen möchte. »Jede kulturelle Gemeinschaft beeinflusst das Schaffen ihrer Mitglieder. Als Jude bin ich mir eben nur dieser Tradition bewusst; sie ist das Einzige, das ich gelehrt wurde und das mich aus diesem Grunde geprägt hat. Ich weiß, dass ich Jude bin; ich weiß, woher ich stamme; aber ich bewege mich nicht ausschließlich in einem jüdischen Kontext.«
Vor einer Definition dessen, was es bedeutet, Jude zu sein, scheut Cohen bis heute zurück. »Ich gehe von der Tradition aus«, erklärte er de Beer. »Die Beschneidung ist für mich das Wesentliche, und zwar die Beschneidung des Gliedes und des Herzens – ich meine damit die wahre Herzensbildung. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht das Judentum Menschen, die eine eigene Weisheit und Erfahrung entwickelt haben und die innerhalb der Familie oder durch Erziehungseinrichtungen den Erfahrungsschatz des gesamten Volkes der nachfolgenden Generation vermitteln können. Wenn der Faden reißt und die jüdische Erziehung bloß oberflächlich ist und gerade noch zu der Erkenntnis führt, dass man Jude ist, so genügt das nicht. Der Faden muss an die Geschichte anknüpfen, und diese Erfahrung muss weitergegeben werden, so wie es die Haggada [hebräisch: Schriftdeutung, die jüdische Auslegung des Alten Testaments] vorschreibt: Du musst den Auszug selbst erleben. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind und dadurch jeder Generation von neuem dieses Erlebnis vermittelt wird, dann gelingt auch diese Herzensbildung. Selbst in kleineren Gemeinden, die ihre Erziehungsarbeit ernst nehmen, wird es möglich sein, Herzen zu beschneiden. Im Rahmen dieser Definition muss aber auch jenen die Tür geöffnet werden, die ihr Los mit den Juden zu teilen wünschen. Ich denke, Herzensbildung erfolgt durch spezifisch jüdisches Erleben, aber auch die, die außerhalb der jüdischen Gemeinde stehen, sich jedoch mit der jüdischen Tradition identifizieren möchten, können die Erfahrung machen.«
In vielem, was Leonard Cohen gesagt und geschrieben hat, lässt sich diese metaphysische Basis nachvollziehen. Cohen war nie ein geistiger Mitläufer, stets suchte er – in der Religion, in der Liebe und im Leben – seinen eigenen Weg und wurde so zum Vordenker einer ganzen Generation.
Leonard Cohens Lebensphilosophie ist also vom frühen Verlust des Vaters gleichermaßen geprägt wie von intensiver mütterlicher Liebe, von den Mythologien der jüdischen Religion ebenso wie von seinen eigenen grundsätzlichen Zweifeln bezüglich jeder Religion – ein Gedankengut, das er bereits als 14-Jähriger in Worte zu fassen und niederzuschreiben begann. Trotz seines Hangs zur geistigen Auseinandersetzung ging der junge Leonard den gleichen Freizeitbeschäftigungen nach wie seine gleichaltrigen Freunde. »Ich spielte Eishockey in der Schulmannschaft und fuhr gern Rad. Besonders interessierte ich mich für Boxen und Ringen.« Während seiner Zeit an der Westmount High School trieb er sehr viel Sport, arbeitete aber auch bei der Schülerzeitung und am Jahrbuch mit. In einem späteren Schuljahr, 1951, gab er sogar »Fotografie« als Hobby an. Und auch die Liebe zu seinem Hund Tinkie, der ihm eines Tages in einem Schneesturm weglief und nie zurückfand, wurde zu einer bedeutungsvollen Episode in seinem Leben. Danach schaffte er sich nie wieder einen Hund an, und noch heute steht in seinem Haus in Los Angeles ein Bild von Tinkie.
Zu dieser Zeit, Anfang der 50er-Jahre, erwachte gleichsam sein Interesse am weiblichen Geschlecht. »Während der Pubertät verbringt jeder Heranwachsende die meiste Zeit damit, sich zurechtzufinden. – Die ersten bedeutsamen Gedichte las ich in der Synagoge. Das waren biblische Geschichten, wovon ich Gänsehaut bekam. Eigentlich hatte ich in der damaligen Zeit ausschließlich Comics gelesen. Marvel-Comics: Superman, Spiderman und andere Superhelden. Damals dachte ich, dass ich so etwas auch schreiben könnte. Ich war mir sicher, selbst irgendetwas schreiben zu können. Zuerst verfasste ich Gedichte an Mädchen, um diese für meine Gedanken zu interessieren.« In The Favourite Game beschreibt Leonard Cohen das Empfinden der ersten sexuellen Gefühle mit den Worten: »Unsere Leidenschaften sind wie Reisende. Zuerst machen sie eine allumfassende Rundreise. Dann sind sie wie Gäste, die oft zu Besuch kommen. Schließlich werden sie zu Tyrannen, die uns beherrschen.«
Was Cohen in jener Zeit ebenfalls faszinierte, war die Hypnose. Zugang dazu fand er über den Vater einer Freundin. Bei ihm selbst funktionierte Hypnose nicht, dennoch besorgte er sich sofort ein Buch darüber – M. Young: 25 Lessons in Hypnotism. How to Become an Expert Operator, ein Buch aus dem Jahr 1899. Was bei ihm nicht anschlug, wandte er selbst zweimal erfolgreich an. Beim ersten Mal ließ er ein Hausmädchen strippen, das andere Mal drang er tief in die Psyche einer Betreuerin in einem Sommerferienlager vor. Er war schon früh von Dingen fasziniert, denen eine gewisse Transzendenz anhaftete. In dieselbe Zeit fällt auch Cohens erster Kontakt zur Welt der Musik. So erlernte er in den sommerlichen Jugendlagern das Gitarrenspiel. Ein Folksänger namens Irving Morton brachte ihm Lieder aus dem People’s Song Book bei, einer Sammlung zeitgenössischer Volkslieder.
Zu Beginn der 50er-Jahre steckte die Popmusik, wie wir sie heute kennen, noch in den Kinderschuhen. Nach der großen Weltwirtschaftskrise und den beiden Weltkriegen begannen sich Blues, Jazz, Gospel, Countrymusik und Folksong als Basis der Popmusik herauszukristallisieren. Vor allem vom Rhythm and Blues und von der Countrymusik, den wichtigsten Vorläufern des Mitte der 50er-Jahre aufkommenden Rock ’n’ Roll, ließ Cohen sich inspirieren. Im Jahr 1993 beschrieb er seine Haltung zur Popmusik folgendermaßen: »Die aus vielen Stilen entstandene Popmusik nimmt eine ähnliche Stellung ein wie die Malerei des 19. Jahrhunderts vor Picasso und Matisse. Deren Arbeiten hat man anfangs auch nicht geschätzt, heute will man sie nicht mehr missen. Es waren einfach neue Ausdrucksformen. Ich denke dabei nicht an Zwölfton- oder atonale Musik; selbst das wäre noch 19. Jahrhundert. Ich meine die Einstellung, mit der eine neue Geschichte erzählt, eine Vision entwickelt wird. Gerade jetzt sind wieder Ansätze in dieser Hinsicht erkennbar.«
Aber auch für die klassische Musik, für Jazz und Walzer hegte Leonard Cohen in seiner Jugend eine Vorliebe. Noch heute bezeichnet er als eines seiner größten musikalischen Idole den schwarzen Sänger und Pianisten Ray Charles, dem er auf dem Elton-John-Album Duets (1993) mit dem Song »Born To Lose« seine Reverenz erwiesen hat.
Im Alter von 15 Jahren nahm Leonard Cohen Klavierunterricht, und mit Hilfe eines in Montreal lebenden Spaniers verbesserte er sein Gitarrenspiel. »Meine erste Gitarre habe ich für zwölf Dollar in Montreal gekauft. Damals gab es noch keine Gitarrenkultur. Das Einzige, was man vermeintlich darüber wusste, war, dass nur Kommunisten Gitarre spielten. Im Park hinter dem Haus meiner Mutter hing oft ein spanischer Flamenco-Gitarrist herum. Er war einsam und spielte fantastisch. Ich bat ihn um Unterrichtsstunden, und er brachte mir Tremolos, Flamenco-Akkorde und die Kombination von Dur und Moll bei. Er lehrte mich die Grundlagen des Komponierens. Die Leute denken nämlich, ich kenne nur drei Akkorde – in Wahrheit kenne ich fünf. Darauf beruhen Songs wie zum Beispiel ›Suzanne‹, ›Stranger Song‹ und ›Master Song‹. Zu meiner vierten Unterrichtsstunde blieb er aus. Ich rief in seinem Hotel an, fragte, wo er sei, und musste hören, dass er Selbstmord begangen hatte.« Die Lieder aus The People’s Songbook, die er im Sommerlager Sunshine 1950 kennen und schätzen gelernt hatte, nahmen zusätzlichen Einfluss auf Cohens Gitarrespiel. »Von diesen Liedern ging eine solche Kraft aus, dass ich überzeugt davon war, Musik muss eine Wirkung auf Menschen ausüben.« Dieser Nachhall ist bei Cohens eigenen Liedern wie etwa »The Partisan«, »The Old Revolution« oder »The Traitor« unverkennbar.
»Martha Wainwright hat eine so schöne Version von ›The Traitor‹ gemacht. Ich selbst verstehe den Song nicht vollständig. Oft versteht man gar nicht, was man gemacht hat, obwohl man sich zu einem bestimmten Standard zwingt, während man etwas macht. Man möchte ja, dass ein Lied mehr oder weniger stimmig ist, aber manchmal, wenn man den Song von jemand anderem interpretiert hört, kann man es nicht mehr erwarten, diese Version noch einmal zu hören. Das ist einer meiner Lieblingssongs. Ich begreife nicht wirklich, worum er sich dreht, doch weiß ich, dass da etwas Großartiges in diesem Song steckt. Stücke wie ›The Traitor‹ stellen eine Wahrheit dar, die schwer auszumachen ist, die sich aber stark auf dein Leben auswirkt. So geht es mir oft mit bestimmten Songs von Dylan oder Edith Piaf. Die französischen Worte sind zu schnell für mich, um sie wirklich zu verstehen. Aber man fühlt, dass es da etwas gibt, das wahr ist. Wahrheit, die man allein nicht ausmachen kann, die jemand für dich in diesem Lied ausfindig gemacht hat. Und du hast das Gefühl, du hättest gerade den letzten Teil des Puzzles eingesetzt. Für diesen Moment hast du das Puzzle gelöst. In diesem Moment ist alles klar. In diesem Moment spürst du, es ist wahr. Ist es nicht wunderbar, wenn alle Teile passen?«, interpretiert Cohen das 1979 auf dem Album Recent Songs veröffentlichte Stück.
Weiterhin von Mythologien und dem geschriebenen Wort angezogen, fiel »mir zu dieser Zeit in einem Antiquariat ein Buch des spanischen Dichters Federico Garcia Lorca in die Hände (unglücklicherweise, wie Cohen Jahre später ironisch anmerkte). Lorca hat meine Weltanschauung enorm beeinflusst. Seine surrealen Schriften, geprägt von transzendentaler Romantik – Romantiker waren wir zu der Zeit schließlich alle –, haben mein Tun und Denken auf die radikalste Weise verändert. Ich musste mehr, musste alles von ihm lesen. Seine Bücher legten mir klar dar: Poesie kann jungfräulich und tiefgründig und zugleich volkstümlich sein.«
Seiner Liebe zu Garcia Lorca setzte Cohen im Jahr 1986 mit dem Album Poets in New York ein Denkmal, einer Zusammenstellung mit Aufnahmen verschiedener Künstler, die zum 50. Todestag des spanischen Dichters veröffentlicht wurde. In seinem ein Jahr später veröffentlichten Song »Take This Waltz«, leicht verändert abgemischt auch auf dem Cohen-Album I’m Your Man erschienen, verarbeitete er Lorcas Gedicht »Little Viennese Waltz«. Neben Religion und Musik ist Garcia Lorca somit die dritte bedeutende Inspirationsquelle für Cohens Werk. In Interviews anlässlich seiner Beteiligung am Poets-in-New-York-Projekt fasste Leonard Cohen seine an Idolatrie grenzende Verehrung in die folgenden Worte: »Mit den ersten Gedichten, die mir von ihm in die Hände fielen, hat Garcia Lorca mein Leben ruiniert.«
Diese Art von Idolisierung hat Leonard Cohen später selbst erfahren, und auch sein Werk weist einige Parallelen zu dem Garcia Lorcas auf. Für den aufstrebenden jungen Dichter aus Kanada war der am 19. August 1936 wegen seines Engagements im Spanischen Bürgerkrieg ermordete Poet das Vorbild für das Schriftstellerleben schlechthin. Lorcas Überzeugung, in seinen Adern fließe das Blut von Zigeunern und Juden, verstärkte Cohens Identifikation mit ihm. Er bewunderte Garcia Lorca für seine Fähigkeit, mit sprachlichen Mitteln surrealistische Bilder zu entwerfen. Darüber hinaus schätzte er ihn, weil er erklärt hatte, Lyrik könne zugleich »elitär« und »populär« sein. Einen weiteren Bezugspunkt fand Cohen darin, dass Lorca im ungefähr gleichen Alter wie er selbst mit ernst zu nehmenden literarischen Aktivitäten begonnen hatte. Cohen fing mit 16 Jahren zu schreiben an, Lorca mit 17.
»Lorca hat mich erzogen. Er war mein Lehrer darin, die Würde des Schmerzes zu erkennen und ihn mit Stolz und Hingabe zu verstehen. Lorca habe ich es zu verdanken, dass ich mich für Spanien und seine Geschichte interessiere. Sein Werk wurde mir zu meiner Bibel.« – Lorca geriet zum ersten großen Vorbild, das er für sein künstlerisches Schaffen und seine Sehnsucht nach Frauen verantwortlich macht. Später gesellten sich Leitsterne wie die Schriftsteller und Mentoren Louis Dudel, F.R. Scott, A.M. Klein, Irving Layton, Roshi und Balsekar hinzu.
Der 21. September 1951 war für Leonard Cohen in zweifacher Hinsicht von Bedeutung. Zum einen war es sein 17. Geburtstag, zum anderen der Tag seiner Immatrikulation an der McGill University von Quebec, der ersten Hochschule im französischsprachigen Teil Kanadas, an der auf Englisch gelehrt wurde, und die großen Anteil an der Verbreitung der Kultur des englischen Sprachraums hatte. Und 1951 schrieb er mit »Twelve O’Clock Chant«, das auch im 1965