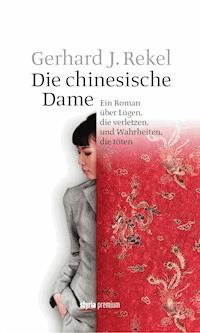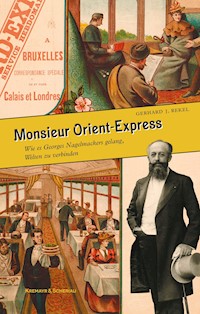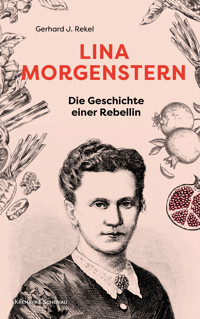
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
1866. Preußisch-Österreichischer Krieg. Mittendrin, in Berlin, Lina Morgenstern (1830–1909). Viele Soldaten kommen verletzt aus dem Krieg, der Staat kümmert sich nicht. Spontan gründet Lina Lazarette und Volksküchen – und rettet damit tausende Soldaten. Freund und Feind. Gegen den Willen ihrer Eltern heiratet sie Theodor. Eine Liebesgeschichte mit vertauschten Rollen: Als ihr Mann in die Pleite schlittert und die Familie mit fünf Kindern plötzlich brotlos dasteht, schreibt Lina in wenigen Wochen einen Bestseller, zehn weitere folgen. Hinter der Maske von Linas quirligem Humor verbirgt sich die nervöse Unrast einer leidenschaftlichen Unternehmerin: Mit heißem Herzen und kühlem Verstand initiiert sie zahlreiche Wohlfahrtsvereine, die erste seriöse Frauenzeitung und den ersten "Internationalen Frauenkongress" auf deutschem Boden. Bis heute gilt sie als eine der wichtigsten Sozialreformerinnen und maßgebliche Begründerin der ersten Frauen- und Friedensbewegung. Eine Geschichte, die Mut macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LINA MORGENSTERN
Gerhard J. Rekel
LINA MORGENSTERN
Die Geschichte einer Rebellin
Inhalt
Ouvertüre – Sommer 1870
Turbulente Vorgeschichte – 1823
Kindheit und Jugend in Breslau – 1830
Ein Held auf der Flucht – 1847
Revolution – 1848
Um jeden Pfennig – 1848
Sieben Jahre Fernbeziehung – 1854
Die verfeinerten Bedürfnisse der Zivilisation – 1855
Für das Seelenvolle – ab 1855
Theodors Taumeln – 1860
In wenigen Wochen Bestsellerautorin – 1861
Die Magenfrage – 1866
Hunger in Zeiten der Epidemie – 1866
Der Duft der Kräuter – 9. Juli 1866
Der Erfolg und seine Kinder – 1867
Laudanum und Kalomel – 1868
Auf dem Bahnhof – Sommer 1870
Die Etappe – Herbst 1870
Mit knapper Not – 1870
Der Zauber des Beginns – ab 1871
Die Start-up-Unternehmerin – ab 1873
Die Verlegerin – 1874
Kochen als Kunst und Wissenschaft – 1878
Prostitution und ein Brief aus England – 1880
Tropfen für Tropfen – 1881
Katastrophen und Erfolge – ab 1882
Italienische Riviera – 1886
Tragödie – 1888
Kampf gegen Götter in Weiß – 1888
„Die Waffen nieder“ – 1890
Die Aktivistin – Januar 1896
Hindernisse und Wut – ab Februar 1896
Politische Spitzel – ab Juni 1896
Der Kongress tagt – 19. September 1896
Dramatische Tage – September 1896
Der große Streit – September 1896
Im Tanzsaal – September 1896
Kongress-Finale – 26. September 1896
Schikanen – 1899
Zedaka – 1900
Die Ambivalenz des Guten
Zeittafel
Linas Vereine
Linas Bücher
Linas Volksküchen in Berlin
Rezepte aus Linas Bestsellern
Literatur und Quellen
Anmerkungen
1
Ouvertüre – Sommer 1870
„Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan werden muss.“
Marie Curie, polnisch-französische Physikerin (1867–1934)1
Lina war anders. Nicht makellos, nicht glamourös, keine Frau, die dem Ideal der meisten Männer des 19. Jahrhunderts entsprach. Ihre Zeitgenossinnen beschrieben sie als klein, rundlich, lustig, voller Energie, spontan, weltoffen und in manchen Bereichen chaotisch.2 Mit ihrem Mann Theodor lebte sie eine unkonventionelle Ehe, deren Geheimnis sich die beiden bis zum Schluss bewahrten. Sie liebte ihre fünf Kinder und gutes Essen. Oft vergaß sie zu schlafen. Sie initiierte so viele Projekte, dass sie manchmal den Überblick verlor.
Vor allem war sie hartnäckig.3
Wenn sich Lina gewisse Dinge genau ansah, und das machte sie oft, klemmte sie ihren Kneifer auf die Nase. Und sobald sie die Sache durchschaute, gab sie Anweisungen: schnelle, kurze Sätze. Pragmatisch, ohne allzu große Höflichkeiten.
Trotzdem versprühte sie eine gewisse Eleganz.4 Weniger äußerlich, die Mode betreffend, sondern in der Art ihres Auftretens, ihrer Haltung, ihrer Sprache, besonders im Umgang mit Rückschlägen – wie diesem: Preußen war seit zwei Wochen im Krieg. Und Berlin in Aufruhr. Die Sommerhitze von 1870 ließ die Stadtbewohner schwitzen, hecheln und fluchen. Die knapp vierzigjährige Lina sah den Ferien mit großer Vorfreude entgegen, die letzten Monate hatten sie angestrengt, die Volksküchen, der Kinderschutzverein, die Fortbildungsschule für junge Frauen, ihre heranwachsenden fünf Kinder – täglich hatte sie unzählige Herausforderungen zu bewältigen.5
Umso mehr freute sie sich, mit ihrer Familie für eine Woche Richtung Potsdam zu flüchten. Am Waldrand von Bornim, unter schattigen Buchen, fand die siebenköpfige Familie in der Nähe eines Bauernhofs ein stilles Häuschen.6 Kühe melken, Blaubeeren pflücken, in den See springen. Linas ältester Sohn Michael, kürzlich dreizehn geworden, hatte sich von der allgemeinen Kriegseuphorie anstecken lassen, die in vielen Gazetten propagiert wurde.7 Der aufgeweckte Junge schnitzte im Wald ein Gewehr mit Bajonett und wollte sich freiwillig zum Kampf gegen die Franzosen melden. Unentwegt redete er auf seine Eltern ein und bat sie, ihn auf die Kadettenschule in Groß-Lichterfelde bei Berlin zu schicken. Ohne sich bewusst zu sein, dass dort die Elf- bis Neunzehnjährigen in einem militärischen Internat zu absolutem Gehorsam verbogen werden.8 Lina und Theodor versuchten, ihren Sohn von der Idee abzubringen. Kein leichtes Unterfangen.
Trotzdem freute sich Lina über die Urlaubstage, denn so konnte sie an der Neuausgabe ihres bereits 1862 erschienenen Buches Die kleinen Menschen. 101 Geschichten und Lieder aus der Kinderwelt feilen.9
Schon in der zweiten Nacht hörte sie plötzlich ein energisches Klopfen: „Aufmachen!“ Als Lina nicht sofort reagierte, brüllte jemand: „Im Namen des Königs, öffnen Sie!“
Das war keine Bitte, keine höfliche Frage, es war ein Befehl. Vor der Tür stand ein bewaffneter Uniformierter. Er verlangte: Frau Morgenstern müsse mitkommen. Nach Berlin. Sofort! Gesandt hatte ihn ein Adjutant des preußischen Kriegsministers Albrecht von Roon. Widerwillig packte Lina das Notwendigste zusammen und versprach ihrer Familie, in wenigen Tagen zurück zu sein.
In der Kutsche erzählte der Uniformierte: Fünfhundert Soldaten würden in den nächsten Stunden ankommen. Das preußische Kriegsministerium beauftrage Lina und ihre Volksküchen erneut, die Kombattanten am Niederschlesisch-Märkischen Bahnhof und am Berliner Ostbahnhof mit Speis und Trank zu versorgen.
Das Militär nutzte die Bahn für rasche Truppenverschiebungen, zum ersten Mal kam es zu Eisenbahn-Aufmärschen.10 Dabei führten viele Linien durch die preußische Residenzstadt. Allerdings schien kein höherer Offizier bedacht zu haben, dass Aufenthalte und Transfers zwischen den vielen Berliner Bahnhöfen lange dauern und die Soldaten Essen und Getränke benötigten.11
Lina ging davon aus, mit der Soldatenverpflegung längst fertig zu sein. In den letzten Wochen vor dem Urlaub hatten sie und ihre Helferinnen nahezu alle durch Berlin in den Krieg ziehenden Truppen mit Speis und Trank versorgt. Über 59.000 Eingezogene.12 Sogar einen Fotografen und ein Feldpostamt hatte Lina organisiert, damit die Soldaten ihren Familien noch einmal schreiben und ein Porträt senden konnten. 50.000 Feldpostkarten – Lina hatte sie dem Oberpostdirektor durch ihr Insistieren abgetrotzt.13 Manche Soldaten hatten Lina angefleht, für ihre Frauen und Kinder zu sorgen, falls sie in Frankreich fallen würden.
Nachdem die Truppen Berlin verlassen hatten, sandte man Lina nach Hause. Jetzt waren die jungen Männer an der Front. Und von dort kamen gute Nachrichten.14
Deshalb drängte der Uniformierte zur Eile. Schon im Morgengrauen würden die ersten Soldaten in Berlin eintreffen, man erwarte einen Zug mit „siegreichen Helden“!
Sollte Lina etwa ein Festmahl oder eine Siegesfeier ausrichten, was wollte das Kriegsministerium von ihr? Schon vor einigen Wochen hatte sich Lina gewundert: Warum planen Generäle so akribisch das Aufstellen der Truppen, den Einsatz der Waffen und das Vorrücken in feindliches Gebiet, vergessen aber, die Soldaten in Berlin mit Essen zu versorgen?15
Lina war froh, dass sie ihr langjähriges Dienstmädchen Amalia mit aufs Land genommen hatte, sie würde nun Theodor bei der Betreuung der Kinder unterstützen.
Als Lina und der Uniformierte sich dem Ostbahnhof näherten, bemerkten sie: Viele Menschen hatten die Häuser mit Flaggen geschmückt und sich an Kiosken und Destillen versammelt.16 Fahne an Fahne, Banner an Banner, überall Freude und Frohsinn. Viele Berliner versuchten, einen Blick in die Zeitungen zu erhaschen, die Blätter waren voll von Siegesmeldungen. Einige Passanten lasen die wichtigsten Zeilen laut vor, immer wieder brach Jubel aus. Berichtet wurde von „der Tapferkeit deutscher Truppen, die sich aufs Glänzendste bewährt haben“17 und einem „großen Sieg bei Weißenburg“.18 Lina beobachtete Männer, die tanzten und sich betranken.
Das Kriegsministerium hatte auch ihre Kolleginnen vom Verein der Berliner Volksküchen holen lassen. Lina wusste, was es bedeutet, für fünfhundert Menschen in wenigen Stunden ein warmes Essen bereiten zu müssen. Sie instruierte ihre Helferinnen, aus der Volksküche in der Invalidenstraße umgehend Reserven zu besorgen: Bohnen, Reis, Zwiebeln, Speck. Und sie bat ihre langjährige Freundin Maria Gubitz, die Kessel im Güterschuppen in der Nähe des Bahnhofs anzufeuern. Würde das für ein „Siegesfest“ reichen?19
Als Lina den Bahnsteig betrat, musste sie sich an Neugierigen vorbeidrängen, die begeistert patriotische Lieder sangen. Die Menschen waren gekommen, um die „Vernichtung des Feindes“ mit ihren „heimkehrenden Helden“ zu feiern, die „alle gekämpft hatten wie die Löwen!“20
Mit einem schrillen Pfiff rollte der angekündigte Zug in die Station. Acht Waggons. Voll besetzt. Kaum stiegen die ersten Helden aus, verstummten plötzlich die euphorischen Berliner, die Jubelstimmung brach in sich zusammen, ein seltsames Schweigen breitete sich aus.
Die meisten Soldaten konnten kaum aus eigener Kraft die Waggons verlassen. Viele hatten einen Arm oder ein Bein verloren, andere waren durch Verletzungen im Gesicht oder am Körper entstellt, Verbände hingen blutig und verdreckt von Kopf oder Gliedmaßen. Die „siegreichen Helden“ wirkten wie „dem Tod geweihte Verlierer“.21 Überall blutende, schreiende und sterbende Krieger.
Was in den folgenden Wochen passierte, hat Lina tief geprägt. Um die Ankommenden zu versorgen, arbeitete sie mit den von ihr organisierten freiwilligen Helferinnen nahezu Tag und Nacht, bis zur totalen Erschöpfung. In zwölf Monaten schlief sie nur zwanzig Nächte bei ihrer Familie.22
Zusammen mit ihren Kolleginnen versorgte Lina etwa 300.000 Menschen und rettete in den von ihr privat improvisierten Lazaretten über 6000 Verletzte, Freund und Feind.23 Trotzdem wurde sie schikaniert. Von Regierungsstellen und Militär. Von der patriotischen Presse. Und von antisemitischen Zeitgenossen. Allesamt Männer. Diese drohten, sie vor Gericht zu zerren, führten sie als Verräterin vor und versuchten, Lina samt Familie um ihre Existenz zu bringen.
Spätestens in diesen Wochen muss sich in ihr eine Wut breitgemacht haben, ein Feuer, das sich später zu einem Flächenbrand entwickelte – ihr Kampf für Gleichberechtigung, Benachteiligte und Frieden. Denn kaum eine andere Frau hat in den folgenden Jahrzehnten eine solche Menge und Vielfalt an Erneuerungen durchgesetzt wie Lina Morgenstern.24
2
Turbulente Vorgeschichte – 1823
„Günstige Winde kann nur der nutzen, der weiß, wohin er will.“
Oscar Wilde, irischer Schriftsteller (1854–1900)25
In der fruchtbaren mittelschlesischen Ebene beiderseits der Oder liegt Breslau. Die heute Wrocław genannte Stadt im Westen Polens war das geistige und kulturelle Zentrum der preußischen Provinz Schlesien, mit barocken Bauten und nahezu einer halben Million Einwohner. Hier ereignete sich Lina Morgensterns dramatische Vorgeschichte, ein Liebesdrama: Wir schreiben das Jahr 1823. Der Vater von Lina, Albert Bauer, stammte aus einer jüdischen Familie. Im Alter von 23 Jahren verliebte er sich zum ersten Mal. Die Angebetete: eine junge Christin. Die Anziehung muss so stark gewesen sein, dass Albert bereit war, zum Christentum überzutreten.26 Der Charme der jungen Frau soll sogar Alberts jüdische Mutter beeindruckt haben. Überraschenderweise stimmte sie der Vermählung ohne Vorbehalte zu, vielleicht waren ihr vor einem Jahr bei der Beerdigung ihres evangelischen Ehemannes die Ähnlichkeiten mancher Rituale von Juden und Christen aufgefallen. Doch gerade als die Vorbereitungen zur Hochzeit begannen, starb die junge Braut „auf tragische Weise“.27
Albert verfiel in eine Depression. Auch beruflich lief es schlecht. Ein Bekannter, ein junger Graf, bemerkte, wie krank Albert aussah, und machte sich Sorgen. Spontan bot der Graf an: Albert könne sich auf seinem Gutshaus in Oberschlesien erholen. Für einige Wochen!
Der Graf wusste nicht, dass Albert Jude war, er ging indes seinen Geschäften in Breslau nach. Albert nahm den Vorschlag an. Schon nach ein paar Tagen traf er in der Nähe des Gutshauses einen alten Freund. Als dieser erfuhr, dass Albert vom Grafen für mehrere Wochen eingeladen worden war, reagierte er fassungslos: „Wenn der Graf wüsste, dass du Jude bist, würde er all seine Hunde auf dich hetzen und dich von seinem Hof jagen!“28
Albert nahm die Warnung ernst. Um Streitigkeiten zu vermeiden, reiste er noch am selben Tag ab. Er wollte nach Krakau und stieg auf ein Pferd. Weil Albert nicht gut reiten konnte, stürzte er von dem galoppierenden Tier, wurde über holpriges Pflaster geschleift und blieb bewusstlos liegen.
Passanten brachten ihn in ein Hospital. Niemand kannte ihn. Man meldete den Vorfall dem zuständigen Senator Jakob Adler, ein mächtiger und wohlhabender Mann. Der Gütige nahm sich des Verletzten an, besuchte Albert täglich und bezahlte seine Behandlung. Jakob Adler war ebenfalls Jude und verstand sich gut mit Albert.
Vollständig genesen, besuchte Albert den Senator in seiner Villa, um sich zu bedanken. Das Dienstmädchen bat den Besucher, im Vorzimmer auf den Hausherrn zu warten. Dort hörte Albert aus einem Nebenraum eine zarte Sopranstimme. Wohlklingend und warm. Eine Arie. Mozart. Albert fragte nach der Sängerin.
Das Dienstmädchen öffnete die Tür, stellte Albert die Musikerin vor, die sich selbst am Klavier begleitete: Fanny, die Tochter des Senators. Achtzehn Jahre. Graublaue Augen. Lange, dunkle Korkenzieherlocken. Augenblicklich verliebte sich Albert in die junge Frau. Und sie sich in ihn.29
Umgehend wollten die beiden heiraten, doch der Senator ließ das nicht zu, obwohl er Albert mochte. Zu früh! Fanny lebte in Krakau, Albert in Breslau. Zwei Jahre lang schrieben die beiden einander leidenschaftliche Briefe. Bis schließlich Fanny zu ihrem zwanzigsten Geburtstag die Erlaubnis erhielt, Albert zu ehelichen. Die Hochzeit fand in der Synagoge der Freien Stadt Krakau statt. Der Senator feierte mit seiner großen jüdischen Familie. Von Alberts Seite kamen nur seine verwitwete Mutter und sein Halbbruder. Für Albert stellte die Hochzeit die Erfüllung eines lange gehegten Wunsches nach einer großen Familie dar. Und den Beginn einer Ehe, aus der seine Tochter Lina hervorgehen würde, die einen für diese Zeit völlig außergewöhnlichen Weg beschreiten sollte.
Albert Bauer (1800–1875)
3
Kindheit und Jugend in Breslau – 1830
„Ich muss mit einem Kopf voller Kometen zu Bett gehen.“
Emily Blackwell gründete mit ihrer Schwester Elisabeth die erste von Frauen geleitete US-Klinik und liebte die Astronomie (1826–1910)30
Albert Bauer wollte Fanny eine Wohnung bieten, wie sie es von ihrer Familie gewohnt war: Senatoren-Standard, im bürgerlichen Teil von Breslau. Es gelang ihm, eine komfortable Fünfzimmerresidenz am Blücherplatz 2 neben dem prachtvollen Rathaus zu ergattern.31 Dafür nahm er einen Kredit auf und arbeitete von acht Uhr morgens bis spät in die Nacht. Fanny liebte gute Gesellschaft und bekochte gerne Gäste. Um seinen Laden in Schwung zu bringen, benötigte Albert ein Lagerhaus. Zusammen mit seinem Halbbruder Isaac-Wilhelm gründete er die Firma „Gebrüder Bauer“, die beiden restaurierten Möbel und handelten mit Antiquitäten.32
Nach knapp einem Jahr dann das große Glück: Fanny schenkte Albert einen Sohn, den das junge Paar Wilhelm nannte. 23 Monate später kam Cecilia. Und bereits nach eineinhalb weiteren Jahren verlautbarte Fanny, sie sei erneut schwanger: Am 25. November 1830 wurde Lina geboren.
„Mitten im Herzen der Stadt Breslau, dem alten, schönen gotischen Rathaus zur Seite, erblickte ich das Licht der Welt“, rekapitulierte Lina.33
Nun musste eine noch größere Wohnung her. Der finanzielle Druck stieg, Albert fand am Ring in der Elisabethstraße 4 eine geräumigere Bleibe.34 Nach vier weiteren Kindern zog die Familie schließlich in eine Villa in der Nähe der großen Synagoge, in der Schweidnitzer Straße 11. Diese bot genug Platz für neun Personen und einen Laden.35 Für Lina muss es nicht ganz einfach gewesen sein, so oft umzuziehen. Jedes Mal Freunde und Nachbarn verlieren, ein weiter Schulweg, auf sich allein gestellt.
Häufig luden Fanny und Albert Künstler und Wissenschaftler zum Abendessen, es kam zu hitzigen Diskussionen, auch im Beisein von Lina. Menschen nahezu aller Gesellschaftsschichten besuchten die Familie. In der Tradition der französischen Salons wurde gespeist, getrunken und bis spät in die Nacht diskutiert. Linas Eltern gaben sich intellektuell, abenteuerlustig und in alle Richtungen neugierig. Autoritäre Ideen schienen verpönt, es zählte die Kunst, durch neue Erkenntnisse, scharfe Pointen und trockene Witze zu überzeugen. Durchaus ungewöhnlich, denn in vielen bürgerlichen Kreisen wurde damals bei Festen von den Männern vorwiegend über Geschäfte, Adelstitel und Pferderennen und den Frauen über Mode und die Oper gesprochen. Später erzählte Lina, dass ihre Mutter sie von frühester Jugend an nicht nur zu den Tätigkeiten im Haushalt motiviert habe, sondern auch zum „Wohltun“.36
Vater Albert schickte Lina vom sechsten bis zum fünfzehnten Lebensjahr auf die Wernersche Höhere Töchterschule37, die sich in Breslau am Ring 19 befand.38 Unterrichtet wurde Stricken, Häkeln und Haushaltsführung. Lina stellten die angebotenen Fächer nicht zufrieden, einzig Geschichte und Literatur interessierten sie. In Deutsch verfasste sie das Gedicht „Der heitere Lebensabend“, das von einer Mitschülerin vor der gesamten Klasse mit Inbrunst vorgetragen wurde – was Lina begeisterte.39
Auch wenn ihr die Schule wenig behagte, so lernte sie doch eine gewisse Arbeitsdisziplin, die darin bestand, die Dinge planmäßig, verlässlich und beharrlich zu erledigen, Haushaltsbücher zu führen und private Schwierigkeiten und Stimmungen hintanzuhalten.
Mehrfach ist überliefert, dass Lina zwischen vierzehn und achtzehn Jahren Sprachen ohne Anleitung lernte und sich für Wissenschaften interessierte. Insbesondere faszinierten sie die Astronomie und die Medizin, die sich gerade im Aufbruch befanden. Linas Mutter entging nicht, wie bildungshungrig ihre Tochter war. Das Mädchen half ihrem älteren Bruder Wilhelm und ihren vier Schwestern bei Schularbeiten, der Mutter beim Haushaltsbuch und dem Vater bei betrieblichen Kalkulationen. Trotzdem war es Lina wie jeder anderen jungen Frau nicht erlaubt, ein Gymnasium oder eine Universität zu besuchen. Kein Studium, kein wirklich spannender Beruf, zu wenig relevante Themen. Lina verachtete die Beschränkungen, die ihr Eltern und Gesellschaft auferlegten. Sie suchte nach Möglichkeiten, ihr Wissen zu erweitern, und der Gedanke, diese Chance vielleicht niemals zu erhalten, quälte sie.40
Weil sie sich immer öfter über den eintönigen Unterricht beschwerte, geriet sie mit ihrem Vater in Streit, der für die private Höhere Töchterschule viel Geld aufwenden musste und seine Tochter der Undankbarkeit bezichtigte. Von seinen Kindern verlangte Albert Fleiß und Disziplin. Später schrieb Lina, in ihrem Elternhaus habe „sittlicher Ernst und strengstes Pflichtgefühl“ geherrscht.41 Ihr Vater habe sie und ihre Geschwister zu „Selbstbestimmung und Berufstreue“ angehalten.42
Schon früh beobachtete sie bei ihrem geschäftstüchtigen Vater, wie er komplexe Abläufe organisierte. Durch ihren älteren Bruder Wilhelm und ihre ältere Schwester Cecilia lernte Lina, zuzuschauen, hinzuhören und dagegenzuhalten. Trotzdem berichteten ihre Geschwister, dass sich Lina in diesen Jahren oft zurückzog, nicht ansprechbar war und ziemlich melancholisch wirkte. Von ihren Brüdern lernte sie, Gefühle so wenig wie möglich zu zeigen und nicht zu weinen, da dies als Schwäche ausgelegt werden könnte. Lina suchte Trost in Büchern, weniger in der Religion. Trotzdem wurde sie im Glauben ihrer Eltern unterrichtet, Linas Großvater war Vorsteher der Jüdischen Gemeinde in Krakau. Sie lernte die Gebete in hebräischer und aramäischer Sprache, ohne die Sätze vollständig zu verstehen. Je älter sie wurde, umso mehr neigte sie zu einer freien Auffassung der Menschenliebe.43 Religion bedeutete für sie Regeln, Zwang und Abhängigkeit, während die Moderne die Freiheit der Gedanken und den Fortschritt versprach. Lina zog dem Leiden und Beten das Tun und Wirken vor.44
Nur hin und wieder, zu den großen Feiertagen, besuchte Lina die 1827 erbaute Synagoge zum Weißen Storch, die sich nur wenige Gehminuten vom elterlichen Wohnsitz auf einem großen Hof befand und über einen prächtigen Thoraschrein verfügte.45
Beeindruckt haben muss Lina hingegen ihr Religionslehrer Abraham Geiger, der zum selbstständigen Nachdenken über ethische Bestimmungen ermutigte.46 Er hatte ein gutes Verhältnis zu Linas Eltern und trat dafür ein, den Gottesdienst durch Musik und Chor sowie Beten in der Landessprache den Menschen näherzubringen.47
In diesen Jahren begann Lina, Kindergeschichten zu schreiben, oft abends, bei Kerzenlicht, was auch dazu geführt haben mag, dass sie bald eine Brille benötigte. Ihre Mutter beunruhigte Linas introvertiertes Verhalten, sie schränkte die Zeit, in der sich Lina mit dem Lesen und Verfassen von Geschichten befassen durfte, rigoros ein. Lina las trotzdem. Heimlich. Bis in die Morgenstunden verschlang sie ein Buch mit Briefen von Rahel Varnhagen sowie Traktate von Bettina von Arnim – beide Frauen setzten sich für Unabhängigkeit und geistige Freiheit ein.48Die funkensprühende Salonnière Rahel hatte mit 43 Jahren den vierzehn Jahre jüngeren Adeligen Karl August Varnhagen von Ense geheiratet, der sie mit seinen Sekretärsdiensten verwöhnte und ihren gesamten Schriftverkehr akribisch sammelte.49 Über fünftausend Briefe. In einem stellte Rahel fest, „dass die Frauen ganz von des Mannes und des Sohnes Stand geprägt sind und vielfach nicht als Menschen mit Geist betrachtet werden“.50 Ihr gesamtes Leben rang Rahel mit ihrem Judentum, den Auswirkungen des Antisemitismus und der Rolle der Frau in der Gesellschaft.
Lina muss die Lektüre fasziniert haben, allerdings führte ihr permanenter Schlafmangel – wie sie später schrieb – „zu quälendem einseitigen Gesichtsschmerz und hochgradiger Bleichsucht“.51 Die Erkrankung wurde schlimmer, ihre Mutter sorgte sich noch mehr und nahm Lina mit zur Kur nach Karlsbad.
Ausgedehnte Spaziergänge durch Wälder, lange Bäder und intensive Behandlungen halfen kaum – bis sich von einem Tag auf den anderen, im Alter von vierzehn Jahre jüngeren Jahren, plötzlich alles änderte.52
4
Ein Held auf der Flucht – 1847
„Am Anfang und Ende jedes glücklichen Lebens ist das Vergnügen.“
Epikur, griechischer Philosoph (341–270 v. Chr.)53
Leidenschaft bewegt. Und kann Bewegung auslösen. Die Mutter erlaubte der Sechzehnjährigen, eine Tanzschule zu besuchen. Ein ausladender Saal mit Parkett, Wandspiegel, am Rand Tischchen mit bunten Blumensträußen. Ein junger Mann spielte am Klavier Musik für Kontertänze und Polka. Nach einigen höflichen Tänzen stimmte er einen Walzer an, der noch bis 1820 am französischen Hof verboten war, weil zu lasziv.54 Die Stimmung wurde ausgelassen, manche Paare stolperten und lachten. Dort und da verträumte Blicke. Ein schüchternes Begehren. Damenwahl. Auf glattem Parkett lernte Lina den neunzehnjährigen Theodor Morgenstern kennen. Er kam aus Sieradz, einer kaum zweitausend Einwohner zählenden Kleinstadt mit Synagoge in der Nähe von Łódź.
In holprigem Deutsch erzählte der junge Mann aufgeregt von Revolutionsmärschen und seiner lebensgefährlichen Flucht.55 Wie viele andere Juden hatte er sich am Krakauer Aufstand vom 18. Februar 1846 beteiligt und gegen Österreich, Russland und Preußen für eine polnische Nationalregierung gekämpft, denn nur diese versprach die vollständige Gleichberechtigung der Juden. Doch der Aufstand wurde von der österreichischen Armee brutal niedergeschlagen. Hals über Kopf musste Theodor ins Exil flüchten.56 Ob er wirklich an entscheidender Stelle am Aufstand beteiligt war, ist nicht belegt. Aber die fast siebzehnjährige Lina muss von seinem revolutionären Enthusiasmus angetan gewesen sein – was für ein Held! Er war ganz anders als ihre Brüder und deren Freunde. Mit welcher Begeisterung er seine Geschichte erzählte. Und wie er tanzte!57
Trotz der Etikette und unter den Augen des strengen Tanzlehrers schien es bei manchen Formationen, als würden Linas Hände jede Distanz überwinden, um etwas ganz Einfaches zu tun: sich zu berühren, sich festzuhalten.
Zwischen geistiger Intimität und körperlicher Nähe ist nur ein schmaler Grat. Und umgekehrt. Vielleicht hat Lina auch der Widerspruch fasziniert: Einerseits erzählte Theodor von seiner Liebe zu den Arbeitern und zur Revolution, andererseits trat er im kurzen Gehrock aus feinem Tuch auf, dazu schwang er bei der Begrüßung einen Zylinderhut aus schwarzem Seidentaft und schlenkerte lässig mit der rechten Hand einen koketten Doktorstock, den er vor dem Tanz zusammen mit dem Hut sorgsam ablegte. Theodor stammte aus einer fünfköpfigen Kleinstadtfamilie. Bald schon ahnte Lina, wie sehr er darauf brannte, aus seinem bisherigen Leben auszubrechen. Während einer Tanzfigur lehnte sie sich beiläufig an seine Schulter!58
Nach dem anfänglichen Gefühlsüberschwang stellten Lina und Theodor bald fest, dass zwischen ihnen mehr als nur eine sinnliche Anziehung bestand. Linas Art, zu fragen, ihre Neugierde auf die Welt und ihre pointierten Schlussfolgerungen dürften Theodor beeindruckt haben. Beide liebten Menschen, die sich nicht anpassten, und beide hatten Interesse an unternehmerischen Ideen. Obwohl sie in wichtigen Bereichen eine ähnliche Haltung einnahmen, verfügten sie über viele entgegengesetzte Charaktereigenschaften: die spontane, quicklebendige und auf Äußerlichkeiten nichts gebende Lina und der kaum zu erschütternde Theodor, der es liebte, in feinem Zwirn zu beeindrucken. Lina lernte ihm zuliebe sogar seine Muttersprache und übersetzte polnische Lieder.59
Lange hielten sich die beiden an ein damals übliches Motto: „Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß, als heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß.“60 Ohne das Wissen der Eltern trafen sie einander.
Trotzdem erfuhr Linas Vater von der Liaison; er fand sogar heraus, dass Theodor eine kleine, schlecht gehende Handelsagentur besaß. In dieser Zeit galt eine Liebesheirat zumeist als Torheit, eine Geldheirat hingegen war das Ziel vieler Eltern, denn sie hatten nicht das Liebesglück im Auge, sondern wollten ihr Kind durch eine Hochzeit existenziell absichern.
Albert Bauer hatte wenig Vertrauen in Theodors geschäftliches Talent, denn der junge Mann schien eine Schwäche für verwegene Pläne zu haben. Die beflissene Routine war Theodor ein unangenehmer Begleiter des Unternehmertums, er scheute die Mühen der Ebene, suchte lieber nach der einmaligen Gelegenheit, der Gunst der Stunde. Linas Vater empfand Theodor als unreif – was er seine Tochter wissen ließ. Immer wieder stellte er ihr Fragen: Was hat der Mann für Ziele? Wie stellt er sich seine Zukunft und die seiner Handelsagentur vor? Wie viel Geld hat er, wie viele Aktien?
Die Aktien der Liebe, der Leidenschaft, der Verlässlichkeit. Nur die schienen Lina wichtig.
5
Revolution – 1848
„Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfebedürftig sind.“
Käthe Kollwitz, deutsche Künstlerin (1867–1945)61
Lina beobachtete, wie sich gegenüber der Familienvilla Hunderte Menschen versammelten. Und es wurden von Minute zu Minute mehr. Großteils Arbeiterinnen und Arbeiter, doch Lina erkannte auch Bauern und Lehrer. Dicht gedrängt wurde geschrien, getrommelt und gepfiffen. Eine ohrenbetäubende Katzenmusik: Mit Glocken, Schellen, Dreschflegeln, Blecheimern und Topfdeckeln verschafften sich die Demonstrierenden Gehör. Sie versuchten, in die Nähe der königlichen Residenz zu gelangen, bewegten sich drohend auf das Schloss zu.
Vor dem Tor brüllte der Festungskommandant Befehle, die Soldaten verstärkten die Stellungen und brachten ihre Gewehre in Anschlag. Lina meinte, unter den Menschen einen Freund zu bemerken, war sich aber nicht sicher. Unbedingt wollte sie jetzt raus, um die Demonstrierenden zu unterstützen.
Der liberale Albert Bauer liebte Kunst und Kultur, stellte jedoch die traditionellen Geschlechterrollen kaum infrage. Er verbot seinen Töchtern, an der Demonstration teilzunehmen. Nicht nur, weil er um seine beiden noch nicht achtzehnjährigen Mädchen besorgt war, sondern weil er keinesfalls wollte, dass Soldaten sie aufgriffen und sein Name diskreditiert werden könnte. Gerade hatte er sich mit seinem Halbbruder Isaac-Wilhelm für die gemeinsame Firma „Gebrüder Bauer – Möbel, Parkett, Spiegel und Polsterwaren“ um den Titel des „Hoflieferanten Seiner Königlichen Hoheit, des Kronprinzen von Preußen“ beworben. Dieser Titel würde in vielen Zeitungen als Anzeige seine Wirkung entfalten und die Filialen der Brüder in Breslau und Berlin sowie die eigene Fabrik in ein gutes Licht rücken. Insbesondere betuchte Adelige waren für den Erfolg von Vaters Geschäften ausschlaggebend.62
Werbeanzeige von Linas Vater
Trotzdem wollten Lina und ihre um zwei Jahre jüngere Schwester Jenny unbedingt auf die Straße. Der Vater wies mahnend auf die Plakate hin, die überall in Breslau aushingen:
Bekanntmachung
… daß diejenigen, welche in der Gegend des Tumults getroffen werden und nach der an sie gehenden Warnung sich nicht folglich ruhig hinwegbegeben, aufgegriffen und zum Arrest gebracht werden sollen, und daß sie, wenn sie auch keiner strafbaren Absicht überführt werden, für ihren Ungehorsam Geld- und Leibesstrafe verwirkt haben.
Königl. Gouvernement und Polizei-Präsidium63
Lina und Jenny durften am 21. September 1848 nur durch das Fenster der Familienvilla den Exerzierplatz gegenüber beobachten. Die Schwestern sahen, dass sich vor dem Stadtschloss etwa 12.000 Menschen in revolutionärer Absicht versammelt hatten.64
Der Kommandant forderte die Protestierenden auf, den Exerzierplatz zu verlassen. Sofort! Die Antwort: Pflastersteine. Daraufhin schossen Soldaten in die Luft. Trotzdem begann die tobende Menge, auf den Schlosseingang zuzustürmen. Die Soldaten reagierten mit Kolbenschlägen und Bajonettstößen. Als sich die Protestierenden nicht davon beeindrucken ließen, richteten die Soldaten ihre Gewehre auf sie. Blut floss.
Jenny (15) und Lina (17)
Erst zuckte Jenny zusammen, dann sah es auch Lina: Ein jüdischer Junge aus dem Nachbarhaus, kaum siebzehn Jahre, drängte sich mit seinem Freund nach vorne, warf einen Pflasterstein.
Sofort schlug ein Wachsoldat auf die beiden Jungen ein.
Im Tumult versuchte Lina, Genaueres zu erkennen, doch sie war zu weit entfernt. Aufgewühlt eilte sie ins Wohnzimmer und holte aus Vaters Glasschrank einen Operngucker. Vater hatte den Voigtländer in Wien für einen Theaterbesuch gekauft. Mit dem Fernglas suchte sie in der Menge nach dem Jungen, sah aber nur wütende und verzweifelte Gesichter. Und Hunger! Die witterungsbedingten Missernten und die seit 1844 grassierende Kartoffelfäule hatten zu großer Not geführt. Weil Betteln in Städten kaum noch etwas einbrachte, stahlen manche nachts Saatkartoffeln von den Äckern. Andere ernährten sich von Unkraut oder Viehfutter. Die Regierungen der deutschen Staaten setzten kaum Schritte, um die Krise abzumildern.
Bereits am 13. März 1848 war in Wien die Revolution ausgebrochen, und es dauerte nicht lange, bis auch Breslau aus den Fugen geriet. Die Eisenbahnaktien stürzten ab, die Börse kollabierte, Fensterscheiben wurden eingeschlagen.
Liberté, Égalité, Fraternité – vor allem die zweite Forderung aus der Französischen Revolution von 1789 konnte Lina gut nachvollziehen, denn auch sie kannte Familien, die sich kaum versorgen konnten. Zahlreiche Kinder mussten bis zu vierzehn Stunden täglich arbeiten, und wer das Glück hatte, eine Schule besuchen zu dürfen, konnte sich oft das Schulzeug nicht leisten.
Die feurigen Reden der Revolutionäre, die sich in vielen Städten Europas für mehr Freiheiten und gegen das ungerechte Verhalten von Regierungen und Industriellen einsetzten, beeindruckten Lina.65 „Es muß darum gehen“, meinte sie, „die Ungleichheiten des Lebens nach Kräften zu ebnen!“66
Im Frühjahr 1848 kam es in Berlin zu Barrikadenkämpfen, in Krakau wurden politische Gefangene mit Gewalt befreit und in Breslau verlangten die Menschen Presse- und Versammlungsfreiheit.67 Karl Marx und Friedrich Engels machten den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit bewusst, Buchdrucker und Zimmerleute forderten mehr Lohn, die Revolutionäre bewaffneten sich und der Breslauer Stadtrat tagte nahezu rund um die Uhr. Linas Urgroßnichte Dagmar Nick berichtet in ihrem Buch Jüdisches Wirken in Breslau über Linas Eltern: „Ich weiß nicht, wie viel Sympathie Albert Bauer für jene aufgebracht hat, die vor seinem Fenster demonstrierten. Ich weiß nur, dass seine Töchter die Revolution mit großem Interesse verfolgten, denn sie waren beizeiten von ihrer Mutter Fanny aufgeklärt worden über das Elend der hungernden, ausgebeuteten Weber im schlesischen Eulengebirge, wo die Regierenden die revoltierenden Arbeiter niederschießen ließen, weil Versprechungen nicht mehr ausreichten, um sie zu beschwichtigen.“68 Und Dagmar Nick merkte auch an: Linas Mutter wollte, „dass ihre Töchter erkennen sollten, was auf der Welt vorging!“69
Endlich entdeckte Lina in der protestierenden Menge den Jungen. Neuerlich Schüsse. Plötzlich quoll Blut aus seiner Brust, er taumelte, sackte in sich zusammen. Lina sah den panischen Gesichtsausdruck seines Freundes, der sich hinkniete und das Blut zu stillen versuchte.
Sie ertrug den Anblick nicht, wollte sofort raus, doch der Vater entriegelte die Wohnungstür nicht. So musste sie zusehen, wie Soldaten und Demonstranten über die am Boden Liegenden trampelten. Lina kämpfte gegen Tränen. Irgendwann schleiften andere die Toten vom Platz.
Indes gelang es den Protestierenden, die Soldaten abzudrängen, es drohte ein Gemetzel – da übertönte plötzlich eine energische Stimme die Menge. Sie gehörte dem 23-jährigen Arzt Dr. Sigismund Asch, er war Vorstand des Breslauer Arbeitervereins, ein Demokrat. Tatsächlich gelang es dem jungen Mann, die Aufmerksamkeit an sich zu reißen. Das Berliner Tagblatt hat seine spontane Rede festgehalten: „Mitbürger, keine Unbesonnenheit! Denn es wäre das schwerste Unrecht, wenn ihr diesen willenlosen Werkzeugen der schwarzen Reaktion auch nur ein Haar krümmen würdet. Es sind ebenso Söhne wie wir alle. Diese Unglücklichen aber sind durch den Eid gebunden, den sie auf die Fahne geleistet haben. Und sie dürfen, ohne ihren Schwur zu verletzen, euren Wünschen nicht nachgeben. Zollen wir daher den unfreiwilligen Söldnern der Reaktion für ihre Pflichttreue unsere Achtung!“70
Mit diesen Sätzen hat Sigismund Asch ein noch größeres Blutbad verhindert. Er forderte von beiden Seiten eine kompromissbereite Haltung, um Verletzte zu vermeiden. Trotzdem wurde Dr. Asch bald darauf verhaftet, die Regierung warf ihn für ein Jahr ins Gefängnis. Linas Schwester Jenny jedoch war von Asch so angetan, dass sie seinen Kontakt suchte und ihn ein paar Jahre später heiratete.71
Dr. Sigismund Asch
Vielleicht konnten Lina und Jenny die Ausschreitungen noch nicht klar einordnen, doch es muss auch innerhalb der Familie zu heftigen Debatten gekommen sein. Obwohl Lina große Sympathien für die Ziele der Revolution hatte, scheute sie nach diesen Erlebnissen Gewalt als Mittel der Wahl.
Das Gemetzel auf dem Exerzierplatz, die distanzierte Reaktion des Vaters und die Zurückhaltung der Mutter dürften Lina verunsichert haben. Was war das für eine Welt: jemanden totschießen, weil er nicht derselben Meinung war oder aus einer anderen Schicht stammte?
Bei Lina muss sich in diesen Tagen eine Sehnsucht herausgebildet haben, die ihren weiteren Lebensweg bestimmte: Sie hoffte auf eine Welt, in der ein Zusammenleben ohne Hunger, Gewalt und Krieg möglich wäre. Sie wollte das Muster der von ihr erlebten Kultur des Unveränderlichen keinesfalls übernehmen. Und sie hatte bereits eine erste Idee, wie sie etwas davon umsetzen konnte. Im Kleinen. Schon in den nächsten Tagen.
6
Um jeden Pfennig – 1848
„Jedes neugeborene Kind bringt schon in Beziehung auf Ernährung, Sauberkeit und fortdauernde Pflege eine Revolution in der Familie hervor.“
Lina Morgenstern, 189672
„Gerade wir als Juden“, meinte Linas Vater, „sollten uns zurückhalten!“ Lina hatte ein zweites Mal versucht, auf die Straße zu gelangen. Neuerlich stellte sich ihr Vater in den Weg. Wurden in Breslau bereits Bürger, die sich bloß zu mehreren trafen, der „umstürzlerischen Umtriebe“ verdächtigt und verhaftet, so hatten Juden einen noch schlechteren Stand, denn sie waren vom Staat nur „geduldet“. Am 8. Mai 1848 traf ein Aufruf aus der 160 Kilometer entfernten Stadt Gleiwitz ein. Männer in Uniform hängten an vielen Straßenecken Plakate auf, verlangt wurde „die Vertilgung der Juden“.73
Albert forderte seine Tochter auf, zu Hause zu bleiben und der Mutter zu helfen, Linas Geburtstagsfeier vorzubereiten. Doch in Wahrheit war das keine Geburtstagsfeier für sie! Theodor durfte sie nicht einladen, es kamen nur Adelige, Geschäftspartner und Kunden ihres Vaters. Eine Enttäuschung.
Schon früh muss Lina erkannt haben: Ausschlaggebend für unsere Zukunft ist, wie Menschen mit Rückschlägen umgehen. Aus der Wut heraus gebar sie eine Idee, wie sie das von den Eltern groß inszenierte Fest „umwidmen“ könnte.74
Nachdem die Gäste gratulierten und ihre Mutter die Rede zu Linas Geburtstag beendet hatte, stand Lina auf und wandte sich an das „erlauchte Publikum“. Sie sah, wie ihr Vater auf dem Stuhl hin und her rutschte, eine Ansprache von Lina hatte er nicht geplant, nun aber vermochte er sie nicht mehr zu unterbinden. Es war ihre erste Rede vor einem erwachsenen Publikum und entsprechend stark fühlte sie ihre Nervosität.
Da sie jetzt das achtzehnte Lebensjahr erreicht habe, begann Lina, könne sie mit der Unterstützung ihrer Eltern einen Verein gründen. Und dies wolle sie hiermit tun. Einen Verein, der Bleistifte, Papier und Kleidung für Schüler kaufe, deren Eltern sich das nicht leisten können.75 Sie habe auch schon einen Namen gefunden: Pfennigverein. Wenn also jeder Anwesende so freundlich wäre, täglich einen Pfennig zu opfern, ließe sich vielen helfen.76 Sie deutete auf eine Liste, in die sich die Besucher eintragen konnten. Jenny hatte bereits eine Kasse vorbereitet.
Grinsend entgegnete ein Adeliger in herablassendem Tonfall: Das sei ja eine wunderschöne Geste. Sie zeige vor allem, wie gut Herr Bauer seine Kinder erzogen habe. Nur leider sei die Idee nicht zu Ende gedacht, denn wer garantiere, dass die vielen Pfennige wirklich bei jenen Kindern ankommen, die es nötig hätten, und nicht von jemand anderem eingesackt würden?
Allgemeines Gelächter. Dann peinliche Stille.
Linas Vater war die Sache unangenehm, er wollte selbst das Wort ergreifen, seine Tochter aber reagierte schneller. Sie hatte unter den Gästen einen Musiklehrer entdeckt, einen älteren Herrn aus ihrer Schule, den sie sehr mochte. Lina zog ihn in die Mitte und konterte: Dieser Lehrer unterrichte in vielen Klassen, er kenne fast alle Schüler und auch viele Eltern, er könne mit Sicherheit dafür sorgen, dass nur diejenigen Unterstützung erhielten, die wirklich bedürftig seien.77
Der Lehrer nickte.
Eine Dame fragte, ob denn nur „Kindern jüdischen Glaubens“ geholfen werde.
Sie garantiere, antwortete Lina, dass „die zu unterstützenden Kinder ohne Unterschied der Konfession ausgewählt werden!“78 Spontan applaudierte Jenny, andere Gäste setzten ein, schließlich klatschte die Mehrheit.
Schon wenige Jahre später half der Verein bedürftigen Kindern aus 21 evangelischen und katholischen Schulen sowie aus einer jüdischen.79 Niemand konnte ahnen, dass der Breslauer Pfennigverein über achtzig Jahre lang, bis in die 1930er-Jahre, existieren würde.80 Lange galt er als erster privater Wohlfahrtsverein überhaupt. Mehr als 16.000 Kinder erhielten Schuhe, Kleidung oder Schreibutensilien.81 Linas Mutter Fanny leitete die Vereinsgeschäfte bis zu ihrem Tod im Jahr 1874.82
Im Pfennigverein trafen sich bald nicht nur bürgerliche und aristokratische Personen, rasch traten auch weniger Wohlhabende bei. Der Austausch unterschiedlicher Meinungen war zumeist ein Gewinn für alle. Es kam zu einem gesellschaftsübergreifenden Verhalten, das Ziel einte und Menschen aus verschiedenen Schichten informierten, berieten und halfen einander.
Lina als junge Frau
Linas Gründung des Pfennigvereins