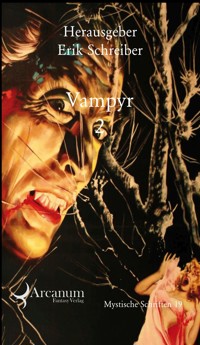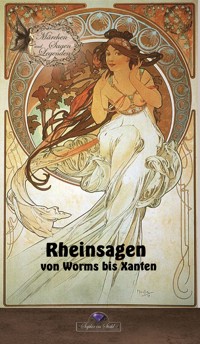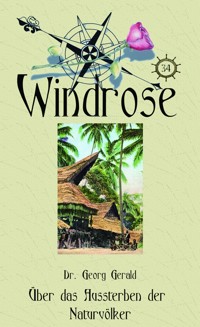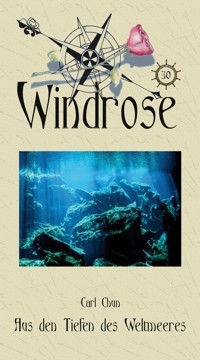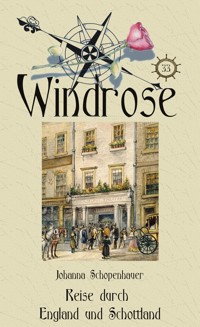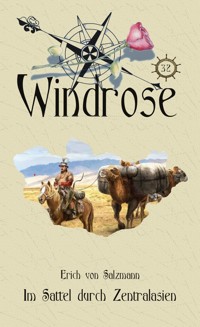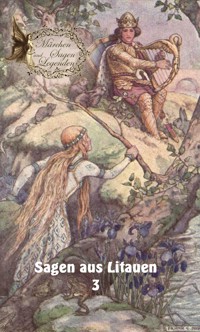
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Märchen Sagen und Legenden
- Sprache: Deutsch
Dieses Taschenbuch beschreibt Märchen und Sagen aus Litauen. Die baltischen Staaten waren schon immer faszinierend. Die Märchen und Sagen werden aus alten Quellen bezogen und neu veröffentlicht. Mit dem vorliegenden Buch lernt man mit den Sagen und Märchen nicht nur die eigene Heimat besser kennen, sondern auch die Märchen der fremden Lande, die doch so vertraut sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Märchen Sagen und Legenden
Sagen und Märchen
aus Litauen
Saphir im Stahl
Märchen Sagen und Legenden 27
e-book: 293
Titel: Sagen und Märchen aus Litauen 3
Erscheinungstermin: 01.06.2025
© Saphir im Stahl Verlag
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild: Archiv Andromeda
Lektorat: Peter Heller
Vertrieb neobook
Herausgeber
Erik Schreiber
Märchen Sagen und Legenden
Sagen und Märchen
aus Litauen
Saphir im Stahl
Vorwort
Es war einmal ... ist der Beginn vieler Märchen, doch die Floskel findet sich in keinem der Märchen und Sagen aus Litauen. Die Märchen spielen an einem fremden Ort, zu einer vergangenen Zeit, an die sich niemand richtig erinnern kann. In diesem Fall ist es das baltische Land Litauen und doch weisen die Märchen auf fremde Länder hin, die man in nur drei Tagen erreichen kann. Seit ewiger Zeit sind Märchen ein Bestandteil der menschlichen Kulturen. Sie überliefern Geschichten und bilden auf ihre Weise eine Brücke zwischen den Menschen unterschiedlichster Länder. Die vorliegende Sammlung von litauischen Märchen und Sagen hat den Zweck, diese Märchen auch denen zugänglich zu machen, die sich nicht nur für Märchenforschung interessieren. Sie sind die eben genannten Brücken zwischen Deutschland und Litauen. Ob nun zauberhafte Ereignisse, magische Wesen mit und ohne Zauberkraft, oder andere heldenhafte Figuren, Märchen haben eines gemeinsam, sie haben ein gutes Ende. In dieser vergangenen Zeit geht es wie heute auch, um Ängste, scheinbar unlösbare Aufgaben und die plötzlich auftauchenden Helden, die die Ängste nehmen. Die Sammlung ist dem deutschen Leser unbekannt. Aber einige Märchen dürften auch in Deutschland bekannt sein. Etwa das Märchen vom Tischlein deck dich. Die litauische Version weicht nur in Kleinigkeiten von der grimmschen Version ab.
Lassen sie sich, ob Kind oder Erwachsener, faszinieren.
Erik Schreiber
Inhaltsverzeichnis
Von einem Landwirt
Von den Laumes
Vom Torfmoor bei Kakschen
Vom Häusler, der ein Doktor war
Vom klugen Hans, der es bis zum König brachte
Vom Wolf
Von der Ratte, die den Königssohn zum Mann bekam
Von einem Knecht und seinem Hund, Kater und Zaubersteinchen
Von dem Armen, dem ein altes Männchen ein Tischlein, ein Hammelchen und einen Knüppel schenkte
Von dem alten Mann, der Herrgott werden wollte
Wie ein Mädchen gegen den König das Spiel gewann
Vom Fischer, der in den Himmel ging
Vom Manne ohne Furcht
Vom Sohn des Kuren
Vom armen Taglöhner, der sein Glück machte
Von dem Tagedieb und Lügner und seinem Kamerad
Von dem Dummbart, der seine klugen Brüder im Njemen ertränkte
Vom Herzen des Einsiedlers
Von des Flachses Qual
Von Mariechen und der heiligen Jungfrau
Vom Schalk
Vom Studenten, der in die Hölle und in den Himmel ging
Vom dummen Hans
Vom Jungen, der seinen Eltern weg lief
Vom verzauberten Schloss
Von dem Oheim, der ein Zauberer war
Wie sich der Mond vor einem Stern verneigte
Vom dummen Hans
Von dem reichen und dem armen Bruder
Von dem Burschen, der seine tote Braut heiratete
Von der heiligen Margareta
Von der Hexe, die dem Mädchen den Kopf abbiss
Von dem Dummbart, der gegen die Königstochter das letzte Wort behielt
Vom armen Mann, der seinen Sohn, noch eh er zur Welt kam, dem Teufel verschrieb
Von dem jungen Burschen, der keine Furcht hatte
Die fliegenden Haselnüsslein
Die Geschenke des Frostes
Die Sonne und die Mutter der Winde
Das Weizenbrötlein
Kastute
Die Zauberschuhe
Das zerschlagene Hühnerei
Jokima und sein Vater Grumpis
Goldhärchen und Goldsternchen
Ein Weib ist schlimmer als der Teufel
Eglä, Königin der Nattern
Von einem Landwirt
Es war einmal ein Landwirt, der auch Handel trieb, der steckte einmal hundert Taler ein und reiste in die Stadt, um allerhand Waren einzukaufen. Unterweges traf er einen Menschen, den fragte er, wohin die Wege führten, denn es waren zwei Wege da. Der Mensch sagte zum Wirt:
„Gib mir hundert Taler, so werde ich dirs sagen; das eine Wort von mir ist hundert Taler wert.“
Da dachte der Landwirt „Ei zum Teufel, was mag das für ein Wort sein, das hundert Taler wert ist? Na, sags nur, ich werde dir das Geld geben.“ Und er zählte ihm hundert Taler zu.
Da sagte der Mensch: „Höre nun zu; der Weg da geht gerade aus, das ist für heute, und jener Weg, der eine Biegung macht, das ist für morgen.“
Da sagte er ferner zu dem Landwirt „Ich will dir noch ein Wort sagen, aber du musst mir abermals hundert Taler geben.“
Dem Wirt ging das sehr im Sinne herum, aber er sagte endlich doch: „Wenn ich schon einmal gezahlt habe, so kann ich auch das andre Wort kaufen.“ Und er gab ihm das zweite Hundert.
Da sagte der Mensch: „Wenn du auf der Reise sein wirst und in ein Wirtshaus kommst, wo ein alter Wirt und eine junge Wirtin ist, da kehre niemals ein, sonst geht dirs nicht gut. Und gibst, du mir noch hundert Taler, so sage ich dir noch etwas.“
Jetzt denkt der Wirt: „Was wird das doch für ein Wort sein; aber zwei Worte habe ich schon gekauft, so will ich auch das Dritte kaufen“ und so zählte er ihm das dritte Hundert zu.
Da sagte der Mensch: „Wenn du eines Tages sehr in Zorn gerätst, so lass die Hälfte deines Zornes auf den kommenden Tag, lass nicht deinen ganzen Zorn an einem Tage aus!“
Der Wirt ging nun nach Hause zurück und jener seines Weges. Die Frau des Wirtes fragte ihn:
„Was hast du eingekauft?“
Er sagte: „Nichts als drei Worte und für jedes gab ich hundert Taler.“
Die Frau sagte „Für nichts und wider nichts wirfst du dein Geld hinaus.“
„Aber, Frauchen, mir tut das Geld nicht leid; du wirst schon sehen, was das für Worte sind“.
Da sagte die Frau: „Na, sprich!“
Da erzählte er, dass er einem Menschen dafür, dass dieser ihm den Weg ausgelegt, hundert Taler habe zahlen müssen; dann sagte er ihr das andre Wort, für das er ebenfalls habe hundert Taler geben müssen, und das Dritte, das er um denselben Preis gekauft habe.
Die Frau sagte „Für nichts und wider nichts; du wirfst dein Geld hinaus!“
Da geschah es später, dass ein Kaufmann mit zwei Frachtwagen voll Waren auf dem Weg gefahren kam, der beim Landwirt vorbei führte, und gerade vor dem Haus des Wirtes starb des Kaufmanns Fuhrknecht, den er in die Stube des Wirtes brachte und dann bestattete. Da forderte der Kaufmann den Wirt auf, er solle ihm den zweiten Frachtwagen fahren, weil er keinen Fuhrknecht habe, und bot ihm fünfzig Taler für die Woche und die ganze Zehrung. Da sagte er zu seiner Frau „Ich werde fahren.“
Sie sagte, „Fahr nur und verdien dir etwas.“
So fuhren sie denn weg, der Kaufmann auf einem, der Landwirt auf dem andern Frachtwagen. Sie kamen an jene zwei Wege und der Kaufmann fragte, wohin zu fahren sei.
Der Landwirt sagte „Wir wollen den Weg für morgen fahren, denn das ist der bessere.“
Der Kaufmann will aber den Weg für heute fahren; der Landwirt aber sagte: „Und gäbest du mir hundert Taler, so führe ich doch nicht den Weg, auf dem du fahren willst.“ So fuhr denn jeder einen andern Weg. Der Landwirt, der den bessern Weg gewählt hatte, war schon mittags in der Schenke, jener aber brach auf dem Weg für heute ein und litt da manchen Schaden, und während er sich abplagte und im Sumpfe waten musste, ward es Abend, ehe er die Schenke erreichte.
In der Schenke war eine junge Frau und ein alter Mann. Der Kaufmann wollte da über Nacht bleiben, aber der Landwirt gedachte jenes Wortes und wollte da nicht bleiben und hätte ihm jemand auch hundert Taler geboten. Der Kaufmann aber blieb da. Der Schenker ging ins Dorf, und während seiner Abwesenheit empfing die junge Frau den Besuch ihres Liebhabers, eines jungen Herrchens, dergleichen es wohl zu geben pflegt. Der Wirt traf bei seiner Rückkehr noch diesen Menschen, ergriff ein Messer, stach ihn tot und nahm dann die Leiche und legte sie, während der Kaufmann schlief, auf dessen Wagen. Der Kaufmann stand früh auf und ging sich zur Reise zu rüsten, und da fand er, dass man ihm einen toten Menschen auf seine Ware gelegt habe. Das ganze Dorf vernahm das Ereignis; man lief zusammen, ergriff den Kaufmann und sagte:
„Du hast das getan; er wird wohl gekommen sein, um dir von deinen Waren zu stehlen, und da hast du ihn erstochen.“ So sehr er auch sich wehrte, so ward ihm das doch nicht geglaubt, man brachte ihn ins Gefängnis und seinen Wagen samt Waren und Pferden verkaufte man wegen des Menschen, und er war doch ganz unschuldig.
Als der Landwirt, der weiter gefahren war, hörte dass man den Kaufmann ins Gefängnis gebracht, und ihm alles weggenommen habe, da kehrte er mit dem Frachtwagen voll Waren in seine Heimat zurück. Als er nach Hause gekommen, ging er in die Stube und da fand er seinen Sohn, der vom Dienst als Soldat heimgekommen war und mit seiner Mutter plauderte, er aber erkannte ihn nicht gleich wieder und meinte, dass ein Liebhaber bei seiner Frau sei, ergriff ein Messer und wollte schon auf den Fremden losspringen und ihn erstechen, da aber bedachte er sich: „Halt!“ ich habe für das Wort: „Lass die Hälfte deines Zorns auf morgen“ hundert Taler gegeben und er zog sich sogleich zurück. Er legte sich also zu Bett ohne den Menschen erstochen zu haben, und am andern Morgen als er aufstand, erkannte er in jenem Menschen seinen Sohn. Da sagte er zu seiner Frau: „Habe ich nun jene Worte zu teuer bezahlt? Hör zu, ich will dir erzählen was geschehen ist.“ Da erzählte er ihr seine ganze Reise. Die Frau freute sich, dass es sich so getroffen habe, und er behielt den ganzen Wagen mit Waren und lebte nachher in Freude und Frieden.
Von den Laumes
In alten Zeiten gab es auch Laumes, und die alten Litauer hielten sie für böse Geister, die an vielen Orten als verwünschte Wesen sich aufhalten mussten und die sich stets in der Gestalt von Frauen zeigten. Sie konnten tüchtig arbeiten, als spinnen, weben und auch Feldarbeiten verrichten, aber nur konnten sie niemals eine Arbeit anfangen oder vollenden. Böses oder Schaden fügten sie den Menschen gerade nicht zu, oft aber taten sie Gutes; der größte Schade, den sie anzurichten pflegten war, dass sie neu geborene Kinder stahlen oder vertauschten. Solche von den Laumes vertauschte Kinder hatten entsetzlich große Köpfe, die sie nie gerade halten konnten; und wenn sie auch zehn Jahre oder älter wurden, so erreichten solche Kinder doch nie ein höheres Alter als zwölf Jahre.
Eine Landwirtin hatte einmal ein solches von einer Laume vertauschtes Kind aufgezogen und es war schon bald zwölf Jahre alt, aber ganz ohne alle Kraft, so dass sie es immer tragen und füttern musste. Da kam zufällig einmal zur Sommerzeit ein altes Bettelmännchen, dem klagte die Wirtin ihre Not wegen des Kindes. Der Bettler gab ihr den Rat, sie solle ein Hühnerei nehmen, es fein ausgiessen, und in die Schale Wasser schütten, und sie so zurichten, dass sie dieselbe wie einen kleinen Kessel aufhängen könne; dann solle sie das Kind mit in die Küche nehmen, ein kleines Feuer anmachen und so tun, als wolle sie Alus brauen; da werde das Kind, wenn es das sehe, zu reden beginnen, aber dann auch sterben. Die Frau tat das alles, und sieh, als sie in der Küche damit beschäftigt war, sagte das Kind
„Mutter, was machst du da?“
Die Mutter sagte „Mein Kind, ich mache Alus.“
Das Kind sagte darauf „Gott erbarm! Ich bin schon so alt, ich war schon auf der Welt ehe das Kamschtschener Wäldchen gepflanzt war, in dem große Bäume wuchsen und das jetzt schon wieder verödet ist, aber etwas so wunderbares habe ich noch nicht gesehen.“ Nachher ward das Kind sofort krank und starb.
Eine sehr wunderbare Geschichte vom Vertauschen der Kinder, die sich in einem Dorfe des Kirchsprengels Budweeten zugetragen, und die noch gar viele unter den alten Leuten zu erzählen wissen, ist folgende. Eine Landwirtin genas eines Kindes; den Tag darauf fuhr der Landwirt gegen Abend in die Stadt, um ein zu kaufen, was man zur Kindtaufsfeier brauchte; der Knecht aber schlief in der Hausflur. Die Litauer hatten aber ehemals sehr große Hausfluren, wie man das noch in alten Gebäuden findet. Spät am Abend als alle in ihren Betten lagen und es schon tief in der Nacht war, kamen zwei Laumes. Wo und wie sie in die Hausflur gekommen waren, das wusste der Knecht nicht; er hörte nur, wie sie mit einander sprachen, denn er war noch nicht recht eingeschlafen, sondern nur eingeschlummert. Sie gingen sogleich in die Küche und zündeten sich da einen Spahn an, schlichen sich dann leise in die Stube und brachten bald darauf das neu geborene Kind der Wirtin heraus, wickelten es auf und wickelten es in ihre Windeln; in die Windeln des Kindes aber wickelten sie den Ofenbesen ein. Als das geschehen war, konnten sie sich durchaus nicht darüber einigen, welche von ihnen den Ofenwisch zur Wirtin hinein tragen und anstatt des Kindes zu ihr hinlegen solle. So zankten sie sich lange herum.
„Trag dus, trag dus!“ Als sie aber sich nicht einigen konnten, trugen sie es beide zugleich. Während dem sprang der Knecht aus dem Bette und legte schnell das Kind seiner Wirtin, das die Laumes in der Küche hatten liegen lassen, zu sich ins Bett. Als die Laumes aus der Stube in die Küche zurückkehrten und das Kind nicht fanden, ergrimmten sie nicht wenig und begannen aufeinander zu schelten:
„Du bist schuld!“
„Nein, du bist schuld; habe ich nicht gesagt, trag du, ich werde hier bleiben und Wache halten; ich habe ja gesagt, dass man es stehlen werde.“ Indem sie so sich ärgerten und sich zankten, kakaryku! Da krähte der Hahn, und beide, husch, husch! stoben zur Türe hin aus. Da nahm der Knecht das Kind und trug es in die Stube. In der Stube brannte wohl der Spahn, aber die Wöchnerin schlief so fest, dass sie der Knecht nicht wecken konnte, sondern sie anfassen und schütteln musste, und auch so dauerte es lange, bis er sie munter brachte. Als sie erwachte, sagte sie,
„Ach, mögest du gesund sein dafür, dass du mich geweckt hast; ich träumte einen so entsetzlichen Traum, als hätte man mir einen Klotz auf die Brust gelegt, so dass ich kaum Atem holen konnte.“ Da erzählte ihr der Knecht den ganzen Hergang der Sache, aber sie wollte es nicht glauben, bis sie selbst sah, dass sie zwei Kinder da habe, eins wohl dem gleich, das sie geboren, aber das andre sah so wundersam aus, das war eben das aus dem Ofenwische gemachte. Den andern Morgen ging der Knecht zum Pfarrer, erzählte ihm die Sache und fragte ihn, was da zu tun sei. Der Pfarrer gab dem Knechte folgende Anweisung
„Wenn du das ganz sicher weist und darauf schwören kannst, so nimm, wenn du nach Hause kommst, den Wechselbalg, leg ihn auf die Schwelle und hau ihm mit der Axt den Kopf ab, denn der Wechselbalg darf nicht vierundzwanzig Stunden alt werden; denn erst nach Verlauf dieser Zeit wird er erst recht lebendig.“
Als der Knecht nach Hause kam, wollte er das doch nicht allein tun, sondern wartete, bis sein Herr aus der Stadt wieder zurückkam. Da erzählte ihm der Knecht alles und beide gingen nach der Anordnung des Pfarrers unverzüglich daran, den Wechselbalg umzubringen. Wie sie ihm aber den Kopf abhieben, da fanden sich in ihm noch alle Strohhalme vor, aber es floss aus ihnen Blut, als wenn es Adern wären. Deshalb meinten nun die alten Litauer, dass solche Dickköpfe von den Laumes vertauscht seien; jetzt aber gibt es keine mehr, oder sie sind doch sehr selten. Eben deshalb musste vor der Taufe stets ein Spahnlicht brennen, wie das bei vielen Litauern auch noch gehalten wird.
Eine andre Geschichte. Ein Knecht schlief in einer Kammer allein und jede Nacht kam eine Laume und drückte ihn eine lange Zeit hindurch, so dass der Mensch schon ganz herab gekommen war. Er versuchte alles, aber nichts half etwas, bis ihm jemand sagte, wie er die Laume fangen könne. Er solle nämlich in den Wald gehn, eine im Dickicht stehende junge Eiche abhauen und sich daraus einen nach oben dünner zugeschnitzten Stöpsel machen, und mit dem solle er das Loch zukeilen, durch welches die Laume in die Kammer krieche; ferner solle er sich aus dreimal neun Stückchen Eisen einen Hammer machen und in den Hammer einen lindenen Stiel einsetzen lassen: mit dem Hammer müsse er jenen Stöpsel eintreiben. Als er das alles in Bereitschaft hatte, gab er eine Nacht Acht, und so bald er merkte, dass die Laume hereingeschlüpft sei, sprang er aus dem Bette, keilte das Loch zu und legte sich wieder nieder. Die Nacht hindurch merkte er sonst nichts, als in einer Ecke, da war es als ob eine Katze im Heu kratze; als es aber Tag ward, da fand er eine sehr schöne Jungfrau, aber sie war sehr traurig. Nicht lange darnach heiratete er diese Jungfrau und es ging ihnen recht gut, denn sie konnte schön und flink arbeiten, nur konnte sie nichts anfangen und nichts vollenden; auch bekamen sie zwei Kinder, aber sie war immer sehr verdrießlich wegen des Stöpsels und bat ihn fortwährend, er möge den Stöpsel heraus ziehen, dann werde sie auch jede Arbeit anfangen und vollenden können. Nach einigen Jahren öffnete er auch jenes Loch, aber sieh da! in der ersten Nacht darauf verschwand auch seine Frau und kehrte nicht mehr zurück; aber jeden Donnerstag Abend brachte sie den beiden Kindern jedem ein weißes Hemdchen fast ein ganzes Jahr lang; sie selbst sah aber niemand.
Wieder in einem Hause starben Vater und Mutter und hinterliessen ein Töchterchen von etwa vierzehn Jahren. Da kamen zwei Laumes zu ihr und sagten:
„Ach, liebes Kind, weine nicht so sehr um dein Väterchen und dein Mütterchen! Wir beide werden dich mit allem versorgen, du sollst an nichts Mangel haben und du wirst weder zu spinnen noch zu weben brauchen.“
Mit solchen schönen Wörtchen beruhigten sie das Mädchen einigermaßen, und nicht lange nachher fand sie in ihrer Kleete ein paar tüchtige Rollen schönes Linnen, und je länger, desto mehr Rollen fanden sich, nicht nur Linnen, sondern auch allerlei teure bunte Stoffe. Die beiden Laumes hatten ihr aber gesagt, sie solle nie etwas mit der Elle messen und wenn sie auch noch so viel habe. Einst aber, nach langer Zeit, da sie nicht mehr wusste, wohin mit ihrem Reichtum, wollte sie die Elle nehmen, messen und auf den Markt fahren und verkaufen; so wie sie aber gemessen hatte, war die Nacht darauf alles verschwunden und sie bekam nie wieder etwas.
Eine Landwirtin, die eine Witwe war, konnte zur Zeit des Schnittes ihr Feld nicht abernten und jammerte sehr darüber. Da kam eine Laume zu ihr und sagte:
„Wenn du mir einmal satt Speck zu essen gibst, so bringe ich dir dein ganzes Sommergetreide mit dem Tage ein.“
Die Wirtin dachte „Das ist doch wenig genug“ und versprach es. Früh war alles Getreide in der Scheuer; da briet geschwind die Wirtin einen tüchtigen Teller voll Speck, und bald kam die Laume und machte sich daran den Speck zu essen. Der war aber sofort aufgezehrt und die Wirtin musste rohen Speck herbeibringen, aber soviel sie auch brachte, jene aß es stets auf. Als sie von der letzten Speckseite nur noch einen kleinen Streifen hatte, schlug sie damit die Laume über den Mund. Die Laume verzog den Mund und sagte
„Klitsch, klatsch! das schlägt und haut über die Lippen; na wart, du Ausbund von einer Kanaille, ich werde dir dafür arbeiten; wie dein Sommergetreide auf dem Felde gelegen, so solls auch wieder dort liegen.“
So geschah es auch. Die Laume trug in kurzer Zeit alles aus der Scheuer wieder auf das Feld und breitete es wieder so aus, wie es gewesen war; den Speck aber ersetzte sie nicht wieder, der war und blieb aufgegessen.
Eine andere Landwirtin, die eine große Arbeiterin war, hatte ein Kleines, und da sie am Tage nicht ihre Arbeit versäumen wollte, so ging sie Abends spät, um die Windeln auf dem Stege des Teiches auszuwaschen; und das geschah zufällig auch einmal Donnerstags Abend. Den andern Donnerstag fingen nach Sonnenuntergang die Laumes an auf dem Stege Wäsche zu bläuen, dass es fürchterlich anzuhören war; und so geschah es nun jeden Donnerstag Abend. Die Leute in dem Hause hatten darüber nicht wenig Verdruss und Sorge. Nach langer Zeit belehrte sie ein alter Mann, sie sollten Bast nehmen und sich daraus eine Peitsche drehen, aber verkehrt müssten sie drehen; mit der Peitsche solle jemand an den Steg gehen und so bald er das Wäschebläuen vernehme, immer auf den Steg los hauen, auch wenn nichts zu sehen wäre. So taten die Leute nun auch. Die Wirtin hatte einen Bruder mit Namen Joachim, der war Soldat gewesen und hatte Mut. Als man am folgenden Donnerstag Abend das Wäschebläuen wieder vernahm, da nahm Joachim die Bastpeitsche, ging zum Stege hin und klatschte mit der Peitsche fürchterlich drauf los. Obwohl er nichts sah, so fand er doch auf dem Stege drei Waschbläuel, die er mit nach Hause nahm. Den Abend wars nun ruhig und den andern Donnerstag Abend auch; aber als Joachim sich in seiner Kammer zu Bette legte, da rief es immer an seinem Kammerfensterchen
„Joachimchen, gib uns unsere Waschbläuelchen wieder!“
Und das ging lange so fort. Eben so geschah es am nächsten Donnerstag Abend, und am dritten rief es wieder „Joachimchen, gib uns unsere Waschbläuelchen wieder, sonst wird es uns sehr schlecht gehen; gib sie zurück, Brüderchen, sonst werden wir umgebracht!“ Da hatte Joachim Mitleid und trug die drei Waschbläuel auf den Steg. Die Laumes nahmen sie sogleich weg und wuschen von der Zeit an nicht mehr.
Wieder eine andere Wirtin hatte ein kleines Kind und es war die Zeit der Ernte. Nach dem Frühstücke machte sie Wasser heiß und badete das Kind, dann wickelte sie es schön ein, ließ es trinken und legte es hin und das Kind schlief ein. Sodann machte sie ihren Schnittern das zweite Frühstück zurecht; und da sie nicht weit hinter den Häusern schnitten, so trug sie es auch selbst hin, indem sie dachte, das Kind werde so lange schlafen bis sie wieder kommen werde. Aber welcher Schreck! Als sie die Stubentüre öffnete, husch! sprang eine Laume zur Türe hinaus. Die Laume hatte irgendwo in einem Winkel gestanden und zugesehen, als die Mutter das Kind badete; und als die Mutter weggegangen war, wollte sie das auch tun, aber sie hatte das Wasser bis zum Kochen heißgemacht und das Kind in das Wasser gelegt. Das Kind hatte davon seine Haut verloren und elend sterben müssen, und so fand es die Mutter tot in der Badewanne liegend.
Wieder eine andere Landwirtin rüstete sich, um zur Zeit der Arbeit ein Schock feiner Linnen zu weben, aber sie konnte kaum anfangen; wegen der vielen Feldarbeit konnte sie nicht zum weben kommen, und sie ärgerte sich nicht wenig darüber, dass sie vergeblich die Zurüstungen getroffen, und sagte sehr oft:
„Mein Linnen werden die Laumes auszuweben bekommen.“ Eines Tages kam auch eine Laume und sagte zu der Wirtin
„Du bietest dein Linnen immer den Laumes zu weben an; da bin ich nun gekommen, ich werde dir dein Linnen bis aufs Fertigmachen ausweben. Wenn du, bis ich ausgewoben, meinen Namen erraten und mich schön bewirten wirst, so gehört das Linnen dir; wenn aber nicht, dann ist es mein.“ Das machte der Wirtin nicht wenig Sorge, aber sie machte doch sofort den Teig zu Kuchen, buk und war so geschäftig als möglich, um die Laume gut bewirten zu können. Indem so die Wirtin ab und zu ging, lobte sich die Laume beim Weben immer selbst und sagte:
„Das webt, das klappert Bigutte.“ Die Wirtin merkte sich das. Als nun die Laume bis zum Fertigmachen gewoben hatte, da stieg sie vom Webstuhle herunter und sagte:
„Na, Wirtin, nun sage, wie ich heiße.“
Die Wirtin erwiderte „Das hat Bigutte ausgewoben und ausgeklappert.“ Als das die Laume hörte, wollte sie weder Bewirtung, noch sonst etwas, sondern lief in grösstem Zorn und immer ausspuckend davon.
Die Alten meinten, dass die Laumes an Donnerstags Abenden sich am meisten unter den Menschen herum zu treiben pflegten. Dieser Abend war der Laumes-Abend, und deswegen durfte man da nirgend wo spinnen. Hatten wo die Frauen am Donnerstag Abend gesponnen, so begannen die Laumes, wenn die Leute schliefen, an demselben Rocken weiter zu spinnen bis der Hahn krähte, und das Gesponnene nahmen sie mit. Deswegen ist der genannte Abend bei den Litauern bis auf diesen Tag ein heiliger Abend, besonders aber darf nicht gesponnen werden. Auch durfte den Abend nach Sonnenuntergang nicht gewaschen oder sonst welche Arbeit verrichtet werden, die die Laumes auch zu verrichten pflegten, damit diese nicht ihren Vorteil dabei hatten und den Menschen Schaden taten.
Vom Torfmoore bei Kakschen
In sehr alten Zeiten stand ein ansehnlicher Wald auf der Stelle, wo jetzt das Kakschener Torfmoor liegt. In dem Walde stunden besonders Birken und Ulmen. Einst aber erhub sich ein großer Sturmwind und brach den ganzen Wald um; weil aber damals nur noch wenig Menschen in Litauen waren, aber Wälder in Überfluss, so blieben die Bäume da liegen und es begann auf ihnen Moos zu wachsen. So entstund das Torfmoor, und auch jetzt noch finden sich viele Baumstämme in demselben.
In jenem Walde waren aber auch viele Seen, kleinere und größere, in welche der Sturm auch viele Bäume warf; und in den Seen begann zuerst das Moos zu wachsen und verbreitete sich von ihnen aus immer weiter. Lange Zeit hindurch wuchs dies Moos über einander, und auf diese Art ward das Moor an solchen Stellen, wo früher Einsenkungen waren, jetzt zehn bis fünfzehn Fuß und darüber tief. Aber noch jetzt gibt es offene Stellen im Moore, die man Untiefen nennt. Diese kleinen Seen waren ehedem viel größer, jetzt hat sie aber das Moos, das von allen Seiten weit in sie hinein wuchs, bedeutend verkleinert. Diese Untiefen haben die Vorfahren mit langen Stangen oder mit langen Stricken, an welche sie Steine banden, oft gemessen, aber sie konnten keinen Grund finden. Einst nahm man an einem Sonntag die Leinen von fast allen Landwirten im Dorfe, band sie zusammen und knüpfte einen schweren Stein daran und ließ sie in die Tiefe hinab; als aber fast alle Leinen hinab gelassen waren, da zog dem, der den Strick hielt, plötzlich etwas die Leinen aus der Hand und sie verschwanden in der Tiefe, so dass sie ohne ihre Leinen nach Hause gehen mussten. Des andern Morgens aber fand jeder seine Leine schön sauber neben dem Stall hangen. Da gab es denn keine kleine Verwunderung und niemand wusste, wie das zugegangen war.
In dem Kakschener Moore hält sich aber seit alten Zeiten eine Teufelin auf, die in einer der Untiefen auf einem eisernen Stuhle sitzt. Einst zog sie aus einer Wolke, die über das Moor zog, ein Schiff nieder, und in dem hält sie sich jetzt auf. Die Mastspitze des Schiffes ragte aus dem Moore hervor und die Alten konnten sie sehen; jetzt aber ist auf der Spitze oder über ihr ein kleines Inselchen von Moos. Die Teufelin pflegte oft auf die Oberfläche zu kommen und die Altvordern konnten sie recht gut sehen. Einst liessen sich die Vorfahren einen Schwarzkünstler kommen und verlangten von ihm, er solle die Teufelin aus dem Moore vertreiben. Als der zu ihr hin ging und ihr ankündigte, er werde sie von hier vertreiben, da gab sie ihm zur Antwort, wenn sie dieses Moor, in welchem sie so lange geherrscht habe, verlassen müsse, so werde sie ihre Herrschaft über alle Insterwiesen bis an die Brücke von Kraupischken ausdehnen und bei Laugalen unter der Brücke ihren Thron aufschlagen und da ihren eigentlichen Wohnsitz nehmen. Als der Schwarzkünstler das von ihr vernommen hatte, ließ er sie in Ruhe; denn es sei besser, wenn sie im öden Moore bleibe, als wenn sie über die schönen Wiesen herrsche und besonders unter einer Brücke ihr Wesen treibe, über welche bis heutigen Tages viele Leute ihren Weg nehmen müssen. Außerdem sagte sie ihm, dass sie, wenn sie das Moor verlasse, das Loch aufmachen werde, welches mit einem großen Pferdekopfe verstopft sei und durch welches alles Wasser des Moores und alle Untiefen abfliessen könnten; und dann würden alle Dörfer, welche dieser Strom treffen werde, im Wasser ihren Untergang finden. Als der Schwarzkünstler alles dies den Altvätern hinterbrachte, erschraken sie heftig und liessen sie fortan in Ruhe. Und so sitzt sie noch jetzt in einer der Untiefen, aber zu sehen bekommt sie niemand mehr. Wenn sie aber einst ihren eisernen Thron zusammen gesessen haben wird, dann wird der jüngste Tag sein.
In dem Moore gab es auch viele Feldteufel, jener Teufelin Söhne; diese pflegten in alten Zeiten mit den andern jungen Burschen in die Kakschener Schenke zum Tanze zu kommen und mit den Mädchen zu tanzen wie andere Bursche. Stets hatten sie dann grüne Kleider an; aber man konnte sie daran erkennen, dass, wenn man ihnen auf die Stiefel trat, diese immer leer waren. Sobald sie das aber merkten, verschwanden sie. Diese Feldteufel quälten viele Leute zu Tode, die über das Moor oder am Moore gingen. Man erzählt, dass man oft im Moore oder neben demselben Leute tot fand, die schrecklich zerkniffen waren, als wären sie zerbissen, so dass das Fleisch von den Knochen abgerissen war; außerdem waren ihre Kleider voll Moos gestopft. So fanden diese Leute ein jämmerliches und entsetzliches Ende. Bisweilen kamen diese Feldteufel zu den Hirten oder zu den Leuten, aufs Feld und erbaten sich ein Pferd unter dem Vorwand, der Vater des Burschen oder des Mädchens, das das Pferd bei sich hatte, habe es befohlen, und stellten sich als wären sie gute Bekannte. Wenn man ihnen nun das Pferd zäumte und gab, so setzten sie sich auf und ritten weit weg, oder sie ritten bis in das Moor und ertränkten das Pferd, oder sie liessen es, nachdem sie geritten, laufen, und da kam das Pferd denselben oder den folgenden Tag nach Hause gelaufen. Später nun wurden hierin die Leute klug und gaben ihnen keine Pferde mehr.
Einst ritt auch ein Korporal von den Jägern auf einem prächtigen Rappen durch das Dorf Kakschen und einige Männer deckten da ein Dach, wo er durch den Hof ritt. Als die ihn sahen, wunderten sie sich darüber, wo der her geritten komme; er hielt aber nicht an, sondern ritt durch jenen Hof hindurch aufs Moor zu und dann übers Moor über alle Untiefen hinweg, und so weit die Männer vom Dache aus es sehen konnten, ritt er bis hinüber. Die Alten erzählen, öfters gesehen zu haben, dass jemand quer über das Moor geritten sei, wo doch niemand auch nur zu gehen vermag.
Vom Häusler, der ein Doktor war
Es war einmal ein Häusler, der hatte eine Frau und ein ansehnliches Häufchen Kinder. Er war sehr arm, wenn er auch noch so sehr arbeitete und sich plagte. Als er nun nicht wusste, was er tun und wie er sich ernähren sollte, da kam er auf den Gedanken, in den Wald zu fahren und Holz zu stehlen. Eines Tages spannte er sein Gäulchen an und fuhr in den Wald, hieb seinen kleinen Schlitten so voll Holz, dass sein Gaul es kaum ziehen konnte, und fuhr in die Stadt zum Verkaufen. Als er in die Stadt hinein fuhr, sah er an einem Hause über der Tür eine Tafel hangen, auf welcher das Schild des Kaufmanns gemalt war; vor dem Hause hielt er und sah immer auf das Schild hin. Der Kaufmann, der ihn da stehen sah, kam heraus und fragte ihn
„Bauer, was stehst du da, was willst du?“ Der Häusler antwortete „Ich habe Holz zu verkaufen.“
Der Kaufmann fragte „Wie viel willst du dafür?“
Jener sagte, „Ich will die Tafel da.“
Der Kaufmann machte sich im Stillen lustig über den dummen Menschen und den von ihm verlangten Preis und ließ sogleich die Tafel abnehmen und gab sie dem Bauer für sein Holz. Der fuhr die Tafel wie eine hochwichtige Sache nach Hause. Die Frau mit den Kindern hatte sich aber inzwischen darauf gefreut, dass der Vater, wenn er aus der Stadt komme, doch etwas für den Lebensunterhalt mitbringen werde, und sobald er nur auf das Höfchen angefahren kam, sprangen gleich alle aus der Stube, um alles was er mitgebracht, vom Schlitten zu nehmen und in die Stube zu tragen. Als sie mit solcher großen Freude an den Schlitten gelaufen kamen, sagte der Vater:
„Na, Mutter, jetzt bringe ich etwas Gutes mit, das ich gekauft habe: da, schau nur, die Tafel.“
Als die Frau das Ding erblickte, fing sie an zu schreien und sagte „Bist du denn ohne allen Verstand? Wir haben keinen Bissen Brot zu Hause und du fährst da ein beschriebenes Stück Holz heim! Du hättest doch für das Geld, das du fürs Holz bekommen, ein paar Metzen Korn oder ein Pfündchen Fett mitbringen sollen.“
Der Mann sagte „Still, Mutter, auch das ist gut, ich werde alles noch mitbringen.“
Am andern Morgen fuhr er wieder in den Wald, und als er den Schlitten voll gehauen, in die Stadt. Als er durch eine Straße fuhr, sah er durch ein Fenster einen Herrn, wie er in seiner Stube hin und her ging und noch seinen schon ganz alten Morgenrock an hatte und aus einer gewöhnlichen Pfeife rauchte. Der Rock und die Pfeife des Herrn gefielen ihm; deswegen hielt er vor dem Fenster und blickte stets durch dasselbe den Herrn an. Der Herr aber war ein Doktor. Als der Herr ihn so lange stehen und durchs Fenster in die Stube blicken sah, ging er heraus und fragte „Bauer, was willst du da?“
Er sagte „Ich habe Holz zu verkaufen.“
Der Herr fragte „Wie viel willst du?“
Der Bauer antwortete „Herr, ich will da deinen Kittel und die Pfeife.“
Der Doktor zog seinen alten und abgetragenen Schlafrock sogleich aus und gab ihn samt der Pfeife dem Bauern für sein Holz. Als der Häusler diese Dinge bekommen hatte, fuhr er froh heim. Der Frau und den Kindern war aber vor lauter Warten die Zeit schon sehr lang geworden, und sie dachten, heute wird der Vater ganz gewiss etwas mitbringen. Und als er angefahren kam, da liefen sie ihm alle entgegen; der Vater aber rief ihnen von ferne zu:
„Na, Mutter, aber heute bin ich freilich glücklich; schau, was für eine feine Pfeife, und sieh! was für einen Kittel vom Herrn Doktor; das alles habe ich heute für das Holz glücklich erworben.“
Als die Frau diese Possen und gänzlich wertlosen Dinge erblickte, fing sie wieder an zu schreien, als werde sie mit Ruten gehauen, und sagte:
„Du Narr, du Dummkopf, du bist doch dümmer als ein Hirtenjunge; wir sterben fast vor Hunger und nun bringst du eine elende Pfeife und einen alten verstänkerten elenden Rock; der Lumpen ist ja nur für den Lumpensammler gut.“
Der Mann beruhigte sie und sagte, „Still, Mutter, es wird alles gut werden, jammere nur nicht.“
Der Häusler ließ nun auf jene Tafel schreiben „Der Doktor, der alles weiß und alles kann!“ und schlug sie über seiner Haustür an; und nun zog er alle Tage den Schlafrock des Doktors an, rauchte aus seiner Pfeife und ging in der Stube hin und her. Nicht lange darauf fuhr ein Herr von einem nicht all zu weit entfernten Hofe vor dem Häuschen vorbei; dem Herrn aber hatte man in der verflossenen Nacht einen sehr teuren Hengst gestohlen. Als der Herr jene Aufschrift erblickte, ließ er den Kutscher halten und den Doktor heraus rufen. Der gute Mann aber ging in des Doktors Kittel barfuß im Zimmer herum. Der Kutscher öffnete die Tür und bat sehr ehrerbietig, der Herr Doktor möge doch so gut sein und heraus kommen. Er ging nun auch schnell hinaus, und der Herr begrüßte ihn ebenfalls höflich und sagte:
„Herr Doktor, man hat mir verflossene Nacht einen sehr teuren Hengst gestohlen; wüstest du wohl, wo man ihn wieder finden könnte? Ich habe ja hier auf der Tafel gelesen, dass du ein Doktor bist, der alles weiß.“
Der Häusler, der auch nicht das mindeste wusste, sagte: „Den Hengst können wir finden.“
Da bat ihn der Herr, er möge mit ihm fahren; jener aber sagte: „Ich habe keine Stiefel.“
Der Herr befahl sogleich seinem Kutscher, sich auf ein Pferd zu setzen, nach Hause zu reiten und ein paar Stiefel zu holen; und es dauerte nicht lange, so waren die Stiefel da. Da zog der Häusler die Stiefel an, setzte sich zu dem Herrn in die Kutsche und fuhr mit.
Als sie ein Ende weit gefahren waren, fragte der Herr „Wie, Herr Doktor, ists noch weit?“
Der sagte „Noch weit.“
Dann fuhren sie in einen großen Wald, und in dem Walde stand ein schöner Hof, den sich Räuber gebaut hatten. Als sie nicht mehr weit von dem Hofe waren, fragte der Herr abermals „Wie, Herr Doktor, ists etwa hier?“
Er sagte „Ja, ja, hier ist es.“
Sobald sie nur auf den Hof fuhren, fing der Hengst im Stall zu wiehern an, und der Herr merkte sogleich, dass es sein Hengst sei. Sie gingen nun hinein und fanden nur einen ältlichen Mann zu Hause; den schalten sie heftig aus und er musste ihnen sogleich den Hengst heraus geben. Der Herr aber kehrte hoch erfreut nach Hause zurück und beschenkte den Doktor reichlich mit allerlei Sachen; auch ließ er auf seine Kosten in die Zeitungen setzen, dass da und da ein Doktor wohne, der allwissend sei. Nun freute sich auch seine Frau, die ihm bisher stets Vorwürfe über sein tolles Benehmen gemacht hatte, über ein solches Glück.
Nicht lange, etwa ein paar Wochen nachher, kam ein Bote aus einem andern Königreiche vom Könige mit einem Briefe, in welchem er gebeten ward, er möge so gut sein und so schnell, als möglich per Post zu ihm kommen, denn des Königs einzige Tochter sei auf den Tod krank, vielleicht könne er sie heilen. Der Häusler, obgleich er auch dieses Mal nicht das geringste wusste, machte sich schnell fertig und reiste ab. Als er in die Stadt kam, wo jener König wohnte, ging er in die Apotheke, kaufte sich allerlei Arznei und ähnlichen Kram, packte sich das alles in ein Kästchen und verfügte sich dann zum Könige. Ach, war da eine Freude, dass der Wunderdoktor gekommen war, als wenn der Herrgott selber gekommen wäre. Der König führte ihn sogleich zu seiner kranken Tochter, und als sie der Doktor besehen hatte, fragte ihn der König, ob er sie zu heilen gedenke.
Der Doktor sagte „Ich denke, in Dreien Tagen wird sie gesund sein; ich bitte mir nur ein Zimmer aus, welches während dieser drei Tage niemand betreten darf; in das bringe man die Kranke und ich werde allein bei ihr bleiben.“
Als das geschehen war, brachte er sein Kästchen und begann der Kranken allerlei Öle und Kräuter einzugeben, ohne zu wissen, ob es gut oder böse sei, ob es helfen könne oder nicht. Mit dem Doktorieren verflossen zwei Tage, aber die Prinzessin blieb immer im früheren Zustande. Am dritten Tage gab er ihr wieder am Morgen von allem ein, und als auch das nichts helfen wollte, nahm er sie mit Gewalt aus dem Bette und setzte sie auf einen Sessel ans Fenster, durch welches man in einen schönen Baumgarten sehen konnte, und dachte
„Vielleicht wird das helfen.“
Als aber alles nicht helfen wollte, da überkam den Doktor keine kleine Furcht; denn er hatte versprochen, dass die Prinzessin am dritten Tage gesund sein müsse. Als er nun nicht wusste, was er anfangen sollte, kam er fast von Sinnen.
Plötzlich sprang er auf sie zu und schrie mit übermäßig lauter Stimme „dass aber auch nichts helfen will!“
Die Prinzessin erschrak so arg, dass sie zusammen fuhr und ihr ein Schauer über den ganzen Leib lief, und während dem auf einmal gings puff! im Halse, und sofort floss Eiter und Blut aus dem Munde. Jetzt sah der Doktor, dass sie ein Geschwür im Halse habe, sprang zu ihr hin und drückte ihren Hals: da floss noch mehr Unreinigkeit aus, und nach ein paar Stunden war ihr schon so wohl geworden, dass sie etwas zu essen verlangte. Jetzt freute sich der Doktor, ging schnell hinaus und befahl, man solle der Kranken zu essen bringen. Als der König und die Königin das vernahmen, kamen sie beide schnell herbei, um nachzusehen, und sieh da, ihre Tochter war schon fast ganz gesund. Da ward dem Doktor überschwängliche Ehre angetan, aber das war nicht genug: der König beschenkte ihn reichlich mit allerlei kostbaren Sachen, gab ihm auch viel Geld und ließ ihn in einer feinen Kutsche nach Hause fahren.